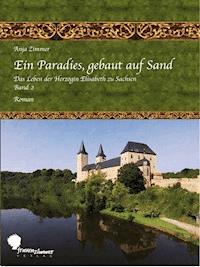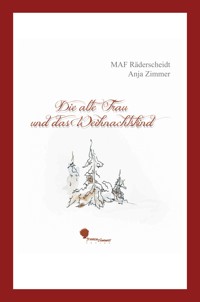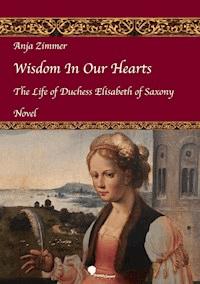Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frauenzimmer
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Band 1: Die Hüterin der Zeit Die Dubliner Studentin Hanna bekommt den Auftrag, für eine alte Lady handschriftliche Manuskripte abzuschreiben. Was für sie zunächst wie ein langweiliger Job aussieht, läßt sie eintauchen in eine Zeit, in der Druiden gegen das immer stärker werdende Christentum kämpfen. Hanna nimmt Anteil am Geschick von Sklaven und Königen, Nonnen und Druiden. Doch spürt sie auch, dass diese Geschichte nicht nur der Vergangenheit angehört. Auf geheimnisvolle Weise scheinen die Zeiten ineinander zu fleißen und die Geschehnisse in der Geschichte auf ihr eigenes Leben überzugreifen. Band 2: Das verborgene Volk Die Dubliner Studentin Hanna geht noch einmal zu der geheimnisvollen Lady, um einzutauchen ins Irland des sechsten Jahrhunderts: Abt Matthew, ein eifriger Missionar der Römischen Kirche, ist am Ziel seiner Wünsche. Als Berater eines schwachen Hochkönigs ist er der eigentliche Herrscher über die Insel. Doch es gibt auch eine junge keltische Kirche, die ein Christentum lebt, das noch stark mit dem alten Naturglauben der Kelten verbunden ist. Gnadenlos werden die getauften Druidinnen und Druiden von Matthew verfolgt. Als die Frau des Hochkönigs bei heidnischen Ritualen ertappt und verurteilt wird, kommt es zu einem erbitterten Kampf, in dem niemand mehr dem anderen vertrauen kann. "Wer auf den spuren der Kelten wandert, wird diese Bücher als Meilensteine empfinden." Wetzlarer Neue Zeitung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 937
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anja Zimmer
Kreuz und Sonne
Roman
Band 1: Die Hüterin der Zeit
Band 2: Das verborgene Volk
Alle Rechte vorbehalten
© 2013
Frauenzimmer Verlag
Laubach - Lauter
ISBN 978-3-937013-09-1
www.Frauenzimmer-Verlag.de
Inhaltsverzeichnis
Klappentext zu Kreuz und Sonne Band 1
Klappentext zu Kreuz und Sonne Band 2
Band 1: Die Hüterin der Zeit
Erstes Blatt: Luft
Zweites Blatt: Erde
Drittes Blatt: Wasser
Viertes Blatt: Feuer
Namenregister zu Band 1
Band 2: Das verborgene Volk
Bealtaine
Lughnasa
Samhain
Imbolc
Namenregister zu Band 2
Hinweise der Autorin
Klappentext zu Band 1: Die Hüterin der Zeit
Die Dubliner Studentin Hanna bekommt den Auftrag, für eine alte Lady handschriftliche Manuskripte abzuschreiben. Was für sie zunächst wie ein langweiliger Job aussieht, lässt sie eintauchen in eine Zeit, in der Druiden gegen das immer stärker werdende Christentum kämpfen. Hanna nimmt Anteil am Geschick von Sklaven und Königen, Nonnen und Druiden. Doch spürt sie auch, dass diese Geschichte nicht nur der Vergangenheit angehört. Auf geheimnisvolle Weise scheinen die Zeiten ineinander zu fließen und die Geschehnisse in der Geschichte auf ihr eigenes Leben überzugreifen.
„Wer auf den Spuren der Kelten wandert, wird diese Bücher als Meilensteine empfinden.“
Wetzlarer Neue Zeitung
Klappentext zu Band 2: Das verborgene Volk
Die Dubliner Studentin Hanna geht noch einmal zu der geheimnisvollen Lady, um einzutauchen ins Irland des sechsten Jahrhunderts: Abt Matthew, ein eifriger Missionar der Römischen Kirche, ist am Ziel seiner Wünsche. Als Berater eines schwachen Hochkönigs ist er der eigentliche Herrscher über die Insel.
Doch es gibt auch eine junge keltische Kirche, die ein Christentum lebt, das noch stark mit dem alten Naturglauben der Kelten verbunden ist. Gnadenlos werden die getauften Druidinnen und Druiden von Matthew verfolgt. Als die Frau des Hochkönigs bei heidnischen Ritualen ertappt und verurteilt wird, kommt es zu einem erbitterten Kampf, in dem niemand mehr dem anderen vertrauen kann.
„Wer auf den spuren der Kelten wandert, wird diese Bücher als Meilensteine empfinden.“
Wetzlarer Neue Zeitung.
Anja Zimmer
Kreuz und Sonne
Band 1
Die Hüterin der Zeit
Erstes Blatt
Luft
Wenn die Hüterin der Zeit durch ihren nächtlichen Sternengarten wandelt, so scheint uns selbst der kühnste unserer Gedanken zum Greifen nah. Das Universum der Träume ist uns in diesen Augenblicken so wirklich wie der eigene Atem.
*
Hanna hatte kein gutes Gefühl, als sie in die Hazelroad einbog. Es war eine Gegend mit heruntergekommenen Reihenhäuschen, in deren verwahrlosten Vorgärten nicht minder verwahrloste Kinder spielten. Einmal mehr bereute sie es, sich bei dieser studentischen Arbeitsvermittlung gemeldet zu haben. Aber sie war auf das Geld angewiesen, und so lange sie nichts anderes fand, mußte sie wohl oder übel an immer neuen Arbeitsstellen ihr Geld verdienen. Natürlich hatte sie auch Stellen gehabt, an denen sie gerne länger geblieben wäre, doch in der Regel wußte sie nicht, auf welches Abenteuer sie sich einließ, wenn sie wieder einen neuen Job bekam.
In der Vermittlung hatte sie noch einmal nachgefragt, ob es wirklich die Hazelroad Nummer fünf sein sollte, denn dort wohnten nicht gerade Leute, die einem so ohne weiteres einen Stundenlohn von zehn Pfund anboten. Ein Privathaus, kein Büro! »Es ist eine süße alte Dame, die noch ältere Handschriften hat und sie von dir kopiert haben möchte. Morgen, vierzehn Uhr, Hazelroad fünf«, hatte die Vermittlerin geantwortet.
Es war schon kurz vor zwei. An den meisten Häusern suchte sie vergeblich nach einer Hausnummer. Gesichter verschwanden hinter Vorhängen. Mit ihrer runden Nickelbrille, der Baskenmütze und dem Dufflecoat fiel sie in dieser Gegend auf wie ein bunter Hund. Sie fühlte sich unwohl inmitten dieser Armut, denn sicher hatte hier niemand auch nur die Möglichkeit gehabt, eine HighSchool oder gar eine Universität zu besuchen.
Auf der linken Seite sah sie die Nummern vier und sechs, dazwischen, etwas zurückgesetzt, ein Häuschen, das eher wie ein Holzschuppen anmutete. Der einsetzende Regen verschleierte ihre Brillengläser. Sie blieb stehen, schob die Brille auf ihrer krausgezogenen Nase nach oben und versuchte, an dem Schuppen etwas zu erkennen, das eine Hausnummer sein könnte. Das war typisch für sie. Sie kam auf die absurdesten Ideen – eine Eigenschaft, für die sie oft den Spott ihres Freundes Michael einzustecken hatte, der als Student der Wirtschaftswissenschaften über derartige Zweifel natürlich erhaben war. In einem solchen Schuppen konnte niemand wohnen, niemand, der alte Pergamente besaß, für deren Kopie er zehn Pfund in der Stunde bezahlte.
Glücklicherweise dachte sie in diesem Augenblick nicht an Michael, denn sonst hätte sie die kleine Fünf, die schief neben der Tür hing, vermutlich nicht gesehen. Aber die Fünf hing dort – unverkennbar. Zögernd ging Hanna durch den Garten, dessen Wildheit doch ein gewisses System erahnen ließ, denn zu beiden Seiten standen sich jeweils die gleichen Bäume und Pflanzen gegenüber, von denen Hanna allerdings die wenigsten mit Namen kannte.
Die Hütte stand wohl nur noch deshalb, weil sie zwischen den beiden Apfelbäumen keinen Platz zum Umfallen fand. Fensterläden hingen lose über zerbröselndem Mauerwerk, das von dem Sturzbach aus der kaputten Regenrinne immer weiter ausgehöhlt wurde. Auch die Reihen der Dachziegel waren unvollständig, wie Hanna mit einem vorsichtigen Blick bemerkte. Es gab keine Klingel, sondern einen Türklopfer in Form eines Tieres mit langer spitzer Schnauze und großen Reißzähnen. Dieses imposante Utensil wollte kaum zum übrigen passen, denn Hanna hoffte, das Gebäude durch ihr Klopfen nicht zum Einsturz zu bringen. Sie klopfte zunächst nur ganz zaghaft. Das Geräusch hallte wider, als verberge sich hinter der Tür ein riesiger Saal. Als eine Tür schlug, wehten hinter den blinden Scheiben zerschlissene Gardinen. Schlurfende Schritte wurden langsam lauter. Endlich hatten die Gänsehaut auf Hannas Körper ihren Höhepunkt und die Schritte die Tür erreicht. Ein schwerer Riegel wurde beiseite geschoben, worauf sich die Tür knarrend öffnete. Hanna hielt die Luft an. Was für einem Menschen mochte sie nun gegenüberstehen?
Das vertrauenerweckende Gesicht einer freundlichen älteren Dame kam zum Vorschein und bewegte Hanna mit einem verbindlichen Lächeln zum Eintreten. Hanna war so verwirrt beim Anblick der Lady, daß sie gar nicht hörte, wie sie sie begrüßte und um ihren Mantel bat. Es war in der Tat eine Lady. Ihr Haar war von leuchtendem Weiß. Als sie sich umwandte, um den Mantel aufzuhängen, sah Hanna, daß es auch sehr lang sein mußte, denn es war im Nacken zu einem ebenso ansehnlichen wie kunstvollen Knoten zusammengesteckt. Ihre Kleidung war zwar in keinem Modemagazin zu finden, nicht einmal in vergilbten Erstausgaben, aber von einer gepflegten Nachlässigkeit, die verriet, daß es für diese Dame wichtigere Dinge gab.
»Guten Tag!«, sagte Hanna etwas verlegen, während sie sich noch mit leicht eingezogenem Kopf in der Eingangshalle umschaute: Es gab viele Türen, großartige Treppen mit dicken Teppichen, der Fußboden war mit solch kostbarem Parkett ausgelegt, daß man sich fast scheute, ihn zu betreten, und die hohe Decke endlich wurde von glänzenden Marmorsäulen getragen.
Hanna stand noch da mit offenem Mund, um sich den Stuck und die großen Vasen anzusehen, da hörte sie die Stimme der Frau. Sie war bereits hinter einer der vielen hohen Türen verschwunden, und Hanna, die noch einen letzten zweifelnden Blick auf die mächtige Eingangstüre warf, beeilte sich, ihr zu folgen.
Die Dame führte sie in eine Art Studierzimmer, wo ein gewaltiger Schreibtisch am Fenster stand, von dem aus Hanna in einen jener weitläufigen Landschaftsgärten blickte, wie man sie vor langer Zeit angelegt hatte. Der große Raum lag im Zwielicht, nur auf den Schreibtisch fiel das Tageslicht. Die Lady hieß Hanna dort Platz nehmen. Dann schob sie für sich selbst einen kleinen Schemel zum Schreibtisch. Bevor sie sich setzte, holte sie aus einer ledernen Kartusche ein aufgerolltes Pergament, das sie vor Hanna ausbreitete.
»Das soll ich kopieren?«
Die Dame überhörte geflissentlich das Entsetzen in Hannas Stimme, nickte ihr nur lächelnd zu und holte weitere Utensilien aus den Schubladen dunkler Eichenschränke.
Hanna schaute resigniert auf das Blatt, das sie kopieren sollte – mit der Hand! Es sah aus wie ein Himmel bei Sturm, Regen und Sonnenschein gleichzeitig: Hier wild aufgetürmte Wolken, von Blitzen durchzuckt, dort Regengüsse, die in Nebelschwaden übergingen, und schließlich feine Schleierwolken, durch die das Licht brach. Je länger sie das Blatt betrachtete – die Dame hantierte noch immer im Hintergrund – um so mehr erahnte sie in den Wolken, Nebelschwaden und dem Regen die Gesichter von Menschen und … einen Falken, dessen spitz zulaufende Flügel mit den Wolken verschmolzen.
Nun trat die Dame wieder an den Schreibtisch. Verschmitzt sah sie Hanna von der Seite an.
»Hören Sie, Misses …«
»Oh, entschuldigen Sie, Miss Roberts, ich habe mich gar nicht vorgestellt, O’Malley ist mein Name.«
»Hören Sie, Misses O’Malley, warum legen Sie dieses Blatt nicht auf einen Scanner? Ich habe einen sehr guten zur Verfügung. Und der Drucker im Büro … ist … auch …«
Die Worte blieben ihr im Halse stecken, als sie beobachtete, wie die Lady unbeirrt fortfuhr, mit einem kleinen Messer Federn zu spitzen und eine schwarze, bröckelige Substanz in Wasser zu Tusche auflöste. Verstohlen sah sie auf ihre Armbanduhr. In drei Stunden fuhr der nächste Bus zurück. So lange würde sie mindestens hier bleiben müssen.
»Möchten Sie etwas trinken, Miss Roberts?«
Hanna nickte nur und starrte auf die Federn. Nachdem die Dame verschwunden war, wagte sie, eine der Federn in die Hand zu nehmen. Vorsichtig tauchte sie die Spitze in die Tusche und sah, wie ein dicker Tropfen der schwarzen Flüssigkeit von der Feder fiel. Sie streifte etwas von der Tusche am Rand des Glases ab, vergewisserte sich, daß nichts mehr tropfen konnte und zog eine Linie auf das frische Pergament, deren Feinheit und Anmut sie erstaunte.
»Oh, Sie haben schon begonnen – mit dem Flügel des ersten Falken.«
Verwirrt schaute Hanna auf die Linie und dann wieder auf das Pergament. Tatsächlich wies ihre Linie denselben Schwung auf, wie der Flügel des Greifvogels.
»Wieso des ersten Falken? – Gibt es denn noch mehr?«
»Oh, ja. Dieser Falke ist der erste. Es ist natürlich ein Weibchen. Sie heißt Fatima. Suchen Sie die anderen!«
Hannas Augen suchten das Pergament ab. Waren die Vögel dort in den Wolkenbergen oder in den Schleierwolken, die so sanft das Ende des Sturms ankündigten?
In den beiden unteren Ecken, im Regen und im Sonnenschein, entdeckte Hanna die beiden anderen Falken fast gleichzeitig.
»Hier, diese beiden!«
»Ja, das sind sie. Drei Falken sind es im ganzen. Es ist gut, daß Sie zuerst den einzelnen Falken, die gute Fatima, entdeckt haben. Die beiden hier unten sind Firdes und Suleika. Sie gesellen sich zu Fatima, und so sind es drei Falken an der Zahl. – Ich werde Sie nun ganz allein lassen. Wie ich sehe, hatte ich ganz recht mit meiner Wahl«, sagte die Frau, während sie Krug und Glas neben Hanna abstellte und ihr einschenkte. Mit einer Handbewegung lud sie sie zum Trinken ein.
»Was ist das?« fragte Hanna, die diesen Geschmack noch nie geschmeckt hatte. Seltsam herb und süß zugleich, von einem fast schwarzen Rot.
»Es ist Holundersaft.«
Die Frau verschwand nun, Hanna sah sich allein in dem dämmrigen Arbeitszimmer, betraut mit einer geradezu bizarren Aufgabe und bewirtet mit einem doch sehr merkwürdigen Getränk. Sie tauchte noch einmal die Feder in die Tusche und begann, die sonderbaren Linien aufs sorgfältigste nachzuzeichnen. Feine kurze Linien schlangen sich ineinander und ergaben ein filigranes Gitter wie bei einem Kupferstich. Doch bestand dieses Gitter bei genauerem Hinsehen – aus Buchstaben! Sie versuchte, die Wörter zu lesen, doch erst beim Schreiben eröffnete sich ihr der Sinn: Es ist der Vergeßlichkeit des jungen Königssohnes Christianus mac Peredur zu verdanken, daß die Heldin unserer Geschichte kein allzu vorzeitiges Ende fand. Der Prinz wollte an diesem Morgen zu einer besonderen Art von Jagd aufbrechen, doch als er bemerkte, daß ihm etwas fehle, welches er nur sehr ungern entbehrte, eilte er unter dem Spott seiner Kameraden, die im Hof seiner väterlichen Festung bereits auf ihn warteten und diese kleine Schwäche zur Genüge kannten, noch einmal hinauf in seine Gemächer.
Diese lagen im oberen Stockwerk, wo sich das Unheil in Form seines älteren Bruders über einer an diesem Morgen erworbenen Dienstmagd zusammenbraute.
Die Stiefmutter dieses Mädchens hatte ihre Drohungen in die Tat umgesetzt und die Pflegetochter tatsächlich an den Verwalter des Provinzkönigs mac Peredur verkauft. Die Frau, die eigentlich froh war, das Stiefkind, mit dem entsetzlich heidnischen Namen Áedh, loszuwerden, hatte unter Tränen versucht, den Kaufpreis in die Höhe zu treiben. Allein, der Verwalter, rotgesichtig und wohlgenährt, war dank jahrelanger Übung hart geblieben: Zwei Groschen war ihm das Mädchen wert. Die hatte er der Frau hingeworfen. Nachdem die Alte die ungewohnten Geldstücke mißtrauisch betrachtet hatte, verschwanden sie in den Weiten ihres schmutzigen Umhangs. Darauf war sie davongeschlurft, ohne sich von dem Mädchen zu verabschieden oder sich nach ihr umzusehen.
Bald stand das Mädchen mit einem Feger in der Kammer von Niall, dem ältesten Sproß der herrschaftlichen Familie. Staunend sah sie sich in der großen Kammer um. Dies war also das Innere dieses imposanten Gebäudes, das direkt am Fluß auf steinernen Fundamenten ruhte und dessen oberen Stockwerke aus mächtigen Eichenbalken gefügt waren. Hier gab es Dinge, die sie noch nie gesehen hatte: Möbelstücke, die ein Meister gefertigt haben mußte, ein Bett, Truhen, Gefäße aus schimmerndem Metall und dergleichen mehr. Doch dann fiel ihr Blick auf das Fenster. Von hier aus konnte man fast das ganze Land überblicken. Die Sonne stand schon hoch am Himmel und hatte den Dunst über den Hügeln aufgelöst. Nun blickte man ungehindert auf die üppige grüne Frühlingslandschaft, das Moor, die weiten Felder und Wiesen, die von unzähligen Hecken und Steinwällen in einen Flickenteppich verwandelt wurden. Gedankenverloren trat das Mädchen ans Fenster. Noch nie hatte sie so weit schauen können.
Außer den Bäumen, auf denen sie schon gesessen hatte, war das Dach des elterlichen Ziegenstalls die höchste Erhebung gewesen, auf der sie jemals gestanden hatte. Am Horizont erhoben sich Hügel und Berge in den blauen Morgenhimmel. Wie glücklich mußte jemand sein, der diesen Ausblick jeden Tag genießen konnte! Sie stützte sich auf das Fenstersims, lehnte sich ein Stück weit hinaus, um noch mehr von diesem herrlichen Anblick in sich aufzunehmen, doch da schauderte sie zurück: ein Abgrund tat sich vor ihr auf! Im selben Moment fühlte sie sich gepackt und weit aus dem Fenster hinausgeschoben, so weit, daß sie fürchten mußte, dreißig Fuß tief hinunter zu stürzen. Sie schrie und wehrte sich, doch dieser Griff wurde fester, drängte sie noch weiter hinaus, wo er sich lockerte. Dem glücklichen Umstand, daß sie nie sonderlich viel im Magen gehabt hatte, verdankte sie nun, daß sie sich nicht erbrach. Doch plötzlich fühlte sie sich emporgezogen und gerettet. »Du wirst ihr nichts tun!« herrschte Prinz Christianus seinen älteren Bruder an. Seine Augen funkelten böse.
Er war bereits auf dem Weg zu seinen Kameraden gewesen, da hatte er Schreie im Gemach seines Bruders gehört.
»Spiel dich nicht auf! Ich bin hier der Erstgeborene, und du hast mich nicht zu maßregeln!« schrie Niall.
Niall war um einiges größer als Christianus, doch lag etwas im Blick des Jüngeren, das den Stärkeren zähmte. Niall verachtete seinen Vater, der beim Volk wegen seiner Milde so beliebt war. Genauso verachtete er seinen gutmütigen Bruder, der ihm nicht einmal einen Spaß mit einer Sklavin gönnen konnte. Wenn er nur erst die Krone der Peredurs trug, dann würde hier ein anderer Wind wehen. Aber noch war es nicht so weit. Noch stand er unter der Herrschaft seines Vaters. Er mußte sich beherrschen, wenn er die Krone nicht verspielen wollte, denn die Stimme seines Vaters hatte Gewicht, wenn die Stammesfürstinnen und fürsten ihren neuen König wählten. Also eilte Niall schließlich ohne ein weiteres Wort aus dem Zimmer und schlug die Tür so laut ins Schloß, daß das Mädchen zusammenzuckte.
Nun schaute sie mißtrauisch den Mann an, der sie aus dieser mißlichen Lage befreit hatte. Er war nur wenig größer als sie selbst und nicht besonders kräftig gebaut, doch wie es schien sehr drahtig. In seinem fein geschnittenen Gesicht lag eine überlegene Gelassenheit, doch ohne Arroganz. Seine starke, gerade Nase zeugte von Willenskraft, was von seinen hohen Wangenknochen, die ihm etwas Kühnes verliehen, unterstrichen wurde. Doch in seinen Augen, von dunklen Schatten umlagert, Augen von so klarem, blanken Braun, wie sie es noch niemals gesehen hatte, lagen Sanftmut und Güte.
»Wie heißt du, Mädchen?«
»Áedh.«
»Áedh? Ein seltsamer Name für ein Christenmädchen!«
»Ich habe diesen Namen nicht von den Leuten bekommen, bei denen ich aufgewachsen bin«, murmelte sie entschuldigend.
»Aber der Name paßt zu dir. Áedh – Feuerflamme – hat man dich sicher genannt wegen deiner roten Haare. Nun, wie dem auch sei, ich denke, es ist besser für dich, wenn du für eine Weile von diesem freundlichen Ort verschwindest. Ich breche gleich zur Jagd auf und könnte einen tüchtigen Jagdburschen gut gebrauchen. Bist du einverstanden?«
Mit der Frage nach ihrem Einverständnis hatte man Áedh bisher nie behelligt, und so stand sie einen Augenblick nachdenklich vor diesem Mann, den sie zum ersten Mal sah, der sich ihretwegen mit seinem Bruder angelegt hatte, nun um ihre Sicherheit besorgt war und überdies noch wissen wollte, ob sie damit einverstanden sei.
»Ich bin – einverstanden!«
Ein völlig neuer Satz in einer noch nie dagewesenen Lage!
Deshalb hielt sie inne, als lasse sie sich diese Worte noch einmal durch den Kopf gehen. Aber da nahm er sie schon am Ärmel und zog sie mit sich fort. Dabei sah sie, wie er einen kleinen, viereckigen Gegenstand, der aussah wie ein flaches Kästchen, vom Tisch nahm, wo er ihn wohl während des Streits hingelegt hatte, und ihn in seinem Gewand verwahrte.
»Wir haben es ein wenig eilig, weißt du. Ich mußte gerade nochmal in meine Kammer, und meine Freunde warten schon auf mich. Aber du mußt erst noch neue Kleider bekommen, denn so kannst du nicht mit in den Wald.«
Er führte sie in die Kleiderkammer, wo er ihr ein Hemd und einen wärmeren Überwurf gab. Er wandte sich um, während sie die neuen Sachen gegen ihre alten, völlig zerschlissenen Kleider eintauschte. Nicht einmal ihr Gürtel war noch zu gebrauchen.
»Setz dich auf die Bank!«
Sie tat es, denn sie sah, daß er Schuhe in der Hand hielt. Sie würde Schuhe bekommen! Als er vor ihr niederkniete, um sie ihr anzuziehen, zuckte sie doch leicht zusammen.
»Gib mir deinen Fuß! – Nein, den rechten.«
Während er ihr die Schuhe anzog und die Riemen einfädelte, beobachtete sie seine Hände. Sie beugte sich ein wenig nach vorn, um ihre ersten Schuhe zu betrachten, dabei streifte eine Strähne ihres dichten roten Haars seine stoppelige Wange. War dies der Grund, warum er ihren linken Fuß länger als notwendig festhielt?
»So, jetzt bist du gerüstet für die Jagd. – Halt, etwas fehlt noch!« Über die Schulter legte er ihr eine Decke für die Nacht. Im Wald reiche es nicht aus, nur im Umhang zu schlafen, wie er sagte. Über die andere Schulter hängte er ihr einen Jagdbeutel, in den er ein kleines Messer, ein Stück Rauchfleisch und eine Kante Brot aus seiner eigenen Tasche tat. Zuletzt drückte er ihr eine Kappe auf den Kopf und sagte lachend: »Du bist ein hübscher Jagdbursche, Áedh! Aber nun komm! Die anderen warten schon.«
Als kurz darauf eine Magd die Kleiderkammer betrat, gewahrte sie am Boden die achtlos zurückgelassenen Kleider Áedhs.
Sie sah sich um, hob dann zuerst das Hemd hoch, um es mit Kennerinnenblick zu begutachten, ließ es aber sofort wieder enttäuscht sinken, klaubte auch den Umhang auf und brachte alles ohne weitere Prüfung in die Lumpenkiste.
In einem kleinen Zug machte sich die Jagdgesellschaft nun auf. Für mindestens sechs Monate wollte man bleiben, wenn das Wetter es zuließ. Allen voran ritt Prinz Christianus, gefolgt von seinen beiden Freunden. Unter diesen war ein Mann, wie Áedh noch keinen gesehen hatte. Sie hielt ihn für einen fremden Magier. Er trug zwar Hemd und Umhang wie alle Männer und Frauen in Eire, doch war seine Kleidung aus Stoffen von leuchtender Farbe gefertigt. Diese Kleider umgaben einen Körper von sehr schlankem, hohen Wuchs, auf sonderbare Art durchgeistigt und kräftig zugleich. Áedh sah ihn nun von hinten, seinen langen dunkelblauen Mantel, auf den dichte schwarze Locken fielen. Doch was sie mit Ehrfurcht, ja sogar mit einer leisen Angst erfüllte, war die Tatsache, daß dieser Mann einen Greifvogel auf seiner Faust trug. Ein solches Tier hatte sie bisher nur von weitem gesehen, hoch oben am Himmel oder in rasend schnellen Sturzflügen, denen das Auge kaum folgen konnte. Was für ein Mensch mußte das wohl sein, daß ein solches Tier ruhig auf seiner Hand saß?
Áedh hatte kein gutes Gefühl, als der Prinz die Richtung zum alten TogherWeg einschlug, einer uralten Straße aus Eichenstämmen, die volle vierzehn Fuß breit war und mitten durchs Moor führte. Hatte er nicht gesagt, er wolle in den Wald? Ins Moor! In dieses Land, das ruhig dalag wie ein bösartiges, schlafendes Tier! Schon als Kind hatte Áedh immer eine tiefe Angst verspürt, wenn sie mit der Familie hinausziehen mußte ins Moor, um dort das Torf zum Heizen zu stechen. Der Bauer hatte die oberste Schicht aus Gras mit einem Spaten abgetragen, dann mit der slane die Masse wie schmale Laibe dunklen Brotes abgestochen und sie hinaufgeworfen aufs Gras, wo sie von der Bäuerin und den Kindern zum Trocknen gegeneinander aufgestellt wurden. Dabei kamen öfters Stücke schwarzen Eichenholzes zum Vorschein, aus denen der Bauer allerlei Haushaltsgeräte schnitzte. Áedh war immer froh, wenn es nur Holz war, das vom Moor freigegeben wurde. Von Zeit zu Zeit hörte man, daß Leute beim Torfstechen die Körper von Menschen fanden, die das Moor verschlungen hatte. Und nun? Nun sprang der junge Prinz von seinem Pferd Fiachna, nahm es am Zügel und führte es von dem sicheren TogherWeg mitten ins Moor! Worauf hatte sie sich nur eingelassen? Was waren das für Menschen? – Ein Zauberer, dem ein Falke gehorchte, und ein Mann, der pfeifend ins Moor lief! Wenn der zweite Freund des Prinzen, der nun gleichfalls vom Pferd stieg, um ins Moor zu gehen, nicht ein so völlig diesseitiger Mensch gewesen wäre, der redete und lachte und über einen stattlichen Bauch verfügte – Áedh hätte auf der Stelle Reißaus genommen. Sie war die letzte, die von den sicheren Eichenstämmen ins Moor springen mußte. Zögernd stand sie auf der Kante und schaute auf die grüne Unberechenbarkeit, die sich vor ihr ausbreitete. Da wandte sich der hinterste der drei Jagdgehilfen, die dem Prinzen und seinen Freunden folgten, ihr zu, um ihr die Hand zu reichen. »Hab’ keine Angst. Der Prinz kennt den Weg.«
Sie gingen im Gänsemarsch, denn im Moor achtet man gerne darauf, wohin der Vordermann seinen Fuß mit mehr oder weniger Glück gesetzt hat. Áedh hatte es vorgezogen, wieder barfuß zu gehen, nachdem sie beim zweiten Schritt im Moor nasse Füße bekommen hatte. Die Sonne schien, Vögel sangen, der Himmel war so blau wie noch nie, als der würzige Duft des Moores ihre Lungen füllte. Die Sonne hatte den Dunst, der am Morgen noch auf dem Land gelegen hatte, aufgesogen und den Blick freigegeben über das weite Moor mit seinen niedrigen Gehölzen, Binsen und Grasflächen, zwischen denen gleißende Tümpel lagen. Nun stieg eine schwüle Wärme von den nassen Flächen auf, doch war es noch zu früh im Jahr, daß dies hätte unangenehm sein können. Unter den Hufen und Füßen entwickelte der Boden ein seltsames Eigenleben: schmatzende Geräusche, wenn man den Fuß hob und aufsteigende Luftbläschen. Oft mußte man große Schritte machen oder gar springen, aber bald konnte man die Stellen, auf denen man sicher war, unterscheiden von denen, wo man sicher nasse Füße bekam.
Langsam faßte Áedh Vertrauen zum Moor, zumal das Wetter lieblich war und keine Gefahr zu lauern schien. Doch unheimlich blieben ihr vor allem diese ebenen Grasflächen, die so rund waren wie der volle Mond und so breit, daß es sicher zwanzig großer Schritte brauchte, um sie zu durchqueren. Einmal trat sie auf den Rand eines solchen Gebildes. Der Boden schlug Wellen, die leise gurgelnd wieder verebbten.
Doch plötzlich sprang vor ihnen ein Kaninchen auf, und was darauf folgte, übertraf alles, was Áedh oder die Jagdgehilfen je gesehen hatten. Noch ehe Áedh sich vom ersten Schrecken erholt hatte, sah sie, wie der Magier den Falken auf das Kaninchen warf. Der Vogel stürzte sich auf das Tier, das zwar mit Hakenschlagen zu entkommen suchte, aber auf der freien Fläche keine Möglichkeit hatte, den scharfen Krallen zu entgehen. Mit einem Biß in den Nacken tötete der Greif seine Beute und ließ sich mit ihr am Boden nieder. Der Magier ging zu ihm hin, bot ihm Futter aus seiner Tasche an, die das Tier bereitwillig nahm. Er ließ den Vogel wieder auf seiner Faust Platz nehmen und brachte das erlegte Kaninchen zu der in ungläubigem Staunen verharrenden Jagdgesellschaft.
»Du hast uns nicht zuviel versprochen, Christianus!«
»Warte nur ab, bis der Saker1 einen Vogel hoch oben am Himmel schlägt. Du wirst begeistert sein. Einen solchen Jagdflug aus nächster Nähe zu beobachten, ist das Herrlichste, was du dir vorstellen kannst, Cedric«, antwortete Christianus seinem Freund.
»Ich lasse ihn jetzt fliegen. Er wird in unserer Nähe bleiben und auf seine Beute herabstoßen«, erklärte der Magier in einem fremdländischen Tonfall. Er warf den Vogel in die Luft. In engen Kreisen drehte sich der Falke immer höher in den Himmel, bis er nur noch als kleiner Punkt zu erkennen war. Es dauerte nicht lange, da tauchte ein Stockentenpaar auf. Schon setzte der Falke, der mindestens eine Meile von seiner Beute entfernt war, zum Jagdflug an. Als er über den Enten war, stieß er wie ein Stein auf sie herab. Er packte das Tier mit solcher Wucht, daß er selbst ins Taumeln kam. Doch nur kurz. Mit wenigen Flügelschlägen hatte er sich wieder gefangen und ließ sich mit seiner Beute am Boden nieder, wo er seinen Herrn zu erwarten schien. Wieder fütterte dieser ihn aus seiner Tasche und nahm ihm die Beute ab. Wenn die Männer sich nicht so freudig begeistert über dieses Schauspiel gezeigt hätten, wäre Áedh wohl erstarrt vor Ehrfurcht vor diesem Mann, dem ein wilder Vogel diente.
Erst gegen Abend wurde der Boden unter ihren Füßen wieder fester. Áedh stellte es mit Erleichterung fest. Sie waren in einem Wald angelangt, an dessen Rand man das Nachtlager aufbaute.
Die Lichtung, nicht besonders groß, war gesäumt von hohen Eichen und Pinien. Weiden und Holunder boten als Unterholz Schutz. Alle genossen den Duft des zarten Grüns, das sich aus den Knospen schob. Áedh war der Frühling noch nie so wunderbar erschienen wie in diesem Jahr. Sie fühlte sich wie befreit aus der Enge der Hütte, in der sie ihre Kindheit und frühe Jugend hinter sich gebracht hatte. Trotzdem war ihr die Männergesellschaft ein wenig unheimlich. Wie würden es diese alten erfahrenen Jäger wohl aufnehmen, wenn ein Mädchen bei ihnen war? Auf dem Weg hatte sie manchmal ihre Blicke gespürt, aber die Gesichter der Männer, so wild und bärtig sie auch erschienen, waren doch klar und gerade, von jener Unbefangenheit gegenüber Frauen, die Áedh nur bei Menschen fand, die dem alten Götterglauben anhingen.
»Komm, hilf uns!« Es waren zwei der Jagdgehilfen, die zu beiden Seiten des Rappen standen und Áedh winkten.
»Wir halten den Packen fest und du löst das Seil!« Áedh tat, wie ihr geheißen. Vorsichtig legten die Männer zwei große längliche Pakete auf den Boden, aus deren Enden Stöcke hervorsahen.
»Das sind die Zelte«, erklärte der Rothaarige und machte sich daran, die Bündel aufzuschnüren. Zum Vorschein kamen dicke und dünne Stangen, die die Männer sorgfältig prüften und ordneten. Die beiden dicken wurden zusammengelegt und an der Schnittstelle mit Keilen versehen, die Áedh festhielt, während der Rothaarige ein Seil darum band und festzurrte. Der andere, mit schwarzem Haar, machte sich bereits daran, zwei weitere dicke Stangen zusammenzusetzen, wobei ihm der Magier zur Hand ging. Den Falken hatte er derweil auf einen eigens dafür vorgesehehnen Stock gesetzt, doch nicht zu weit weg. Nun wurden die dünnen Stangen an ihren abgeflachten Schnittstellen zusammengefügt.
»He, Fintan, hier sind noch Stangen von deinem Zelt!«
Áedh hielt wieder die Stangen, während der Mann auf kunstvolle Weise ein Seil darum schlang und fest verknotete.
Als drei lange Stangen entstanden waren, legte der Jäger sie kreuzweise übereinander, so daß ein fast gleichmäßiger Stern entstand. Die Enden der einen Seite ließ er etwas länger. Auch der Stern wurde auf geschickte Art zurecht geknotet, so daß er zwar sehr stabil war, doch auch noch »Spiel« hatte.
Der Prinz und der Magier holten von Cedrics Pferd die Zeltplanen und breiteten sie aus. Mit der langen Stange ging der Mann, den die anderen mit »Gwion« ansprachen, nun unter die Zeltplane und setzte ihr oberes Ende in deren Spitze. Áedh mußte nun seine Stelle einnehmen und die Stange festhalten, während er den Stern unter die Plane holte. Es war nicht leicht, den Stern in seine richtige Position zu bringen: Die Plane hing in dicken Falten schwer herunter. Die Männer, die draußen standen, halfen so gut sie konnten, indem sie den festen Stoff auseinanderzogen. Schließlich war der Stern an der richtigen Stelle, wo Áedh ihn nun festhalten mußte. Keine leichte Aufgabe! Gwion beeilte sich, den Stern festzubinden. Dann wurden die Ausbuchtungen des Zeltes auf die Enden der Stangen gelegt und mit dickem Leder und Filz ausgepolstert. Leicht gedämpft hörte Áedh die Stimmen von draußen. Nun wurden Pflöcke eingeschlagen, und langsam spannte sich das Zelt.
»Lass mal los. Es dürfte jetzt von alleine stehen«, sagte Gwion.
Ja, es stand. Ein geräumiges Zelt, in dem drei Leute Platz zum Schlafen fanden.
»War ein feiner Zug vom Herrn, ein Mädchen mitzubringen. Schön!« Er sagte das in einem Ton, der Áedh lächeln ließ, denn er war nicht im entferntesten anzüglich, sondern einfach und freundlich. Er sah ihr dabei ins Gesicht, und Áedh hatte das Gefühl, gut aufgehoben zu sein in dieser Gesellschaft.
Zwei weitere Zelte standen schließlich, bei deren Aufbau Áedh nicht mehr geholfen hatte, denn ihr oblag es, Brennholz zu sammeln.
Das Holz wurde in der Mitte des Lagers aufgeschichtet. Bald brannte es, und schließlich wurden über der Glut die unterwegs erlegten Tiere gebraten. Áedh stieg der Duft von gebratenem Fleisch nicht zum ersten Mal in die Nase. Sie war gespannt auf den Geschmack, denn die anderen Jagdgehilfen freuten sich auf den Braten, und so hoffte sie, auch etwas davon zu erhalten.
Zuerst bedienten sich Prinz Christianus und seine Freunde, dann die Jagdgehilfen und Áedh. Sie beobachtete von weitem ihren Herrn, von dem sie bisher nur weniges gehört hatte. Seine Augen leuchteten im Schein des Feuers. Wie er lachte mit seinen Freunden! Er schien ein Mensch zu sein, dem es an nichts fehlte, der sich in seiner Umgebung sicher und wohl fühlte, der bedenkenlos schwache Stellen zeigen konnte, ohne einen Angriff zu befürchten.
Plötzlich merkte er, daß sie ihn ansah. Sie wollte sich schnell abwenden, aber er nickte ihr freundlich zu.
Warum hatte er sie gerettet? Offenbar war er zufrieden, daß man sie so selbstverständlich aufgenommen hatte. Er hatte wohl beobachtet, wie einer der Männer ihr ein Stück Fleisch abgeschnitten und auf eine Scheibe des festen Brotes gelegt hatte. Sie wollte es vermeiden, einen adligen Herrn mit vollen Backen anzugrinsen und sah deshalb etwas verlegen zu Boden. Sie war verwirrt von diesem ganzen Tag. Wie entsetzlich hatte er begonnen, und wie gut endete er nun! Ihr schwirrte der Kopf von all den neuen Eindrücken, von den ruhigen, tiefen Stimmen der Männer, vom Prasseln des Feuers und den Geräuschen des nächtlichen Waldes. Halb ängstlich, halb zuversichtlich schaute sie den Männern zu, wie sie um die Feuerstelle herumsaßen, erzählten und manchmal leise lachten. Fintan hatte sogar eine Harfe dabei und sang dazu. Dieses Instrument hatte Áedh jemals weder gesehen noch gehört. Also war sie entzückt von diesen Klängen, die so leicht und zart über dem dunklen Rauschen des Badhrens2 schwebten, das Gwion spielte. Dieses Instrument war ihr, wenn nicht vertraut, so doch zumindest bekannt. Sie erinnerte sich noch gut daran, daß sie es als Kind einmal gehört und über die geschwinden Hände des Spielers gestaunt hatte.
Auch der Magier saß am Feuer, und Áedh betrachtete nun verstohlen seine Vorderseite. Seine Haut war von einer tiefen Bräune, die besonders seinen ebenmäßigen Gesichtszügen etwas Geheimnisvolles verlieh. Seine schwarzen Augen, geschmückt mit langen Wimpern, sahen in die Flammen oder ruhten auf dem Saker. Während der Mahlzeit hatte der Greifvogel auf seiner Schulter Platz genommen. Nun saß er wieder auf der Faust des Mannes, der in einem seltsam singenden Tonfall sprach.
Áedh kuschelte sich bald in dem dritten Zelt, in dem Proviant und andere Dinge untergebracht waren, unter ihre Decke. Die Plane, die über dem Eingang hing, hatte sie ein wenig zurückgeschlagen. Es war ihre erste Nacht in einem Zelt. Während sie in die Flammen sah und noch dem Sänger zuhörte, dachte sie darüber nach, was sie wohl erwarten würde, ob sie den Anforderungen, die der Prinz an sie stellen würde, gewachsen sei. Sie mußte sicher viel Neues lernen, neue Fertigkeiten …
Auf sehr angenehme Art und Weise spürte sie ihren Gürtel. Dieser Umstand ließ sie all ihre Bedenken beiseite schieben und in einen ruhigen Schlaf fallen, in welchen sie das Rauschen des Badhrens begleitete wie fernes Donnergrollen.
Am nächsten Morgen mußte sie sich erst langsam zurechtfinden. Das Feuer brannte noch. Jemand hatte wohl Wache gehalten. Áedh nutzte die Gunst der Stunde, stand auf und schlich sich in den Wald, wo sie bald fand, wonach sie suchte: einen Bach. Geschwind wusch sie sich, um so schnell wie möglich wieder in ihre Kleider zu kommen. Gerade als sie fertig war und zum Lager zurückkehren wollte, hörte sie hinter sich eine Stimme: »Guten Morgen, Áedh!« Sie fuhr herum. Es war der Magier. Natürlich kannte er ihren Namen! Sie hatte ihn gleich an seinem Tonfall erkannt. Freundlich stand er vor ihr, den Falken auf der Faust.
»Es tut mir leid, wenn ich dich erschreckt habe.«
Anstatt zu antworten, starrte sie ihn unverhohlen an.
»Du bist ein Mädchen, nicht wahr?«
Sie nickte und trat einen Schritt zurück. Er aber achtete nicht darauf, sondern plauderte fort: »Ich hätte es beinahe nicht bemerkt, denn in meiner Heimat schmücken sich die Mädchen und tragen ihr Haar ganz anders als die Männer. Christianus sagte es mir.«
»Ihr habt über mich geredet?« Nun kam Leben in sie, denn das war ihr nicht recht!
»Ja. Du hast schon geschlafen. Da konnte ich dich nicht selbst fragen, wer du bist. – Hast du Lust, mit mir die Gegend zu erkunden? Ich will mir die jungen Falken ansehen.«
Bei diesen Worten des Magiers, die er wieder so dicht aneinandergereiht hatte, daß sie klangen wie ein Zauberspruch, war Áedh merklich zusammengezuckt. Dies war ihm nicht entgangen, und so fügte er hinzu: »Aber laß uns vorher etwas essen.«
Als er sah, daß Áedh nun den Kopf reckte, um zu sehen, was er aus seiner Tasche holen würde, lächelte er. Er gab ihr ein dünnes Fladenbrot, das mit Honig gefüllt war, dazu ein paar gedörrte Apfelringe. Während sie noch etwas scheu die Dinge aus seiner Hand nahm und zunächst leicht mißtrauisch betrachtete, sagte er: »Auch einen Falken zähmt man, indem man ihn speist.«
Wieder lächelte er. Diesmal flößte ihr sein Lächeln Vertrauen ein. »Kommst du mit mir? Ich will sehen, wie weit die jungen Falken sind.«
Áedh sah zurück zum Feuer. Der Prinz schlief noch. Aber der Magier war ja sein Freund. Also wollte sie ihm auch vertrauen. Außerdem war sie begierig, junge Falken zu sehen.
Als sie sich dem Magier wieder zuwandte und sagte: »Ich komme …«, da war er schon verschwunden. Verblüfft sah sie in den Wald, denn sie hatte keinen Schritt gehört. Er war wie vom Erdboden verschluckt.
»Ich bin hier«, rief er leise. Sie gewahrte ihn erst zwischen dem dichten Unterholz, als der Falke auf seiner Hand mit den Flügeln schlug. Da beeilte sie sich, ihm zu folgen, und war sich sicher, daß ihr nun äußerst sonderbare Dinge begegnen würden.
Áedh und der Magier waren eine ganze Weile schweigend hintereinander gegangen, bis der Mann begonnen hatte, sie ein wenig auszufragen. Als sie nur zögerlich geantwortet hatte, war er dazu übergegangen, von sich zu erzählen. Ismael hieß er und stammte aus einem fernen Land namens Persien. Dort hatte er Prinz Christianus kennengelernt. Auf der Jagd hatten sie sich miteinander angefreundet, denn Christianus war tief beeindruckt gewesen von der Beizjagd, womit er wohl die Jagd mit dem Vogel meinte. Er sprach von Christianus’ Begeisterung für die Falken. Und da ihn selbst, Ismael, in Persien nichts mehr hielt, war er seinem Freund auf dessen herzliche Einladung hin gefolgt und war mit ihm nach Eire3 gekommen, wo die Jagd mit den Greifvögeln noch unbekannt war. Nun wollte er seinem Freund helfen, Vögel zu zähmen und für die Jagd abzurichten, denn es gebe nicht Schöneres, als einem Falken beim Jagdflug zuzusehen. – Allein wenn Áedh an den gestrigen Tag dachte, klopfte ihr Herz wieder schneller. – Das Zähmen eines Falken brauche allerdings viel Geduld und Ruhe, fuhr Ismael fort. Deshalb sei man in einer so kleinen Gruppe aufgebrochen, um den Falken nicht zu ängstigen. Langsam müsse er an Menschen gewöhnt werden, da sei es nicht gut, wenn viele um ihn herum seien.
Auf Áedhs Frage, ob er denn ein Magier sei, hatte er den Kopf in den Nacken geworfen und gelacht, daß sein Kehlkopf auf und niederhüpfte. Nein, ein Magier sei er wirklich nicht. Die einzige Magie, die er verwende, sei Geduld. Aber nun sei es an der Zeit zu schweigen, denn sie näherten sich dem Falkenhorst.
Von weitem konnte Áedh das Ende des Waldes erkennen. Fing nun wieder das Moor an? Neugierig strebte sie vorwärts, doch Ismael hielt sie am Ärmel fest.
»Nicht so schnell. Der Horst wird gleich unter uns sein. Wir wollen die Falken nicht erschrecken. Auch müssen wir erst sehen, ob die Alten in der Nähe sind«, flüsterte er.
So arbeiteten sie sich vorwärts, jedes Geräusch vermeidend, bis sie am letzten Baum angekommen waren. Da sah Áedh, daß der Wald keineswegs in eine offene Landschaft überging, sondern daß sie an einem Abgrund standen, der wohl hundert Fuß tief war. Sofort standen ihr wieder die schrecklichen Momente auf der Festung vor Augen. Ismael merkte, daß sie zurückschauderte.
»Hast du Angst? Du kannst dich an mir fest halten. – Bitte ohne mir den Arm zu brechen!«
Áedh krallte sich also in seinen Ärmel, um mit ihm an den Abgrund vorzurobben.
»Du kannst ruhig hingucken, es ist nicht schlimm. Der Felsvorsprung, auf dem die Falken nisten, ist nur etwa zehn Fuß unter uns.«
Mit größter Vorsicht schob Áedh ihren Kopf nach vorn – und schaute direkt in den Falkenhorst. Drei junge Falken saßen darin. Zwei von ihnen hatten bereits ihre Daunenfedern verloren und trugen das braune Federkleid der Jungvögel. Der dritte schob gerade erst ein paar braune Spitzen durch seine weißen Daunen. Vorsichtig zogen sich Áedh und Ismael wieder zurück. Erst als sie ein ganzes Stück in den Wald hineingegangen waren, fing Ismael an zu sprechen.
»Wir werden uns die beiden Braunen etwas genauer ansehen. Ich hoffe, es ist ein Weibchen dabei. Die Männchen eignen sich weniger für die Jagd. Sind zu klein. Mit ihnen gibt es keinen Entenbraten.«
Tags darauf brach die Gruppe gemeinsam zu dem Horst auf. Die Männer gingen so leise, daß sie nicht mehr Lärm verursachten als Áedh und Ismael allein. Sie führten Seile und eine große Tasche mit sich. Es war noch früh am Morgen. Die Laute der Nacht waren verstummt und die Tiere des Tages noch nicht erwacht.
Alle schienen sonderbar erregt. Ismael führte die Gruppe an, gefolgt von dem Prinzen und dessen Freund Cedric. Die Jagdgehilfen Fintan, Gwion und Dagda, deren Namen Áedh gestern erfahren hatte, sprachen kaum ein Wort. Auch sie waren gespannt bis zum äußersten, was sie nun wohl erwarten würde. Fintan, der Harfenspieler, hatte zwei Krähen geschossen, wie Ismael ihn geheißen hatte.
Nun näherten sie sich dem Horst. In dem Abgrund, der sich vor ihnen auftat, lagen noch die Nebel der Nacht. Die Sonne erhob sich am anderen Ende des Tales, um mit ihren ersten Strahlen den Morgendunst zu erleuchten. Die Menschen, die nun ganz nah am Abgrund über dem lichtdurchfluteten Wolkenmeer standen, hielten eine lange Weile inne, bevor sie sich von diesem Anblick lösen konnten.
Mit ruhigen Bewegungen legte Ismael seinen Mantel ab und band sich ein Seil um die Mitte seines Körpers. Dann hängte er sich die Tasche quer über die Brust, nachdem er die beiden von Fintan erlegten Tiere darin verstaut hatte. Das andere Ende des Seiles hielten die Männer, während Ismael sich zunächst auf dem Bauch an den Abgrund heranschob. Der Prinz und Cedric suchten mit den Augen den Himmel ab, ob sich nicht etwa die Falkeneltern zeigten, doch diese waren bereits auf Nahrungssuche. Die Jungen saßen allein auf dem Nest. Also machte sich Ismael für den Abstieg bereit.
Áedh beobachtete schaudernd von sicherer Warte aus, wie er langsam hinter dem Abgrund verschwand. Doch dann war ihre Neugierde stärker, und sie gesellte sich zu den Männern, die alle bäuchlings am Abgrund lagen. Ismael war am Nest angelangt. Die beiden älteren Falkenjungen flatterten wie wild mit den Flügeln und kreischten, was Ismael nicht davon abhielt, sie sorgsam in der großen Tasche zu verwahren, nicht ohne vorher die beiden Krähen ins Nest gelegt zu haben. Dann zogen ihn die Männer wieder nach oben.
*
»War das wirklich gut, die Falkenjungen von ihren Eltern zu trennen?«
Ismael atmete tief durch, sah Áedh kurz an, die mit sorgenvoller Miene vor ihm stand und sah dann wieder auf die beiden Tiere, die er in ein künstliches Nest gesetzt hatte, um sie dort mit Hasenfleisch zu atzen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten fraßen die beiden nun schon recht gut aus seiner Hand. Drei Tage war es her, daß er sie aus dem Nest geholt hatte. So oft er dergleichen schon getan hatte, es fiel ihm noch immer schwer. Durch Áedhs geflüsterte Frage wurde er von neuem daran erinnert, daß er sich etwas aus der Natur genommen hatte, das ihm nicht gehörte.
Da die Falken nicht mehr sperrten, wandte sich Ismael um zu Áedh. Er legte ihr seinen Arm um die Schulter, als er mit ihr zurück zum Lager ging, denn das Nest lag etwas abseits, um die Vögel nicht zu erschrecken, aber doch nahe genug, um sie bei Gefahr schützen zu können.
»Weißt du, Áedh, viele Jungvögel sterben noch in ihrem ersten Jahr. Ich weiß nicht genau wieviele, aber es sind eine ganze Menge Vögel, die ihr erstes Jahr nicht überleben. Besonders hier, wo der Sommer kälter ist als der Winter in meiner Heimat.«
»Warum?«
»Sie finden nicht genügend Nahrung, sind dann geschwächt und verhungern. Hier können sie sogar erfrieren. Bei mir werden sie gefüttert und gewärmt. – Außerdem hat das dritte Junge im Horst jetzt viel bessere Aussichten zu überleben als vorher. Im Horst überleben nur die Stärksten, die Ältesten, die zuerst aus dem Ei geschlüpft sind. Die Jüngeren sind kleiner und schwächer. Sie können sich bei der Atzung durch den Altvogel nicht so laut bemerkbar machen wie ihre Geschwister. Und wenn sie dann verhungert sind, werden sie von ihren Geschwistern gefressen.«
»Wie grausam!«
»Uns Menschen kommt das grausam vor, aber die Natur ist niemals grausam. Es können nur die Stärksten überleben. Bei uns Menschen müssen die Starken den Schwachen helfen. In der übrigen Natur ist das anders. Wenn die Starken, die gerade überleben können, ihre Kraft aufbrauchen, um schwachen Tieren zu helfen, dann sterben auch die Starken. Deshalb ist es falsch, mit dem jüngsten Falken, der von seinen Geschwistern gefressen wird, Mitleid zu haben.«
»Dann würde ich gerne nochmal zu dem Horst gehen, um zu sehen, wie der jüngste Falke nun wächst.«
»Ja. Ich hoffe, die beiden Krähen die wir ihnen ins Nest gelegt haben, haben ihm schon geschmeckt. Übrigens ist es auch für die Eltern besser, wenn sie nur einen Vogel zu füttern haben. Dann bleibt mehr Nahrung für sie selbst. Viele Altvögel sterben im Winter, wenn sie im Frühling und im Sommer mehr als zwei Junge ernähren mußten.«
*
Natürlich, es gab eine Menge guter Gründe, Jungvögel aus dem Nest zu holen. Aber Áedh wurde das Gefühl nicht los, daß Ismael nur sein Gewissen beruhigte. Es versöhnte sie aber, daß er den Falken, wie zum Opfer, Tiere dargebracht hatte und ihr, so oft sie sich an den Horst heranwagte, immer ein Stück rohes Fleisch mitgab, das sie an dem Abgrund für die Falken hinterließ.
In den nächsten Wochen konnte sie beobachten, wie aus dem kleinen Daunenball ein kräftiger Jungvogel wurde, der schon bald, seine Schwingen erprobend, auf dem Rand des Nestes umherhüpfte.
Einmal, als Áedh von einem solchen Ausflug zurückkehrte, sah sie den Prinzen. Er saß an einen Baumstamm gelehnt und hielt jenes eckige Kästchen, das Áedh schon am ersten Tag aufgefallen war, in den Händen. Er hatte es aufgeklappt und sah angestrengt hinein, während sich seine Lippen leise bewegten. Als er sie sah, hielt er inne, um sie anzusprechen. Da er mit ihr plauderte, als sei sie seinesgleichen, verlor auch Áedh alle Scheu, die sie bis dahin noch vor ihm gehabt haben mochte, und sie fragte ihn: »Herr, warum habt Ihr mich mitgenommen und vor Eurem Bruder bewahrt?«
»Was glaubst du, Áedh?«
Sie zögerte nicht lange, sondern antwortete ihm: »Weil Ihr mehr ein Mensch als ein Mann seid?«
»Sind denn Männer keine Menschen?«
»Doch, aber erst an zweiter Stelle. In erster Linie sind sie meistens Männer.«
»Fühlst du dich nicht wohl bei uns Männern?«
»Doch! Ich fühle mich sehr wohl, Herr. Aber es sind auch besondere Männer, die mich nicht spüren lassen, daß ich eigentlich nur eine Sklavin bin.«
Es war selten, daß Sklaven über ihren Stand sprachen, schon gar nicht vor ihren Herren. Christianus sah das Mädchen von der Seite an: Sie ging leise pfeifend neben ihm her. Zum ersten Mal fiel ihm auf, wie hübsch sie eigentlich war. Hier im Wald trug sie ihr langes rotes Haar oft zu einem Zopf geflochten, was er bedauerte. Er dachte an ihre erste Begegnung, als eine Strähne ihres dichten Haares seine Wange gestreift hatte. Es mußte schön sein, die Hände darin zu vergraben. Doch da blinzelte sie ihn aus den Augenwinkeln an, er fuhr sich über die eigenen kurzen Haare und sah wieder auf den Weg.
*
Auch Ismaels Arbeit mit den Falken entging Áedh nicht, zumal er sie gerne heranzog, damit sie ihm behilflich sei. Beide Vögel hatten sich als Weibchen entpuppt. Ismael nannte sie Firdes und Suleika. Es dauerte nicht lange, und die beiden waren flügge.
Nun begann die eigentliche Arbeit des Falkners. Ismael hatte vielfältige Aufgaben für die Männer. Aber er ließ immer nur einen mitkommen zu den Tieren, um diese nicht zu erschrecken. Aus einem weichen, aber zähen Leder ließ er sie das Geschüh für die Vögel herstellen; Lederriemen, die auf eine bestimmte Art und Weise mit Schlitzen versehen waren, so daß man sie an den Beinen der Falken befestigen konnte. Die Männer und Áedh waren eifrig bei der Sache. Dagda hatte als erster ein Paar Riemen fertiggestellt, die Ismael zufrieden begutachtete. Dann band er einen der Riemen an einem dünnen Stock fest, wobei ihm alle genau zusahen. Über dem Riemen befestigte er eine kleine Glocke, die er Bell nannte. Er lachte nicht, als man ihm Knoten präsentierte, die so ganz anders aussahen als seine eigenen.
»Nun macht es noch einmal und laßt mich dabei zusehen.«
Sie taten es.
»Nein, so nicht. Du mußt zuerst die herumgelegte kurze Spitze durch den mittleren Schlitz stecken und dann den ganzen Riemen mit der hinteren Spitze voran durch den vorderen Schlitz hindurchziehen«, sagte er zu Gwion, dessen Hände auf dem Badhren wesentlich geschickter waren.
»Ja, genau so!« lobte Ismael.
Christianus, der diesen Knoten schon kannte, war als erster fertig und sah auf Áedhs Hände, die an solch feine Arbeiten offensichtlich nicht gewöhnt waren.
»Warte«, sagte er und legte seine Hand auf ihren Arm. Er neigte sich zu ihr, als er ihr die Arbeit aus den Händen nahm, sie aber unter ihren Augen ließ. Verwirrt sah sie auf seine Hände, feingliedrig und doch sehnig, die geschickt mit diesem dünnen Material hantierten, und sie dachte daran, wie er ihr die Schuhe angezogen hatte. Nun zeigte er ihr, wie man den Knoten band, um sie es selbst vollenden zu lassen.
»Gut, Áedh!« sagte er und schien nicht zu bemerken, daß sie tief errötet war, denn gleich wurde seine Aufmerksamkeit von Cedric beansprucht, dessen Riemen gerade von dem Stöckchen fiel. Áedh schaute auch bei Cedric zu, doch achtete sie dabei viel mehr auf die Hände des Prinzen als auf die Art des Knotens; den wollte sie lieber noch einmal allein üben. Zu interessant war der Anblick von Christianus’ Händen. Die Gelenke der Finger traten deutlich hervor, die Fingerglieder selbst waren sehr schmal. Mit all ihren alten und frischen Schrammen, den schmutzigen Nägeln und den dicken Adern auf den Handrücken erinnerten seine Hände an die Krallen des Greifvogels. Da er die Ärmel aufgestreift hatte, was er sehr selten tat, erkannte man auf seinen Unterarmen jede Bewegung unter seiner hellen Haut.
»Du kannst mich jetzt zu den Falken begleiten, Christianus!« Ismael und der Prinz verschwanden im dichten Unterholz.
»Nun probier es an Suleika!«
Das war leichter gesagt als getan. Ein Stock hatte den entscheidenden Vorteil gehabt, daß kein Vogel an ihm hing, der wild mit den Schwingen flatterte und dessen Schnabel und Fänge nicht zu unterschätzen waren. Ismael hielt Suleika fest. Beim dritten Versuch gelang es Christianus, das Geschüh zu befestigen. Erleichtert sah er zu, wie Ismael den Vogel schließlich wieder ins Nest setzte.
»Das war genug für heute. Laß uns ins Lager zurückgehen. Es wird bald dunkel, und die anderen warten bestimmt schon.«
Vom Lager her drangen leise Stimmen, das Knistern des Feuers, Gesang und das dunkle Rauschen des Badhrens.
Gwion sah nicht auf von seinem Instrument, aber Cedric kam auf die beiden Ankömmlinge zu.
»Wie geht es unseren Damen?«
»Wir haben ihnen das Geschüh angelegt. Christianus war nicht ungeschickt. Aus ihm wird noch ein richtiger Falkner.«
Áedh sah, wie Christianus etwas verlegen lächelte und sich dabei auf die Schulter klopfen ließ.
»Ismael übertreibt. Suleika hätte mich beinahe aufgefressen!«
»Wie ich sehe, können auch die Menschen in Eire übertreiben. Vor allem, wenn sie von ihren Helden sprechen oder – von ihrem Sommer«, lachte Ismael. »Es wundert mich keineswegs, daß die Kelten die Sonne anbeten und selbst die irischen Christen nicht auf die Sonne verzichten wollen!«
»Was unseren Sommer angeht«, erwiderte Christianus, »so magst du recht haben. Ich gebe zu, daß das, was wir einen Sommer nennen, lediglich aus etwas wärmerem Regen besteht. Und an den Tagen, an denen sich tatsächlich die Sonne zeigt, hat man nichts davon. An dem einen Tag muß man zum Schmied, um sich einen Zahn ziehen zu lassen, und an dem anderen Tag kommt die Schwiegermutter zu Besuch.
Aber was unsere Helden angeht, so trifft jedes Wort zu, so wahr ich hier stehe! Cúchulainn hat jede seiner Taten vollbracht, so wie ich es dir erzählt habe, mein lieber Ismael! Nach dem Abendessen will ich dir eine weitere Tat von ihm erzählen. Und die Banshee soll dich holen, wenn du zweifelst!«
»Wer«, rief Ismael nun aus, »ist nun wieder diese Banshee? Ihr Leute, ich sage euch, Christianus hat mir auf unserer gemeinsamen Reise so viele Helden und Götter vorgeführt, daß ich glaube, es gibt auf dieser Insel ihrer mehr als normale Sterbliche.«
»Die Banshee ist die Todesfee. Der Herr glaubt nicht an sie. Aber sie führt die Gestorbenen in die Anderswelt«, erklärte Dagda ruhig.
»Die Anderswelt?« fragte Ismael. Konnte es auf dieser Insel denn nie eine Antwort geben, ohne daß man gleich wieder eine neue Frage stellen mußte?
»Die Anderswelt ist der Himmel der Heiden«, warf Christianus ein.
»Unsere Toten sind nicht weit weg im Himmel!« wagte Dagda zu widersprechen, wenn auch mit gesenkten Augen. »Die Anderswelt ist hier und jetzt. All die Toten, die Feen und Geister umgeben uns, ohne daß wir sie sehen könnten. Erst wenn wir sterben, sind unsere irdischen Augen gereinigt, und wir sehen die Anderswelt in ihrer vollen Schönheit! Gerade deshalb nennt man sie auch das Land hinter den Wellen, Land der Frauen oder Land der Jugend«, sagte Dagda, während er ehrfurchtsvoll in den Wald blickte, wie um sich zu vergewissern, daß seine Rede vor den unsichtbaren Ohren Gnade gefunden hatte.
Áedh und Gwion hatten mittlerweile einen niedrigen Tisch gezimmert, umgelegte Baumstämme dienten als Bänke. Alle fanden an der groben Tafel Platz, als Fintan das Essen auftrug. Es gab nicht nur Fleisch, sondern auch Wurzeln und Kräuter dazu, die Dagda gesammelt hatte. Auch Pilze waren darunter, die man aufhob, um sie nachher auf Stöcken über dem Feuer zu rösten. Als sie ihr Mahl beendet hatten, machten sie es sich am Feuer bequem. Dort saß man wärmer in der nun hereinbrechenden Dunkelheit und konnte in die tanzenden Flammen sehen, während Christianus sein Versprechen einlöste und von Cúchulainn erzählte.
Áedh kannte diese Geschichten von Kind an. Und doch hörte sie sie immer wieder mit einem leisen Schauder, wenn davon die Rede war, wie Cúchulainn mit seinen Gegnern verfahren war. Aber gern hörte sie die Geschichte aus Cúchulainns Kindheit, als dieser einen Kampfhund besiegte, der von dreimal drei Männern an drei Leinen gehalten werden mußte: Der kleine Cúchulainn hatte mit dem Ball gespielt, als er von der Bestie überfallen wurde. Ohne Furcht hatte er dem Tier seinen Spielball in den Rachen gestopft, es an den Hinterbeinen gepackt und an einem steinernen Pfeiler zerschmettert.
Diese Geschichte erfüllte Áedh geradezu mit Genugtuung, eingedenk eines Hundes, der nicht weit vom Hof ihrer Zieheltern wohnte – ein widerliches, struppiges Vieh, das alles und jeden anfiel. Aber diese Geschichte war heute abend nicht dran, sondern eine andere, die in Cúchulainns späterer Jugend spielte.
Die Funken stoben aus der Glut, als Dagda frisches Holz auflegte. Der Prinz nahm einen tiefen Schluck Wasser aus seinem Kelch und begann: »Cúchulainn, als er herangewachsen war, ging zu Scáthach, einer furchterregenden Frau in Waffen, um sich mit ihr zu messen.«
Bei diesen Worten verfinsterten sich Dagdas Brauen, er nahm seinen Stock aus dem Feuer und sah den Prinzen an. Diese Bewegung war so auffällig, daß nun alle wiederum ihn ansahen. Da hielt er seinen Stock wieder ins Feuer, doch seine Stirn glättete sich nicht.
Der Prinz fuhr fort: »Zu dieser Scáthach, die nicht nur Waffen trug, sondern auch über magische Kräfte verfügte, ging unser Held. Von weitem konnte er bereits ihre Festung – mit mächtigen Palisaden und Türmen bewehrt – erblicken, von der ihn anscheinend nichts mehr trennte, doch ich sagte euch – Scáthach verfügte über magische Kräfte. Cúchulainn schritt wacker aus, ohne sich vom Regen verdrießen zu lassen. So kam er an eine Brücke, dünn wie ein Haar, scharf wie ein Blattrand und glatt wie ein Aal. Ruhig lag die Brücke über einem Abgrund, doch nur scheinbar friedlich, denn sie lag nur reglos auf der Lauer, wie ein Raubtier.
In dem Moment, als Cúchulainn seinen Fuß auf dieses heimtückische Biest setzte, begann es zu rumoren. Unser Held, dessen Art es nicht war, ängstlich zu sein, ging weiter. Als er in der Mitte der Brücke angelangt war, schnellte sie empor und richtete sich auf wie ein Mastbaum, um den Helden in den Abgrund zu schleudern. Cúchulainn kam erst im eiskalten reißenden Wasser zu sich, das durch den Abgrund rauschte.
Wütend schwamm er ans Ufer, erklomm den steilen Hang und versuchte sein Glück erneut. Mit wildem Blick betrat er nun die Brücke, auf alles gefaßt. Er stieß seine Füße fest auf, als wolle er sich dieses Biest so gefügig machen. Doch es half ihm nichts, als er wieder in der Mitte war, richtete sich die Brücke auf, doch weil er darauf vorbereitet war, schleuderte sie ihn nicht noch einmal ins Wasser, sondern nur an den Abhang. Nun packte den Helden seine gefürchtete Raserei! Ihr wißt, was das bedeutet! Er wurde so wütend, daß sich sein Körper in seiner Haut drehte: Die Füße und Knie, sein Bauch und seine Brust, sein Gesicht sahen nach hinten, sein Rücken nach vorn. Sein Brüllen war fürchterlich. (Wenn es um Cúchulainns »heilige Raserei« ging, die ihn des öfteren überfiel, fragte sich Áedh immer, wie er noch brüllen konnte, wenn doch sein Körper in seiner Haut umgedreht war. Bei dieser Frage konnte Áedh sich nicht lange aufhalten, denn schon ging es weiter:)
Brüllend sprang Cúchulainn auf die Brücke, hieb mit seinem Schwert auf sie ein, bis auch das leiseste Rumoren verstummt war, und gelangte sicher auf die andere Seite. Er lenkte seine Schritte geradewegs zur Festung. Dort angekommen, klopfte er an das eichene Tor, das ihm jedoch nicht aufgetan wurde.
Er klopfte noch einmal – wieder kam niemand herbei, um ihn einzulassen. Da nahm er seinen Speer und schleuderte ihn gegen das dicke Eichenholz des Tores. Sein Speer durchdrang das Holz, und nun tat ihm Uathach, die Tochter Scáthachs beeindruckt auf. Uathach führte den Beinamen ›die Schreckliche‹, und es bedurfte keines zweiten Blickes, um den Grund dafür zu erkennen. Wie ihre Mutter war sie eine Frau in Waffen, grobschlächtig und plattgesichtig, mit Haaren wie struppiges Stroh.«
Auch bei diesen Worten verfinsterten sich die Brauen Dagdas, die sich während der Erzählung von der Brücke wieder gefällig gelegt hatten. Er sah zur Seite und schüttelte sachte den Kopf, nur von Áedh bemerkt. Doch auch Gwion schien mit der Beschreibung Uathachs unzufrieden zu sein, denn er ließ ein leises Knurren vernehmen.
»Uathach führte den Helden ins Innere der Festung, wo sie ihn für einen Moment allein ließ, um ihrer Mutter seine Ankunft zu melden. In dieser Zeit besah sich Cúchulainn die Festung, deren Inneres fast noch furchterregender war als ihr Äußeres. Auf den Rundgängen der Palisaden standen Wächter, die ihn mit finsteren Blicken fixierten. Überall war schweres Kriegsgerät zu sehen. Ein Rückzug war unmöglich.
Als Uathach zurückkam, lag ein seltsames Lächeln auf ihren Lippen. Sie hieß den Helden ihr zu folgen. Sie geleitete ihn in ein Turmgemach, wo sie ihm ein Bad bereitete. Als er sich entblößte, wandte sie sich nicht ab, sondern trat auf ihn zu, ließ schließlich ihre Hand im Wasser spielen und bedeutete ihm, daß es sein Schaden nicht sei, wenn er ihr zu Willen wäre, während sie ihm übers Haar strich.
Cúchulainn weist ihr unsittliches Ansinnen dergestalt deutlich zurück, daß er ihr dabei einen Finger bricht. Laut schreiend rennt sie davon. Auf ihr Geschrei stürzt Uathachs trenfer herbei, um sie zu rächen, doch wird er nach kurzem Gefecht von Cúchulainn besiegt.«
»Was ist nun wieder ein trenfer?« flüsterte Ismael in Cedrics Ohr.
»Ein trenfer ist ein starker Mann, der einer Frau dient und sie beschützt«, antwortete Cedric. Dann fuhr Prinz Christianus fort: »Cúchulainn bekam an diesem Tag zum zweitenmal seine gefürchtete Wut, in der er die Festung Scáthachs dem Erdboden gleichmachte. So schritt er fort zum nächsten Abenteuer. Dies führte ihn nach …«
Dagda räusperte sich so vernehmlich, daß Christianus innehielt und ihn ansah.
Mit seiner dunklen Stimme hub Dagda nun sehr leise an zu sprechen: »Mein hoher Herr, Ihr macht Eurem Namen allzu viel Ehre.«
»Was soll das, Dagda? Wie kann ich dem Namen Peredur zu viel Ehre machen? Und was wäre daran falsch?«
»Ich spreche nicht vom Namen Eurer Familie, Herr!« sprach Dagda, den selbst die leise Schärfe in der Stimme des Prinzen einschüchterte.