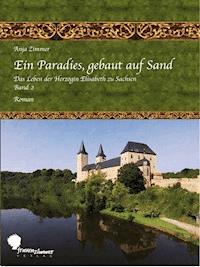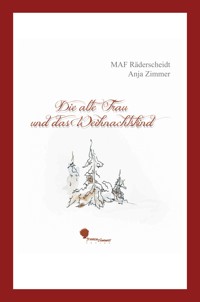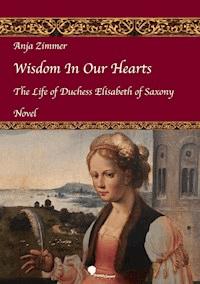14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Sax-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Ich habe Licht gebracht!", ruft die fünfjährige Louise Otto, als sie zum ersten Mal eines der neuen Schwefelhölzchen entzünden darf. "Licht bringen" - Dieser Vorsatz zieht sich durch Louises Leben wie ein roter Faden. In einer Zeit, in der Bürgermädchen nicht einmal allein aus dem Haus gehen dürfen, bereist Louise ganz alleine Deutschland. Und obwohl es streng verboten ist, Missstände auch nur anzusprechen, wirft Louise in ihren politischen Gedichten, Artikeln und Romanen immer wieder Schlaglichter auf die entsetzlichen Lebensumstände des Industrieproletariats und nimmt sich dabei vor allem der rechtlosen Arbeiterinnen an. Und sie erkennt, dass es keine soziale Gerechtigkeit geben kann, ohne die Gleichstellung von Mann und Frau. Sie fordert - beinahe schmerzlich aktuell - Lohngleichheit und das Recht auf Erwerb für alle Frauen. Große Hoffnung auf Veränderung bringt schließlich die Revolution, die im März 1848 ihren Anfang nimmt. Louise und die ihr Gleichgesinnten glauben sich schon am Ziel ihrer Wünsche, als in der Frankfurter Paulskirche eine Nationalversammlung entsteht. Um in dieser Aufbruchstimmung für Frauen ein Netzwerk der Solidarität zu schaffen, gründet Louise die erste Frauenzeitung Deutschlands. Einen Unterstützer findet sie in dem jungen Revolutionär August Peters, mit dem sie bald mehr als eine Freundschaft verbindet. Doch die Gegenrevolution lässt nicht lange auf sich warten: Als der Dresdener Maiaufstand blutig niedergeschlagen wird, sieht sich Louise Bespitzelungen und Verhören ausgesetzt. Ihre Welt verfinstert sich vollends, als sie erfährt, dass August Peters Gefangener der preußischen Armee ist ... Anja Zimmer beschreibt das Leben der Schriftstellerin und Mitbegründerin der deutschen Frauenbewegung Louise Otto-Peters (1819-1895) in einem spannenden Roman und zeigt, dass viele von Louises Forderungen nichts von ihrer Aktualität eingebüßt haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Anja Zimmer
»Ich habe Licht gebracht!«
Louise Otto-Peters, eine deutsche Revolutionärin
Umschlag-Titelbild (im Hintergrund, Bild verändert):
Unbekannter Künstler: Revolution in Dresden 1848/1849.
Die Kämpfe auf dem Neumarkt im Mai 1849.
Städtische Galerie Dresden – Kunstsammlung
Museen der Stadt Dresden,
Fotograf: Franz Zadniček
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.
ISBN: 978-3-86729-400-3
ISBN E-Book: 978-86729-566-6 (epub)
ISBN E-Book: 978-86729-567-3 (pdf)
1. Auflage 2019
Alle Rechte vorbehalten
© Sax-Verlag, Beucha · Markkleeberg 2019
Layout und Herstellung: Sax-Verlag, Markkleeberg
E-Book-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmund, www.readbox.net
Umschlaggestaltung: Juliane Schneeweiss, www.juliane-schneeweiss.com
www.sax-verlag.de
Anja Zimmer
»Ich habe Licht gebracht!«
Louise Otto-Peters, eine deutsche Revolutionärin
Für Julia und Katharina,Loana und Emma
VORWORT
Louise Otto-Peters war eine überzeugte Demokratin und Hauptakteurin der Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts. Der Anspruch auf gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen Leben, das Recht auf Bildung bis hin zum Universitätsstudium und auf existenzsichernde Erwerbsarbeit begleiteten die frauenemanzipatorische Arbeit Louise Ottos seit Beginn ihrer journalistischen und literarischen Karriere im Vormärz. Unter dem Motto »Dem Reich der Freiheit werb’ ich Bürgerinnen« bot sie in ihrer »Frauen-Zeitung« ab 1849 allen Frauen, unabhängig von Klasse oder Religion, ein öffentliches Podium zum Meinungs- und Erfahrungsaustausch. Die Zeitung machte Frauen erstmals als Gruppe mit politischer Handlungsfähigkeit in der neuen Bewegung sichtbar. Die von Louise Otto-Peters ab 1866 über drei Jahrzehnte mitredigierte Zeitung »Neue Bahnen« des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins trug wesentlich zur nationalen und internationalen Organisierung der Frauen bei. Ihre Forderung »Menschenwürdiges Dasein für Alle, auch für die Frauen« bündelt die Ziele der Frauenbewegung.
Nach Hedda Zinners Romanbiografie »Nur eine Frau« (1954), die vier Jahre später von der DEFA verfilmt wurde, und Max Grossmanns historischem Roman »Und weiter fließt der Strom« (1966) ermöglicht Anja Zimmers Buch im Jahr des 200. Geburtstages 2019 von Louise Otto-Peters einen Blick aus heutiger Zeit auf die Begründerin der organisierten deutschen Frauenbewegung. Dafür konnte die Autorin auf vielfältige Forschungsergebnisse zurückgreifen, die seit 1993 kontinuierlich im Umfeld der Louise-Otto-Peters-Gesellschaft e. V. erbracht wurden.
Die Autorin nimmt uns mit in die Zeit des Biedermeier, in die Louise Ottos Kindheit und Jugend fiel und die durch die Restauration der bestehenden Ordnung ebenso geprägt war wie durch die revolutionären Bestrebungen des Vormärz. Sie verbindet unterhaltsam Fakten aus Louise Ottos Leben mit den politischen Umständen und zeigt so deren Entwicklung zur Schriftstellerin und zentralen Gestalt der ersten deutschen Frauenbewegung.
Wir danken der Autorin Anja Zimmer sowie Birgit Röhling vom Sax-Verlag, dieses bewegte und bewegende Leben mit der Romanbiografie weiter bekannt zu machen.
Sandra Berndt und Gerlinde Kämmerer,Louise-Otto-Peters-Gesellschaft e. V.,im Januar 2019
PROLOG
Karlsbad 1819
In deutschen Fürstenhäusern ging Angst um. Ein bürgerliches Schreckgespenst schlich die Korridore entlang, lugte selbst bei fröhlichen Bällen durch die Fenster und hauchte jedem Adligen vor dem Einschlafen Eiseskälte in den Nacken: »Freiheit!«. Und in den finstersten Stunden hallte das Wort »Demokratie!« durch die Prunksäle.
Um dieses Gespenst ein für alle Mal in Ketten zu legen, trafen sich die Herrscher des Deutschen Bundes in Karlsbad. Ganz harmlos sah es aus, als sich die Herrschaften wie zufällig in dem beschaulichen Kurort begegneten.
Es waren heiße Tage im August, als die Fürsten, Diplomaten und Minister in Karlsbad anlangten.
»Ach, Sie auch hier?«, wird manch einer im Scherz gesagt haben, während er sich noch die Schweißtropfen von der Stirn tupfte.
Wie zufällig traf man sich im Park, an den Springbrunnen, tauschte Höflichkeiten aus. Die mitgeführten Gattinnen machten sich gegenseitig Komplimente zu ihrer Garderobe und verabredeten sich zu Einkaufstouren in der Stadt.
Nur sehr genaue Beobachter hätten ahnen können, dass diese Zusammenkunft so vieler hochrangiger Herrschaften einen Zweck hatte, denn abends sah man die Damen allein im Theater. Hatten die Herren nur beim Billard die Zeit vergessen? Hatten sie nach dem Abendessen so viel Cognac und Zigarren genossen, dass ihnen das Theater gestohlen bleiben konnte?
Die Herren saßen beisammen, waren jedoch vollkommen nüchtern und der Billardtisch blieb unbeachtet. Zu ernst war die Lage in den deutschen Ländern, die sich nach dem Sieg über Napoleon 1815 zum Deutschen Bund zusammengeschlossen hatten.
Fürst Metternich übernahm den Vorsitz, da er als führender Staatsmann die Versammlung einberufen hatte. Seine schneidende Stimme stieß auf keinerlei Widerstand. Allzu begierig wollten sie alle, was er wollte: strengere Zensur, mehr Befugnisse für die Polizei1, Überwachung der Lehre an den Universitäten, da diese immer gefährliche Brutstätten für neue Ideen waren. Außerdem ordnete Metternich eine neue Exekutionsordnung und ein Durchsuchungsgesetz an. Letzteres gab der Polizei die größtmöglichen Freiheiten, Wohnungen, Briefe, kurz, das gesamte Leben von Personen zu untersuchen, die sich durch ein zu freies Wort verdächtig gemacht hatten.
Mit den Karlsbader Beschlüssen wäre also Friedhofsruhe herzustellen. Erleichtert ging man auseinander, um sie nun in die Tat umzusetzen. Viele Freiheitskämpfer wurden verhaftet, Turnvereine verboten, da sich die jungen Männer dort nicht aufs Turnen beschränkt, sondern in ihren Zusammenkünften aufrührerisches Gedankengut ausgetauscht hatten. Professoren, die in dem Verdacht standen, demokratische Ideen an ihre Studenten weiterzugeben, wurden entlassen und mit Berufsverbot belegt. Was blieb ihnen anderes übrig als die Flucht in die Schweiz, nach Frankreich?
Ja, die Deutschen mussten nicht bis nach Amerika schauen, um zu sehen, dass ein freieres Leben möglich war, denn in ihrer direkten Nachbarschaft gab es Länder, in denen man nicht über die Missstände schweigen musste, und wo Herrscher sogar bereit waren, sie abzuschaffen.
Missstände gab es etliche in Deutschland. In vielen Ländern des Deutschen Bundes sehnten sich die Menschen sogar nach der Herrschaft der Franzosen zurück, unter denen sie mehr auf dem Teller gehabt hatten. Wenn die Zukunft wie ein düsterer Berg vor den Menschen liegt, dessen Ersteigung nur noch mehr Qual, Hunger und Elend bringt, dann sehnen sie sich zurück in eine Zeit, die sie gut und alt nennen. Vor allem, wenn der Fortschritt an ihren Hütten vorbeirauscht.
Meißen, im Frühjahr 1824
»Vater, was ist das?« Neugierig schaute Clementine auf die unscheinbare Schachtel, die der Vater mit großer Geste mitten auf dem Küchentisch platziert hatte. Nach einem langen Arbeitstag war er nach Hause gekommen, die Dämmerung lag schon im Raum.
»Das, meine Lieben, ist die Zukunft.« Bedeutungsschwer schaute er in die Runde. Die Frauen und Mädchen konnten seine Gesichtszüge nur schemenhaft erkennen, aber das geheimnisvolle Blitzen in seinen Augen war überdeutlich. »Ja, kommt nur alle her und staunt. Kommt, Antonie und Francisca und du, meine liebe Frau. Ja, auch Tante Malchen. Kommt und schaut euch das an.« Die Mädchen, zwölf und zehn Jahre alt, ließen ihre Strickarbeiten sinken, Mutter Charlotte trocknete ihre Hände an der Schürze ab und trat an den Tisch. Sogar Tante Malchen hielt inne im Kartoffelschälen, stellte die Schüssel zur Seite und kam dazu. Gerade wollte der Vater die Schachtel öffnen, da fragte die vierzehnjährige Clementine: »Wo ist Louise? Sie muss das auch sehen. Ich lauf schnell und hol sie.« Schon war sie aus der Tür. Man hörte ihre Rufe und Schritte in der Wohnung und schließlich durchs Treppenhaus hallen.
Unterdessen wurde die Schachtel von Tante Malchen misstrauisch beäugt. »Wenn das die Zukunft sein soll, dann bin ich traurig, nicht noch älter zu sein. Ich hoffe, dass meine Zukunft nicht in einer hässlichen Pappschachtel steckt.« Schon wollte sie sich wieder ihren Kartoffeln zuwenden, als Clementine mit Louise erschien. Die Kleine war fünf Jahre alt und tippelte an der Hand ihrer Schwester in die Küche.
»Wenn das, was unser Vater mitgebracht hat, die Zukunft ist, dann muss Louise es auch anschauen. Schließlich ist sie die Jüngste und wird hoffentlich am längsten von uns allen leben«, sagte Clementine.
Bei diesen Worten zog Tante Malchen unhörbar die Luft ein. Die Ottos hatten schon zwei ihrer sechs Kinder begraben. Und Louise, die schon immer so schwach und kränklich gewesen war, dass sie erst mit vier Jahren das Laufen gelernt hatte, versprach keineswegs so alt zu werden, wie Clementine es gerade prophezeit hatte. Dazu kam, dass sie nicht gerade wuchs, sondern schon als Kind einen kleinen Buckel mit sich herumschleppte und bei ihrem ohnehin unsicheren Gang leicht hinkte.
Die Mutter schenkte ihrer optimistischen Tochter einen dankbaren Blick und forderte sie stumm auf, Louise auf einen Stuhl zu heben. Still schaute Louise ihre Familie an.
Der Gerichtsdirektor und Stadtrat Fürchtegott Wilhelm Otto war ein Mann von klaren Worten und schlichten Taten, doch nun öffnete er die Schachtel wie ein Magier eine Schatzkiste. Den Inhalt stellte er auf den Tisch: eine kleinere Schachtel und ein Glas, das scheinbar Wasser enthielt. Die kleine Schachtel hielt er schüttelnd an sein Ohr, der Inhalt raschelte leise.
»Schwager, die Kartoffeln springen nicht freiwillig aus ihren Schalen.« Tante Malchen hatte für derlei Firlefanz weder Zeit noch Verständnis.
»Malchen, auch du wirst begeistert sein. Warte nur ab. Louise, du darfst die kleine Schachtel öffnen.«
Louise tat, wie der Vater sie geheißen hatte, schaute kurz hinein und leerte den Inhalt auf den Tisch. Zum Vorschein kamen Holzstäbchen, in etwa so lang wie die Finger der Frauen, die nun danach griffen.
Tante Malchen hielt sich eines der Stäbchen vor die Augen und schaute mit krausgezogener Nase dieses Ding an, das ihr Schwager angepriesen hatte wie das achte Weltwunder. Mit einem ärgerlichen Seufzer warf sie es zurück auf den Tisch und ging wieder an die Kartoffeln. Ihre Schwester hätte gut daran getan, einen anderen Mann zu heiraten.
»Was macht man damit?«, fragte Louise, die die Stäbchen eingehend untersuchte.
»Nun, ihr älteren Mädchen? Wisst ihr, was das ist? Habt ihr das noch nicht in der Zeitung gelesen?«, fragte der Vater. Auf den Gesichtern der Mädchen und der Mutter breitete sich ein Strahlen aus.
»Ich sehe, ihr ahnt es schon«, rief er. »In dem kleinen Gefäß hier ist Schwefelsäure.« Vorsichtig öffnete er es und legte den Deckel daneben auf den Tisch.
»Louise, du darfst ein Hölzchen vorsichtig hineintauchen, aber nur kurz. Warte, ich führe deine Hand.«
Louise schaute ihren Vater an. Sie spürte, dass jetzt ein ganz besonderer Moment war, denn so freudig gespannt hatte sie den Vater noch nie erlebt. Sie fühlte, wie sich die große warme Hand des Vaters um ihre legte, dann tauchten sie gemeinsam den Stab in das Glas. Ein scharfes Zischen – und eine Flamme loderte am Ende des Hölzchens. Louise war so erschrocken, dass sie es beinahe fallen gelassen hätte. Feuer! Sagten die Großen nicht immer, dass man damit vorsichtig sein müsse? Noch nie hatte sie selbst die mühselige Arbeit des Feuermachens bewerkstelligen müssen, nur immer der Tante, der Mutter und der ältesten Schwester zugeschaut. Manchmal dauerte es gar zu lange, bis endlich der Funken in dem Zunder glomm und zur Flamme wuchs. Und nun? Sie selbst, die Jüngste und Kleinste von ihnen, hatte einen Holzstab in ein Glas getaucht und Licht gemacht. Stolz richtete sie sich auf. Wie eine Fackelträgerin schaute sie ihre Familie an und rief triumphierend: »Ich habe Licht gebracht!«
Alle applaudierten. Francisca brachte eine Kerze, die Louise mit dem Streichholz entzündete, dann setzten sich alle an den Tisch, in dessen Mitte die Kerze gestellt wurde. Darum verstreut lagen die Zündhölzer.
»Und man taucht es einfach in diese Flüssigkeit?«, fragte Antonie ungläubig.
»Ja, in die Schwefelsäure. Aber damit muss man sehr vorsichtig sein, denn sie ist gefährlich«, erklärte der Vater. Natürlich wollte jede ausprobieren, ob sie es auch könne. Es war kinderleicht! Das Schlagen des Steins, das Pusten, das beschwörende Zureden, wenn der Funke nicht recht wollte, all das hatte jetzt ein Ende.
»Dann bin ich jetzt wohl überflüssig?«, knurrte die Tante.
»Malchen, ich denke, die Kartoffeln springen noch immer nicht freiwillig aus ihren Schalen. Aber du hättest Zeit gespart, in der du länger schlafen kannst – nur zum Beispiel.« Herr Otto zwinkerte seiner Schwägerin zu.
»Oder lesen!«, warf Francisca ein, wofür sie einen strafenden Blick ihrer Tante einfing.
»Lesen! Als müsste eine Frau lesen«, murmelte sie ärgerlich.
»Aber sie arbeiten doch während des Lesens. Immer wird etwas im Haushalt getan, wenn eine vorliest«, rechtfertigte die Mutter ihre Töchter. »Sie nähen, sticken und stricken, schnippeln Obst und Gemüse zum Kochen und Einmachen; selbst die Vorleserin hat ihren Strickstrumpf in der Hand. Auf meine fleißigen Mädchen lasse ich nichts kommen, Schwester.«
»Ich will, dass meine Töchter lesen«, stellte Herr Otto klar. »Clementine ist jetzt vierzehn Jahre alt, wird in diesem Jahr konfirmiert und muss die Schule verlassen. Da muss sie sich selbst weiterbilden und lesen. Ich bringe meinen Töchtern nicht umsonst die Zeitungen mit. Es wäre doch peinlich, wenn sie irgendwo in ein Gespräch verwickelt würden und wüssten dann nicht Bescheid über das, was in der Welt vor sich geht. Sie müssten sich ja schämen für ihre Ahnungslosigkeit.«
»Lieber Schwager, ich bin der Meinung, dass anständige Mädchen gar nicht in Gespräche verwickelt werden, wo sie über Politik und dergleichen Bescheid wissen müssten.«
»Die Mädchen werden nicht ewig hier in der Stube hocken bleiben, sondern auf Bälle gehen. Gut, bei Antonie und Francisca hat es noch etwas Zeit, aber in wenigen Jahren wird Clementine zu einem Ball gehen wollen. Unsere Töchter sind hübsch, und ich will nicht, dass man sie nur als hübsche Hüllen lobt. Sie dürfen und sollen auch für ihren Verstand gelobt werden.«
Tante Malchen schwieg zerknittert. Es hatte keinen Sinn, mit ihrem Schwager zu streiten. Er war und blieb ein unvernünftiger Mensch.
Trotz Tante Malchens schlechter Laune über derartig unnötige Neuerungen wurde es ein richtig ausgelassener Abend. Man hätte meinen können, im Hause Otto werde gefeiert. Tatsächlich feierte man – nichts weniger als den Fortschritt und den Anbruch einer neuen Zeit.
Nur Louise saß wieder ganz still dabei, schaute in die von ihr entzündete Kerze und empfand ein nie gekanntes Glück; eine Ahnung, dass dies erst der Beginn einer neuen, großartigen Zeit war.
Familie Otto besaß ein großes Eckhaus am Baderberg. Außer ihnen wohnten dort noch fünf weitere Familien zur Miete. Durch die gute Stelle als Gerichtsdirektor und die Einnahmen des Hauses hatte die Familie ein schönes Auskommen. Die Stellung des Vaters als Stadtrat brachte Ansehen. Trotzdem achtete die Mutter darauf, dass ihre Töchter alle Arbeiten im Haushalt lernten und selbst erledigten. Zu lebhaft stand ihr das schlechte Beispiel ihrer Schwägerin vor Augen. Ihr Schwiegervater, der alte Medizinalrat Otto, hatte es damals keineswegs gebilligt, dass sein Sohn Fürchtegott die arme Künstlertochter geheiratet hatte. Nicht genug, dass Charlottes Vater ein Porzellanmaler gewesen war, er hatte sich obendrein noch als Tanzmeister betätigt. Jahrelang waren sich Fürchtegott und Charlotte treu geblieben. Erst als die Treue Früchte trug und sich Charlottes Leib ein wenig zu wölben begann, willigte der Alte ein. In der Rosengasse hatte er ein kleines Haus übrig, das könnten sie haben, wenn sie ihn nur nicht mehr belästigten.
Nein, Fürchtegott und Charlotte belästigten den alten Herrn nicht mehr. Erst als die Ehe seines Sohnes Eduard das Elend einer reichen Erbin offenbarte, lenkte er ein. Während Eduards Frau bis mittags schlief, ihren Haushalt verlottern ließ und Eduard sich ins Wirtshaus flüchtete, dämmerte es dem Alten, dass allzu reiche Erbinnen für den Alltag oft wenig taugten. Sie hätte nicht einmal selbst anpacken, sondern lediglich die ihr zur Verfügung stehenden Dienstboten anweisen müssen, doch selbst das verstand sie nicht. Eduard genügten die Fluchten ins Wirtshaus bald nicht mehr, um ausreichend Abstand zwischen sich und seine Gemahlin zu bringen. Er trat beim polnischen Militär als Arzt ein, wohin ihn seine hagere Frau in Männerkleidern verfolgte.
Da erst ließ sich der Alte zu einem Besuch in der Rosengasse herab und fand alles sehr einfach, aber ordentlich bestellt. Charlotte war eine Frau, die mit geringen Mitteln ein behagliches Heim schaffen konnte. Das leckere Essen, nach welchem der Medizinalrat sich den Mund an einer handbestickten Serviette abwischte, überzeugte ihn vollends und er war voll des Lobes über seine Schwiegertochter, die er zuvor in seinem Haus an der Frauenkirche nicht einmal hatte empfangen wollen. Er schenkte den beiden das Haus am Baderberg und ließ sich von Charlotte pflegen, als er gebrechlich wurde. Er tat ihr sogar die Ehre an, ihr medizinische Rezepte zu übereignen.
Im Haus am Baderberg kam Louise am 26. März 1819 zur Welt. Sie war das jüngste der sechs Geschwister, von denen eines zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr lebte und der Tod bald ein weiteres zu sich holen würde.
Louise war von Anfang an kränklich, schmächtig und schien ihren Geschwistern bald folgen zu wollen. Doch sie lebte und brachte sogar Licht ins Haus ihrer Eltern. Sie blieb ein stilles Kind. Die Mutter beobachtete oft ihre Jüngste, wie sie schaute. Louise hatte eine sehr eigene Art, in die Welt zu blicken. Ihre großen blauen Augen schienen alles durchdringen zu wollen: Jeden Menschen, den sie auf der Straße sah, die Armen, die an die Tür kamen, um Brot und kleine Münzen zu erbetteln. Sie schaute der Mutter zu, wie sie einer armen Frau das Kind aus den Armen nahm, es wusch, speiste und in saubere Tücher gewickelt der dankbaren Frau zurückgab.
Louises Augen ruhten unverwandt auf den Damen, die sonntags ihre prächtigen Roben in die Kirche ausführten. Sie blickte scheu zu ihrem gestrengen Großvater auf, der alles darangesetzt hatte, die Ehe zwischen seinem Sohn und der Tochter eines Porzellanmalers zu verhindern. Wenn sie ihn in seinem Haus an der Frauenkirche besuchten, was selten vorkam, schaute sich Louise stumm in dem Haus mit seinen großen Zimmern und verwinkelten Treppen und Korridoren um. Man sah ihr an, dass sie all diese Erlebnisse, Menschen, Dinge auf eine intensive Weise in sich aufnahm, die der Mutter große Sorgen bereitete. Vor allem, weil Louise zuweilen ihren Blick nach innen zu kehren schien, als betrachte sie die gesammelten Eindrücke in ihrem Innersten.
Immer wieder versuchte die Mutter, allzu heftige Ereignisse von ihrer Tochter fernzuhalten, doch Louise hatte ihre Augen und Ohren überall. Jedes Wort, das die Erwachsenen, die so viel älteren Schwestern sprachen, schnappte sie auf. Vor allem wenn der Vater von seiner Arbeit berichtete, legte die Mutter oft den Zeigefinger auf die Lippen, damit Louise nicht die dunkle Seite seines Berufes kennenlernen musste.
Louise war zehn Jahre alt, als der Vater eines Abends mit schweren Schritten nach Hause kam. Wie immer begrüßte sie ihn schon auf der Treppe, wo er sie sonst nach ihren Schularbeiten fragte, aber an jenem Abend war es anders. Er legte ihr nur kurz die Hand auf den Kopf, ging an ihr vorbei, als sehe er sie gar nicht. In der Küche ließ er sich auf einen Stuhl fallen und stützte den Kopf in seine Hände. Louise sah, dass den Vater etwas schier Übermenschliches niederdrückte. Sie schlich ihm nach.
»Charlotte, meine gute Frau, bitte setz dich zu mir.«
Alarmiert schaute seine Frau ihn an. Rasch schob sie Louise aus der Küche, erteilte ihr einen Auftrag und schloss die Tür hinter ihr. Louise gehorchte ihrer Mutter üblicherweise, doch heute schaute sie durchs Schlüsselloch, schaute und lauschte, weil sie ihren eigenen Vater kaum wiedererkannte. Als sei er um Jahre gealtert, saß er zusammengesunken da. Louise sah nur seinen Rücken, ab und an das Gesicht ihrer Mutter, auf dem sich schon nach den ersten Worten des Vaters ein namenloser Schrecken ausbreitete.
»Charlotte, sag mir, kann es wirklich die Pflicht eines Christenmenschen sein, einem anderen Menschen das Leben abzusprechen und zu nehmen?«
Hastig nahm sie seine Hand. »Fürchtegott, musstest du wirklich …« Sie wagte nicht, es auszusprechen. Als er stumm nickte, schlug sie sich die Hand vor den Mund. »Der Himmel sei uns allen gnädig. Willst du … kannst du darüber sprechen?«, fragte sie sanft.
»Ich musste heute den Stab brechen über einem Mörder. Er sagt, er sei unschuldig, obwohl alle Beweise gegen ihn sprechen. Es gibt sogar Zeugen. Ich will dem Mann so gerne glauben. So gerne hätte ich Gnade walten lassen, aber ich entscheide es nicht allein. Allerdings bin ich derjenige, der dann den Stab brechen und das Urteil sprechen muss. Die anderen, die mir keine Wahl gelassen haben, die gehen schön nach Hause und waschen ihre Hände in dem Wasser, das Pilatus ihnen vererbt hat. Ich bin derjenige, der mit schwerem Herzen und einem noch viel schwereren Gewissen hier sitzt.«
Louise hielt den Atem an. Sie hatte genug verstanden, um zu wissen, dass ihr Vater, ihr gütiger Vater, einen Mann zum Tode verurteilt hatte. Sie kannte die Gebote. Du sollst nicht töten, hieß das sechste. Verstieß der Vater damit nicht gegen dieses Gebot? Manchmal gingen Louise und ihre Schwestern dem Vater entgegen, wenn er von der Arbeit kam. »Lauft bis zum Galgenberg. Dort wartet auf mich«, sagte er dann. An dem weithin sichtbaren Gerüst wurden schon lange keine Menschen mehr aufgehängt. Heutzutage wurden sie mit dem Schwert enthauptet. Konnte das alles richtig sein? Was waren das für Menschen, die Gesetze machten, die gegen göttliches Recht verstießen?
»Musst du bei der Hinrichtung anwesend sein?«, fragte Charlotte leise.
»Nein, das darf ich mir zum Glück ersparen. Es wird schon genug Gaffer geben, die sich eine Hinrichtung nicht entgehen lassen. Ich bin entsetzt, dass auch Leute aus unserem Freundeskreis, ja, sogar Frauen, sich eine Hinrichtung anschauen, als sei es ein Lustspiel.«
Charlotte schaute stumm vor sich hin. »Ich weiß nicht, was in diesen Menschen vorgeht. Als ich noch ein junges Mädchen war, da überredeten mich ein paar Freundinnen mitzukommen. Sechs Räuber sollten geköpft werden.« Fürchtegott legte seiner Frau eine Hand auf den Arm, doch sie schien diese alte Geschichte loswerden zu wollen. Mit schreckensstarren Augen blickte sie in ihre Vergangenheit. »So viel Volk hatte sich versammelt. Man hätte meinen können, es sei eine Kirmes und es gebe Freibier für alle, so dicht drängten sie sich auf der Richtstätte. Ich schaute mich um, sah in all diese geifernden Gesichter, die nur darauf warteten, dass der Henker endlich beginnen möge. Die sechs Räuber – Männer, die ganz offensichtlich die Not zu ihren Schandtaten getrieben hatte – standen gefesselt auf dem Podest. Leute drängten sich nach vorn, stießen mir ihre Ellbogen in die Rippen, nur um aus nächster Nähe sehen zu können, wie der Henker diese armen Teufel köpfte. Ich blickte mich nach meinen Freundinnen um, die mich überredet hatten, ich sah sie nicht mehr. Ich sah nur noch eine Welle von Fratzen, die über mich hinwegbrandete. Ich roch nur noch die Angst der Verurteilten und die Geilheit der Menge. Ja, verzeih mir dieses Wort, ich kann es nicht anders nennen. Ich fühlte mich, als käme ich aus einer anderen Welt. War ich denn die einzige, die Mitgefühl für diese Männer hatte? Der Blick des einen traf mich, bohrte sich in meine Augen, in meinen Verstand, so flehend, voller Angst. Da wurde ich ohnmächtig und wurde weggetragen. Wenigstens dazu war man fähig. Als ich die Augen aufschlug, lag ich etwas abseits des Platzes, hörte nur noch, wie einer der Männer, die mich hergebracht hatten, darüber schimpfte, dass sie mindestens einen der Räuber verpasst hätten. Ich schleppte mich davon, denn ich hatte Angst vor den Geräuschen, dem Schreien, dem Schlag des Schwertes, dem Grölen der Menge.
Oh, verzeih mir, ich wollte dich nicht quälen«, rief sie plötzlich aus, wie aus einem Albtraum erwachend. »Verzeih mir, du leidest ja genau wie ich darunter. Du warst gezwungen, den Stab zu brechen.« Sie schlang die Arme um seinen Nacken. An ihrem unregelmäßigen, heftigen Atmen erkannte Louise, dass sie weinte.
»Wie könnte ich meiner Charlotte böse sein?«, flüsterte Fürchtegott und streichelte den Rücken seiner Frau, die sich nur langsam wieder beruhigte.
Louise stand schreckensstarr vor der Tür. Die Erzählung ihrer Mutter, gestammelt nur, ließ Bilder in ihr aufsteigen. Überdeutlich sah sie den Richtplatz, spürte sich selbst inmitten der Menge und es waren ihre eigenen Augen, in die sich der flehende Blick des Verurteilten bohrte. Sie war es, die sich nun davonschleppte. Aber ihr gelang es nicht, vor den Geräuschen zu fliehen: In ihrem Kopf hallten die Schreie der Räuber und die Schläge des Schwertes wider.
Es dauerte nicht lange, und das Armesünderglöckchen läutete in Meißen. Die Mutter suchte sich eine Arbeit im Keller, wie sie es immer bei diesem Klang tat. Niemand aus dem Hause Otto ging auf die Straße, alle beschäftigten sich irgendwie in der Küche, konnten sich nicht auf ihre Arbeit konzentrieren, waren fahrig und schauten einander schließlich bange an. Louise hielt es nicht mehr in der Küche. Sie wollte hinunter zur Mutter. Auf dem Weg dorthin kam sie an einem der Fenster vorbei, die hinaus auf die Straße blickten. Da sah sie den Zug. Und sie konnte nicht anders, als ans Fenster zu treten und hinauszustarren. Wie unter einem Bann stand sie, der ihr nicht erlaubte, die Augen wegzuwenden von den Scharfrichtern, die auf schwarz und silbern gezäumten Pferden der Prozession voranritten. Alle Henker Sachsens hatten sich eingefunden, gekleidet ganz in Schwarz, die Schwerter an ihren Gürteln. Nur der erste unter ihnen, der den Verurteilten köpfen würde, hatte sein Schwert schon entblößt. Auf einem Karren folgte der Elende, dem all dieser Aufwand galt. Gefesselt, schmutzig wie ein Tier, kauerte er in dem Wagen und ließ den Hass der Menge, die ihn mit Schmutz bewarf, über sich ergehen.
Louise spürte seine Angst mehr als alles andere. Wusste er, dass er gerade an dem Haus vorbeifuhr, in dem sein Richter saß? Konnte er ahnen, wie viel Schmerz es dem Gerichtsdirektor bereitete?
Erst als die Straße wieder leer, die Glocke längst verstummt war, kam die Mutter aus dem Keller und fand ihre Jüngste bleich und zitternd am Fenster.
»Louise, hast du dir etwa den Zug angeschaut?«, fragte sie mit gerunzelter Stirn.
»Ich wollte zu dir, Mutter, da hab ich …« Ihre Worte gingen in heftigem Schluchzen unter. Charlotte legte ihrer Tochter eine Hand auf die Schulter. »Du hättest in der Küche bleiben und dort deine Arbeit tun sollen. Geh!« Louise schaute ihre Mutter fragend an. Durfte sie es wagen, sich an sie zu schmiegen, ihre Arme um sie zu schlingen, damit die Mutter sie tröstete?
»Geh jetzt!«, sagte die Mutter in ungewohnter Strenge, worauf Louise die Stufen hinauf und in die Wohnung rannte. Ihr Hals schmerzte, als würde etwas sehr Großes darinnen feststecken.
Während Charlotte noch auf das sonnenbeglänzte Kopfsteinpflaster schaute, sah sie einen Amtskollegen ihres Mannes heraneilen. »Was will der noch?«, fragte sie sich grollend.
Im nächsten Moment hörte sie ihn läuten und energisch an die Tür hämmern.
Die Fensterläden der Küche waren noch geschlossen, der Raum lag im Dämmerschein; nur hier und da malte die Sonne grelle Linien auf den Boden, wo sie durch die Ritzen der Läden eindrang. Die Schwestern und der Vater hatten sich noch nicht aus ihrer Entsetzensstarre gelöst, als draußen im Treppenhaus Schritte und Rufe näher kamen.
»Fürchtegott!«, rief Charlotte. Klang das nicht glücklich? Fürchtegott lief hinaus aus der Wohnung und sah seine Frau mit seinem Amtskollegen die Treppe heraufkommen. Auf ihrem Gesicht mischten sich Tränen und Lachen.
»Fürchtegott, stell dir vor!«, rief sie. »Der Mann wurde vom obersten Richter begnadigt«, ergänzte der Amtmann. »Es hat sich ein Zeuge gefunden, der den Mann entlasten konnte. Buchstäblich im letzten Moment. Ich weiß, wie schwer Sie darunter gelitten haben, Herr Otto. Deshalb wollte ich es Ihnen so schnell wie möglich sagen.«
»Danke. Ich danke Ihnen. Ich wäre nie wieder froh geworden.« Mehr brachte Fürchtegott nicht heraus. Charlotte lag mit Freudentränen in seinen Armen. Von diesem Bild etwas peinlich berührt, ging der Amtmann eilig davon. Er hatte die entscheidende Nachricht überbracht. Er musste dem Gerichtsdirektor Otto nicht mehr berichten, wie glückselig die Angehörigen den Mann in Empfang genommen hatten. Und erst recht nicht musste er erfahren, wie die Menge gemurrt hatte über das entgangene Schauspiel. Dass sie sich selbst schuldig gemacht hatten, weil sie einen Unschuldigen geschmäht und sein Blut gefordert hatten, kam ihnen nicht in den Sinn.
Nicht nur Erlebnisse hinterließen ihre Furchen auf Louises Seele, auch Schillers Werke brannten sich in ihr Gedächtnis. Die Monologe aus der Jungfrau von Orleans, Maria Stuart und vor allem der Satz aus dem Don Carlos: »Sire, geben Sie Gedankenfreiheit!« wurden von ihr sowohl zu passenden als auch unpassenden Gelegenheiten deklamiert. Passend waren ihre Auftritte, zu denen sie sich gerne verkleidete, im Kreis der Familie. Unpassend waren sie in einem Kurbad, wo sie sich nach langer Krankheit erholen sollte. Die feinen Damen machten der mitgereisten Tante Malchen schwere Vorwürfe, wie sie solche Schriften einem elfjährigen Kind zu lesen geben könne.
Tante Malchen, deren Bewunderung für feine Damen weitaus größer war als ihr Horizont, konfiszierte den Schiller. Aber es war zu spät: Louise kannte schon alles auswendig und nahm nicht nur Anteil an den Schicksalen der starken Frauengestalten, sondern zog zum großen Missfallen der Tante auch ihre Schlüsse daraus. Selbst wenn diese Stoffe in der fernen Vergangenheit angesiedelt waren: kam ihnen nicht heute, in ihrer eigenen Gegenwart, Bedeutung zu? In Sachsen wurde niemand von den Engländern bedrückt, aber Bedrückung und Elend gab es genug. Letztlich war es egal, wer die Not der Menschen verursachte; Gedankenfreiheit musste gewährt werden, wenn man die Herrschenden auf Missstände aufmerksam machen wollte, damit sie Abhilfe schafften.
Da erreichten Nachrichten aus Frankreich das beschauliche Meißen: In Paris hatte die Bürgerschaft den König zur Abdankung und Flucht nach England gezwungen, denn dieser hatte versucht, das Parlament aufzulösen. Nun gab es in Sachsen kein Halten mehr.2 König Anton, der im Greisenalter seinem Bruder auf dem Thron gefolgt war, hatte keineswegs die Reformen eingeführt, nach denen die Sachsen lechzten. Vielmehr hütete er den Scherbenhaufen, den sein Napoleon treu ergebener Bruder hinterlassen hatte. Zensur, Willkür, Bespitzelung waren an der Tagesordnung. Kurz, die Sachsen hatten genug gelitten unter ihren Königen, die ihnen nichts als Krieg, Elend und Hunger beschert hatten.
In Ermangelung einer Bastille erstürmte man in Dresden das Polizeihaus in der Scheffelgasse. Dies geschah in der Nacht vom 9. auf den 10. September 1830. Die Polizei stand in dem Ruf, arrogant, korrupt und gewalttätig gegen kleine Leute zu sein. Nur gegen die Obrigkeit katzbuckelte sie, denn sie war auf den Monarchen vereidigt und damit der Handlanger eines korrupten Staates, der sich selbst lähmte und die Interessen des Volkes längst aus den Augen verloren hatte.
Auch in Meißen waren Tumultuanten unterwegs, die die Häuser der Stadträte mit Steinen bewarfen. In dieser Nacht saßen Charlotte und Fürchtegott in der dunklen Stube und lauschten hinaus auf die Straße. Die Töchter hatten sie zu Bett geschickt, doch diese waren weit entfernt davon, zu schlafen. Louise hatte schon den ganzen Tag die Unruhe gespürt, aber nicht zu fragen gewagt. Die Gesichter ihrer Eltern waren so angespannt und verschlossen wie nie.
»Clementine, was sind das für Leute, die heute Nacht draußen unterwegs sind?«, flüsterte sie in die Finsternis. Eng hatte sie sich an ihre älteste Schwester geschmiegt, die sie in ihren Armen barg. Schemenhaft sah sie das Bett auf der anderen Seite des Raumes, wo Antonie und Francisca lagen. Die beiden schienen schon zu schlafen. Machte ihnen das alles keine Angst?
»Das sind Tumultuanten«, flüsterte Clementine. »Diese Leute wollen nichts anderes als nur Tumult. Sie machen die Straßen kaputt, reißen die Pflastersteine heraus und werfen sie in die Fenster.«
»In unsere auch?« Louise klang ängstlich.
»Ich denke nicht«, erwiderte Clementine nach kurzem Zögern. »Weißt du, Louise, wenn man Veränderungen will, dann muss das in friedlichen Bahnen verlaufen. In Dresden haben sie zwar die Polizeiwache gestürmt, aber was das letztlich bringen wird … Wir können nur hoffen und beten, dass alles ein gutes Ende nimmt.«
Dies war ein frommer Wunsch, denn seit Jahrzehnten gärte es in vielen deutschen Ländern. Nachdem die Franzosen anno 1789 ihren König geköpft hatten, war die revolutionäre Welle über die Grenze geschwappt. Französische Soldaten brachten Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit zuerst in den Südwesten Deutschlands, wo die Mainzer 1793 den rheinisch-deutschen Freistaat ausriefen. Es gab eine demokratische Wahl, doch das Parlament ging unter im preußischen Kugelhagel.
Jahre später hatte Napoleon Europa fest im Griff. In Dresden wohnte König Friedrich August I. Mehr als ein Wohnen kann man seine Tätigkeit nicht nennen, denn seine Regierungstätigkeit beschränkte sich darauf, Napoleon zu huldigen. Viel zu eng knüpfte er sein eigenes Schicksal an das des Franzosen. Solange dieser glorreich war, ging es auch dem sächsischen König gut. Als die Trikolore zu sinken begann, hätte sich Friedrich August gerne bei seinen früheren deutschen Amtskollegen gemeldet, worauf diese begreiflicherweise keinen Wert legten. Nicht einmal zum Wiener Kongress, der 1815 ganz Europa neu ordnete, luden sie ihn ein. Der Fortbestand Sachsens war unsicher. Das Land musste Gebietsverluste hinnehmen und Reparationen bezahlen. Glücklicherweise räumte man dem ehemals so bedeutenden Land einen Platz im Deutschen Bund ein, der Staatenversammlung, die man auf dem Wiener Kongress ins Leben rief.
Viele Menschen in den deutschen Ländern hatten gehofft, dass ihr Leben nun besser würde, mussten aber erkennen, dass sich Zensur, Bespitzelung, ja sogar Hunger und Elend häuslich niederließen und nicht den Eindruck machten, als wollten sie Deutschland jemals den Rücken kehren.
König Anton von Sachsen war an sich kein schlechter Mensch. Er trug sogar den Beinamen »der Gütige« mit einer gewissen Berechtigung, denn in Einzelfällen war er bereit, seinem Volk große Zugeständnisse zu machen – wenn ihm diese Einzelfälle überhaupt zu Ohren kamen. So ließ er konsequent alles Wild in den Gegenden bejagen, aus denen sich die Bauern erfolgreich über Wildschäden beschwert hatten. Allerdings verfügten sich die Wildschweine unter dem massiven Druck der Jäger in die Nachbarschaft, um dort ungestört zu wüten. So lange, bis es auch den dortigen Bauern gelang, sich Gehör zu verschaffen.
Oder König Anton wollte auf seinen Reisen keinerlei Geschenke annehmen und sich auch nicht feiern lassen von den Städten, durch die er kam. Vielmehr legte er den Stadtvätern nahe, das gesparte Geld in die Verbesserung von Straßen, Krankenhäuser und eine bessere Bezahlung der Handwerker zu investieren.
Ja, für dergleichen Anekdoten sorgte der gute König Anton; allerdings fehlte ihm ein Überblick über das Staatswesen an sich. Er hatte lediglich sehr vage Vorstellungen davon, wie die einzelnen Kräfte in seinem Staat ineinandergriffen, wie der Staatsapparat aus Beamten funktionierte, woher Gelder kamen, wohin sie flossen, an welchen Stellen womöglich der Korruption die Türen offenstanden.
All diese Dinge waren Anton nicht wichtig. Er genoss das Leben mit seiner Gemahlin Therese, die beiden widmeten sich der Kultur und waren gerne und viel auf Reisen.
Freundlicherweise hatte Herr Detlev von Einsiedel die schwere Bürde der Regierungsgeschäfte auf sich genommen und versah seinen Dienst so gewissenhaft, dass er niemandem sonst erlaubte, ihm dreinzureden. Im Laufe der Zeit hatte er sich eine Machtfülle angeeignet, die selbst den Sonnenkönig in Staunen versetzt hätte. Er allein hatte das Recht, bei König Anton vorzusprechen; ihm allein unterstand die sächsische Polizei. Seine Bergwerke erhielten Staatsaufträge, und als Unterstützer des Pietismus und einer lutherischen Orthodoxie hielt er seine Hand über jede einzelne Pfarrstelle, die im Königreich zu besetzen war.
Einsiedel duldete keine Lockerung der Pressegesetze, jedes kritische Wort wurde auf die Goldwaage gelegt und brachte seinem Urheber oft Festungshaft ein.
Die Sachsen ächzten unter der »Einsiedelei«.
Einen weiteren Tiefpunkt erreichte König Anton, als er die Feiern zum dreihundertjährigen Jubiläum der »Confessio Augustana« absagte. Am 25. Juni 1530 hatten lutherische Fürsten auf dem Reichstag zu Augsburg dem Kaiser ihr Bekenntnis vorgelegt. Zwar hatten sie die Unterschiede zwischen ihrem Glauben und der katholischen Kirche dargelegt, aber auch Gemeinsamkeiten unterstrichen, um dem Kaiser die Anerkennung ihres Bekenntnisses so leicht wie möglich zu machen. Kaiser Karl V. hatte abgelehnt und die Fürsten verließen unter Protest den Reichstag und wurden fortan Protestanten genannt.
Seither wurde der 25. Juni in Sachsen groß gefeiert. Erst recht, als sich dieser Tag zum dreihundertsten Male jährte, bereitete man sich auf ein großes Fest vor. Wein- und Essensvorräte wurden angeschafft, Festkleider bestellt. Musik, Theaterstücke und Umzüge wurden vorbereitet. Zunächst gaben sich die Behörden dem vorfreudigen Treiben gegenüber aufgeschlossen, doch Detlev von Einsiedel blickte weiter: Er ahnte, dass dieser Festtag von den Sachsen dazu benutzt werden würde, politische Kundgebungen abzuhalten, denn schon lange bestand die Forderung nach Gewerbefreiheit, nach einem Haushaltsplan. Um jegliche Demonstrationen in dieser Richtung im Keim zu ersticken, wurde nicht einmal ein Umzug der Kinder gestattet. Außerdem bliesen die Jesuiten ihrem katholischen König ins Ohr, dass dem protestantischen Treiben Einhalt zu gebieten sei – ausgerechnet im Mutterland der Reformation.
Zu Recht waren die Sachsen empört und trafen sich trotzdem, um den Tag feierlich zu begehen. Was hätte man auch sonst tun sollen mit all den Weinvorräten und Festkleidern? Dies sah die Polizei als einen Verstoß gegen das Versammlungsverbot und schritt ein. Dabei wurde ein junger Mann getötet. Niemand konnte die Menschen daran hindern, zu dessen Beerdigung zu gehen, bei der man sich nicht auf fromme Grabreden beschränkte, sondern die Obrigkeit und vor allem die Polizei scharf kritisierte. Das Ganze artete zu einer regelrechten politischen Versammlung aus, doch kein Polizist wagte einzuschreiten.
Dies war nicht der einzige Vorfall, der die Menschen gegen die Polizei aufbrachte. Auch wenn die Geschehnisse in Sachsen harmlos waren im Vergleich zu Paris, drängten weise Berater König Anton von Sachsen, seinen Neffen, den überaus beliebten Prinzen Friedrich August, zum Mitregenten zu erheben. Das war die eleganteste Lösung, um die Hinrichtung eines Königs zu vermeiden. Wer konnte schon ahnen, wozu die Sachsen fähig waren, wenn sie nur fuchdch3 genug wurden! Allen Beteiligten war klar, dass damit eine Absetzung Einsiedels einhergehen musste. Der Mitregent nahm sein Amt auf, während sich Einsiedel ins Private zurückzog. Nun war der Weg frei für Reformen, die Prinz Friedrich August gemeinsam mit den Herren Lindenau, Könneritz und Falkenstein in Angriff nehmen wollte. Die Sachsen setzten all ihre Hoffnungen auf den Prinzen und seine ebenfalls jungen Berater.
Wie beliebt ein Herrscher sein kann, erlebte Louise im späten September 1830, als Prinz Friedrich August auf seiner Rundreise durch Sachsen auch nach Meißen kam.
Diesmal hielt Familie Otto nichts in ihrem Haus. Mit allen ihren Mitbewohnern liefen sie hinaus auf die breiten Straßen, wo die Kutsche des hübschen Prinzen vorbeikommen würde. Dicht drängten sich die Menschen an den Straßenrändern, um einen Blick auf den Mann zu erhaschen, auf den sie ihre Hoffnung setzten. Prinz Friedrich August war schon jetzt für seine Güte und Volksnähe bekannt. Was sollte erst geschehen, wenn er allein an der Macht war und seine Güte Gesetz wurde? Man traute ihm alles zu und feierte ihn wie einen Messias.
Wie in anderen Städten auch, hatten junge Männer am Stadtrand von Meißen die Kutsche des Prinzen angehalten und die Pferde ausgespannt, um die Kutsche selbst durch die Stadt zu ziehen. Jubel brandete ihm entgegen, Hüte und Taschentücher wurden geschwenkt, Vivat! und immer wieder Vivat!, rief die Menge.
Und Louise schaute.
Sie schaute von einer Treppe aus, auf die sich die Familie aus der Menschenbrandung geflüchtet hatte, auf dieses Meer aus fröhlichen Gesichtern. Hoffnung sprach aus ihnen. Hoffnung auf bessere Zeiten, auf Freiheit, auf Zeitungen, die wirklich schreiben durften, was in Sachsen geschah, oder einfach nur die Hoffnung auf einen vollen Magen. Kinder wurden der Kutsche entgegengehoben, als solle der Prinz sie segnen. Dicht und immer dichter drängten sich die Menschen zu der Kutsche hin. Sie schlossen einen undurchdringlichen Kreis aus großen Hüten, feinen Kleidern, Zylindern und Sonntagsstaat.
Nur ganz am Rand, dort, wo niemand sich mehr drängte, wohin der Glanz des Prinzen nicht mehr fiel, da hoben dürre Arme zerlumpte Kinder in die Höhe. Dann war der Prinz fort und die Schatten stahlen sich davon, wissend, dass ihr Los auch mit diesem Mann nicht leichter würde.
Aber Louise hatte sie gesehen. Sie kannte diese Schatten, die immer wieder an der Haustür ihrer Eltern erschienen wie eine Mahnung an die Vergänglichkeit auch des bescheidensten Wohlstandes. Ausgemergelte Frauenleiber, an deren schlaffen Brüsten vergeblich Kinder hingen. Ungenährt, ungewollt, ungeliebt. So viele waren es. So viele. Ihre ganze Hoffnung galt einem Stück Brot. Glück, Zufriedenheit und die Sicherheit eines Hauses waren nichts weiter als Versprechen, die das Leben selbst längst gebrochen hatte.
Im Hause Otto wurde noch lange gefeiert. Freunde und Nachbarn waren alle bei dem Gerichtsdirektor eingeladen, um auf das Wohl des Mitregenten zu trinken. Louise, in deren Kopf sich viel zu viele Bilder überschlugen, zog sich zurück in das Schlafzimmer, das sie mit den Schwestern teilte. Papier und Feder hatte sie schnell zur Hand und schrieb auf dem Fensterbrett ihr erstes Gedicht. Es dauerte nicht lange und Clementine schaute herein.
»Da bist du ja! Wir haben dich schon gesucht. Was machst du?« Sie trat hinter Louise und schaute ihr über die Schulter. Louise schaute kurz zu ihr auf, dann heftete sich ihr Blick wieder auf das Papier, auf dem schon ein paar Strophen entstanden waren. Wörter waren durchgestrichen, durch andere ersetzt, Pfeile deuteten an, wohin die Wörter gehörten.
»Dann lass ich dich lieber wieder alleine«, flüsterte Clementine und strich dabei ihrer jüngsten Schwester übers Haar. »Aber komm nachher und lies es uns vor, ja?«
In Louises Kopf arbeitete es fieberhaft. Kaum hatte sie wahrgenommen, dass Clementine bei ihr gewesen war. Das gerade Erlebte verdichtete sich zu Wörtern; Wörter versammelten sich zu Zeilen, fügten sich reimend ineinander, verdichteten sich zu Strophen. Sie las ihr Gedicht wieder und wieder durch, strich und ergänzte so lange, bis sie zufrieden war. Sie schrieb alles ins Reine und ging zurück zu ihrer Familie.
Wie erstaunt waren die Freunde und Nachbarn, als die Elfjährige mit einem Zettel in der Hand zu ihnen kam und Ruhe verlangte. Man wischte sich die Münder an den Servietten ab und drehte sich um. Der Nachbar mit der roten Nase fürchtete einen längeren Vortrag und versorgte sich mit einem vollen Glas Wein, seine Frau und die Söhne pickten Kuchenkrümel von den Tellern und stießen sich kichernd in die Seiten. Clementine klatschte in die Hände und brachte selbst die letzten Schwätzer zum Schweigen.
Und Louise trug ihr erstes Gedicht vor. Sie pries darin den Mitregenten, ermahnte ihn, für sein Volk zu leben, nur auf dieses sich zu verlassen, dann könnten ihm auch die Jesuiten nichts anhaben. Man applaudierte fröhlich, wobei sich die Nachbarn die berechtigte Frage stellten, woher die Elfjährige so gut über die Jesuiten Bescheid wusste.
»Sie schnappt alles auf!«, seufzte die Mutter, die mit ihrem Mann natürlich über die Hintergründe der abgesagten Feierlichkeiten im Juni gesprochen hatte.
Tatsächlich änderte sich mit Prinz Friedrich August mehr, als man zu hoffen gewagt hatte. 1831 bekam Sachsen sogar eine Verfassung, die Freiheit der Person, Freizügigkeit und Beschwerderecht einschloss. Die Pressefreiheit zählte nicht dazu – schließlich wollte man sich nicht auf eine Stufe stellen mit den Revolutionären auf der Straße.
Fürst Metternich reagierte prompt und ließ die sächsische Regierung wissen, man könne und wolle es nicht als möglich betrachten, dass die königlich sächsische Regierung sich Gesetze durch einen aufgeregten Pöbel oder durch irregeführte Bürger vorschreiben lasse.4
Auch aus Preußen kam keineswegs Lob. Der junge Lindenau war daraufhin nach Preußen gereist, um dort die Wogen zu glätten und um Verständnis für die sächsischen Reformen zu werben. Dies tat er mit dem Hinweis, dass König Anton de facto nicht mehr regiere. Diese Tatsache beruhigte den preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm und er schrieb am 3. Januar 1831 an den Mitregenten Prinz Friedrich August: »Wirklich, gnädigster Herr, wüsste ich nicht die Zügel der Herrschaft bey Ihnen in so frischen, kräftigen Händen, ich würde für uns als Nachbarn eine gewisse Besorgnis nicht unterdrücken können.«5
So unterschiedlich waren die Meinungen über die sächsischen Reformen. Die einen sahen darin den Untergang der gottgewollten Ordnung, die anderen ein laues Lüftchen, wo es einen Sturm gebraucht hätte.
Nach wie vor war es gefährlich, allzu laut seine Meinung kundzutun oder auch nur Tatsachen auszusprechen wie das Elend der Weber, der Klöpplerinnen oder des Industrieproletariats. Daher zog man sich zurück in die eigenen vier Wände, die im Laufe der Zeit immer heimeliger wurden. Allgemein waren die hellen Wände der Wohnstuben mit Blümchenmustern betupft, der Kaffee dampfte neben dem Kuchen, den die weißbeschürzte Hausfrau gebacken hatte, Schillerlocken wippten neben unwissenden Mädchengesichtern, die Biedermeier-Herren sprachen nicht mehr von Politik, sondern ließen leise Hausmusik erklingen. Selbst die Hirsche röhrten lautlos in ihren Ölgemälden. Lediglich die neumodisch kurzen Röcke, die nicht nur die Schuhe, sondern auch die Knöchel (Jawohl! Die Knöchel!) der Damen sehen ließen, sorgten eine Weile für Aufregung.
Fürchtegott Otto hatte die Leipziger Zeitung abonniert und las sie gerne mit seiner Frau und den Töchtern. Tante Malchen hörte dann und wann zu, behielt ihre Gedanken aber für sich, wenn ihr Schwager allzu modern wurde.
Einmal kam er mit den niedergeschriebenen Landtagsverhandlungen nach Hause, umarmte und küsste seine Frau, als wolle er ihr gratulieren, und rief: »Nun freue dich! In wenigen Jahren schon ist die Geschlechtsvormundschaft aufgehoben. Wenn ich sterbe, kannst du machen, was du willst und brauchst nicht erst einen Curator.«
»Das ist hoffentlich noch lange hin, mein lieber Mann, aber Gott sei Dank!«, erwiderte die Mutter. »Das wird auch gut sein für die Mädchen. Denkst du denn, dass die Änderung bald kommen wird?«
»Ich denke schon. Im Moment spricht man im Landtag nur darüber, aber wenn unsere Mädchen über einundzwanzig Jahre alt sind, wird dieses Gesetz sicher schon in Kraft getreten sein.«
Unter den älteren Töchtern brach ein wildes Geschnatter los. »Mündig! Jetzt dauert es nicht mehr lange, dann können wir selbst bestimmen.«
»Hört, hört! Haben wir euch denn so sehr geknechtet?« fragte der Vater belustigt.
»Ach, nein, Vater!« Clementine sprang von ihrer Arbeit auf. »Aber es ist doch ein anderes Lebensgefühl, wenn man weiß, dass man auch als unverheiratete Frau etwas gilt.«
»Was genau bedeutet das, Vater?«, fragte Louise und blickte von ihren Schularbeiten auf.
»Das, meine Liebe, bedeutet, dass unverheiratete Frauen über einundzwanzig Jahren und Witwen mündig sind. Man betrachtet sie vor dem Gesetz nicht mehr wie Kinder, sondern sie dürfen selbst bestimmen, wo und wie sie leben, wofür sie ihr Geld ausgeben – wenn sie welches haben. Sie dürfen selbst vor Gericht gehen, wenn ihnen Unrecht geschehen ist, und jemanden verklagen.«
»Nur die verheirateten Frauen stehen noch immer unter der Vormundschaft ihrer Ehemänner«, warf Charlotte ein. »Ich kann nur hoffen, dass auch das bald aufhört.«
Louise hörte schon nicht mehr, wie sich die Eltern scherzhaft stritten, wer denn hier im Hause mehr das Sagen habe. »Leben, wo und wie sie wollen.« Dies fiel tief in Louises Geist. Wie dankbar war sie, in dieser Zeit zu leben, in der so viel möglich war.
»Lernt nur fleißig, ihr Mädchen, dann braucht ihr nicht zu heiraten, wenn ihr nicht wollt«, schloss der Vater und setzte sich mit einem behaglichen Lächeln zwischen seine Töchter.
»Was wird es ihnen denn nützen, wenn sie noch so klug und gebildet sind?«, sagte die Mutter, worauf Tante Malchen zustimmend nickte: »Wenn sie zu klug sind, wird kein Mann sie wollen. Welcher Mann will schon eine Frau, die ihm vorschreibt, wo es langgeht? Die am Ende klüger ist als er! Und ganz aus ist es, wenn sie gebildeter ist als er. Wie kann in einem solchen Hause Frieden herrschen?«
»Liebe Tante, denkst du denn wirklich, dass häuslicher Frieden darin besteht, dass eine Frau weit hinaufschaut zu einem Mann, der ihr göttergleich überlegen ist? Auch Männer sind aus Fleisch und Blut und haben morgens beim Aufstehen strubbelige Haare und schlechten Atem.« Die aufkommende Empörung der Erwachsenen versuchte Clementine einzudämmen: »Aber«, rief sie mit erhobenem Zeigefinger, »ich werde einen Mann auch mit strubbeligem Haar lieben können, wenn er mich ebenfalls liebt, so wie ich bin. Ich werde ausschließlich der Liebe wegen heiraten.«
»Ein reicher Mann, der kann dich schön verhätscheln, aber mit einem armen Kerl, da ist die Liebe schnell vergranscht6. Ich werd dich dran erinnern, wenn du in einer Hütte haust und jeden Groschen dreimal umdrehen musst.« Tante Malchen sprach mit auffälliger Überzeugung. Sie gehörte zu den vielen Tausenden, die niemals geheiratet hatten und sich mit dem begnügen mussten, was verheiratete Geschwister ihnen zugestanden: einem Platz am Tisch, einem Bett. Dafür mussten sie sich nützlich machen, jeden Tag neu ihre Daseinsberechtigung verdienen.
Die Frage, ob Clementine aus Liebe oder für Geld heiratete, wurde nicht mehr beantwortet. Sie starb am 31. Dezember 1831 an Schwindsucht und wurde am Neujahrstag begraben. So traurig hatte die Familie Otto noch niemals ein neues Jahr begonnen. Am schlimmsten traf es Louise. Clementine, ihre Clementine war nicht mehr da. Clementine, die zwischen all der Arbeit doch auch Zeit für sie gehabt, sie umarmt und getröstet hatte, wenn die Bilder in ihrem Kopf gar zu heftig geworden waren. Wer sollte sie nun verstehen, wen konnte sie jetzt noch teilhaben lassen an der verworrenen Welt ihres Inneren?
Ihr kleiner, verwachsener Körper war ein einziges Schluchzen, als sie ihren Kopf in ihren Armen barg. Sanft fühlte sie die Hand der Mutter auf ihrem Kopf. »Ich weiß, Louise, Clementine stand dir am nächsten.« Mit einem Aufschrei umklammerte Louise ihre Mutter. »Ich will, dass sie zurückkommt. Sie soll wieder bei uns sein.« Dann brach sie in so heftiges Weinen aus, dass die Mutter all ihre Aufmerksamkeit ihrer Jüngsten zuwenden musste. »Louise, es tut uns allen unendlich weh.« Und leise, wie zu sich selbst sprechend, fügte sie hinzu: »Die ganze Welt steht auf dem Kopf, wenn Eltern ihre Kinder begraben müssen. Sie war meine Erste. Und sie war ein ganz besonderer Mensch. Ich weiß selbst nicht, wie ich ohne sie auskommen soll.« Seufzend ließ sie ihre Jüngste los. »Es muss weitergehen. Für uns alle, die wir noch da sind, muss es weitergehen. Hier, Louise, die Äpfel müssen zu Apfelbrei verarbeitet werden, bevor sie ganz verderben.« Die ruhige Stimme ihrer Mutter brachte sie kaum zu sich. Ganz mechanisch griff sie nach dem Küchenmesser, das die Mutter ihr hinhielt, und schnitt die Äpfel auf. Schnitt die faulen Stellen heraus, das Kerngehäuse; schnitt die Äpfel in kleine Stücke und ließ sie in den Topf fallen, in den auch die Mutter ihre Stücke fallen ließ. Mit einem scheuen Blick bemerkte sie, dass die Mutter mit dem Handrücken ihre Augen wischte, um dann mit versteinertem Gesicht desto emsiger zu arbeiten.
Louise schaute.
Ihre Augen ruhten unverwandt auf den Herrschaften der Stadt, die mit großartigen Garderoben durch die Straßen flanierten. Sie sahen gelangweilt aus, wie sie da an den Schaufenstern standen, die Auslagen betrachtend, die ihnen längst keinen neuen Reiz mehr verschafften. Sie saßen in den feinen Cafés, aßen Torten, die ihnen nicht bekommen würden, weil das üppige Mittagessen noch im Magen lag. Sie schienen keinerlei Zweck zu haben, sondern waren einfach nur da, bevölkerten die Straßen wie gierige Dämonen, die mit riesigen Händen alles an sich rissen. Nichts blieb für diejenigen, die wirklich Hunger hatten.
Dies war nicht nur in Sachsen der Fall, sondern in allen Ländern des Deutschen Bundes. Und diejenigen, denen der Hunger nicht jeden klaren Gedanken aus dem Kopf fraß, hungerten nach mehr: nach Freiheit! Zwar herrschte Friedhofsruhe in den deutschen Landen, aber es gärte …
Wieder einmal war es im Badischen, wo sich der Widerstand mit Vehemenz regte: Da politische Versammlungen verboten waren, rief ein gewisser Philipp Jacob Siebenpfeiffer dazu auf, die Jubelfeier für die bayerische Verfassung7 ganz besonders eifrig zu besuchen. Die bayerische Verfassung war nichts, das man hätte bejubeln müssen, aber eine große Menge Volkes kam in jenen späten Maitagen des Jahres 1832 auf dem Hambacher Schloss zusammen. Die Tatsache, dass Siebenpfeiffer, der sich bereits durch die Herausgabe kritischer Zeitungen verdächtig gemacht hatte, zu diesem Fest einlud, hätte die Behörden aufrütteln können. Doch allzu schnell rüttelte und regte sich nichts bei deutschen Behörden. Die Jubelfeier gestaltete sich also ungestört zu einem riesigen Volksfest, zu dem etwa dreißigtausend Menschen strömten. Zum ersten Mal wagte man, schwarz-rot-goldene Fahnen zu zeigen, die für ein vereinigtes Deutschland standen. Mit diesen zog man hinauf zum Schloss, wo Siebenpfeiffer seine Eröffnungsrede hielt:
»Es wird kommen der Tag, wo der Deutsche vom Alpengebirg und der Nordsee, vom Rhein, der Donau und Elbe den Bruder im Bruder umarmt, wo die Zollgrenzen und die Schlagbäume, wo alle Hoheitszeichen der Trennung und Hemmung und Bedrückung verschwinden.
Dann wird in strahlendster Gestalt sich erheben, wonach wir alle ringen und wozu wir heute den Grundstein legen – ein freies deutsches Vaterland.
Es lebe das freie, das einige Deutschland!
Hoch leben die Polen, der Deutschen Verbündete!
Hoch leben die Franzosen, der Deutschen Brüder, die unsere Nationalität und Selbstständigkeit achten!
Hoch lebe jedes Volk, das seine Ketten bricht und mit uns den Bund der Freiheit schwört! Vaterland – Volkshoheit – Völkerbund hoch!«
Ein geeintes Deutschland mit einer freiheitlichen, ja sogar demokratischen Verfassung wurde gefordert.
Aber die Männer, die dieses Leuchtfeuer deutschen Volkswillens entzündet hatten, waren nicht in der Lage, es am Brennen zu halten. Die Fackel verlosch in einem Sumpf aus Eitelkeit, Eigensinn und Kleinkrämerei. Bei der abschließenden Versammlung, bei der sich die führenden Köpfe der Opposition heißredeten, wurde lediglich beschlossen, das jeder auf eigene Faust handeln solle. Man war sich einig, dass man sich nicht einigen konnte. Die Behörden hielten sich nicht lange damit auf, sich darüber zu amüsieren, sondern handelten. Alle Forderungen, die man so kühn in den Hambacher Sommer gerufen hatte, kamen als ein hohnlachendes Echo zurück: Die Repressalien wurden verstärkt, Oppositionelle umso gnadenloser verfolgt, die Zensurschrauben noch enger angezogen. Denn natürlich sah die Obrigkeit in diesem Fest keinen Aufbruch in eine strahlende Zukunft, sondern den Untergang jeglicher Ordnung. Anarchie und Bürgerkrieg würde ihrer Meinung nach dieser Hambacher Skandal nach sich ziehen.
Tatsächlich berichtete die Presse in den umliegenden Kleinstaaten ausführlich über das Hambacher Fest, was die Menschen in den angrenzenden Gebieten zu Aufständen ermutigte. Pressefreiheit, Meinungsfreiheit mussten herrschen, wollte man der Obrigkeit die fatalen Missstände aufzeigen. Wie sonst sollte Abhilfe geschaffen werden, wenn man immer nur über den Hunger und das Elend der Menschen schwieg? Doch die Hoffnungen auf Freiheit und ein besseres Leben gingen unter im Kugelhagel der Soldaten.
Heinrich Heine, der selbstverständlich auch auf der schwarzen Liste stand, die von den Behörden geführt wurde, schrieb nur wenig später:
»Während den Tagen des Hambacher Festes hätte mit einiger Aussicht guten Erfolges die allgemeine Umwälzung in Deutschland versucht werden können. Jene Hambacher Tage waren der letzte Termin, den die Göttin der Freiheit uns gewährte.«
Aber die Menschen ließen nicht locker: Am 3. April 1833 stürmten die Frankfurter die Konstablerwache, in der Hoffnung, dadurch eine Revolution in allen Ländern des Deutschen Bundes auszulösen, doch auch sie scheiterten. Allerdings machten sie mit ihrer Aktion den Herrschenden nur allzu bewusst, wie brandgefährlich die Stimmung unter den Menschen war. Um die Friedhofsruhe weiter zu gewährleisten, versammelte Fürst Metternich seine Mitstreiter 1834 in Wien zu einer Ministerialkonferenz, bei der ganz im Geheimen alle Zugeständnisse, die man bisher gewährt haben mochte, wieder rückgängig gemacht wurden: Die Abgeordneten in den örtlichen Parlamenten, die ohnehin kaum gegen ihre Provinzfürsten ankamen, wurden weiter in ihren Rechten beschnitten, durften nicht einmal mehr beim Haushalt mitbestimmen, sondern nur noch zuschauen, wie ihre Fürsten immer mehr Geld für Prunk und Militär ausgaben, anstatt dem hungernden Volk die Steuerlast zu erleichtern. Das Militär sollte nur noch auf den Monarchen vereidigt werden, nicht einmal mehr auf eine Verfassung – und sei sie noch so rückständig. Und natürlich wurden Meinungs- und Pressefreiheit noch weiter eingeschränkt.
Überall waren Spitzel unterwegs. Die Polizei überwachte jeden, der auch nur im Verdacht stand, eigenständig zu denken, und auch diejenigen, die laut auszusprechen wagten, dass man die Arbeiter mit ihren Familien nicht verhungern lassen könne. Dass man den Kindern, die sich schon mit fünf Jahren ihre Knochen in den Fabriken kaputtschufteten, doch wenigstens abends ein wenig Schulunterricht gönnen solle. Dass man die Kinder nicht zwölf Stunden am Tag und an sechs Tagen in der Woche für Löhne arbeiten lassen sollte, die nicht ausreichten, um sie satt zu machen. Dass man den Webern faire Preise zahlen, den Klöpplerinnen im Erzgebirge wenigstens so viel geben sollte, dass sie sich und ihre Kinder vor dem Hungertod bewahren könnten.
Wer dies aussprach, wurde hart verfolgt und bestraft. Doch die Lage in den deutschen Ländern wurde für die Ärmsten der Armen immer prekärer. In den Fabriken standen moderne Maschinen, die in Windeseile schafften, wofür ein Mensch an seiner Werkbank Tage brauchte. Für diese Menschen war der Fortschritt geradezu tödlich. Konnte, durfte das sein, dass der Fortschritt über die Menschen hinwegschritt; sie niederwalzte und zermalmte? War unter diesen Umständen Fortschritt möglich? Musste der technische Fortschritt nicht zwangsläufig einhergehen mit einem neuen Menschenbild, einer neuen Gesellschaftsordnung? Konnte es auf lange Sicht gut gehen, wenn nur ein Teil des Volkes im 19. Jahrhundert angekommen war und der weitaus größere Teil noch lebte wie im Mittelalter? Würde sich die tödliche Seite dieser Entwicklung nicht irgendwann bitterst rächen, zerstörerisch wüten in den Villen und Palästen derer, die im Moment davon profitierten? Konnte man wollen, dass Arbeiter ausschließlich arbeiteten? Sechzehn Stunden am Tag? Ohne Absicherung bei Krankheiten, die bei der schweren Arbeit, die in vielen Fabriken verrichtet wurde, gang und gäbe waren? Konnte man zulassen, dass der Fortschritt abrupt zum Stehen kam vor der ärmlichen Behausung derer, die ihn mit ihrer Hände Arbeit schufen?
Unterdessen war der Tod erneut im Hause Otto eingekehrt. Nach Clementines Tod hatte sich Louise enger an die Mutter angeschlossen, doch eines Tages begann die Mutter, immer heftiger zu husten. Der Husten wurde immer stärker und schüttelte unbarmherzig ihren Leib, der zusehends schwächer wurde. Die Auszehrung oder Schwindsucht war nicht heilbar. Louise war sechzehn Jahre alt, als die Mutter im Oktober 1835 starb. Charlotte war erst 54 Jahre alt.
Der Vater versuchte nun, seinen Töchtern alles zu sein, Vater und Mutter. Vor allem um seine Jüngste machte er sich Sorgen, weil die größte Sorge der Mutter auf ihrem Sterbebett Louise gegolten hatte. Was sollte aus dem verträumten, verwachsenen Mädchen werden, dessen Augen bald intensiv in die Welt schauten, bald sich nach innen zu wenden schienen, wo sie das Gesehene kaum verarbeiten konnten? Louise war dankbar für ihren verständnisvollen Vater, der sie mit allem, was sie tat, gewähren ließ. Er redete ihr nicht drein, wenn sie las, schrieb oder einfach nur still vor sich hin blickte. Enger als jemals schloss sie sich an ihren Vateran, in dem sie einen Vertrauten und einen Verbündeten in ihrer Trauer fand. Doch im Februar 1836 starb er an einem Schlaganfall.
Louise hatte das Gefühl, in eine bodenlose Dunkelheit zu fallen.
Dresden im Frühjahr 1839
Es war ein schöner Frühlingsabend, als Louise und ihre Schwestern mit dem Schiff nach Dresden fuhren. Antonie und Francisca wurden begleitet von ihren Bräutigamen, die sie Tante Therese vorstellen wollten. Nach allen Erzählungen waren die beiden jungen Herren nicht erpicht darauf, aber irgendwann musste es sein.
Das Schiff passierte die letzte Flussbiegung und vor ihnen lag im Schein der Abendsonne die barocke Stadt mit ihren Türmen, der dunklen Kuppel der Frauenkirche. In der Nähe des Schlosses streckte eine Baustelle ihre Kräne in den Himmel.
Immer näher kamen sie, deutlicher hoben sich die Bauten aus dem Abenddunst hervor, bald sahen sie die Anlegestelle, an der schon viele Menschen auf das Schiff warteten.
»Antonie, siehst du schon unsere Tante Therese?«, fragte Louise und beugte sich an der Reling vor.
»Wie könnte ich Tante Therese übersehen? Schau, da drüben steht sie und schwenkt ihren Regenschirm, wahrscheinlich aus lauter Angst, wir könnten sie übersehen, uns in Dresden verlaufen und unter die Räder kommen.«
Bei diesen Worten wechselten Heinrich Burckhardt und Julius Dennhardt vielsagende Blicke. Sie würden sich und ihren beiden Bräuten sicher schöne Tage machen in der Stadt und den Argusaugen der Tante ausweichen.
Francisca und Louise kicherten, als sie die Tante sahen. Ja, die gute Therese Vogel gab sich immer sehr mondän, wenn sie ins beschauliche Meißen kam, und wurde nicht müde zu betonen, wie groß und weltstädtisch Dresden war. Allerdings führte dies dazu, dass sie übermäßig besorgt war, wenn die Meißener Mädchen nach Dresden kamen. Wie eine Glucke hatte sie gut acht auf die drei Schwestern. Louise winkte ihr zu, was noch heftigeres Tantenwinken zur Folge hatte. Die gute Therese Vogel war verwitwet, trug schwarze Kleider mit vielen Rüschen und immer einen Hut mit einem kleinen Schleier. Dadurch war sie zwischen all den frühlingshaft hell gekleideten Menschen gut zu erkennen.
»Gut, dass sie weiß, dass wir sie schon gesehen haben, sonst würde sie womöglich noch auf und ab hüpfen«, vermutete Francisca und nahm ihren Koffer.
»Aber Francisca, den Koffer musst du doch nicht nehmen. Gib ihn mir«, verlangte Heinrich und nahm seiner Braut die Last ab. Francisca lächelte ihn dankbar an, zumal das Gedränge an Bord des Schiffes so kurz vor der Ankunft in Dresden lästig wurde. Julius nahm seiner Braut ebenfalls das Gepäck ab und vergaß auch Louise nicht. So kam die kleine Reisegruppe ans Ufer. Dort standen sie vor der Tante und die beiden Herren sahen sich einem kritischen Blick unterzogen. Ein Militärarzt hätte nicht prüfender dreinschauen können.
»Da habt ihr euch zwei schöne, stattliche Männer ausgesucht«, waren die ersten Worte der Tante, noch bevor sie ihre Nichten begrüßt hatte. Die beiden Herren gaben der Tante die Hand und verneigten sich kurz, indem sie sich vorstellten.
»Burckhardt und Dennhardt. Und schöne Namen haben sie obendrein. Guten Tag, meine Lieben alle. Es muss eine angenehme Fahrt gewesen sein, von Meißen hierher, bei dem Wetter.«
Die drei Schwestern begrüßten ihre Tante mit einer Umarmung.
»Aber nun lasst uns erst einmal zu mir nach Hause gehen. Ihr seid sicher alle müde von der Reise, nicht wahr?« Louise musste neben der Tante gehen, die beiden Paare folgten.
»Was wird dort gebaut, Tante?«, fragte Louise, als sie die Baustelle passierten, deren Kräne sie schon vom Schiff aus gesehen hatten.