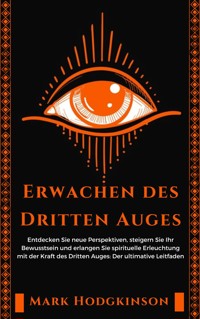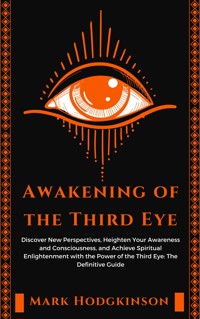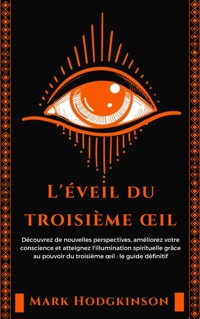20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Sports - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
5. August 2024. Paris, Roland Garros. Im Finale gegen Carlos Alcaraz gewinnt Novak Djokovic jenen Titel, der ihm in seiner Sammlung noch gefehlt hat: Olympisches Gold. Nach seinem Matchball weint der oft so unterkühlt wirkende Serbe hemmungslos. Novak Djokovic ist ein Phänomen. Niemand, weder Federer noch Nadal, keine Steffi Graf und keine Serena Williams, ist erfolgreicher als der serbische Superstar, der bei den US Open 2023 seinen 24. Grand-Slam-Einzeltitel gewann. Doch wer ist der Mensch hinter dem Sportler, der nicht nur mit spektakulären Siegen Schlagzeilen macht, sondern abseits des Platzes für so manche Kontroverse sorgt? Tennis-Autor Mark Hodgkinson zeichnet in seiner umfassenden Biografie, für die er mit Wegbegleitern, Mentoren, Trainern und Rivalen gesprochen hat, das Bild einer ebenso faszinierenden wie komplexen Persönlichkeit, die sich durch ihr Streben nach Perfektion und unkonventionelle Überzeugungen auszeichnet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
In Erinnerung an meine Mutter
Inhalt
EINLEITUNG
DAS GOLDKIND
OPFER
AM SCHEIDEWEG
DER MANN HINTER DEM DJOKER
GEDANKENFUTTER
VOLLENDETE ZUKUNFT
EIN TENNISORIGINAL
EINSAMER WOLF
„DAS WAR’S“
DER ZAHLENMENSCH
„SEI FROH, WENN DU GEHASST WIRST“
DUNKLE ENERGIE
GEFANGEN
„DER OBERSCHURKE DER WELT“
BESESSENHEIT
GOAT
EINLEITUNG
Dezent ist es nicht gerade, aber wer bucht schon einen Tisch im Novak-Restaurant, wenn er Bescheidenheit erwartet. In einer glorreichen Endlosschleife der Tennis-Nostalgie – oder auch Novalgie – werden auf den Monitoren an den Wänden frühere Matches und Novaks beste Ballwechsel abgespielt. Novak Djokovic empfiehlt natürlich, während des Essens nicht fernzusehen, da das unsere Nahrung schlechten Emotionen aussetzen könnte, aber für sein eigenes Restaurant in Belgrad macht er eine Ausnahme: Hier gibt es ohnehin nur gute Vibes.
Wenn man das Restaurant betritt, kommt man am Djokovic-Wasserspiel vorbei und wird am Kopf der Treppe von einer überdimensionierten Statue des Tennisspielers als Terrakotta-Krieger empfangen – teilnahmslos und irgendwie auch allwissend und unerschütterlich – und erst dann vom Oberkellner. Alles hier sprengt den Rahmen – warum auch nicht? –, sogar die riesigen Vitrinen mit einigen von Djokovics Trophäen. Auf dem Weg zum Tisch sticht ein gerahmter Motivationsspruch ins Auge: „Make it happen!“ Er ist von brennenden Kerzen umgeben, die den Worten etwas Sakrales verleihen. An anderer Stelle prangt eine Art metallene 3-D-Skulptur seines Logos. Fast jeder Fleck an der Wand, der nicht von Bildschirmen eingenommen wird, ist mit Fotografien von Djokovic bedeckt, wie er Bälle schlägt und Pokale in die Höhe hält.
Eine Säule ist mit Hunderten von alten Tennisbällen befüllt, von denen er vielleicht sogar einige selbst gedroschen hat. Als bildeten all die Mühen und der Schweiß des Tennisplatzes das Fundament dieses Restaurants. Es gibt sogar ein grelles, fast psychedelisches Kunstwerk, das Djokovic als kleines Kind zeigt, einen Schläger schwingend – eine Erinnerung daran, wie alles begann. Wer es noch nicht bemerkt hat: Wir sind in Novak Djokovics Welt eingetaucht (in der es auch glutenfreie Alternativen gibt).
Wenn Sie also gerade in Belgrad gelandet und auf der Suche nach Djokovic sind, wenn Sie besser verstehen möchten, wer er ist und wie er tickt, dann eignet sich das Novak-Restaurant besonders gut als Einstieg. Frisch aus dem Flieger, beginnt man die mit Tennisbällen verzierte Speisekarte zu psychoanalysieren. Wie schmeckt Erfolg? Das ist die Frage, die dieses Restaurant geben will. Aber wenn man hier sitzt und Pilzrisotto, Tomatensalat und ein Stück Novak-Tarte verspeist, während man von den bewegten und unbewegten Bildern des Spielers umgeben ist, fragt man sich schon: Wer ist hier eigentlich in wessen Kopf? Es dürfte auf der Welt kaum ein zweites Restaurant geben, das eine Person des öffentlichen Lebens auf eine solch umfassende, multimediale Art und Weise feiert, geschweige denn eines, das sich im Besitz eines Spitzensportlers und dessen Familie befindet. Das alles ist weder abfällig noch bissig gemeint. Es ist ein lustiger, fröhlicher Ort, das Essen ist gut, und falls Sie sich je in Belgrad aufhalten, sollten Sie hingehen. Das Novak-Restaurant ist aber auch – auf gute Art – ziemlich überwältigend. Es ist viel mehr, als man sich vorstellen kann. Aber das gilt für fast jeden Aspekt von Djokovics Leben.
Djokovic ist der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten. Er ist der GOAT, der Greatest of All Time. Das an sich ist schon interessant. Noch fesselnder ist, wie er diese Größe erreicht hat: von den Bomben und Entbehrungen seiner Jugend über Erfahrungen jüngeren Datums, wie zum Beispiel das „Gefängnis“ in Melbourne, bis hin zu all den psychologischen Kämpfen, die mit dem Streben nach großen Erfolgen einhergehen. Hinzu kommt, dass Djokovic der neugierigste, unkonventionellste und progressivste aller Tennisspieler ist. Ja, Djokovic kann rutschen und mit mehr Flexibilität und Elan in den Spagat gehen als jeder andere Spieler. Auch gibt es niemanden, der Aufschläge so perfekt retourniert wie er, was er teils den Beatles zu verdanken hat (dazu später mehr). Und doch ist das Faszinierendste an ihm nicht, wie er sich bewegt oder wie er den Ball schlägt, sondern wie er denkt. Er ist der originellste Kopf im Tennis, womöglich sogar in allen Sportarten.
Vielleicht sind Sie bereits ein riesiger Djokovic-Fan und Teil der #NoleFam. Oder nicht, finden ihn aber dennoch faszinierend. Wo auch immer Sie ansetzen, wenn Sie das moderne Tennis mit all seinen Psychodramen wirklich schätzen und begreifen möchten, müssen Sie einen Blick in Novaks Kopf werfen. Sich auf die Suche nach Novak zu begeben, bedeutet, so tief wie möglich in seine Psyche einzutauchen.
DAS GOLDKIND
Tief in Novak Djokovics Luftschutzkeller hinabzusteigen – jenen Ort, an dem er während der Nato-Bombardierungen im Jahr 1999 viele Nächte verbrachte –, fühlt sich an, als würde man in jugoslawischen Beton hinabsteigen. Niedrige Decken, feuchte, fleckige Wände, die erdrückend wirken – selbst die Luft, die hier unten Mangelware ist, riecht schwach nach Beton. Man hat schon oft von der Belgrader Betonlandschaft gehört oder von zubetonierten Stadtteilen. Aber nichts bereitet einen auf das Grau und die Strenge dieses Bunkers vor, der sich ein paar Kilometer südlich des Stadtzentrums unter einem brutalistischen Wohnblock im Banjica-Viertel befindet.
Es ist aber nicht nur der kalte, raue, unversöhnliche Beton, der mehr als irritierend wirkt. Man stellt sich vor, wie sich Djokovic und all die anderen Menschen in diesem Bunker gefühlt haben mögen, und hat das Gefühl, dass es immer noch ein Ort der Angst, Verwirrung und aufsteigenden Wut ist, als ob der Beton um einen herum diese Emotionen aufgesaugt hätte und sie nun daraus abstrahlten.
Für Djokovic, der elf Jahre alt war, als die Nato-Flugzeuge begannen, Serbien zu bombardieren, ist das der Ort, an dem er Angst und Schrecken empfand, wo er „emotional verstört“ war, weil er nicht wusste, was ihn, seine beiden jüngeren Brüder Marko und Djordje und seine Eltern Srdjan und Dijana erwartete. Dies war der sicherste Ort in der Umgebung, ursprünglich errichtet als Atombunker. Um in das Herz des Bunkers zu gelangen, muss man eine Stahltür in der Farbe von frischem, sauerstoffreichem Blut passieren, eine Betontreppe hinabsteigen und zwei Stahltüren öffnen, deren dickere etwa dreißig Zentimeter stark ist – eine Tür, wie man sie sich in einem Banktresor oder U-Boot vorstellt. Die Menschen verschlossen die Türen hinter sich und riegelten sich hermetisch ab, indem sie an den riesigen Rädern drehten, um sich vor Explosionen und Feuer zu schützen.
Aber selbst hier drinnen, in diesen angeblich bomben- und feuersicheren Räumen, wussten sie, dass sie nirgendwo absolut sicher waren, dass selbst ein Atombunker nicht vor einem direkten Treffer schützte. In der fast vollkommenen Dunkelheit starrte Djokovic in das Gesicht seiner Mutter, um zu verstehen, was er fühlen sollte – wenn sie ängstlich aussah, und das tat sie meist, wusste er, dass auch er Angst haben musste.
Versteckt und verewigt in Beton, sieht der Keller noch fast genauso aus wie in den 1990er-Jahren, es ist eine Zeitkapsel, die einen in die Zeit zurückversetzt, in der Djokovic ein verängstigtes, verwirrtes Kind war inmitten vieler anderer verängstigter, desorientierter Kinder und auch Erwachsener. In eine Zeit, in der er auf Tiefflieger horchte, die Löcher in den Belgrader Nachthimmel zu reißen schienen, und dann den verheerenden, endlosen Donner der Bomben und Raketen erleben musste (der zwar durch den Beton gedämpft wurde, was jedoch die Angst der Schutzsuchenden in diesen langen, schrecklichen Nächten nicht minderte).
Wenn man den Bunker betritt, hat man das Gefühl, Djokovic näher zu sein, ihn besser zu verstehen. Der Bunker besteht aus einer Abfolge von kleinen Räumen und düsteren Ecken, und während man herumläuft und sich durch die Spinnweben kämpft, wird einem klar, dass das kein Ort ist, den Djokovics ehemalige Nachbarn oder die neuen Bewohner allzu oft aufsuchen dürften. Er ist selbst nur ein paarmal zurückkehrt, um sich genau daran zu erinnern, wie der Bunker aussieht; was er aber nie vergessen wird, ist die Intensität seiner Emotionen und wie es sich anfühlte, dort unten zu sein.
Alte Sessel und ein paar Korbstühle stehen verstreut herum; wahrscheinlich schon seit 1999. Der Müll auf den Tischen und am Boden dürfte ebenfalls ein Vierteljahrhundert alt sein. Nackte Glühbirnen baumeln von den Decken und verbreiten ein diffuses, chemisch-gelbes Licht, das kaum die Dunkelheit zu durchdringen vermag. Ein Nachbar, der den Keller aufgeschlossen hat, sagt, der einzige Unterschied zwischen damals und heute ist, dass 1999 Matratzen auf dem Boden lagen. Dort fror Djokovic unter einer Decke, als Belgrad eine grausame Premiere erlebte und als erste europäische Hauptstadt von der Nato bombardiert wurde, um den Rückzug des serbischen Militärs aus dem Kosovo zu erzwingen.
Djokovic war, um es in seinen ernüchternden Worten zu sagen, „von Tod umgeben“. Außerhalb des Bunkers, so erinnert er sich, „glühte Belgrad wie eine reife Mandarine“. Die Stadt war entweder verdunkelt oder von Nato-Kampfjets erleuchtet, dazwischen gab es nichts. In 78 aufeinanderfolgenden Nächten kamen die Flugzeuge und warfen ihre Bomben ab. Sobald die Sirenen ertönten, drängte die Familie in den Bunker im Keller des Wohnhauses seines Großvaters Vladimir. Zu Beginn der Bombardierung wohnten Djokovic, seine Brüder und seine Eltern etwa 200 Meter entfernt in einem Gebäude ohne Schutzraum und mussten sich ihren Weg durch die Dunkelheit, das Chaos und den Lärm bahnen.
Laut Novaks Vater, Srdjan Djokovic, löste eine solche Situation im Frühjahr 1999 bei seinem Sohn ein lebenslanges Trauma aus. Am erschütterndsten für Djokovic war eine Nacht in der ersten Woche der Bombardierung, als gegen drei Uhr morgens die Geräusche von Explosionen und berstendem Glas die Familie aus dem Schlaf rissen. Seine Mutter sprang auf, schlug mit dem Kopf gegen einen Heizkörper und wurde ohnmächtig. Eine gefühlte Ewigkeit, vielleicht aber auch nur ein paar Sekunden, lag sie bewusstlos auf dem Boden. Alle drei Kinder weinten. Als Dijana wieder zu sich kam, brachen sie zum Luftschutzbunker auf, konnten jedoch kaum etwas sehen – die Beleuchtung war ausgefallen, und die Straßen waren voller Rauch. Der Lärm der Flieger und der Detonationen war so enorm, dass sie einander nicht hören konnten, selbst wenn sie sich in die Ohren schrien.
Überwältigt und voller Panik stürzte Djokovic zu Boden, und als er mit aufgeschürften Händen und Knien dalag, blickte er auf und sah ein stählernes graues Dreieck „über den Himmel rasen“; einen F-117-Tarnkappenbomber, wie ihm später bewusst wurde. Dieses Bild ist ihm für immer im Gedächtnis geblieben: ein todbringendes Dreieck, das aus dem Nichts kommt und Bomben auf ein wenige Blocks entferntes Krankenhaus abwirft. Der horizontal gelagerte Bau hatte sich in ein „riesiges, mit Feuer gefülltes Sandwich“ verwandelt. Djokovic dachte, er würde sterben. Einen Moment später war der Bomber verschwunden, und die Familie lief weiter zum Bunker. Sosehr sich Djokovic heute bei einem gewonnenen Punkt nach dem Jubel der Menge sehnt, so sehr fürchtet er sich immer noch vor plötzlichen, lauten Geräuschen. Wenn ein Feueralarm losgeht, kann es passieren, dass er vor Schreck aufspringt.
Um näher am Bunker zu sein, zog die fünfköpfige Familie in die Zweizimmerwohnung im ersten Stock des großväterlichen Hauses, die sowohl über eine normale Eingangstür als auch über eine schützende Gittertür verfügte. Außerhalb des Bunkers wurden die Straßen von Explosionen erschüttert; drinnen zitterten die Kinder vor Angst.
Zumindest in den ersten Nächten. Danach verschob sich etwas. Die Familien im Bunker fanden sich allmählich mit ihrer neuen Realität ab, und da sie nun einmal hier unten sein würden, konnten sie genauso gut versuchen, sich abzulenken. Dicht gedrängt – Djokovic schätzt, dass sich etwa 50 Wohnungen in dem Gebäude befanden, sodass jeder Zentimeter Betonboden besetzt war – spielten die Bewohner Karten, sangen oder spielten Monopoly, Risiko und andere Brettspiele. Eine Normalität, die nur vorgetäuscht war, und doch wurden an diesem äußerst unbehaglichen Ort starke, lebenslange Bindungen geknüpft: In dieser Zeit lernte Djokovic einen gleichaltrigen Jungen kennen, Neven Markovic, der ebenfalls im ersten Stock des Gebäudes wohnte. Markovic, inzwischen ehemaliger Profifußballer, Trauzeuge von Djokovic und Jelena Ristic, ist bis heute einer der engsten Freunde des Tennisspielers.
Schon nach ein paar Minuten im Keller sehnt man sich nach Luft und Tageslicht. Allein die Vorstellung, Nacht für Nacht in diesen Bunker zurückkehren zu müssen, ist grauenhaft. Draußen setzen Wandgemälde mit Darstellungen von Djokovic ein paar Highlights in dem grauen Viertel. Hinter dem ehemaligen Zuhause der Familie befindet sich ein Bild von ihm und seinem Großvater auf der einen Seite, auf der anderen eines von seiner ersten Trainerin, Jelena Gencic. Wenn man den betonierten Bolzplatz passiert, auf dem Djokovic als Kind Tennisbälle schlug, stößt man auf ein weiteres Gemälde, darauf steht in serbischer Sprache: „Auf Gott vertrauen wir.“ Ein Nachbar weist auf einen Fehler in dem Bild hin, da es Djokovic beim Schlagen einer Linkshänder-Rückhand zeigt, aber das schmälert kaum die Kraft des Gemäldes und seiner Aussage für die Menschen in Banjica: Einer der Ihren hat es auf die Weltbühne geschafft.
Einige Jugendliche, die sich in der Nähe von Djokovics einstigem Wohnblock die Zeit vertreiben, sprechen in höchsten Tönen von ihm – ihre Großmütter informieren sie immer, wenn seine Matches im Fernsehen laufen, damit sie es sich auch ansehen –, aber weniger wegen seiner sportlichen Leistungen als wegen seiner Großzügigkeit. Sie erzählen davon, wie viel Geld er der Schule vor Ort gespendet hat, um das Nötige zu kaufen, und wie er, wenn er in der Stadt war, die Zeit gefunden hat, den Siegern eines Fußballturniers, das auf den Betonplätzen ausgetragen wurde, ihre Trophäen zu überreichen. Trotz der Schrecken, die Djokovic in Banjica erleben musste, sind auch schöne Erinnerungen geblieben, zum Beispiel, wie er mit seinen Freunden im Freien Fußball spielte (obwohl er sich so oft die Knie auf dem Betonplatz aufgeschürft hat, dass er bis heute kaum glauben kann, dass sie überhaupt heil geblieben sind), wobei manchmal versehentlich eine Fensterscheibe in der Erdgeschosswohnung zu Bruch ging und sie schnell das Weite suchen mussten.
Doch das Trauma bleibt. Auf der Rückfahrt ins Zentrum von Belgrad kommt man an einem alten Militärgebäude vorbei, das 1999 zerbombt und nicht wieder aufgebaut wurde. In dieser Stadt muss man nicht lange suchen, um die Narben des Krieges zu sehen. Aber wie Djokovic wollen die meisten hier die Vergangenheit hinter sich lassen.
Über Jahre nagte die Wut an Djokovic. Er empfand die Bombardierung von 1999 als „ultimative Grausamkeit“, und wie viele andere Serben war er voller Zorn, ja Rachegedanken. Bis ins Erwachsenenalter spürte er diese Wut in sich. Er konnte nicht verstehen, warum sich die Nato-Staaten zusammengeschlossen hatten, um ein so kleines Land zu bombardieren, warum sie Bomben auf diese, wie er sagt, hilflosen Menschen auf der Straße abwarfen. „Die Narben dieses Gefühls, dieser Wut, sind bis heute in uns allen gegenwärtig“, sagte Djokovic einmal. Zu Beginn seiner Karriere nutzte er diese Wut als Treibstoff, der ihm auf der Tour einigen Erfolg bescherte. Auch wenn er in Hass und Wut „feststeckte“, wie er sagte, hatte er das Gefühl, sie zumindest zu seinem Vorteil genutzt zu haben. Er spielte mit Wut im Bauch, und diese Wut brachte ihn voran.
Mit der Zeit musste Djokovic jedoch einsehen, dass Gefühle wie „Hass, Rache und Verrat“ auch belasten und bremsen können, beruflich wie privat. Er wollte diese Gefühle loswerden. Für Djokovic passt das Gleichnis von der Schlange und der Säge zu seiner Erkenntnis, dass man sich mit seiner Wut nur selbst schadet. Als sich die Schlange versehentlich an einer Säge verletzt, glaubt sie, das Werkzeug hätte sie angegriffen, und windet sich wütend und rachsüchtig darum herum, woraufhin sie verblutet.
Djokovic ist bewusst, dass das serbische Volk in sehr unterschiedlicher Weise von Leid und Trauma heimgesucht wurde. Seine Familie hatte noch Glück, weil sie im Unterschied zu vielen anderen weder ihr Zuhause noch enge Freunde oder Familienmitglieder verloren hat. In den Zeitungen wurden seinerzeit Listen mit den Namen der Toten abgedruckt, von denen seine Eltern einige kannten. Den Schmerz derer, die Verwandte oder Freunde auf diesen Listen entdeckten, mochte er sich kaum vorstellen. Obwohl Djokovic die Nato-Bombardierungen, den Tod und die Verwüstung, die sie über sein Land brachten, nie vergessen wird und die „Fuck Nato“-Graffiti in Belgrad gesehen haben dürfte, entschied er sich zu vergeben. Es war eine bewusste Entscheidung, an sich zu arbeiten und mit seinen Gefühlen und seiner Wut umzugehen. Djokovic wollte nicht mehr von Wut angetrieben werden, sondern von Liebe, denn „Liebe ist Vergebung“.
Das war nicht einfach, aber Djokovic hat einen offenen Geist – worauf wir später genauer eingehen werden – und sagt selbst, dass er sein Herz öffnen wollte. „Novak hat gelernt zu vergeben und ist wahrscheinlich früher zu dieser Einsicht gelangt als andere“, sagt Dusan Vemic, der Djokovic kennt, seit der zukünftige Tennisstar sechs oder sieben Jahre alt war, und ihn später auf der ATP-Tour trainierte. „Novak ist ein Mensch, der sich immer weiterentwickelt und dazulernt. Er möchte über sich hinauswachsen und erforscht das Leben unermüdlich. Er ist an einem Punkt in seinem Leben, wo er versucht, die Entscheidungen anderer Menschen zu verstehen, sich in sie hineinzuversetzen und so rational wie möglich zu sein.“
Die Überwindung der Wut habe Djokovic geholfen, ein stärkerer Mensch zu werden, sagte die Serbin Jelena Jankovic, eine ehemalige Weltranglistenerste im Dameneinzel. „Als Nation ist man wütend, wenn man von jemandem bombardiert wird. Das ist beängstigend. Aber wir normalen Menschen können nichts dagegen tun“, sagte sie. „Doch sobald man diese Angst überwunden hat, wird man als Person stärker und versucht, sein Bestes zu geben, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen und sich einen Namen zu machen.“
Djokovics Glaube als orthodoxer Christ habe ihm geholfen zu verzeihen, meint sein Jugendtrainer Bogdan Obradovic, der ihn kennt, seit er zehn Jahre alt war. „Das ist Novaks Philosophie, die nicht nur ihn, sondern auch viele andere orthodoxe Serben prägt“, sagt Obradovic. „Wir sind in der Lage zu vergeben.“ Djokovic schaffte es, weiterzumachen, sich zu lösen. „Wenn man in der Wut feststeckt“, hat Djokovic einmal gesagt, „was kann man dann noch aus seinem Leben machen?“
*
Djokovic war gern möglichst einen Tag nach den Bombern vor Ort. Nachdem er sich für das Tennistraining angezogen und seine Schlägertasche so sorgfältig gepackt hatte, als würde er zum Country Club aufbrechen, verließ er im Morgengrauen die Wohnung und ging auf die Jagd nach der Zerstörung in Belgrad. Er suchte nach frisch geschwärztem Gras, neuen Kratern, deformiertem Stahl und Beton. Nach den Orten, die die Wunden des Vortages trugen.
So pervers oder grauenhaft es heute klingen mag, es hatte eine gewisse Logik, dass Djokovic und seine Familie sich über das Radio informierten, wo die Bomben in der Nacht zuvor abgeworfen worden waren: Sie gingen auf die Tennisplätze in den getroffenen Stadtteilen, da die Nato ja mit großer Wahrscheinlichkeit nicht ein und dieselbe Stelle zweimal hintereinander bombardieren würde. Djokovic musste auch die Tageszeit im Blick behalten: Ein aufstrebender junger Tennisspieler in Belgrad im Jahr 1999 zu sein, bedeutete, ein Amateur-Analytiker der Nato-Bombardierungsmuster zu sein. Man musste lernen – und das fühlte sich manchmal trotz des Grauens wie ein Spiel für ihn an –, wann die sicherste Zeit des Tages war, um auf dem Platz zu stehen. Oft war es in der Morgendämmerung am ruhigsten, manchmal mittags.
Wenn Djokovic heute in Belgrad ist, trainiert er meist woanders, in einer eleganteren, schickeren Anlage, wo die Szene hingeht, exklusiv gekleidete Damen und Herren, die auf der Terrasse mit Blick auf die Außenplätze (Hallenplätze gibt es natürlich auch) Espresso schlürfen. Aber als Junge spielte er oft im Tennisclub Partizan, einem mit seinem schmuddeligen Look, den Graffiti an den Außen- und abblätternder grüner Farbe an den Innenwänden nicht gerade instagramtauglichen Verein. Dafür ist die Atmosphäre freundlich, unaufdringlich und bescheiden – und Djokovic kein großes Thema. Im Eingangsbereich hängen zwar Plakate von ihm, doch sind sie verblasst und vergilbt – sie stammen aus der Zeit, als er noch für Adidas warb. Gegenüber hängen gleichberechtigt Poster von Ana Ivanovic, die einen Grand-Slam-Titel gewonnen hat. Ansonsten gibt es an den Wänden noch ein paar alte Fotos, die Djokovic unter anderem im schwarz-weiß gestreiften Trikot des Clubs zeigen, aber keine Statue oder etwas anderes Offizielles, das daran erinnert, dass der erfolgreichste Tennisspieler der Geschichte hier trainiert hat; dafür wiederum die Büste eines Generals, der in der Clubgeschichte eine Rolle spielte.
In einer Zeit, da fast jede Entscheidung, die man traf, große Risiken mit sich bringen konnte, war es besonders gewagt, im Tennisclub Partizan zu spielen, der zwar in der Nähe von Banjica lag, aber auch nicht weit von einer Militärschule, was die Bomber in diese Gegend lockte. Novaks Mutter war dann besonders nervös: Was, wenn die Nato eine Bombe auf den Trainingsplatz ihres Sohnes abwarf?
Einige Wochen nach Beginn der Nato-Bombardierung geschah jedoch etwas Erstaunliches: Viele Menschen in Belgrad beschlossen, keine Angst mehr zu haben. „Nach all dem Tod und der Zerstörung haben wir einfach aufgehört, uns zu verstecken“, schrieb Djokovic in seinem Buch Siegernahrung. Es war befreiend für ihn zu erkennen, dass man angesichts der Feuerkraft der Nato machtlos war, und sein Schicksal zu akzeptieren. Djokovic und seine Familie waren Teil dieses Mentalitätswandels. Sie gingen nicht mehr in den Bunker. Die Mutter entwickelte einen gewissen Fatalismus angesichts der Möglichkeit des Todes und erklärte ihrer und anderen Familien im Luftschutzkeller, dass sie verrückt würde, wenn sie dort auch nur eine weitere Nacht verbringen müsste. Sie würde mit ihrer Familie in die Wohnung zurückkehren, und sollte die Nato eine Bombe auf ihr Gebäude abwerfen, wäre das ihr Schicksal. Djokovic, zweifellos von der Haltung seiner Eltern beeinflusst, dachte ähnlich. „Wenn wir getroffen werden, werden wir getroffen, wir können nichts dagegen tun.“
Der Krieg ließ die Familie zusammenrücken. Physisch, da alle fünf im selben Bett schliefen, die Fenster zum Schutz vor Glassplittern mit Decken verhängt, aber auch emotional. Es ist eine der stärksten Erinnerungen Djokovics an die Zeit der Bombardierung – ein eindringlicher, verbindender, aber auch subversiver Moment –, als sich Tausende von Menschen auf einer Belgrader Brücke versammelten und alle T-Shirts mit Zielscheiben auf der Brust trugen. Einige hatten sich sogar Zielscheiben auf die Stirn gemalt und sangen. Sie verhöhnten die Nato-Piloten. Wenn seine Familie und seine Nation das überleben konnten, dachte er, würde ihnen nichts mehr etwas anhaben und er könnte mit dem Rest seines Lebens anfangen, was er wollte. Im Vergleich dazu wäre alles andere ein Kinderspiel – auch Tennis.
Die Bomben fielen, und Djokovic spielte weiter Tennis. Mit seinem Bedürfnis, inmitten all der Schrecken weiterzutrainieren, hielt er sogar in Kriegszeiten an seiner Ausbildung fest (nur kurz, in den ersten Tagen der Bombenangriffe, verlor er seinen Fokus). Tatsächlich intensivierte er sein Training sogar, weil die Schulen geschlossen waren. Aber noch wichtiger war, dass die Konzentration auf Djokovics Training – jeden Tag vier bis fünf Stunden – der ganzen Familie half weiterzumachen und allen ein Gefühl von Normalität und Routine vermittelte, auch wenn er durch die ganze Stadt streifte, um einen geeigneten Trainingsplatz zu finden.
Djokovics Mutter war unerbittlich. Die Familie sollte nicht den ganzen Tag zu Hause herumsitzen und heulen. Hätten sie das getan, sagte sie, wären sie vor lauter Sorge, dass die Wohnung bombardiert würde, verrückt geworden. Djokovic war fasziniert von Tennis, seit er mit drei Jahren zum ersten Mal einen Tennisplatz gesehen hatte. Seine Liebe zu dem Sport gab ihnen einen Grund, jeden Tag hinauszugehen und weiterzuleben. Oft hatte der Platz, den sie fanden, nicht einmal ein Netz, oder der Belag war aufgerissen und kaputt. Kollateralschäden des Krieges. Aber das spielte nie eine Rolle. Und auch wenn es gefährlich war, sich in Belgrad auf einem Tennisplatz aufzuhalten – an anderen Orten der Stadt war es nicht weniger gefährlich. Djokovics damalige Trainerin Jelena Gencic zum Beispiel hatte bei einem Bombenangriff ihre Schwester verloren. Um sieben Uhr abends waren die Djokovics wieder zu Hause und zogen die Vorhänge zu wie angeordnet. Nicht selten kollidierte Djokovics Sehnsucht nach Normalität mit der Realität einer Stadt unter Beschuss. Mitten im Training heulten die Sirenen, die Flugzeuge fegten über den Himmel. Und als Djokovic seinen zwölften Geburtstag im Tennisclub Partizan feierte und seine Familie ihm ein Geburtstagsständchen brachte, donnerte plötzlich ein Jet über sie hinweg und übertönte alles.
Diese für ihn entsetzlichen Momente, in denen er sich völlig hilflos fühlte, überstanden zu haben, verlieh ihm die Kraft und Widerstandsfähigkeit, die ihn seine ganze Karriere hindurch begleiten sollte. Die Erinnerungen steigerten seinen Hunger und Ehrgeiz, als Tennisspieler zu bestehen. Er wollte beweisen, dass ein Junge, der die Schrecken des Krieges überlebt hatte, der Beste werden konnte in einer Sportart, die weltweit von Sportlern aus weitaus wohlhabenderen Ländern ausgeübt wird, die noch dazu nie bombardiert worden sind.
„Zerstört, aber noch am Leben – das war Djokovic während des Krieges“, so Bogdan Obradovic. Seiner Ansicht nach haben diese frühen Lebenserfahrungen Djokovic zusätzliche Energie, dauerhafte Stärke und Resilienz verliehen. „Die Menschen, die während dieses furchtbaren Krieges so sehr gelitten hatten, konnten nicht noch mehr leiden. Es musste irgendwann aufhören. Man erreicht einen Tiefpunkt. Danach wird es entweder schlimmer – oder man rappelt sich wieder auf. Es gibt keine anderen Optionen. Wenn man von etwas Bösem angegriffen wird, gewöhnt man sich daran. Man weiß genau, gegen wen man kämpft, und erkennt, dass selbst das Böse keinen Spaß daran hat“, sagt Obradovic. „Danach spürt man diese unerklärliche Energie. Das alles kann dich entweder zerstören oder stärker machen. So war es bei Novak – es hat ihn zu einem stärkeren Menschen gemacht.“
Bereits vor den Bombardierungen war das Leben in Belgrad aufgrund eines internationalen Handelsembargos immer schwieriger geworden. Djokovic erinnert sich, dass er morgens um 5.45 Uhr in der Schlange stand, um Brot für die Familie zu kaufen. „Ein Junge wie ich, der in Serbien aufwächst, soll eines Tages ein Tennis-Champion werden? Das war selbst unter günstigsten Bedingungen unwahrscheinlich. Und es wurde noch unwahrscheinlicher, als dann die Bomben fielen“, schrieb Djokovic einmal. Aber war nicht vielleicht das Gegenteil der Fall? Konnte es nicht sein, dass die Bomben Djokovics Erfolgschancen als Tennisprofi vergrößerten? Genauso wie es Höhen und Tiefen im Leben gibt, geht es auch auf dem Tennisplatz auf und ab. Djokovic wusste es damals vielleicht noch nicht, aber die Brutalität des Krieges, und dazu gehörte unter anderem, Nacht für Nacht in einem Luftschutzkeller zuzubringen, hatte ihm noch größere innere Kraft verliehen.
Der Krieg scheint auch Djokovics Freundin Ana Ivanovic abgehärtet zu haben, die als Mädchen manchmal mit Trockenübungen am Boden eines leeren Schwimmbeckens trainierte und später zur Nummer eins im Damentennis avancierte. Mit Jankovic, einer weiteren Serbin, die die Weltrangliste anführen sollte, bildeten sie die goldene Generation der zukünftigen Weltranglistenersten. „Wir waren hungrig, weil wir nie etwas geschenkt bekommen haben“, erklärt Jankovic. „Alles, was wir hatten, mussten wir uns verdienen, und wir mussten härter arbeiten als alle anderen aus anderen Nationen, um uns zu beweisen. Wir kamen aus einem Land, das nicht sehr reich war und keine tollen Einrichtungen oder Tennistraditionen hatte, und es fühlte sich manchmal wie eine ,Mission Impossible‘ an. Aber wir hatten einen starken Willen. Als Nation sind wir nicht mit dem zweiten Platz zufrieden. Wir mussten die Nummer eins sein. Es gab keine Alternative. Entweder du bist der Beste, oder du bist nichts. Das ist unsere Mentalität.“
Das serbische Wort inat, für das es keine direkte Übersetzung gibt, beschreibt eine Mischung aus Trotz, Sturheit, Starrsinn und „F… you“-Mentalität, eine gewisse Bissigkeit, gepaart mit ätzendem Humor. Einige würden sagen, dass Djokovic diese Art schon als Junge hatte und sie ihn bis heute prägt. „Inat bedeutet, wütend zu sein und diese wirklich starke Motivation zu verspüren, den Leuten das Gegenteil zu beweisen. Man will wirklich gut sein. Ich glaube, Novak hatte dieses Gefühl während seiner ganzen Karriere“, sagt Jankovic. „Ich hatte es auch. Wir wollten die Besten sein. Als Serben haben wir das im Blut. Wir wollen etwas erreichen, auch wenn wir aus einem kleinen Land kommen, das nicht das wohlhabendste ist oder die besten Einrichtungen hat. Aber wir haben etwas, was andere nicht haben. Wir haben inat. Und wir werden es euch beweisen.“
Die Bombenangriffe von 1999 bestimmen weiterhin Djokovics Denken auf dem Platz. „Novaks Herkunft, der Krieg und die Bomben, die überall um ihn herum detonierten, haben ihn furchtlos gemacht“, so Chris Evert, ehemalige Weltranglistenerste und 18-fache Grand-Slam-Gewinnerin im Dameneinzel. „Wenn man eine solche Kindheit hatte, mit solchen traumatischen Erfahrungen, hat man keine Angst mehr. Wenn einen das nicht zu einem bestimmten Typ Mensch formt, diese Erfahrungen in so jungen Jahren, dann weiß ich auch nicht. Novak nutzt alle negativen Momente in seinem Leben, um sich in seinen Matches zu stärken. Er sagt sich: ‚Okay, es steht fünf beide im fünften Satz, Novak, aber du hast schon viel Schlimmeres durchgemacht.‘ Der Krieg hat ihm die Angst genommen, im Tennis und im Leben. Er hat ihn stärker und resilienter gemacht. Er hat viel Kraft.“
Es gibt aber auch Menschen in Djokovics Umfeld, die der Meinung sind, dass man den Einfluss des Krieges nicht überbewerten sollte. Der Krieg habe ihm zwar Auftrieb gegeben, aber es sei durchaus möglich, dass er auch in friedlicheren, ökonomisch stabileren Zeiten so erfolgreich geworden wäre. „Es stimmt schon, dass dieser Aspekt von Djokovics Geschichte extrem ist“, überlegt Janko Tipsarevic, der selbst in Belgrad aufgewachsen ist, in die Top Ten aufstieg und einer der engsten Freunde von Djokovic ist (ihre Familien haben gelegentlich gemeinsamen Urlaub gemacht). „Viele Athleten stammen aus ärmlichen Verhältnissen, sind mit nur einem Elternteil aufgewachsen oder kommen aus Vierteln mit einer hohen Kriminalitätsrate – schauen Sie sich nur die NBA oder NFL in den USA an. Wir allerdings mussten jede Nacht um unser Leben fürchten. Zweieinhalb Monate lang gehörte es für uns zur Normalität, abends bombardiert zu werden, also gingen wir in den Luftschutzkeller – und tagsüber spielten wir Tennis. Ich bin mir sicher, dass das Novak letztlich noch widerstandsfähiger gemacht und ihm geholfen hat, seine Ziele zu erreichen. Aber das macht nur fünf oder zehn Prozent aus, mehr nicht. Ich vertraue auf seine mentalen Fähigkeiten, seine mentale Größe. Selbst wenn sein Vater Jeff Bezos und er in einem reichen Land aufgewachsen wäre, hätte er erreicht, wozu er bestimmt war: der Beste zu sein.“
Daria Abramowicz, eine Sportpsychologin, die in den letzten Jahren Iga Swiatek auf ihrer Tour begleitet hat, teilt die Ansicht, dass Djokovics frühe Lebenserfahrungen und die Geschichte, die er sich und anderen erzählt, ihn außergewöhnlich widerstandsfähig gemacht haben. „Novak identifiziert sich als stolzer Serbe. Er fühlt sich seinem Land eng verbunden. Wenn das eigene Land eine solche Geschichte hat und man es danach schafft, ein glückliches Leben und eine erfolgreiche Karriere aufzubauen, kann einem das enorme Kraft und Widerstandsfähigkeit verleihen. Manchmal kann es auch eine Bürde sein, und in manchen Situationen beides zugleich. Es ist auf jeden Fall extrem individuell“, so Abramowicz. „Meiner Meinung nach, und das kann man auf so vielen Ebenen beobachten, ist Novak unglaublich stark und widerstandsfähig geworden.“
Die Bombenangriffe hatten aber noch andere nachhaltige Auswirkungen auf Djokovic. Die Gräuel des Krieges lehrten ihn, stets dankbar für alles zu sein, was er hatte. Und so seltsam es auch klingen mag, Djokovic ging aus dem Jahr 1999 mit einem Gefühl hervor, das noch stärker war: Hoffnung.
*
Ohne Übertreibung kann man sagen, dass Djokovic aus dem Nichts kam. Er wurde in einem Land geboren, Jugoslawien, das heute nicht mehr existiert und in dem es so gut wie keine Tenniskultur gab. Wie er einmal selbst einräumte, war Tennis damals in Belgrad ungefähr so beliebt wie Fechten. In jener Zeit „war der Sport nirgends zu finden – er war quasi tot“, sagte Bogdan Obradovic, der Dojokovic im Alter von zehn bis sechzehn Jahren immer wieder trainierte und später zum Davis-Cup-Titel führte. Neben dem Beton war ein weiteres Erbe des Kommunismus, dass Tennis in Jugoslawien und auch danach in Serbien weiterhin als elitärer Sport angesehen wurde. Ein Club in Belgrad war allein Botschaftern und Diplomaten vorbehalten, während das serbische Fernsehen jahrelang nur ein einziges Tennismatch im Jahr übertrug: das Einzelfinale der Herren in Wimbledon. Die Bilder vom Centre Court mit ganz in Weiß gekleideten Spielern hätten die Zuschauer in Belgrad auch kaum davon überzeugen können, dass es sich hierbei um einen Sport für Arbeiter handelte. „Es war ein Sport für Aristokraten“, erinnerte sich Obradovic. „Alle hatten ein bisschen Angst vor Tennis.“
Hatte die serbische Regierung etwas Geld übrig, investierte sie es in Mannschaftssportarten wie Fußball, Basketball und Handball oder auch in Volley- und Wasserball. Warum das Risiko eingehen und in eine Einzelperson investieren, noch dazu in eine mit aristokratischen Bestrebungen?
Die Gegend um den Kapaonik, einst ein Ort der Ruhe in den Bergen, wo Kaninchen zwischen den Bäumen herumflitzten, wurde 1999 mit Streubomben übersät, weshalb Djokovic aufgrund der Gefahr durch nicht gezündete Munition jahrelang nicht in den „schönsten Tennisclub der Welt“ zurückkehren konnte. Dort, auf den drei Hartplätzen in der Nähe der elterlichen Red Bull Pizzeria, hatte er zum ersten Mal Tennis gespielt. Erst zwanzig Jahre nach dem Krieg, als die Gegend wieder sicher war, durfte er zurückkehren. Der Wald hatte sich den Club wieder einverleibt, aber für Djokovic war es noch immer ein Ort mit größter Bedeutung. Eines der Steingebäude lag in Trümmern, die Hälfte einer Holzkonstruktion war in sich zusammengefallen, und die Tenniswand, wo er als Kind so viele glückliche Stunden und Tage verbracht und an seiner Technik gefeilt hatte, war von Bombensplittern durchlöchert. Aber zumindest hatte sie „standgehalten“, wie Djokovic es ausdrückt, so, wie auch seine emotionale Verbindung zu diesem Fleckchen Erde überdauert hatte. Djokovics Liebe zu diesen Plätzen, die inzwischen überwuchert waren, lässt sich zum Teil auf den Ort zurückführen. Aber auch darauf, wie dieser sein Leben verändert hat. Niemand in Djokovics Familie hatte je Tennis gespielt. Es war reines Glück, unverschämtes Glück – oder, wie Djokovic sagen würde, „Schicksal“ –, dass jemand beschlossen hatte, direkt vor dem Restaurant ein paar Tennisplätze anzulegen. Wären sie nicht genau dort gewesen, wäre er vielleicht nie so früh mit dem Sport in Berührung gekommen, wenn überhaupt. Hatte sich Djokovic die „Reise“, auf der er sich befindet, überhaupt ausgesucht? Er selbst glaubt, dass seine Seele, wie die jedes Menschen, vorbestimmte Ziele und Aufgaben hat. Er musste nur herausfinden, welche das waren.
Ebenso glaubt er daran, dass seine Seele seine Eltern auswählte. Er wurde in eine skibegeisterte Familie hineingeboren – sein Vater, sein Onkel und seine Tante fuhren Ski und bewunderten den italienischen Skirennfahrer Alberto Tomba. Seine Eltern hatten sich sogar auf einer Skipiste kennengelernt – seine Mutter war gestürzt, woraufhin sein Vater, ein Skilehrer, herbeifuhr und fragte, ob sie Hilfe bräuchte. Djokovic hat sich nie darüber gewundert, dass er sich für Sport interessierte; überraschend war eher, dass er sich für Tennis entschied, eine Sportart, für die seine Eltern ihre Komfortzone verlassen mussten. Es war eine Welt, die sie nicht kannten, und noch oft würden die Djokovics sich gedanklich öffnen müssen, ohne genau zu wissen, worauf sie sich da einließen.
Djokovic war sofort begeistert von dem Sport. Seine Liebe zum Tennis begann nicht erst, als er vier Jahre alt war und seinen ersten Schläger bekam. Er war gerade einmal drei und brachte den Männern, die die Tennisplätze vor dem Restaurant bauten, Essen und Getränke. Djokovics Vater bemerkte, wie sein Sohn die Plätze betrachtete, und kaufte „Nole“ (Djokovics Spitzname) einen neonpinken Tennisschläger und einen Schaumstoffball. Djokovic war die Farbe egal, Hauptsache, er gehörte ihm. Wenn er nicht gerade mit dem Schläger ausholte – ein Video zeigt ihn in einem grünen Trainingsanzug, mit einer Baseballkappe und total konzentriertem Blick auf dem Platz –, trug er ihn den ganzen Tag mit sich herum, ohne ihn je zur Seite zu legen.
Ein zweiter Glücksfall war Jelena Gencic, die zuvor Monica Seles und Djokovics zukünftigen Coach Goran Ivanisevic trainiert hatte und auf diesen Plätzen Tennisunterricht für Kinder gab. Djokovic war fünf Jahre alt, als er zum ersten Mal teilnahm. Er war kein gewöhnlicher Fünfjähriger, wie Gencic feststellte. Er kam eine halbe Stunde zu früh zu seiner ersten Stunde und hatte eine riesige Tennistasche dabei, in der sich sein Schläger, ein Handtuch, eine Flasche Wasser, eine Banane und ein paar Armbänder befanden. „Wer hat denn deine Tasche gepackt, deine Mutter?“, fragte Gencic erstaunt. Worauf Djokovic erwiderte: „Nein, ich habe sie selbst gepackt.“ Sie fragte ihn, woher er wusste, was er brauchen würde. Aus dem Fernsehen, antwortete er. Seinen Perfektionismus, heute für jeden offensichtlich, hatte Djokovic von Anfang an.
Wenige Tage später sagte Gencic zu Djokovics Eltern, dass ihr Junge, der kaum größer war als der Netzpfosten hoch, ein zlatno dete sei, ein goldenes Kind. Golden, weil er nicht nur Talent hatte, sondern auch die Konzentration, die auf eine große Zukunft im Profitennis hindeutete. Das gefiel Dijana, die Novak als ein „Kind Gottes“ betrachtete. „Jelena machte Novak und seiner Familie Hoffnung, dass er es als Tennisspieler schaffen könnte“, erklärt Jankovic. „Niemand hätte das für möglich gehalten, bis Jelena ihn unter ihre Fittiche nahm.“
Djokovics Tennisträume begannen mit den Gesprächen, die er mit Gencic führte. „Jelena hat einen Traum in Novak geweckt, den er seitdem verfolgt“, sagt Bogdan Obradovic. „Sie hat ihm die Liebe und die Leidenschaft für Tennis vermittelt. Es war wichtig für Novak und auch für seine Familie, jemanden zu haben, der ihn unterstützt und bestärkt, der ihm sagt, dass er sehr talentiert ist und eines Tages die Nummer eins werden kann. Sie liebte Tennis, und sie liebte harte Arbeit. Sie war sehr diszipliniert. Sie war wie ein Offizier, sehr tough. Aber sie hatte dabei immer ein breites Lächeln im Gesicht. Jelena hatte eine sehr positive Einstellung.“
Man muss kein Psychologe sein, um zu erkennen, dass es kaum unterschiedlichere Tennispersönlichkeiten als Pete Sampras und Novak Djokovic gibt. In den 1990er-Jahren sprang Sampras auf dem Wimbledon-Rasen ab und zu hoch in die Luft wie ein Basketballspieler in der NBA, um einen Slum-Dunk-Smash zu schmettern. Aber davon abgesehen ging es dem Kalifornier nur ums Tennis und nicht darum, eine Show abzuliefern. Dennoch war es Sampras, der ruhige und eher reservierte König von Wimbledon, der den jungen Serben – einen später höchst extrovertierten Spieler – dazu inspirierte, auch in Wimbledon gewinnen zu wollen. Djokovics erste Erinnerung an das Turnier stammt aus dem Jahr 1993. Er war sechs Jahre alt und erlebte am Fernseher, wie Sampras den Titel gewann. Rückblickend ist Djokovic natürlich bewusst, dass er und Sampras sehr unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Aber was ihm an seinem Idol gefiel, war die Art, wie er mit Druck umging, und dass er bei den wichtigen Punkten immer einen guten Aufschlag hinbekam. Djokovic hatte noch nie jemanden gesehen, der mental so unbeeindruckt von der Aura des Centre Courts in Wimbledon schien.
Djokovic bastelte sich sogar aus Plastik- und Papierresten eine Wimbledon-Trophäe. Ganz unbewusst nutzte er schon damals einen mentalen Ansatz, auf den er als Erwachsener noch oft zurückgreifen würde: Visualisierung. „Hallo“, sagte er zum Spiegel und hielt seine Plastiktrophäe hoch, „mein Name ist Novak Djokovic, und ich bin der Wimbledon-Champion.“ Jahre später, als er 2011 Wimbledon zum ersten Mal gewann und die echte goldene Trophäe mit der Ananas hochhielt, musste er an seine Kindheit und an all die Male zurückdenken, in denen er genau von diesem Moment geträumt hatte. Bis er sieben Jahre alt war, ging es beim Tennis für ihn nur um den Spaß. Dann wurde es ernst. Damals trat er im serbischen Fernsehen auf, erklärte den Zuschauern, dass Tennis sein „Job“ sei, und formulierte seine Vision für die Zukunft: Er würde die Nummer eins der Welt werden.
Etwa zu dieser Zeit lernte Dusan Vemic, der elf Jahre älter ist als Djokovic, den jungen Novak im Tennisclub Partizan kennen. Vemic staunte über die Ausdrucksweise des Jungen. „Seine Tennistasche war fast so groß wie er selbst. Erst dachte ich, er wäre einfach ein nettes kleines Kind, aber als wir uns unterhielten – er war gerade einmal sechs oder sieben Jahre alt –, merkte ich, dass ich mit ihm wie mit einem Erwachsenen sprechen konnte. Er war eins dieser Wunderkinder“, erinnert sich Vemic, der Jahre später zu Djokovics Trainerteam gehörte. „Novak hat einen in vielerlei Hinsicht brillanten Verstand. Er handelt, spricht und denkt wie jemand, der 20 Jahre älter ist als er. Er kann einen mit seiner Auffassungsgabe ziemlich überraschen. Das war schon so, als er noch ein Junge war. Mir fiel sofort auf, dass er intensiv nachdachte und genau wusste, was er tat, zum Beispiel, wenn er an seiner Technik und seiner Beinarbeit feilte. Man merkte, dass er meinte, was er sagte. Es war erstaunlich, jemanden so Junges zu sehen, der auf diese Art über Tennis nachdachte und nicht einfach herumblödelte. Ich hätte mir damals nicht vorstellen können, dass Novak der werden würde, der er heute ist. Aber ich dachte mir schon bei diesem ersten Gespräch, dass der Junge etwas Besonderes an sich hatte.“
Djokovics Verstand – nicht seine Art zu spielen – war das erste Anzeichen dafür, dass ihn Großes erwartete. Als Kind hatte er selbst in den weniger spannenden Momenten eines Matches den Fokus, den selbst viele erwachsene Sportler nicht haben. „Manchmal kann Tennis ein bisschen langweilig sein, weil nicht jede Sekunde, jeder Punkt es in ein Highlight-Reel schafft“, sagt Vemic. „Genau dann aber muss man konzentriert sein. Diese Art von Reife erreicht man erst nach Jahren als Profi. Er hat von Anfang an so gespielt, schon als Kind. Er hat sich, so gut er konnte, auf jedes Match vorbereitet und war bei jedem Punkt voll konzentriert. Er hatte Respekt vor jedem einzelnen Punkt.“
Glücklicherweise hatte Djokovic Gencic, seine „zweite Mutter“, die so viel mehr für ihn war als nur eine Tennistrainerin. Wie man einen Tennisball schlägt, war nur eine Lektion in der Erziehung, die Djokovic bei Gencic genoss. Bei ihr lernte er von klein auf, wie wichtig Ernährung ist. Sie erklärte ihm, dass Monica Seles weder Coca-Cola trank noch Cheeseburger aß, und wie wichtig Schlaf für sie war. Es war, als wäre Seles in seinem Kopf. Er fing an, die neunfache Grand-Slam-Gewinnerin zu bewundern und zu lieben (und fragt sich als Erwachsener, wie viele Grand-Slam-Titel sie wohl noch gewonnen hätte, wäre ihr 1993 in Hamburg nicht auf dem Platz in den Rücken gestochen worden). Klassische Musik war ein weiterer wichtiger Baustein. Gencic machte ihn mit Tschaikowskys Ouvertüre 1812 vertraut und fragte ihn, wie er sich beim Zuhören fühlte – sie wollte, dass er sich an diesen Adrenalinrausch erinnerte, die Kraft der Musik abspeicherte, damit er sie auf dem Platz abrufen konnte, wenn er einen schweren Tag hatte und einen Weg finden musste, um sein Niveau zu steigern. Sie ermutigte ihn, Sprachen zu lernen, zu singen, Gedichte zu lesen, darunter die Werke des russischen Romantikers Alexander Puschkin, und „bewusst zu atmen“. Wer verstehen möchte, warum Djokovic anders tickt als die meisten Sportler, der kommt an Gencic nicht vorbei; sie hat im beigebracht, seinen Geist zu öffnen.
Mitten im Grand Slam, bei den French Open 2013, ereilte Djokovic die Nachricht, dass Gencic gestorben war. Da er bei ihrer Beerdigung nicht anwesend sein konnte, schrieb er einen Brief, den seine Mutter verlas. Djokovic nannte Gencic darin einen „Engel“ und dankte ihr für ihre Geduld, Unterstützung und „unermessliche Liebe“.
*
„Goldkind“ oder „Tennisalien“? Im Alter von zehn Jahren strahlte Djokovic eine unglaubliche Energie auf dem Tennisplatz aus. Als Bogdan Obradovic den Jungen zum ersten Mal spielen sah, spürte er das sofort. „Novak spielte nicht das beste Tennis. Seine Technik war nicht überragend. Aber alle in seinem Umfeld waren fasziniert, weil man diese Energie spüren und sehen konnte.“
Djokovics Vater hatte Novak zu Obradovic in einen Tennisclub in einem Belgrader Vorort gebracht, um den Trainer zu fragen, wie er die Aussichten des Jungen einschätzte. Abgesehen von Novaks „außerirdischer“ Energie und seinem offensichtlichen Talent gab es noch etwas, das Obradovic im Zuge dieser ersten Begegnung „vollkommen überraschte“: die Professionalität des Kindes. Nicht nur dass der „stille Junge“ seine Tennistasche gepackt hatte, wie er es schon seit Jahren tat, er hatte auch unaufgefordert begonnen, sich aufzuwärmen und über den Platz zu laufen. Anderen Zehnjährigen musste man erst beibringen, wie sie ihren Körper auf das Training vorzubereiten hatten, und sie dann immer wieder daran erinnern; Djokovic wusste bereits, was zu tun war. Obradovic staunte, mit welcher Konzentration Djokovic jeden Ball schlug und dass er bereits eine richtige Warm-up- und Cool-down-Routine hatte.
Nach seiner ersten Trainingsstunde fragte Obradovic das Kind: „Was erhoffst du dir vom Tennis? Was ist dein Ziel?“ Das wusste Novak genau: „Ich will die Nummer eins der Welt werden.“ Obradovic antwortete: „Das sagt sich so leicht, aber man muss sehr viel tun, um dorthin zu kommen.“ Djokovic ließ sich davon nicht beirren. „Das ist okay. Ich werde alles tun, was notwendig ist, um dorthin zu kommen. Das ist mein Traum, und ich werde es schaffen!“
Elektricni Orgazam, oder Electro Orgasm, ist eine Rockband aus Belgrad, die in den 1980er-Jahren in Jugoslawien erfolgreich war. Ohne dass sie es wussten, spielten sie eine wichtige Rolle in Djokovics Tennisentwicklung und halfen ihm, der beste Returnspieler in der Geschichte des Tennis zu werden. Obradovic, dessen zwei Leidenschaften Tennis und Musik sind, brachte eines Tages seine Gitarre mit auf den Platz und spielte Djokovic den Song „Everyone in Yugoslavia is Playing Rock ’n’ Roll“ vor. Er wollte ihm zeigen, dass einen gegnerischen Aufschlag zu retournieren viel mit dem Hören und Spielen von Musik gemeinsam hat: Es geht immer um den Rhythmus. „Hör genau hin, Novak, du musst dem Rhythmus des Songs folgen“, sagte Obradovic. „Und dann wirst du den Rhythmus in deinem Return, in deiner Bewegung, in allem spüren. Es ist wie ein Song. Alles ist miteinander verbunden.“
„Die Musik“, sagte der Trainer zu Djokovic, als er auf seiner Gitarre spielte, „ist zwischen den Noten.“ Was er ihm damit vermitteln wollte, war, dass es beim Tennis wie in der Musik auf das Timing ankommt und bei einem großartigen Rückschläger entsprechend darauf, „ein gutes Rhythmusgefühl zu haben und etwas im richtigen Moment zu tun“. Er forderte Djokovic dazu auf, auf jedes Detail des gegnerischen Aufschlags zu achten. Dabei sollte er auch auf das Geräusch des Balls beim Abprall achten, denn darauf würde er ebenso reagieren müssen wie auf die Aufschlagbewegung. Obradovic riet Djokovic, sich auf den Aufschlagrhythmus seines Gegners einzustimmen: seine Hände, wie er den Ball in die Luft wirft, wie er in die Luft springt, um den Ball zu treffen, wie er ihn trifft und was dabei mit dem Schläger passiert. „Du wirst lernen, den Rhythmus zu lesen und zu reagieren“, sagte Obradovic, der Djokovic auch mit den Beatles bekannt machte, indem er ihm „Yesterday“ und viele andere ihrer Songs vorspielte.
In vielerlei Hinsicht reichte seine Lektion zu Electro Orgasm weit über den Tennisplatz hinaus. Bevor er seine Gitarre weglegte, hatte Obradovic noch eine weitere Botschaft: „Das Wichtigste, Novak, ist Folgendes: Wenn du Musik hörst und sie verstehst, wirst du ein glücklicherer Mensch.“
OPFER
Schlaflos und nervös ging Srdjan Djokovic manchmal nachts durch die Straßen. In seiner Verzweiflung hatte er sich von Kredithaien Geld geliehen, um das Tennistraining seines Sohnes bezahlen zu können. Bei einem seiner nächtlichen Streifzüge wurde er sogar verhaftet, nachdem die Polizei auf ihn aufmerksam geworden war. Als er jedoch erklärt hatte, dass er nur ein Tennisvater mit Geldproblemen wäre, saß er mit den Beamten lachend und Schnaps trinkend bis zum Morgen auf dem Revier.