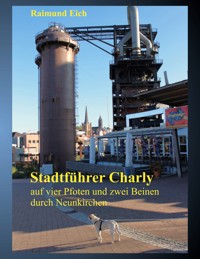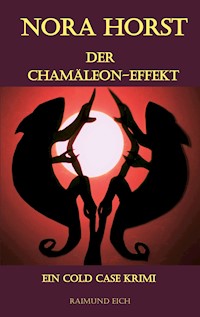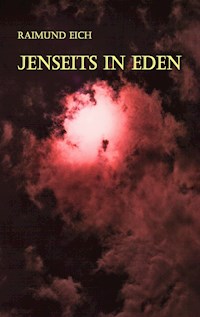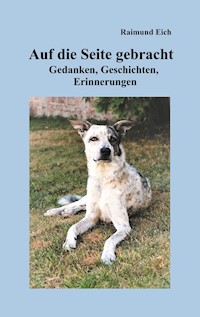
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die schönsten Geschichten schreibt das Leben selbst, sagt man. Doch das Schicksal hält bekanntlich nicht immer nur Gutes für uns bereit. Aber auch solche Geschichten können schön sein, wenn sie positive Gefühle und Empfindungen in uns auszulösen vermögen. In sechzehn realen und fiktiven Episoden nimmt der Autor die Leserinnen und Leser mit auf eine emotionale Reise in Gedanken, Geschichten und Erinnerungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 102
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Raimund Eich, Jahrgang 1950, lebt im Saarland.
Neben zwei Tatsachenromanen und Büchern mit heiteren und besinnlichen Gedichten und Geschichten hat er einige Werke veröffentlicht, in denen er sich insbesondere mit gesellschaftlichen und geisteswissenschaftlichen Themen befasst. Hierin lässt er auch naturwissenschaftliche und technische Aspekte in sehr anschaulicher Form mit einfließen. Daraus resultieren einzigartige Bücher, spannend, dramatisch, informativ und unterhaltsam zugleich.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Der Schatz im Silbersee
Don Camillo, ein Held meiner Kindheit
Endrik B.
Fleckenmonster
Fluch und Segen
Der Wichtelfall
Denkmal Sense Eduard
Mamas Sessel
Ein Geschenk des Himmels
Sieben Leben
Zwei Herzen im Gleichschritt
Morgens um neun
Der Tod kommt pünktlich
Zauberwelt
Lieber Gott, mach mich fromm
Ein stinknormales Leben
Nachwort
Weitere Veröffentlichungen
VORWORT
„Die schönsten Geschichten schreibt das Leben selbst“, wer von uns kennt dieses Zitat nicht? Ein schöner Spruch, ohne Zweifel, aber nach meinem Dafürhalten ein Unvollständiger, denn das Leben schreibt nun mal nicht nur schöne Geschichten. Es hat für uns leider auch Hässliches, Trauriges und mitunter auch Grausames auf Lager
Doch wann ist eigentlich eine Geschichte schön, fragt man sich, wenn man ein Buch mit möglichst schönen Geschichten schreiben will. Sind es nur heitere und unbeschwerte Stories mit glücklichem Ausgang? Ich glaube nicht, denn zum Leben gehören Licht- und Schattenseiten gleichermaßen.
Ganz gleich, um was es in einer Geschichte geht, ob Weltbewegendes oder Alltägliches, ob Gutes oder Böses, ob mit oder ohne Happy End, eine Geschichte muss die Leser emotional berühren und mitnehmen. Sie sollten beim Lesen die Gefühle nachempfinden, die man als Autor selbst mit den schönsten Formulierungen leider oft nur unzureichend zum Ausdruck bringen kann. Und dann sind es auch schöne Geschichten, selbst wenn sie traurig oder ohne glücklichen Ausgang sein sollten.
Auch den tieferen Sinn zu erkennen, der hinter so mancher Geschichte steckt, kann meiner Meinung nach als schön und bereichernd empfunden werden.
So gesehen wünsche ich Ihnen eine ebenso unterhaltsame wie sinnvolle Lektüre.
Raimund Eich
DER SCHATZ IM SILBERSEE
Meine Sturm- und Drangzeit als edler und tapferer Indianerhäuptling, nicht nur an Fastnacht, sondern das ganze Jahr über beim Spielen in der so genannten Wildnis meiner Heimatstadt, lag eigentlich schon hinter mir, denn in wenigen Tagen würde ich 14 Jahre alt werden. Das kindliche Abenteuerspielen hatten wir Jungs mittlerweile ersetzt durch Straßenfußball, so etwas ging tatsächlich noch in den Nebenstraßen in Neunkirchen Anfang der Sechziger Jahre, und, wie soll ich es sagen, zudem auch mit der Eroberung des weiblichen Geschlechtes. Meine dicksten Freunde Eberhard, Werner und Hans-Jürgen hatten im Gegensatz zu mir schon erste Techtelmechtel und Kusserfolge zu verzeichnen. Ich tröstete mich zwar mit dem Gedanken, dass ich der Jüngste von uns Vieren sei, aber die Zeit drängte, denn das virtuelle Sammeln von Skalps niedergemetzelter Feinde zählte schon lange nicht mehr als Erfolg. Dem Zeitgeist folgend definierten wir diesen zwischenzeitlich über das Toreschießen beim Fußballspielen ... und über das Küssen von Mädchen.
„Der Schatz im Silbersee“ schien mir eine willkommene Gelegenheit zu sein, das Angenehme, einen spannenden Abenteuerfilm, mit dem unvermeidlichen ersten Kuss, zu verbinden. Ein Opfer dafür hatte ich bereits im Auge. Elke, deren Oma meiner Mutter zuweilen im Haushalt aushalf, sollte die Auserwählte sein. Also kratzte ich meine bescheidenen Ersparnisse zusammen und lud Elke ein, mit mir in die Nachmittagsvorstellung von „Der Schatz im Silbersee“ zu gehen. Von Eberhard hatte ich den todsicheren Tipp, einen Kussangriff möglichst erst dann zu starten, wenn eine romantische Filmszene über die Leinwand flimmerte.
Als wir nachmittags im Eden-Kino auf den sündhaft teuren Sperrsitz-Rängen weiter hinten Platz nahmen, war das Kino fast bis auf den letzten Platz gefüllt. Nach der obligatorischen Wochenschau in Schwarz-Weiß und der Pause vorm Hauptfilm, die mich noch eine Schachtel Eiskonfekt kostete, ging es endlich los. Fieberhaft wartete ich auf eine geeignete Gelegenheit für meinen geplanten Einsatz. Endlich eine mir jedenfalls romantisch genug erscheinende Szene, untermalt von der eindringlichen Filmmusik des Karl-May-Films. Doch als ich gerade dabei war, mich mit zitternden Händen und Angstschweiß auf der Stirn in Richtung meiner Angebeteten zu beugen, peitschten plötzlich Schüsse durch den Saal. Colonel Brinkley und seine Banditen waren dabei, die Farm von Mrs. Butler auf der Suche nach dem fehlenden Teil der Schatzkarte vom Silbersee zu überfallen. Dies konnte ich mir nicht entgehen lassen und stellte daher meinen eigenen Angriff bis auf Weiteres zurück. Allerdings zogen mich Winnetou und Old Shatterhand immer mehr in ihren Bann, sodass ich die Welt um mich herum völlig vergaß, und damit auch Elke. Erst nachdem der Bösewicht Colonel Brinkley in der Höhle am Silbersee mit dem Schatz für immer in der Tiefe versunken war und das Licht im Saal langsam wieder anging, kehrte ich ins irdische Leben zurück. Doch wo war Elke? Jedenfalls saß sie nicht mehr neben mir.
Verzweifelt irrte ich auf der Suche nach ihr an den vielen Zuschauern vorbei, die den Ausgängen zustrebten. Auch vorm Kino keine Spur von ihr. So rannte ich schließlich die steile Straße hinunter, dorthin, wo Elke mit ihrer Oma in einem Hinterhaus wohnte. Hier fand ich sie tatsächlich auch wieder, im dunklen Durchgang zum Hinterhaus ... heftig knutschend mit dem blöden Angeber, der im Kino neben uns gesessen und sie fortwährend angemacht hatte.
DON CAMILLO, EIN HELD MEINER KINDHEIT
Er war weder jung noch schön und entsprach offen gestanden überhaupt nicht dem klassischen Bild eines Helden der Kindheit. Aber er war bärenstark und ging keinem Streit aus dem Weg. Das gefiel mir.
Was mich jedoch am meisten an ihm faszinierte, war, dass er mit dem gekreuzigten Jesus, den er Herr nannte, in seiner Kirche richtige Zwiegespräche führen konnte, und dass der ihn mit seiner unglaublich sanften Stimme stets auf den Pfad der Tugend zurücklenkte, wenn ihn der bullige Bürgermeister Giuseppe Bottazzi alias Peppone und seine kommunistischen Parteigenossen mal wieder auf die Palme gebracht hatten.
Die Rede ist von Don Camillo bzw. von den Spielfilmen „Don Camillo und Peppone“, die Anfang der Sechziger Jahre in schwarzweiß über den Bildschirm flimmerten. Gespräche mit dem Herrn im Himmel, bei denen man richtige Antworten bekam, wollte ich auch führen können, und so löste Don Camillo, der Priester in der schwarzen Soutane, schweren Herzens Zorro, meinen ersten Helden der Kindheit, ab, wenn auch nur für kurze Zeit. Ich wollte jedenfalls Priester werden, und da Zorro auch immer schwarz gekleidet war, nahm ich mir vor, später statt des Priestergewandes einfach Zorros schwarzen Umhang und dessen schwarzen Hut zu tragen. Nur auf die schwarze Maske wollte ich freiwillig verzichten.
Aber als mir mein Vater, der diese Entwicklung offenbar mit Skepsis beobachtete, eines Tages erklärte, dass man sich als Priester nicht so einfach über Kleidungsvorschriften hinwegsetzen könne und vor allem auch nicht mit Mädchen herummachen dürfe, ging Don Camillos Stern allmählich bei mir unter und wurde für einige Zeit durch den edlen und tapferen Apachenhäuptling Winnetou ersetzt.
Irgendwann habe ich ihn allerdings wiederentdeckt, den Don Camillo, als mir zu meinem fünfzigsten Geburtstag alle Filmkassetten mit den alten Don Camillo-Filmen geschenkt wurden Seitdem versuche ich ihm wieder nachzueifern. In Bezug auf heftige Wortgefechte und Streitereien mit Andersdenkenden funktioniert das auch tadellos. Nur das Zwiegespräch mit dem Herrn Jesu will mir bis auf den heutigen Tag leider nicht gelingen.
ENDRIK B.
Im April 1966 trat ich meine Lehre als Elektriker bei den Saarbergwerken an. Dabei hatte ich eigentlich keinen blassen Schimmer von Elektrotechnik. Obendrein bestand bei mir leider auch kein besonderes Interesse an Technik wie bei vielen anderen Jungs in meinem Alter, die sich entsprechende Berufe sozusagen als Herzenswunsch ausgesucht hatten. Ich hatte dagegen einen ganz anderen Herzenswunsch, nämlich den, möglichst keinen Beruf ergreifen und nicht jeden Tag arbeiten gehen zu müssen. Aber unser Klassenlehrer in der Realschule hatte etwa ein Jahr vor dem Abschluss begonnen, uns auf das Berufsleben einzustimmen und uns erklärt, der Begriff Beruf sei abgeleitet von dem bedeutungsvollen Wort Berufung. Jeder Mensch würde sich in seinem Leben zu etwas berufen fühlen, mit dem er sein Leben auszufüllen und zu gestalten habe. Wir sollten daher alle mal tief in uns hineinhorchen, dann würde uns unsere innere Stimme schon sagen, zu was wir uns berufen fühlten. Bei manchen könne es auch sein, dass sie sich zu mehr als einem Beruf berufen fühlten. Dann müsse man halt abwägen und sich für einen seiner Traumberufe entscheiden. In der nächsten Woche sollten wir ihm einen Zettel mit unseren Berufswünschen abgeben, die er dann mit uns gemeinsam besprechen wollte. Also horchte ich in mich hinein in der Hoffnung auf eine göttliche Eingebung. Das Einzige, was mir auch ohne innere Stimme schon vorher absolut klar war, dass ich niemals in einem Büro arbeiten wollte und vor allem nicht im Öffentlichen Dienst, denn diesem Verein konnte ich schon damals überhaupt nichts abgewinnen.
Als ob ich es geahnt hätte, bei mir war beim „in mich Hineinhorchen“ überhaupt nichts zu hören. Absolut nichts. Nein, nicht ganz, etwas in mir sagte mir zwar kaum hörbar, aber dafür umso deutlicher: „Lass bloß die Finger weg von Beruf und Arbeit, das bringt dir nur jahrzehntelange Mühe und Ärger.“ Seither weiß ich, dass unser Verstand nichts im Vergleich zu unserer inneren Stimme ist.
Wie auch immer, da damals nichts Gescheites, oder besser gesagt nichts Verwertbares für mich zu hören war, entschloss ich mich, meine Berufswahl einfach an der meiner besten Freunde zu orientieren. In der Schule war das Edwin, der jeden Morgen aus seinem Heimatort mit dem Zug nach Neunkirchen fuhr und dann zu mir nach Hause kam. Edwin wartete in Verkaufsladen unserer Bäckerei geduldig so lange, bis ich endlich fertig war und wir uns dann buchstäblich auf den letzten Drücker gemeinsam auf den Weg zur Schule machten. Edwin hatte zwar auch keine innere Stimme gehört, sich aber im Gegensatz zu mir wenigstens schon mal mit verschiedenen Berufen und Berufsmöglichkeiten beschäftigt. Und Edwin favorisierte zu dieser Zeit eine Karriere bei der Bundesbahn. Warum weiß ich auch nicht. Vielleicht weil er jeden Tag mit dem Zug fuhr und dieser bewegenden Tätigkeit daher etwas abgewinnen konnte. Edwin wollte jedenfalls nach dem Realschulabschluss die mittlere Beamtenlaufbahn einschlagen und als Bundesbahnassistentenanwärter dort anfangen. Diese Berufsbezeichnung faszinierte mich derart, dass ich spontan beschloss, mich Edwins Berufswahl anzuschließen. Somit hatte ich also schon mal einen Berufswunsch zu Papier gebracht, aber sicherheitshalber wollte ich noch einen zweiten angeben, weil ich instinktiv ahnte, dass unser Lehrer mit Sicherheit diejenigen näher unter die Lupe nehmen würde, die nur einen Beruf auf ihrem Zettel stehen hatten. Also fiel mein Augenmerk auf Hans-Jürgen, den etwa gleichaltrigen Sohn unserer Nachbarn, mit dem ich in der Freizeit immer zusammen war. Hans-Jürgen hatte die Hauptschule besucht und schon ein Jahr vorher eine Lehre als Elektriker beim Neunkircher Eisenwerk begonnen. Hans-Jürgen war ein leidenschaftlicher Bastler, der fast jedes Gerät auseinandernahm und auch wieder heil zusammenschrauben konnte, was mir mächtig imponierte. Viel wichtiger für mich war jedoch, dass ich morgens zusammen mit ihm zur Arbeit und mittags wieder nach Hause gehen könnte und dass wir dabei sicher viel Spaß haben würden. In logischer Konsequenz entschied ich mich daher wie auch mein Freund Hans-Jürgen für die Elektrotechnik, womit ich bereits zwei Alternativberufe aufzeigen konnte. Nur, der Elektriker erschien mir doch etwas zu wenig im Vergleich zum Bundesbahnassistentenanwärter. Diesen Makel löste ich, indem ich mich spontan für den nicht minder imposanten Titel Elektroingenieur entschied.
Vom Ingenieurberuf wusste ich eigentlich so gut wie nichts, bis auf das, was in Micky Maus Heften von Daniel Düsentrieb, von Beruf bekanntlich ein genialer Erfinder mit dem Wahlspruch „Dem Inschinör ist nichts zu schwör“, zu lesen war. Mit Elektroingenieur hatte ich jedenfalls einen zweiten klangvollen Berufswunsch gefunden. Es gab da lediglich ein kleines Problem, und zwar mein Herbstzeugnis, ein halbes Jahr vor dem Realschulabschluss, mit dem ich mich um eine Lehrstelle, früher hieß das noch so, bewerben musste. Während ansonsten bei meinen Herbstzeugnissen meistens „Versetzung gefährdet“ draufstand, hieß es diesmal, niederschmetternd für meine Eltern, sogar „Abschluss sehr gefährdet“. Sage und schreibe drei Fünfen schlugen darin zu Buche. Wenn es wenigstens noch