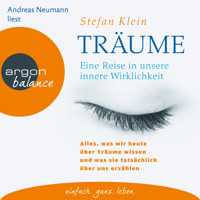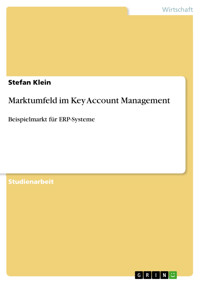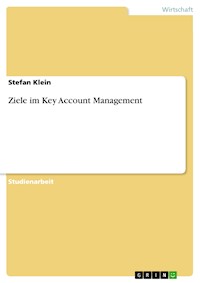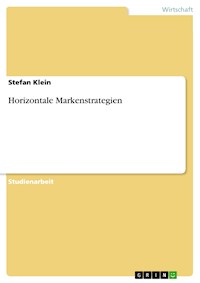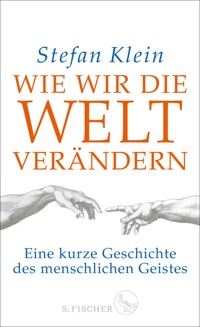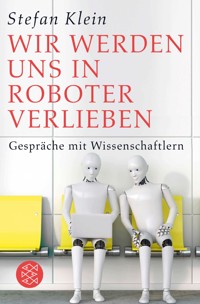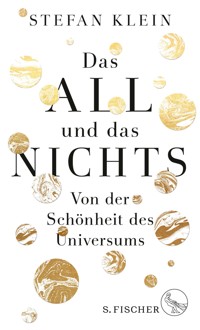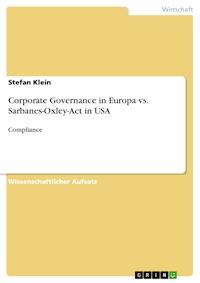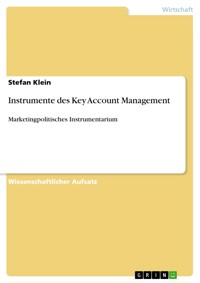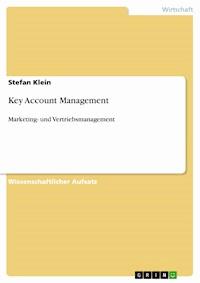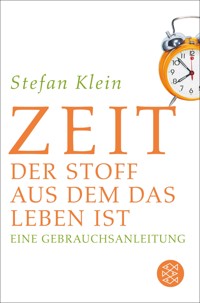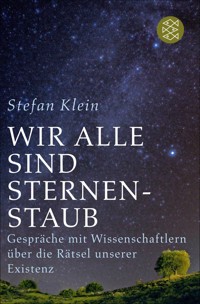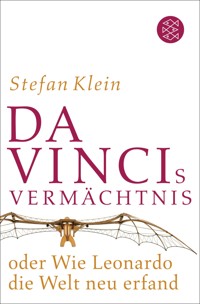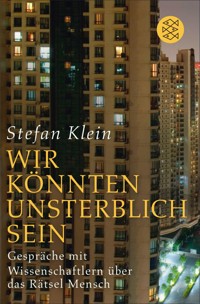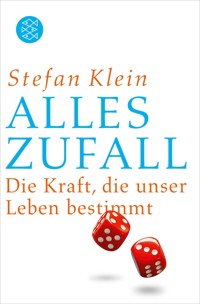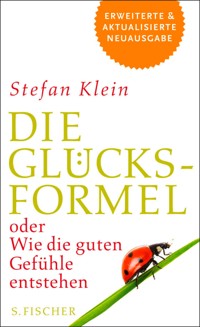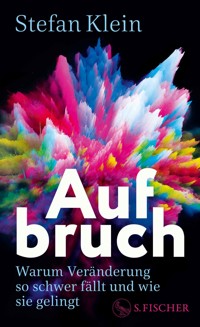
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Bestseller-Autor Stefan Klein über die alles entscheidende Frage: Warum verändern wir im Persönlichen wie in der Gesellschaft nichts, obwohl wir doch alles wissen? Was hindert uns am Aufbruch? Wie kann er gelingen? Klimakrise und künstliche Intelligenz, die alternde Gesellschaft und internationale Konflikte fordern uns heraus. Wir müssen uns selbst und die Welt verändern, wenn wir überleben wollen. Warum klammern wir uns dann an alte Gewohnheiten und falsche Gewissheiten, statt den Wandel jetzt anzugehen? Stefan Klein erklärt fundiert und mitreißend, warum wir auf Neues von Natur aus widerwillig reagieren und wie uns die sieben Illusionen über den Fortschritt lähmen. Indem er geschickt Erkenntnisse der Wissenschaften mit einprägsamen Geschichten verbindet, zeigt er auf, nach welchen Gesetzen Wandel funktioniert. In seiner unnachahmlichen Art erklärt Stefan Klein einleuchtend und verständlich die Gründe, warum Veränderungen so schwerfallen, und macht Hoffnung, dass es nicht zu spät für den Wandel ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Stefan Klein
Aufbruch
Warum Veränderung so schwer fällt und wie sie gelingt
Über dieses Buch
Klimakrise und künstliche Intelligenz, die alternde Gesellschaft und internationale Konflikte fordern uns heraus. Wir müssen uns selbst und die Welt verändern, wenn wir überleben wollen. Warum klammern wir uns dann an alte Gewohnheiten und falsche Gewissheiten, statt den Wandel jetzt anzugehen? Stefan Klein erklärt fundiert und mitreißend, warum wir auf Neues von Natur aus widerwillig reagieren und wie uns die sieben Illusionen über den Fortschritt lähmen. Er zeigt anhand von faszinierenden Beispielen, nach welchen Gesetzen Wandel funktioniert.
Ein Wegweiser zu einer Kultur, die das Neue nicht fürchtet, sondern feiert.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Stefan Klein, geboren 1965, studierte Physik und analytische Philosophie in München, Grenoble und Freiburg. Sein Buch »Die Glücksformel« stand über ein Jahr auf allen deutschen Bestsellerlisten und machte den Autor auch international bekannt. In den folgenden Jahren erschienen weitere hochgelobte Bestseller, u.a. »Alles Zufall«, »Der Sinn des Gebens« und zuletzt »Wie wir die Welt verändern. Eine kurze Geschichte des menschlichen Geistes«.
Inhalt
Teil I Das gespaltene Bewusstsein
Auf dem Vulkan
Die Unbeirrbaren
Starr vor Schreck
Stillstand ist kein Schicksal
Die gelähmte Gesellschaft
Anatomie eines Zusammenbruchs
Denn sie wussten nicht, was sie taten
Sehend in den Kollaps
Maschinen außer Kontrolle
Das große Altern
Zwei Seelen wohnen, ach …
Nackt ohne Bildschirm, nackt vor der Welt
Die Kunst, sich zu trösten
Teil II Sieben Illusionen über den Fortschritt
Erste Illusion: Wir sind Realisten
Eine rettende Botschaft
Die Entdeckung der kognitiven Dissonanz
Die Mutter aller Illusionen
Die Welt aus der Konserve
Das Gehirn lebt in der Zukunft
Stier und Elefant
Zweite Illusion: Lust auf Neues
Warum wir lieben, was wir kennen
Angst ist nicht die Antwort
Homo explorans
Entspannter Geist zaubert Lächeln
Die Freuden der Wiederholung
Der Mensch als Automat
Zombies im Gehirn
Warum Kampagnen und Vorsätze scheitern
Wie man Gewohnheiten ändert
Der Weg zur Freiheit
Dritte Illusion: Es ist noch immer gut gegangen
Der letzte Schnee
Vom sonnigen Gemüt der Deutschen
Optimisten leben besser
Wenn es dem Esel zu wohl ist
Gestern noch auf stolzen Rossen
Der Tod lauert immer woanders
Von den Fakten zur Erkenntnis
Ratlose Götter
Vierte Illusion: Wissen ist Macht
Wenn Hochmut tötet
Filterblase im Kopf
»Je steifer der Kittel, umso stolzer der Arzt«
Die Scheu vor der Lösung
Schneller als die Schnecke
Fünfte Illusion: Freiheit kann alles
Im Gleichgewicht des Schreckens
Die Logik des Krawalls
Sophias Dilemma
Eine blockierte Revolution
Das Paradox der Moderne
Für eine Handvoll Euro
Bitte nicht so konkret
Sechste Illusion: Wir wollen das Beste
Schokolade und ein Nobelpreis
Scheiden tut weh
Trügerische Paradiese
Wenn Gewinne nicht locken
Warum »Blut, Schweiß und Tränen« nicht fruchtet
Auf dem Pflaster der Strand
Siebte Illusion: Ideologien haben ausgedient
Postfaktische Politik
Burkas überall?
Lob der Einfalt
Wie wir uns verführen lassen
Ideologien sind eine Krücke
Angst macht konservativ
Gegen die Erstarrung
Teil III Wie Veränderung funktioniert
Wege aus der Abhängigkeit
Abschied vom Tabak
Wie man Frauen verführt, sich zu vergiften
Ärzte rauchen Camel
Ein Sturm zieht vorüber
Die fünf Phasen der Revolution
David gegen Goliath
Die Macht des Selbstverständlichen
Die große Befreiung
Werte statt Wissen
Olympes Kampf
Von der Ansteckungskraft guter Ideen
Die verschlungenen Pfade der Veränderung
Aufstand der Frauen
Gebrauchsanleitung für eine bessere Welt
Eine Kultur der Veränderung
Aufbruch in vier Schritten
Erster Schritt: Entscheidungsfähig werden
Zweiter Schritt: Gewohnheiten ändern
Dritter Schritt: Kettenreaktionen vorbereiten
Vierter Schritt: Gute Geschichten erzählen
Das Wesen der Hoffnung
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Teil IDas gespaltene Bewusstsein
Auf dem Vulkan
»Das Richtige wissen und es nicht tun ist Mangel an Mut«, soll Konfuzius gesagt haben. Doch so einfach ist es nicht. Die Absurdität und die Folgen menschlichen Starrsinns habe ich nie so dramatisch erlebt wie bei meinem Besuch auf Montserrat. Diese kleine Karibikinsel hat alles, um als Paradies zu gelten. Das Meer schimmert tiefblau und glasklar, Palmen neigen sich über einsame Strände. Freundliche Menschen leben inmitten üppiger Vegetation, und aus den Blättern zwitschern seltene, knallgelbe Stärlinge. Jahrzehntelang war Montserrat ein Geheimtipp der Rockstars. Die Rolling Stones und Sting, Michael Jackson und Elton John wussten genau, warum sie sich für ihre Plattenaufnahmen in Studios auf die Insel zurückzogen.
Und Montserrat hat einen Vulkan. Deshalb reiste ich im Juni 1997 dorthin. Eine Redaktion hatte mich geschickt, um über Vulkanologie zu berichten. Gab es ein besseres Objekt als den tausend Meter hohen Soufrière Hills, den mir Geologen als den aktivsten Vulkan der Welt genannt hatten? Ich wollte auch darüber schreiben, wie die Menschen im Schatten des Lavadoms lebten, der jederzeit explodieren konnte. Zwei Jahre zuvor hatte ein Ausbruch den Hauptort der Insel, Plymouth, verschüttet. Die Bewohner hatte man rechtzeitig evakuiert.
Der Fotograf, der mich begleitete, wollte Aufnahmen aus der, wie es hieß, verlassenen Stadt. Also holten wir eine Genehmigung ein und fuhren los. Eine meterhohe, schwefelig stinkende Staubwolke wirbelte hinter unserem Jeep auf, und je näher wir Plymouth kamen, desto öfter mussten wir husten. Die giftige Vulkanasche reizte unsere Lungen. Am Ziel bot sich uns eine apokalyptische Szenerie: Die Straßen lagen unter Lavabrocken begraben, die meisten Häuser waren eingestürzt.
Wir glaubten, in den Trümmern allein zu sein. Plymouth war nicht nur zerstört und vergiftet, sondern lag auch in der Schusslinie des Vulkans, der jederzeit wieder ausbrechen konnte. Deshalb erlaubte die Regierung Aufenthalte hier nur für wenige Stunden. Doch zwischen den Ruinen bewegten sich Menschen. Ein alter Mann kochte auf einer Öltonne sein Mittagessen, und im Eingang eines zerfallenden Hauses wusch eine junge Frau eine ältere. Auf einer Brache, die wohl einmal der Hauptplatz des Städtchens war, palaverten zwei Dutzend Frauen und Männer in der Asche, und zwischen ihren Beinen spielten ein paar Kinder im giftigen Staub. Die Anwesenden beachteten uns kaum. Was wollten sie hier? Sie wirkten nicht so, als hielten sie sich nur vorübergehend in der verbotenen Zone auf. Ich sprach eine Frau an, die eine Tür an einer Ruine aufsperrte. »Wir wohnen hier«, antwortete sie. Ob wir hereinkommen wollten? Sie führte uns in einen von einem geborstenen Fenster schlecht beleuchteten Raum. Es gab ein schmales Doppelbett, einen kleinen Tisch, zwei Stühle. Alles war mit Asche bedeckt. Warum sie nicht in die neuen Unterkünfte umgezogen sei, die die Regierung im sicheren Norden der Insel bereitgestellt habe?, fragte ich sie. »Dies ist unser Haus«, antwortete sie, und dabei setzte sie für uns Teewasser auf. »Hier bin ich geboren. Hier habe ich immer gelebt. Und hier werde ich sterben.«
Die Unbeirrbaren
Zwei Tage später brach der Vulkan ohne Vorwarnung aus. Die neue Eruption war weitaus stärker als alle bisherigen. Eine Rauchsäule quoll kilometerhoch in den Himmel, und vom Krater des Soufrière schossen Glutlawinen ins Tal. Hubschrauber stiegen auf, um die Menschen, die sich noch immer in der verbotenen Zone aufhielten, zu retten. Und während sich pyroklastische Ströme, tödliche Gemische aus heißen Gasen, Steinen und Asche, auf Plymouth zu wälzten, kreuzten vor dem Ort Schiffe der Royal Navy auf, denn Montserrat ist eine britische Kronkolonie. Die Marinesoldaten holten die Menschen, die in der Stadt ausharrten, auf ihre Schiffe.
Doch als nach Tagen alle Vermissten in den sicheren Nordteil der Insel gebracht waren, flogen die Hubschrauber noch immer. Die Soldaten suchten nun aus der Luft nach Menschen, die sich nach ihrer Rettung wieder auf den Weg gemacht hatten. Die Geretteten wanderten über die glühende Asche die alten Saumpfade entlang, hinauf zu ihren Häusern und Süßkartoffelfeldern unter dem Vulkan. Sie versuchten das Land zu erreichen, das man ihren Vorfahren zugesprochen hatte, als Montserrat seine Sklaven in die Freiheit entließ, und das sie jetzt nicht aufgeben wollten, obwohl sich 600 Grad heiße Schlacke meterdick über die Erde ergoss. An Mut, den Konfuzius als Voraussetzung für richtiges Handeln ansah, mangelte es ihnen ganz bestimmt nicht.
Und dann beobachteten wir, der Fotograf und ich, auf dem Hubschrauberlandeplatz, was die zum zweiten Mal Geretteten taten, nachdem sie aus den Maschinen geklettert waren: Sobald die Soldaten sie im Gewimmel aus den Augen verloren, schlichen sie sich davon und machten sich erneut auf den Weg nach Plymouth und in die Dörfer, wo die Hitze des Vulkans Betonhäuser zum Schmelzen gebracht hatte. Als die Helikopter entladen waren, hoben sie ab, um die Unbeirrbaren ein weiteres Mal einzusammeln. Immer öfter allerdings zerrten die Soldaten Leichensäcke aus dem Laderaum.
Starr vor Schreck
Natürlich schüttelt man den Kopf, wenn Menschen in einem aussichtslosen Kampf ihr Leben riskieren, weil sie sich nicht auf eine veränderte Wirklichkeit einstellen können. Man empfindet auch Mitleid mit den Verzweifelten, die alles daransetzen, gegen jede Vernunft ihre alte Existenz zurückzugewinnen.[1]
Aber ist uns das Verhalten der Bauern von Montserrat wirklich so fremd? Weder stehen wir unter dem Schock einer Katastrophe, noch laufen wir Gefahr, aus Schmerz den Verstand zu verlieren. Doch mildere Formen der Realitätsverweigerung erleben wir täglich. Hier eine Bekannte, die ihren aufreibenden und dabei unbefriedigenden Job schon seit Jahren erträgt, obwohl es ihr an besseren Alternativen keineswegs mangelt, dort der Freund, der sich in seiner Beziehung demütigen lässt, weil er noch immer hofft, dass irgendwann die alten Tage des Verliebtseins zurückkehren könnten. Und wer hat sich selbst noch nicht dabei ertappt, dass man bestens begründete Empfehlungen, sein Leben zu ändern, in den Wind schlägt? Man weiß genau, was geschieht, wenn man nicht endlich beginnt, sich mehr zu bewegen oder weniger Alkohol zu konsumieren. Man fasst einen guten Vorsatz, versucht es zaghaft und kehrt nach kurzer Zeit zu den alten Gewohnheiten zurück. Und dann beschwichtigt man sich, so schlimm wird es schon nicht werden.
Noch stärker als Einzelne neigen Menschen in Gruppen dazu, sich der Wirklichkeit zu verschließen. Jeder, der eine Organisation von innen erlebt hat, kann davon berichten. Eine der schwierigsten Aufgaben jedes Unternehmens, jeder öffentlichen Einrichtung und jedes Sportvereins ist es, sich der Zeit anzupassen. Eine ganze Industrie von Unternehmensberatungen für »Change Management« müht sich, unwilligen Mitarbeitern, Mitgliedern und Kunden neue Abläufe schmackhaft zu machen. Dabei könnte man sich die meisten Honorare für teure Berater sparen, denn sobald ein Projekt auch nur andeutet, bestehende Verhältnisse zu ändern, ist sein Scheitern fast sicher. Einer Umfrage unter Tausenden Topmanagern weltweit zufolge scheitern mehr als 70 Prozent aller Vorhaben, die auf Veränderung welcher Art auch immer angelegt sind.[2]
Kein Wunder also, wie zwiespältig viele Menschen reagieren, wenn sie wahrnehmen, dass die Welt alles andere als stillsteht. Wir sehen die Zeichen: Die Bäume werfen ihre Blätter jetzt schon im Sommer ab. Unsere Kinder lösen ihre Schulaufgaben, indem sie die Fragestellung in einen Chatbot eintippen. Wenn wir auf die Straße gehen, begegnen uns immer weniger junge, immer mehr ältere Menschen.
Wir ahnen: In den kommenden Jahren werden wir fast alles in Frage stellen müssen, was uns heute noch selbstverständlich erscheint. Wir erkennen: Die Klimakrise, den Aufstieg der künstlichen Intelligenz, das dramatische Altern unserer Gesellschaft und unser eigenes Altern meistern wir nur, wenn wir radikal neue Wege gehen. Wir wissen: Eine Erde, auf der sich acht Milliarden Menschen des für uns heute selbstverständlichen Wohlstands erfreuen, kann es nicht geben. Wir fürchten: Unser Überleben steht auf dem Spiel. Denn wir sind umgeben von »Zeitbomben, deren Zünder auf weniger als 50 Jahre eingestellt sind«, wie es der amerikanische Evolutionsbiologe Jared Diamond ausgedrückt hat. Es ist keineswegs übertrieben, unsere Welt mit dem Vulkan von Montserrat zu vergleichen.
Und doch stellen wir uns dem Wandel entgegen. In einer Zeit, in der die Menschheit und jeder Einzelne sich der Veränderung öffnen müssen, beherrscht uns die Tyrannei der Gewohnheit.
Nehmen wir einmal die Bewusstseinsspaltung, in die uns der Klimawandel versetzt. Wir erschrecken über Unwetter und katastrophale Überschwemmungen, und kein vernünftiger Mensch zweifelt daran, dass sich sehr bald halbe Länder in Wüsten verwandeln, wenn wir weiter Öl und Kohle verbrennen. Schon heute sterben allein an dem durch fossile Brennstoffe freigesetzten Feinstaub Jahr für Jahr weltweit mehr Menschen, als die Covid-Pandemie in ihrem ganzen Verlauf umgebracht hat.[3] Fest steht auch, dass sich durch den Klimawandel in Deutschland vermehrt Infektionskrankheiten ausbreiten werden.[4] Dabei erfreuen uns Benzin und Kerosin, Öl und Gas keineswegs. Täglich fluchen wir über die Folgen: Lärm und Stau, exorbitante Heizkosten, Schlangen am Flughafen und Hitzewellen im Sommer.
Man könnte nun meinen, dass wir uns leichten Herzens von all dem verabschieden würden. Schließlich gibt es Alternativen. Aber im Gegenteil – je mehr Horrornachrichten vom Klimakollaps uns erreichen, und je mehr wir selbst unter unseren Gewohnheiten leiden, umso grimmiger verteidigen wir das Automobil, das Privileg, in den Urlaub zu fliegen, sogar den Heizkessel im Keller. Die Möglichkeit, dass wir mit einem anderen Lebensstil glücklicher sein könnten, ziehen wir gar nicht erst in Betracht.
Dass wir den Wandel unmöglich verhindern können, ist uns durchaus bewusst. Und so behaupten wir gar nicht, dass wir es wollen. Unsere Absichten hören sich viel bescheidener an: Andere Wege gehen durchaus, nur bitte nicht gerade jetzt. In einer unsicheren Welt suchen wir in unseren Gewohnheiten Halt. Wir klammern uns an sie wie Ertrinkende an die letzten Planken eines untergehenden Schiffs.
Die folgenden Kapitel berichten auch von der Schreckensstarre angesichts der Einwanderung, der Allgegenwart immer mächtigerer Computer und der Alterung der Gesellschaft. Nicht nur die Gesellschaft ist gelähmt, sondern auch jeder Einzelne. Wir beobachten das Phänomen bei nahestehenden Menschen und, wenn wir ehrlich sind, bei uns selbst: Man erkennt eine Chance und weiß, wie klug es wäre, sie zu ergreifen. Doch dann bleibt alles beim Alten.
Gründe sind schnell gefunden. Es fehlt, wie immer, am Geld. Fragt man, warum sich die Gesellschaft nicht zum Besseren ändert, nennt man unfähige Politiker, korrupte Eliten und die Defekte des Kapitalismus. Doch wir äußern solche Erklärungen sonderbar halbherzig. Einerseits kann niemand die genannten Faktoren bestreiten. Andererseits gibt doch jeder[5] zu, dass sie keineswegs die einzige und noch nicht einmal die größte Hürde darstellen. Man weiß genau, dass da noch etwas ist. Wäre sonst so oft von Veränderungsmüdigkeit und Verlustangst die Rede? Solche Begriffe umschreiben nur, dass Veränderung nicht an den Umständen, sondern an den Betroffenen scheitert – die Menschen wollen sie nicht. Das ist eine wichtige Erkenntnis: Veränderung ist nicht nur ein soziales, sondern vor allem ein kognitives Problem.
Aber warum? Gerne begründet man den Widerstand gegen Veränderung mit einer aktuellen Situation, die uns, nun ja, überfordert. Damit scheinen doch wieder Umstände schuld. Nun sind auch die gängigen Diagnosen »Veränderungsmüdigkeit« und »Verlustangst« selten ganz falsch. Aber sie berücksichtigen nur die Oberfläche, und sie vernebeln mehr, als sie erhellen. Vor allem verharmlosen sie das Problem. Sie akzeptieren den Stillstand, sogar die Realitätsverweigerung als Folge einer leider misslichen Situation, wie wenn diese unabwendbar wären.
Stillstand ist kein Schicksal
Dieses Buch nimmt den Widerstand gegen Veränderung ernst. Es betrachtet ihn weniger als eine Folge besonderer Umstände, sondern vielmehr unserer zutiefst widersprüchlichen Natur. Einerseits ist Neugier einer der stärksten Antriebe des Menschen, andererseits lehnen wir Neues instinktiv ab. Einerseits sehnen wir uns nach einem besseren Leben, andererseits wollen wir unsere private Welt bewahren.
Es ist keine Besonderheit unserer Zeit, dass Menschen keine Veränderung wollen. Auch frühere Generationen standen Neuem ablehnend, allenfalls zwiespältig gegenüber. Doch zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte sind die globalen Lebensgrundlagen bedroht. Die Frage, wie viel Veränderung uns angenehm wäre, stellt sich nicht mehr. Sie kommt so oder so.
Da hilft es weder, die Umstände noch die menschliche Unvernunft zu beklagen. Ebenso müssen alle Bemühungen fehlschlagen, der Trägheit mit guten Worten, Mahnungen oder Zwang entgegenzuwirken. Solange diese die menschliche Natur übergehen, verstärken sie eher den Widerstand. Die Erfahrungen der Umweltbewegung, auch all derer, die sich für eine gerechtere Welt einsetzen oder auch nur ihre eigene Organisation auf einen neuen Weg bringen wollen, sind bitter. Die meisten sind gescheitert, weil sie die Bereitschaft zu Veränderung falsch eingeschätzt haben.
Dabei sind Gesellschaften sehr wohl zum Aufbruch fähig. Niemand erwartete noch ein Jahr vor dem Ereignis den Fall der Berliner Mauer. Und immer wieder haben sich Menschen von jahrtausendealten Sitten befreit und begonnen, anders zu leben – von der Abschaffung der Sklaverei über die Einigung Europas bis zur Gleichstellung der Geschlechter und sexuellen Orientierungen. Keiner dieser Umbrüche ist vollendet. Aber sie alle haben in kurzer Zeit erreicht, was vorher undenkbar erschien.
Menschenmöglich ist sogar weltweite Kooperation. Eine gemeinsame Anstrengung aller Nationen hat Aids zurückgedrängt und eine der tödlichsten Seuchen, die Pocken, für immer besiegt. Das Protokoll von Montreal rettete die Ozonschicht der Erde, die in 1980er Jahren vor dem Zusammenbruch stand. Leicht vergisst man diese Erfolge, weil man sie schon als selbstverständlich ansieht. Sie sind es nicht.
Wie kann der heute nötige Aufbruch gelingen? Wir blockieren uns selbst. Der einzige Weg ist also, dass wir uns selbst und andere besser verstehen. Veränderung setzt voraus, dass wir lernen, einander zuzuhören und einander ernst zu nehmen. Können wir herausfinden, welche Ängste uns und unsere Mitmenschen lähmen, welche Illusionen uns schwächen, wie wir uns manipulieren lassen?
Nur wer die Fallen kennt, die wir Menschen uns selbst stellen, kann sie vermeiden. Dabei steht unser heutiges Wohlergehen ebenso auf dem Spiel wie das Schicksal kommender Generationen. Die Wissenschaft hat in den letzten Jahren nachgewiesen, dass dieselben Illusionen und Fehlentscheidungen, die unsere Zukunft gefährden, schon jetzt unsere Lebenszufriedenheit mindern. Sie hat aber auch Auswege gezeigt. Es ist nun an der Zeit, diese Einsichten zu nutzen.
Unsere Zukunft hängt davon ab, ob wir unsere Lust am Neuen wecken. Schiffbrüchige können gerettet werden, wenn es ihnen gelingt, den Kopf über Wasser zu halten.
Die gelähmte Gesellschaft
Untergegangene Zivilisationen faszinieren uns, weil wir ahnen, dass uns Ähnliches bevorstehen könnte. Wir lesen ihre Geschichte wie eine Krankengeschichte. Unwillkürlich fragt man sich, ob bestimmte Symptome, die das Siechtum des Patienten ankündigten, nicht auch bei uns selbst festzustellen sind. Wenn wir aber solche Anzeichen erkennen – wäre es dann nicht möglich, vielleicht sogar wahrscheinlich, dass sich schon bald über die Ruinen unserer Städte jene tödliche Stille senkt, die regelmäßig die Entdecker ausgelöschter Kulturen erschreckte?
»Wir stiegen über große Steinstufen hinauf, die an manchen Stellen perfekt, an anderen von den zwischen den Spalten wachsenden Bäumen umgestürzt waren. Unser Führer bahnte mit seiner Machete einen Weg durch den dichten Wald … zwischen halb vergrabenen Fragmenten folgten wir ihm zu vierzehn Denkmälern. Eines der Monumente hatten enorme Wurzeln von seinem Sockel gestürzt, ein anderes hatten die Äste umklammert und aus der Erde gehoben, ein drittes war zu Boden geschleudert und von riesigen Schlingpflanzen gefesselt. Ein Denkmal aber stand mit seinem Altar in einem Hain, und die Bäume schienen es zu verhüllen wie ein heiliges Objekt … Die einzigen Geräusche, die die Ruhe dieser begrabenen Stadt störten, waren die Schreie der Affen und das Knacken der unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbrechenden Äste.«[6]
So berichtete der amerikanische Forschungsreisende John Stephens im Jahr 1839 aus dem Bergland im entlegenen Westen Honduras. Ein alter Bericht eines spanischen Eroberers ließ ihn dort Ruinen vermuten. Doch was er in einem Tal wenige Meilen vor der Grenze zu Guatemala vorfand, verschlug ihm den Atem. Jenseits des Flusses Copán erhob sich eine gewaltige Mauer aus dem Dschungel, über 30 Meter hoch und einst Teil einer Befestigung. Stephens und seine Begleiter überquerten den Fluss und kletterten hinauf. Zu ihren Füßen erstreckte sich ein Labyrinth aus Wänden, überwuchert von riesigen Mahagonibäumen. Menschen lebten hier offenbar schon seit vielen Jahrhunderten nicht mehr. Stephens erkannte die Grundrisse von Toren und Tempeln, ein Stadion und einen Palast, die im tropischen Regen zerfielen. Über all dem ragte die Spitze einer Pyramide. Neben der Pyramide führte eine Treppe, auf der Hunderte Hieroglyphen eingraviert waren, wie ziellos in den Himmel.
Wer hatte diese Stadt errichtet, und warum war sie verlassen? Die Ruinen von Copán liegen im historischen Siedlungsgebiet der Maya, und Stephens wusste, welche Errungenschaften diese Hochkultur hervorgebracht hatte. Die Baumeister der Maya standen ihren Kollegen in der alten Welt nicht nach. Die Landwirte kultivierten ihren Mais auf kunstvoll terrassierten und bewässerten Feldern. Astronomen in eigens errichteten Observatorien sagten den Lauf der Gestirne voraus und führten nicht einen, sondern gleich drei verschiedene hochkomplexe Kalender. Die Mathematiker benutzten ein Zahlensystem mit der Null, während man sich in Europa noch Jahrhunderte später mit den umständlichen römischen Zahlen abmühte. Es gab eine Schrift, eine Literatur, Bibliotheken. Das Amatl-Papier war dem europäischen Pergament weit überlegen.
Etwas – oder jemand – musste dann diese große Zivilisation ausgelöscht haben. Jedenfalls waren es nicht die Raubzüge der Europäer, die den Niedergang brachten. Dies unterscheidet die Maya von anderen amerikanischen Völkern. Als die Eroberer eintrafen, war ihr Reich schon zerstört. Bereits der Bericht des spanischen Pioniers, der Stephens in den Dschungel geführt hatte, sprach von überwucherten Ruinen an den Ufern des Flusses Copán.
So vermutete Stephens, dass eine unbekannte Katastrophe zum Untergang führte: eine Dürreperiode oder ein Erdbeben, eine Epidemie oder ein verheerender Krieg. Diese Zivilisation hatte viele Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende bestanden, um ihren hohen Entwicklungsstand zu erreichen. Dass eine solche Kultur ihren eigenen Untergang herbeiführt, erschien ihm undenkbar.
Anatomie eines Zusammenbruchs
Heute wissen wir, dass Stephens teils recht hatte, teils irrte. Copán war eine Stadt der Maya, und tatsächlich gehörten die Maya zu den beständigsten Hochkulturen, die die Menschheit je hervorgebracht hat. Deren Anfänge reichen ins dritte Jahrtausend vor Christus zurück. Gegen Ende des zweiten Jahrtausends vor Christus wuchsen die ersten Städte, im ersten Jahrtausend vor Christus entwickelten die Maya die Schrift und die Staaten. Ihre größte Blüte erlebte die Zivilisation während der fünf Jahrhunderte vor ihrem plötzlichen Ende im neunten Jahrhundert nach Christus. Damit überdauerte diese Kultur sogar das alte Ägypten.
Und wirklich löste eine Katastrophe den Untergang aus. Doch weder Eroberer noch Erdbeben brachten die Maya zu Fall. Das Rätsel beantwortete vielmehr ein Stalagmit aus einer Tropfsteinhöhle, die in der Sprache der Maya »Palast der Könige« heißt. In einer Reihe bahnbrechender Veröffentlichungen aus den Jahren zwischen 2010 und 2020 berichteten Geologen von radiochemischen Analysen dieses Stalagmiten sowie von Bohrkernen, entnommen dem Grund mehrerer mittelamerikanischer Seen.[7] Die in dem Stalagmiten und Bohrkernen eingeschlossenen Sedimente gaben den Wissenschaftlern präzise Auskunft über die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit vergangener Zeiten. Sie zeigten übereinstimmend, dass um 800 nach Christus das Klima in Mittelamerika geradezu kollabierte.[8] In diesen Jahren brach die Hochkultur der Maya zusammen.
Die durchschnittlichen Niederschlagsmengen halbierten sich, sanken zeitweise sogar auf ein Viertel – Geowissenschaftler nennen solch extreme Trockenheit »Megadürre«.[9] Seit jeher regnete es im Land der Maya vor allem im Sommer, und die Bewässerungssysteme der immer intensiveren Landwirtschaft sammelten diese Güsse, um den Winter zu überstehen. Aber gerade die kräftigen Sommerregen blieben nun aus. Die großen Wasserreservoirs, die die Maya angelegt hatten, vertrockneten.[10] Millionen Menschen verdursteten und verhungerten, Kriege und Unruhen brachen aus.
Doch die Maya waren keineswegs nur Opfer der Naturgewalten. Anders als Stephens vermutete, waren sie auch Täter. Heutige Forschung spricht dafür, dass die Maya den Klimawandel, der ihre Zivilisation vernichtete, selbst ausgelöst hatten. Auch wenn es Perioden längerer Trockenheit natürlichen Ursprungs in Mittelamerika immer wieder gegeben hat: Nie seit der Besiedelung Mittelamerikas fiel im Land der Maya so wenig Regen wie um die Wende zum ersten Jahrtausend.
Die Megadürre begann, als die Städte der Maya prächtiger und die Könige mächtiger waren als jemals zuvor, als die Kultur ihren Höhepunkt erreicht hatte. Das sei kein Zufall, sagen der amerikanische Klimatologe Benjamin Cook und seine Kollegen.[11] Während die Maya ihre Kultur und Technik entwickelten, wuchs die Bevölkerung. Die Menschen entwaldeten das Land, um auf immer größeren Flächen Mais anzubauen. Das führte erstens zu Bodenerosion, denn Mais wächst in weit auseinanderliegenden Reihen und wurzelt so flach, dass Regen und Wind den Humus abtrugen; die Erde begann zu vertrocknen. Die Maya mussten für ihre Äcker immer neue Wälder roden. Der fatale Effekt der Entwaldung: Weil von den Feldern weniger Wasser als aus dem dichten Blätterwerk der Bäume verdunstete, sank die Luftfeuchtigkeit. Also fiel weniger Regen. Ein Teufelskreis setzte ein. Durch die Rodungen gingen die Sommerniederschläge, von denen die Landwirtschaft lebte, um 20 Prozent zurück. In guten Jahren, wenn der Regengott gnädig war, mochte das Wasser für den Ackerbau gerade noch reichen. Aber der menschengemachte Klimawandel hatte die Natur aller Reserven beraubt. Die kleinste Störung im Wettergeschehen führte jetzt zum Zusammenbruch der Produktion. Auf den Hunger folgten Anarchie und Kriege, vermutlich auch Epidemien. Die Zivilisation der Maya hatte einen Kipppunkt erreicht, von dem aus sie nicht mehr zur Stabilität zurückkehren konnte.
In den Herrscherhäusern Copáns allerdings schien man sich kaum Sorgen zu machen. Die Mayakönige wetteiferten vor allem darum, einander mit immer größeren Tempeln zu übertreffen, wie der amerikanische Geograph Jared Diamond angemerkt hat. »Das wiederum erinnert durchaus an den auffälligen Konsum heutiger amerikanischer Spitzenmanager.« Glaubten sie, dass ihre Welt ewig bestehen würde? Niemand konnte oder wollte sich offenbar vorstellen, dass eine so glanzvolle, seit Tausenden Jahren bestehende Hochkultur untergehen könnte. Kaum eine Generation später war es so weit. Um das Jahr 850 brannte Copáns Königspalast endgültig nieder. Die wenigen Überlebenden von Hunger, Durst, Krankheiten und Morden verließen die Städte. Die auf einen Bruchteil ihrer früheren Stärke dezimierte Bevölkerung floh an Orte, wo es noch ganzjährig Wasser gab, und versuchte, dort etwas Mais anzubauen. Die Wildnis eroberte die riesigen Felder zurück, die einst die Städte ernährt hatten, und die ersten Bäume schlugen ihre Wurzeln in den Ruinen. Und während sich wieder die Wälder ausbreiteten, kehrten auch die Wolkenbrüche im Sommer zurück. Die Zivilisation der Maya jedoch war für immer verloren.
Denn sie wussten nicht, was sie taten
Es ist verlockend, die Überheblichkeit der Maya mit unserer eigenen zu vergleichen. Doch wer voreilig Parallelen zieht, übersieht etwas Wesentliches: Die Maya wussten nicht, was sie taten.
Nichts deutet darauf hin, dass sie die komplizierten Zusammenhänge zwischen der Albedo der Bäume und saisonalen Niederschlagsmengen kannten, die Klimatologen des 21. Jahrhunderts mit ihren Supercomputern entdeckten. Für die Maya lag Trockenheit daran, dass Chaak, der Gott des Regens, des Donners und der Fruchtbarkeit, sie wollte. Und die einzige Möglichkeit, das zu ändern, war, Chaak günstig zu stimmen. Dann brachten sie ihm geweihten Mais, einen erlegten Jaguar oder auch ein Menschenopfer dar, damit Chaak seine Blitzaxt schwingen, die Wolken zerschmettern und Güsse auslösen möge.
Viele Hochkulturen sind an Umständen gescheitert, die sie selbst zu verantworten hatten. In keiner dieser Gesellschaften erkannte man die Zusammenhänge. Die Indus-Zivilisation im heutigen Pakistan etwa gehörte zu den drei frühesten Hochkulturen überhaupt. Sie war wohl auch die erste Zivilisation, die durch eine selbstverschuldete Umweltkatastrophe zugrunde ging. Das geschah um die Wende zum zweiten Jahrtausend vor Christus. Die Gelehrten in den prächtigen Städten am Indus, wo die Häuser sogar wassergespülte Toiletten hatten, ahnten nicht, warum die Ernten ausblieben. Die Gründe ähnelten, wie wir heute wissen, denen, die auch den Niedergang der Maya bewirkten. Zu intensiver Ackerbau erodierte die Böden, Rodung der Wälder verringerte die Niederschläge. Als dann auch noch ein Klimawandel den Zyklus der Monsunregen störte, kollabierte die Landwirtschaft und mit ihr die Städte.[12]
Selbst die Geschichtsschreiber im römischen Weltreich begriffen nicht, was geschah. Bedeutende spätantike Historiker wie Ammianus Marcellinus erkannten zwar, dass die Tage des Imperiums gezählt waren. Doch sie führten den Niedergang auf den Verlust alter Tugenden, Korruption und Einfälle von Barbaren zurück. Sie übersahen, dass diese Zustände eher Symptome als Ursachen der Machtauflösung waren. Heute gilt als gesichert, dass weder Dekadenz noch Reitervölker aus dem Osten das Imperium zerstörten.
Vielmehr erstickte das römische Weltreich an seinem eigenen Erfolg.[13] Die Besetzung immer größerer Gebiete verschlang immer höhere Kosten, die die Steuereintreiber ab dem dritten Jahrhundert nach Christus nicht mehr aufbringen konnten. Hinzu kam ein Wirtschaftssystem, das auf Ausplünderung der Provinzen angelegt war. Die römischen Ingenieure glänzten im Bauwesen und konstruierten geniale Maschinen für das Militär; bessere Technik für eine Industrie oder eine produktivere Landwirtschaft dagegen schien niemanden zu interessieren. So bewirtschaftete man im Rom der Kaiserzeit die Äcker noch immer mit weitgehend denselben primitiven Werkzeugen wie tausend Jahre früher zur Zeit Alexanders des Großen.[14] Die Großgrundbesitzer hatten ja Sklaven. Wenn es ihnen an Arbeitern mangelte, lag das Land brach, mit der Folge, dass der Staat noch weniger Steuern einnahm.[15] So wurden ausgerechnet die Gewohnheiten, die das Imperium groß gemacht hatten, zu seinem Fluch. Das Weltreich musste enden, weil seine Gesellschaft unfähig war, sich zu verändern.
Der Niedergang des Römischen Reichs, die Hungersnöte am Indus, der Untergang der Maya und der Zusammenbruch vieler anderer Zivilisationen haben eines gemeinsam: Die Menschen stürzten blind in die Katastrophe. Sie konnten das Unglück nicht abwenden, weil sie weder die Situation noch ihren eigenen Beitrag daran verstanden.
Sehend in den Kollaps
Wir hingegen kennen unsere Lage genau. Täglich führen uns die Medien vor Augen, wie es um uns steht. Wir sehen Bilder von Flutkatastrophen, ausgetrockneten Flüssen und brennenden Wäldern auf allen Kontinenten. Wir lesen, dass jeden Tag 150 Tier- und Pflanzenarten für immer verschwinden, einfach ausgelöscht werden. Erfahren schließlich, dass Deutschland nicht den mindesten Grund hat, sich als Musterschüler zu fühlen. Pro Kopf stößt Deutschland mehr Kohlendioxid aus als jedes andere Land in Europa.[16] Um seinen fairen Beitrag zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad zu leisten, müsste Deutschland seine Treibhausgasemissionen 30-mal schneller senken als bisher.[17]
Wir hören Experten, die vorrechnen, dass dies nur der Anfang sei, weil die Temperaturen gerade erst zu steigen beginnen, sich auch das große Sterben in der Natur weiter beschleunigen werde. Nur noch wenige Jahre, bis die steigenden Ozeane Hafenstädte überschwemmen, Äcker vertrocknet, ganze Länder unbewohnbar sein werden.
Brauchen wir noch die Weckrufe der Klimatologen? Wir erleben selbst, was geschieht. Jedes Jahr laufen wir früher im Sommer über braunen Rasen, und dass im Winter große Seen zufrieren, ist nur noch Erinnerung. Man müsste sich schon in eine Höhle zurückziehen und alle Sinneskanäle verschließen, um zu glauben, dass wir in einer heilen Welt leben. Die weltweite Klimakrise ist eine Notlage von einem in der Menschheitsgeschichte nie dagewesenem Ausmaß.
Maschinen außer Kontrolle
Aber damit nicht genug. Die Zerstörung der Lebensgrundlagen ist keineswegs die einzige Gefahr, in der wir wissentlich schweben. Computer haben in kürzester Zeit so gut wie alle Lebensbereiche verändert. Wenn Bildschirme die Arbeit, Algorithmen die Meinungen und Dating-Apps die intimsten Momente bestimmen, fällt es heute schon schwer zu sagen, ob wir die Maschinen kontrollieren oder sie uns. Auch dies ist erst der Beginn. Denn gegenüber der Technik in wenigen Jahren werden heutige Computer wie ein harmloses Spielzeug erscheinen.
Künstliche Intelligenz bietet zweifellos Chancen. Sie wird Büroangestellte von ermüdenden Routinen befreien, Ärzten bei der Diagnostik assistieren, Wissenschaftlern helfen, neue Medikamente zu finden. Sie wird Schülern individuelle Lehrpläne schneidern und Psychotherapien wirksamer machen. Selbstfahrende Autos und menschenleere Fabrikhallen werden in wenigen Jahren normal sein. Die Wirtschaftsleistung pro Kopf könne sich verzehnfachen, sobald künstliche Intelligenz die Fähigkeiten des menschlichen Verstands erreicht, prognostiziert eine Studie der Vereinten Nationen.[18]
Doch der technische Fortschritt verändert die Gesellschaft. Ein offener Brief, den im März 2023 über hundert weltweit führende Forscher auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz unterzeichneten, beschreibt, was uns bevorsteht.[19] Darin heißt es, künstliche Intelligenz werde zunehmend zur Konkurrenz für den Menschen, und weiter:
»Wir müssen uns fragen: Sollen wir zulassen, dass Maschinen unsere Informationskanäle mit Propaganda und Lügen fluten? Sollten wir alle Jobs automatisieren, auch die erfüllenden? Sollten wir nichtmenschliche Intelligenzen entwickeln, die uns irgendwann zahlenmäßig überlegen sind, uns überlisten, überflüssig machen und ersetzen könnten? Sollen wir den Verlust der Kontrolle über unsere Zivilisation riskieren?«
Man kann es nicht besser sagen. Allerdings ist die Liste keineswegs vollständig. Etwa lässt der offene Brief aus, dass sich künstliche Intelligenz perfekt dazu eignet, Menschen zu überwachen.
Selbst wenn wir solche Auswüchse verhindern: Maschinen werden nicht länger nur Befehle ausführen. Sie werden die Aufgaben von Managern, Anwälten und Ärzten übernehmen und Entscheidungen treffen. Vorsichtige Schätzungen sagen den Verlust von 300 Millionen Arbeitsplätzen in den Industrieländern während der kommenden Jahre voraus. Zwei Drittel aller Jobs werden sich durch den Einsatz der künstlichen Intelligenz verändern.[20]
Der enorme Reichtum, den die neue Technik verspricht, werde die in so gut wie allen Ländern heute schon spürbaren Spannungen weiter verschärfen, warnt die bereits genannte Untersuchung der Vereinten Nationen.[21] »Die massiven Profite dürften sich auf wenige konzentrieren. Viele werden zurückgelassen. […] Geballte technologische und wirtschaftliche Macht übersetzt sich in politische Macht. Eine machtlose Mehrheit dagegen bleibt in einem Gleichgewicht der Unzufriedenheit gefangen.«
Während die Klimakrise die Zivilisation von außen gefährdet, kann außer Kontrolle geratene Digitalisierung die Gesellschaft von innen spalten. Wachsende Ungleichheit und Polarisierung droht sie zu zerreißen. Das bedeutet nicht, dass die westlichen Demokratien unaufhaltsam dem Abgrund entgegenrasen. Die Herausforderungen durch den immer schnelleren technischen Fortschritt lassen sich bewältigen.[22] Aber zu glauben, unsere Gesellschaft könne ungestraft weitermachen wie bisher, wäre gefährlich naiv.
Auf die Frage, welche mögliche Auswirkung der heute schon eingeführten sozialen Medien ihm die größte Sorge bereite, antwortete der ehemalige Facebook-Spitzenmanager Tim Kendall mit einem Wort: »Bürgerkrieg.«[23]
Das große Altern
Und schließlich zwingt uns eine dritte Entwicklung, unser gewohntes Leben zu ändern. Sie schreitet langsamer voran als die Klimakrise und der rasante Aufstieg der künstlichen Intelligenz. Doch auch ihre Anzeichen sind bereits spürbar: Wenn wir auf die Straße gehen, blicken wir in immer mehr ältere Gesichter, und im Café ist niemand mehr, der uns bedient.
Festmachen lässt sich die Entwicklung an einer einzigen Zahl: 31. So viele Rentnerinnen und Rentner kamen im Jahr 2020 auf 100 Erwerbsfähige. Im Jahr 2000 lag der sogenannte Altersquotient noch bei 20. Das heißt, er stieg in nur zwanzig Jahren um mehr als Hälfte. Im Jahr 2040 wird der Altersquotient sich auf 47 verdoppeln. Dann müssen zwei Arbeitende für einen Rentner aufkommen.[24] Diese Zahlen beschreiben Deutschlands Zukunft, aber ähnlich sieht es in allen Industrieländern aus. Selbst in den meisten Gegenden Afrikas und Asiens werden immer weniger Kinder geboren. Die Menschheit altert weltweit.
Eigentlich ist es erfreulich, dass immer mehr Menschen immer länger leben. Nur ist unsere Gesellschaft nicht darauf eingerichtet, dass in Deutschland heute schon fast die Mehrheit über fünfzig ist. Das Ärgernis, wochenlang auf einen Handwerker zu warten, weil niemand mehr da ist, der die Arbeit rechtzeitig erledigt, ist nur ein Vorgeschmack auf kommende Zeiten. Wir sehen leeren Kassen und einer Zukunft entgegen, in der Pflegekräfte und Ärzte fehlen. Und dies sind nur die offenkundigsten Erscheinungen einer dramatisch alternden Welt.
Die folgenreichsten Veränderungen bemerken die meisten Menschen kaum, weil diese sich allmählich in ihnen selbst vollziehen. Mit den Lebensjahren altert nicht nur der Körper, sondern auch der Verstand. Nicht, dass ältere Gehirne weniger leisten als junge. Doch sie arbeiten anders. Entwicklungspsychologen haben die Prozesse ausführlich beschrieben: Menschen riskieren im Alter weniger, werden generell ängstlicher. Sie verlassen sich auf ihre Erfahrung, versuchen seltener, Probleme auf neue Weise zu lösen. Der Antrieb zu experimentieren lässt nach.