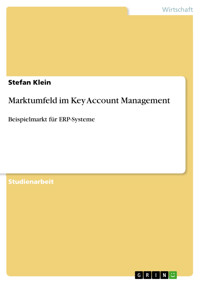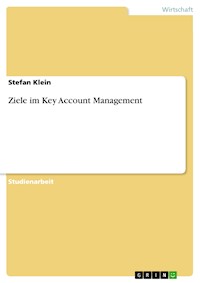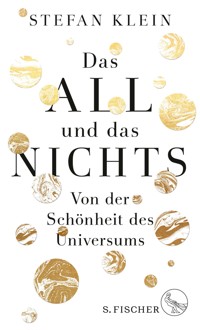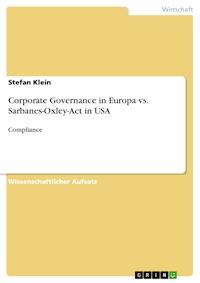8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie entstand die Welt? Was ist Leben? Was bedeutet Bewusstsein? Die unglaublichen Fortschritte, die Forscher in den letzten Jahrzehnten in der Physik, in der Evolutionsbiologie, in den Neurowissenschaften und in der Gentechnologie gemacht haben, erlauben ganz neue Antworten auf diese alten Fragen der Menschheit. Stefan Klein zeichnet die aufregende Chronik der Schöpfung nach und berichtet vom aktuellen Stand der Forschung. »So macht Wissenschaft Spaß.« Unicum
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Stefan Klein
Die Tagebücher der Schöpfung
Vom Urknall zum geklonten Menschen
FISCHER E-Books
Inhalt
Vorwort
Die Fragen, über die der Mensch seit jeher rätselt, lassen sich in Mysterien und Probleme unterscheiden: Vor einem Mysterium stehen wir fassungslos staunend, ein Problem erscheint uns grundsätzlich lösbar. Geburt und Tod, Weltanfang, Weltende – für die Menschen der Antike waren alle großen Fragen Mysterien. Man kann die Geschichte seither als den fortwährenden Versuch auffassen, Mysterien in Probleme zu verwandeln.[1]
Nie zuvor war die Menschheit dabei so erfolgreich wie im letzten Jahrzehnt. Denn noch nie hat sie so viele Entdeckungen gemacht und nie haben Forscher so weit Zugang zu den Ursprüngen und den letzten Dingen der Natur gewonnen.
Physiker sind dem Urknall experimentell bis auf eine zehnmilliardstel Sekunde nahe gekommen. Kosmologen haben das Alter des Universums bestimmt und erkannt, dass es keinen Weltuntergang geben wird, anders, als sie dachten. Inzwischen gehen sie daran, ihre Vermutung zu belegen, dass unser Kosmos nur einer von vielen sein könnte.
Wie das Leben entstand und nach welchen Gesetzen die Natur immer neue Wesen erschafft, wurde zumindest in Umrissen wissenschaftlich geklärt. Neu entdeckte Lebensformen in verborgenen Nischen, in der Tiefsee und im Inneren der Erde, fast unabhängig von der Außenwelt und mit einem fremdartigen Stoffwechsel, geben Hinweise auf mögliches Leben auch woanders im All. Und die Wissenschaft hat schließlich selbst das menschliche Bewusstsein als ein Ergebnis der Evolution gedeutet.
So hat der Homo sapiens begriffen, dass auch er ein ganz gewöhnliches Produkt der Schöpfung ist; zugleich aber hat er sich selbst aufgeschwungen zum Schöpfer. Ein geklontes Schaf wurde zum Symbol einer neuen Zeit, in der der Mensch die Kreatur nicht nur ihm untertan macht, sondern sie nach seinen Bedürfnissen formt. Ins Visier seiner Gestaltungswut hat er sogar seine eigene Gattung genommen. Genetiker entschlüsseln das menschliche Erbgut, Mediziner wollen Organe vom Fließband liefern und träumen vom geklonten Homo sapiens.
Von all diesen Entdeckungen und Umbrüchen handelt dieses Buch. Es berichtet von dem einschneidenden Wandel, den die Naturwissenschaften in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durchgemacht haben: Immer weniger befriedigt von Antworten auf die bloße Frage »Wie funktioniert das?«, wollen Grundlagenforscher die Welt nun aus ihrer Entstehungsgeschichte heraus erklären. Die Prozesse der Schöpfung sind ihr Thema geworden. Sie haben sich des Stoffs angenommen, aus dem noch vor kurzem allein die Mythen, Philosophien und Religionen bestanden.
Schon die Lehre Charles Darwins, dass sich das Leben vom Einfachen zu immer komplizierteren Formen entwickelte, sich fortwährend veränderte und immer vielfältiger wurde, besaß eine Suggestivkraft nicht geringer als die biblische Schöpfungsgeschichte, hat der Biologe Edward Wilson einmal gesagt. Doch Darwins Evolutionstheorie war ein Leuchtfeuer in ihrer Zeit, nicht Ausdruck einer verbreiteten Überzeugung.
Bis sie eine solche werden konnte, musste zuerst die Forschung ihre Detailarbeit leisten, musste der böhmische Mönch Gregor Mendel durch Kreuzungsversuche in seinem Klostergarten die Vererbungsgesetze entdecken, mussten Mikroskope aufkommen, um die Chromosomen als Träger der Erbinformation sichtbar zu machen, und mussten schließlich, im Jahr 1953, Francis Crick und James Watson die Struktur der Erbsubstanz bis in deren Atome erklären.
Erst nachdem all diese Voraussetzungen in der Biologie und der Physik geschaffen worden waren, konnte die Wissenschaft während der letzten Jahre auf breiter Front in die Grenzgebiete des Glaubens vordringen. Messinstrumente wie Superteleskope, welche fast alles, was im Universum überhaupt sichtbar ist, ins Blickfeld gerückt haben, Methoden wie die Hirndurchleuchtung und der Fortschritt bei der Entschlüsselung der Gene haben die Forscher dazu in die Lage versetzt. Wilson nennt diesen Aufbruch »eines der größten Abenteuer, das je stattfand«[2]. So sind die großen Fragen, über die der Homo sapiens immer schon gegrübelt hat, mindestens teilweise der Überprüfung zugänglich geworden: Wie entstand die Welt? Was ist Leben? Was bedeutet Bewusstsein?
Dieses Buch beschreibt, welche Antworten die Forscher heute auf diese Fragen geben. Ein Motiv, das in diesen Erklärungen immer wieder auftaucht, ist der Zufall. Mit der Entdeckung, was für eine ungeahnt zentrale Rolle er in der Natur spielt, war eine der großen wissenschaftlichen Revolutionen des 20. Jahrhunderts verbunden. Umso erstaunlicher ist es, dass Biologen und Chemiker zunehmend zu dem Schluss kommen, Leben musste auf der Erde fast zwangsläufig entstehen. Die Frage, wie viel Zufall und wie viel Notwendigkeit dazu führten, dass die Welt so wurde, wie sie ist, gehört zu den hintergründigsten der heutigen Forschung.
Dass meine Darstellungsweise eher erzählerisch als wissenschaftlich-systematisch ist, hat zwei Gründe: Zum einen gehen viele Abschnitte auf Berichte zurück, die ich in den Jahren 1996–1998 für den ›Spiegel‹ verfasst habe. Zum anderen scheint mir kaum eine Form dem Gegenstand so angemessen wie die des Erzählens.
Mit Wortschöpfungen wie »schwarzes Loch«, »Urknall« oder »egoistische Gene« gebraucht die Wissenschaft selbst zunehmend Metaphern. Die Fallgesetze, die Galileo im 16. Jahrhundert aufschrieb, sind noch jedem Schulkind beizubringen. Wer in die Regeln der Atomphysik, in die um 1920 entdeckte Quantenmechanik eindringen will, benötigt schon ein Physikstudium samt Ausbildung in höherer Mathematik. Die mathematischen Abgründe der heutigen Theorien vom Anfang der Welt aber versteht, sofern diese nicht sein Spezialgebiet sind, auch kein Physiker mehr.
Deswegen kommen die Wissenschaftler selbst, schon um sich untereinander zu verständigen, nicht umhin, sich der Metapher zu bedienen. So nähert sich die Naturwissenschaft auch in ihrer Bilderfreudigkeit den uralten Mythen.
»Je tiefer wir in das Universum eindringen, umso mehr überrascht uns das erzählerische Element, das uns auf allen Ebenen begegnet«, schreibt Ilya Prigogine, der für seine Entdeckung der Entstehungsweise neuer Strukturen den Chemie-Nobelpreis erhielt. »Die Natur präsentiert uns eine Reihe von Erzählungen, von denen eine Bestandteil der anderen ist: die Geschichte des Kosmos, die Geschichte der Moleküle, die Geschichte des Lebens und des Menschen bis zu unserer persönlichen Geschichte. Unweigerlich denkt man an Scheherazade, die jede ihrer Erzählungen unterbricht, um eine neue, noch schönere zu beginnen.«
Hamburg, März 2000
Stefan Klein
Vorwort zur Neuauflage 2009
Wenn ein Buch, das sich der aktuellen Forschung widmet, mehr als zehn Jahre nach seinem ersten Erscheinen kaum an Gültigkeit eingebüßt hat, könnte man beim Autor einen erstaunlichen Scharfblick vermuten. Und tatsächlich hat die Wiederlektüre des eigenen Buchs mich selbst überrascht. Denn alle Antworten, die es gibt, erscheinen nach wie vor gültig – obwohl sich die Wissenschaft stürmisch entwickelt hat. Und die damals offenen Fragen stellen sich drängender denn je.
Aber natürlich bin ich kein Hellseher; die erstaunliche Dauerhaftigkeit der »Tagebücher« verdankt sich vielmehr ihrem Thema. Oft heißt es, in der experimentellen Wissenschaft stehe jede Einsicht ständig zur Disposition: Sobald neue Daten ihr widersprechen, landen die bisherigen Vorstellungen augenblicklich auf dem Müllhaufen der Wissenschaftsgeschichte. Doch dies ist ein Mythos, der selbst abgeschafft gehört. Denn die Wirklichkeit sieht ganz anders aus: Einmal anerkannte Ergebnisse werden selten widerlegt. Viel eher schreitet die Forschung voran, indem sich die Bedeutung einzelner Fragen verändert. Neue Felder eröffnen sich, andere verlieren an Attraktivität und werden nicht mehr beackert. Statt Irrlehren zu entlarven, lässt man sie einfach verkümmern.
Wie sich die Gewichte verschieben, illustrieren auch die »Tagebücher der Schöpfung«. Dolly etwa, das geklonte Schaf, blieb eine Einzelgängerin. Zwar wurden inzwischen ein afghanischer Windhund namens Snuppy und selbst eine Haflinger-Stute geklont, dennoch erfüllten sich weder die Hoffnungen noch die Befürchtungen, die Dollys Geburt im Jahr 1997 ausgelöst hatte. Die Technik des genetischen Nachbaus höherer Lebewesen scheiterte an den Hürden der Natur, erwies sich als viel zu aufwendig und unsicher.
Die mittlerweile verstorbene Dolly, Snuppy und ihr Schicksal stehen allerdings auch in diesem Buch eher allein. Denn die meisten Themen haben seit der Erstauflage an Aktualität eher gewonnen. Die Suche nach einer neuen subatomaren Physik zum Beispiel nimmt neuen Schwung auf, wenn wie geplant der Genfer Beschleuniger LHC Elementarteilchen auf im Labor nie erreichte Geschwindigkeit bringt. Viele Theorien darüber, wie der Kosmos in seinen ersten Momenten entstand und wie seine Zukunft wird, nannte ich vor zehn Jahren noch Spekulation, heute gelten sie als gut begründete Erkenntnis. Ebenso sorgt die Evolutionsbiologie noch immer für Sensationsfunde, denn Molekulargenetik und die Arbeit an Fossilien wachsen, wie ich es beschrieb, weiter zusammen.
Nicht nur sein Gegenstand, auch ein Autor verändert sich. Ein Jahrzehnt und vier Buchtitel nach der Erstausgabe der »Tagebücher der Schöpfung« würde ich vieles anders ausdrücken. Trotzdem habe ich mich bei der Überarbeitung auf die nötigen Aktualisierungen beschränkt. Die Kapitel über Genforschung und die Entwicklung synthetischer Körperteile habe ich schon bei der letzten Neuauflage 2004 mit ausführlichen Nachträgen ergänzt. Der Ton der Erstauflage hingegen blieb – weder können noch sollen die Kapitel verleugnen, dass sie aus journalistischen Texten entstanden. Schließlich gleichen Bücher in vielerlei Hinsicht Organismen: Auch wenn sie alles andere perfekt sind, greift man selten ungestraft in sie ein.
Berlin, Januar 2009
Stefan Klein
Zeichen in der Tiefe
Die Zeichen sieht nur, wer auf dem Rücken liegt. Aber um aufrecht zu sitzen, geschweige denn zu stehen, ist der hinterste Raum der Höhle von Pergouset ohnehin zu niedrig.
Eingeritzt in den Lehm treten sie aus dem Gewölbedunkel hervor: Zwitterwesen zwischen Vogel und Mensch, spitzohrige Zweibeiner, denen aus der Schulter ein Schnabel wächst; Antilopen mit Rüssel; krakelige Linien, die an riesige weibliche Geschlechtsteile erinnern.
»Monster« nennt Michel Lorblanchet sie. »Psychedelische Monster.« Um sie zu besuchen, ist er durch einen kaum schulterbreiten Gang in das südfranzösische Erdreich gekrochen. Hier haben die Signaturen überdauert, seit 12000, vielleicht auch seit 14000 Jahren, niemand weiß es genau. Sicher ist nur: Die Mondmilch trägt die merkwürdige Hinterlassenschaft mindestens seit dem Ende der letzten Eiszeit. »Mondmilch« nennen die Geologen den blassen Kalkstein, den Verwitterung so weich gemacht hat, dass schon ein zarter Fingerzug eine Spur darin hinterläßt.
Rücklings in der Mondmilch liegend, hat der Archäologe Lorblanchet das Liniengewirr abgezeichnet, Strich für Strich. Acht Jahre lang dauerte diese einsame Arbeit, über die er nicht sprach, damit kein Eindringling die empfindlichen Bilder zerstörte. Er lernte die Abdrücke verschiedener Fledermausarten erkennen und die Zeichen an der Wand von den Kratzspuren der Füchse und Marder zu unterscheiden; begriff, dass die Höhle schon in der Steinzeit so feucht war, weil ein naher Fluß sie einmal im Jahr überschwemmte und das Gestein aufweichte. Am Ende hatte er jede feuchte Wand seiner Höhle ertastet, sie bis in ihre kleinsten Unebenheiten erforscht.[3]
Dann kam er wieder, diesmal nur mit einer Fackel in der Hand, denn er wollte die Werke so erleben wie einst deren Schöpfer. Nicht einmal ein fallender Wassertropfen stört die Stille der Höhle, sagt Lorblanchet. Wer mit verdrehtem Körper im flackernden Licht darin liege, fühle sich wieder geboren, wie außerhalb der Zeit. Und dann erwachten die Tiere zum Leben.
Auf einem Deckengewölbe verendet gerade ein Steinbock, die Brust von einer Lanze durchbohrt, die Beine in einem Netz verheddert. In einer Spalte so eng, dass der Künstler hier blind gezeichnet haben muss, schimmert ein fein gearbeiteter Pferdekopf, mit Nüstern, halb offenem Maul, Augen, Pupillen und Iris. Aus einer Felswand wölbt sich ein Stein hervor wie der Bauch einer Schwangeren, auf Nabelhöhe ist ein ovales Loch ausgehöhlt, darunter eine Vulva graviert: Eine ganze Traumwelt, ein Universum von Zeichen hatten die Menschen der Steinzeit in diesem feuchten Loch angelegt.
Was mag sie dazu bewogen haben? Und was bedeuten die Zeichen? Die Heutigen werden die Bilder aus sich selbst heraus nie mehr ganz entschlüsseln können, aber gerade das macht sie so interessant. Denn wir verstehen die Gravuren deswegen nicht, weil sie mehr besagen, als sie abbilden: Offenbar hatten die Zeichnungen auch eine symbolische Bedeutung, offenbar drehten sie sich um die Beziehung zwischen Mensch und Natur und darum, wie Menschen versuchten, sich eine Welt nach ihren Ideen zu schaffen – von den Monstern in Pergouset führt ein verschlungener Weg bis zur Kunst der Moderne, bis zu den heutigen Deutungen des Kosmos.[4]
Doch die Höhlenbilder markieren nicht den Beginn dieses Weges. Denn die Anfänge des menschlichen Schöpferdrangs sind noch vor dem ersten Auftritt des Homo sapiens selbst zu finden. Nur wer die ganze Geschichte dieser Versuche kennt, kann ahnen, wozu die Zeichen der Steinzeit einst gedient haben mochten. Vermutlich benutzten schon die Neandertaler Symbole.
Das zeigt eine gespenstische Entdeckung, die eine Gruppe von rumänischen Höhlentauchern um den Geologen Christian Lascu im Jahr 1987 gemacht hatte, die aber erst zehn Jahre später im Westen bekannt wurde. Durch einen unterirdischen Wasserlauf hatte sich Lascu Zugang zu einer riesigen Tropfsteingrotte im Bihorgebirge verschafft, deren Trockeneingang seit Zehntausenden von Jahren verschüttet ist.
Mammutzähne und Bärenschädel bedeckten den Boden im Zentrum der kathedralenartigen Räume, teils wüst verstreut, teils wie absichtlich niedergelegt: Überreste, die amerikanische Wissenschaftler später auf 75000 bis 85000 Jahre vor Christi datierten, die Zeit der Neandertaler in Europa. Nirgends fanden sich Bärenskelette. Die Schädel aber waren in symmetrischen Kreuzen angeordnet und nach der Windrose ausgerichtet.
Zufall? Der Pariser Archäologe Jean Clottes, der als oberster Kustos alle prähistorischen Fundstätten in Frankreich betreut, glaubt nicht daran. Die Neandertaler, erklärt er, müssen »gewisse kreative Fähigkeiten« gehabt haben. Wollten sie sich ausdrücken, blieb ihnen gar nichts anderes übrig, als Fundstücke zusammenzulegen und so Installationen der Frühzeit zu schaffen. Denn wahrscheinlich war erst der Homo sapiens mit einem Gehirn ausgestattet, das ihn zu Assoziationen, differenzierter symbolischer Darstellung und damit zum Zeichnen befähigte.[5]
Tausende von münzgroßen Kreisen weisen die beiden riesigen Felsmonolithen in der Steppe oberhalb der australischen Coornamu-Sümpfe auf, die einheimische Stammesvölker noch heute als heilig verehren. Die Einkerbungen sind geordnet in regelmäßigen Mustern, eines davon in Form eines Kängurus. Als Anthropologen diese Linien während der neunziger Jahre analysierten, sahen sie darin einen Anfang der modernen Kreativität. Atomphysikalische Untersuchungen an ausgegrabenen Splittern primitiver Steinkeile nämlich ergaben, dass die Gravuren möglicherweise vor mindestens 58000 Jahren entstanden waren.[6],[7] Damit wären diese Kreise die frühesten Zeichnungen der Welt. An anderen Fundstellen in Nordaustralien entdeckten die Archäologen dunkelrotes Farbpulver aus Hämatit, einem natürlichen Eisenoxid, das für Felsbilder verwendet wurde, und datierten es auf die Zeit vor über 55000 Jahren.[8]
Noch länger zieren Zickzacklinien und Dreiecke die Steine in der Blombo-Höhle nahe des Kaps der Guten Hoffnung – seit mehr als 77000 Jahren. Aus dieser Zeit stammen auch die ältesten bekannten Schmuckstücke der Menschheit: Ebenfalls in der Blombo-Höhle entdeckten Archäologen Dutzende säuberlich durchbohrte Muschelgehäuse, die einmal zu einer Kette aufgefädelt gewesen sein müssen.[9] Damit reicht die Geschichte, die diese Funde erzählen, fast so weit zurück wie die unserer Art selbst. Die ersten Menschen, die aussahen wie wir, betraten vor gut 100000 Jahren die Bühne der Welt.
Doch erst im Europa der Altsteinzeit kam es zu dem, was Jean Glottes die »Explosion« der menschlichen Kreativität nennt: Der Mensch schuf erste Abbilder der Realität. Von diesem großen Sprung kündet die Höhle, auf die der Archäologe Jean-Marie Chauvet wenige Tage vor Weihnachten 1994 bei einem Streifzug durch die Karstlandschaft des Ardèche-Tals stieß.
Ein sonderbar kalter Luftzug, den er plötzlich verspürte, ließ den Höhlenforscher aus Leidenschaft in einer 160 Meter steil aufragenden Felswand nach einem Eingang suchen. Ein Tunnel führte ihn und zwei Begleiter in eine Unterwelt aus Gängen und Hallen von den Abmessungen eines Doms. Dort fanden sie Kolossalgemälde vor, die nunmehr zu den bedeutendsten Entdeckungen des 20. Jahrhunderts zählen. Ganze Herden von Rentieren, Wisenten, Auerochsen und Raubkatzen sprangen den Forschern, wie Chauvet sagt, »regelrecht von den Wänden entgegen«.
Bären, verschiedene Raubkatzen, ein Uhu – 300 Tierbilder, immer wieder von Handabdrücken und geometrischen Gravierungen unterbrochen, hatten prähistorische Künstler auf dem Fels hinterlassen. Anmut und Perfektion dieser Werke aus Pflanzenrot und Kohlenruß sind betörend. Löwenmuskeln sind mit Licht und Schatten gezeichnet, Rhinozerosse scheinen an den Wänden miteinander zu kämpfen, ihre Hörner zornig ineinander verhakt. Pferdeherden galoppieren in perspektivischer Sicht am Betrachter vorbei, dem Ausgang entgegen.[10]
Noch überraschender als die Schönheit der Felsmalereien ist ihr Alter. Anhand der Radioaktivität winziger Kohlekrümel, die Chauvet aus den Zeichnungen zweier Nashörner und eines Bisons gekratzt hatte, konnten Physiker die Bildwunder auf 30340, 30940 und 32410 Jahre datieren. Damit sind diese Werke doppelt so alt wie die berühmten Höhlenzeichnungen von Lascaux in Südwestfrankreich und Altamira in Spanien; sie entstanden schon kurz nachdem der Homo sapiens dem Neandertaler in Europa seinen Platz streitig gemacht hatte. So ist die Chauvet-Höhle die bei weitem älteste unter allen derartigen Grotten und erstaunlicherweise auch die malerisch ausgereifteste.
Um herauszufinden, mit welcher Technik die ersten modernen Menschen diese Werke hergestellt haben konnten, ist Lorblanchet, der derzeit auch die Monsterhöhle von Pergouset erforscht, selbst in die Rolle eines Steinzeitkünstlers geschlüpft. Den Mund voll zerkauter Holzkohle, spuckt er immer wieder schwarzen Speichel an eine Felswand. Als würde er ein Schattenspiel darbieten, hält er Hände und Finger zu Schablonen geformt. So entsteht, in vielen Tagen Arbeit, das Bild eines Pferdes, das jenen in der Chauvet-Höhle täuschend ähnelt. Daneben sprüht der Forscher, ebenfalls mit Spucke, die seltsamen negativen Handabdrücke auf den Fels, wie sie in fast allen urzeitlichen Bilderhöhlen auftauchen, vielleicht als eine Art Signatur des Künstlers.
Die Sprühmethode hat er bei Stammesvölkern gelernt, die so noch heute Felsen in Nordaustralien verzieren. Und tatsächlich entdeckten Chemiker Spuren derselben Eichen-Holzkohle, die sie im Farbauftrag der europäischen Steinzeitgemälde nachgewiesen hatten, auf Menschenzähnen, welche sich in prähistorischen Gräbern nahe der Höhle von Lascaux fanden.
Was aber mag sich in den Bilderhöhlen abgespielt haben? Als fast sicher gilt, dass sie keine Wohnstätten waren, denn es wurden keinerlei Abfälle darin gefunden. So kommen diese geisterhaften Orte nur als Stätten urzeitlicher Magie infrage. Die Zeichnungen, die Malereien und die Installationen dienten wahrscheinlich dem Kult.
Aus vorzeitlichen Fußabdrücken und Analysen der Wandbilder glauben Clottes und Lorblanchet auf zwei Typen von Anbetungshöhlen schließen zu können: Stätten schamanischer Geheimkulte und Tempelgrotten für jedermann.
Wie Kirchenfresken zieren die riesigen, naturalistischen Tiermalereien die Kuppelräume der Höhlen von Chauvet und Lascaux. Nach einer ausgeklügelten Dramaturgie angeordnet, war ihre Funktion offensichtlich vor allem, einen würdigen Hintergrund zu schaffen für Zeremonien im Erdinneren, zu denen große Menschenscharen erschienen – die vielen Fußabdrücke zeigen es.
Ramponierte Stalagmiten lassen vermuten, dass Steinzeit-Vandalen mit den abgebrochenen Trümmern auch ihren Lieben daheim ein Stück Höhlenweihe vermitteln wollten, durch ein heiliges Mitbringsel aus der Tiefe. Fährten von jugendlichen Füßen deuten darauf hin, dass in manchen Höhlen Initiationsriten vonstatten gegangen sein müssen. Und das Skelett einer Viper, die dort natürlicherweise niemals gelebt haben könnte, lässt vermuten, dass Steinzeitmenschen Tiere für ihre Riten benutzten.
Dass die Künstler in den Bildern der Höhlen eine Interpretation der damaligen Welt angelegt haben, dass sich in diesen vielleicht sogar eine Mythologie spiegelt – und keineswegs nur ein Jagdzauber, wie lange gedacht –, ist seit Chauvets Entdeckung überaus wahrscheinlich. Denn anders als in den zuvor bekannten Höhlen beherrschen dort Löwen, Nashörner und Bären die Fresken: Tiere, welche die Steinzeitmenschen wohl kaum je erlegten.
Abgelegene Höhlen wie die von Pergouset, für größere Versammlungen viel zu eng, führen noch deutlicher vor Augen, dass die Kunst der frühen Menschen von Beginn auch auf Jenseitiges zielte. Weil sie nicht für Menschenmengen gedacht, mussten die Bilder dieser Geheimhöhle auch nicht aus der Ferne wirken.
Nur im Streiflicht werden die Strichmonster sichtbar, weil sie nur aus Linien im Untergrund bestehen. Doch sie sind nicht deswegen so wirklichkeitsfern gezeichnet, weil die Menschen damals es nicht anders beherrschten. Zwanzig Jahrtausende zuvor waren schließlich nur unweit von hier die Malereien der Chauvet-Höhle in all ihrem Naturalismus entstanden – die scheinbar so wirren Gravuren von Pergouset können also keine primitiven Vorformen späterer Kunst sein. Vielmehr zeigen sie erste abstrakte Darstellungen von der Natur. Und wer sie genau studiert, erkennt, wie wohl überlegt die Abfolge der Bilder ist.
Siebzig Meter hinter dem Eingang des lang gestreckten Schachts beginnt die Galerie aus der Eiszeit zunächst ziemlich realistisch: Spuckende Hirschkühe zieren die vorderen Gewölbe. Mit knappen Strichen sind Wisente und Steinböcke gezeichnet, deren Nüstern gebläht sind und denen die Mäuler offen stehen.
Die Monster erscheinen erst tiefer in der Grotte, und beim weiteren Eindringen werden sie immer bizarrer: Pferde mit Giraffenhälsen; Zebras mit Kuhhufen; Köpfe, die an Dinosaurier erinnern. In den hinteren Räumen schließlich lösen sich die Formen zunehmend auf. Vielfach bedeckt nur noch ein Liniengewirr die Felswände, gleichsam ein Brodeln in der Tiefe. Hier finden sich die Vogelmenschen und eine weitere riesige Vulva, gezeichnet um eine natürliche Felsöffnung herum – vielleicht verstanden die Urheber die Erde selbst als weiblich, die Tiere als Wesen, die aus der Höhlentiefe ans Licht geboren werden.
Eine ganze Geschichte, einen gewaltigen Comic, präsentiert diese Höhle. In all ihrer Rätselhaftigkeit zeugt sie davon, wie bereits die Frühmenschen darum rangen, einen Sinn in der Schöpfung zu finden. Bewegte schon die Jäger der Altsteinzeit die Frage, wer sie sind und woher sie einst kamen?
Kosmos
Auf der Suche nach der vierten Dimension
Die Sonne senkte sich über den Barrikaden. Der König war gestürzt, der Pulverdampf verflogen. Da richteten die Aufständischen ihre Vorderlader auf ein neues Ziel – sie beschossen die Turmuhren.
Ein blindwütiger Eifer hatte an diesem ersten Abend der französischen Julirevolution im Jahr 1830 die Rebellen erfaßt: Gleichzeitig, aber ohne voneinander zu wissen, wie es der Essayist Walter Benjamin beschrieb, waren mehrere Gruppen in den Pariser Kleinbürgervierteln erneut ausgezogen. Diesmal galt ihr Angriff einem unsichtbaren und allmächtigen Feind.
Die Rebellen hatten ein Lied auf den Lippen. Sie sangen von »Schüssen auf die Zahnräder, um den Tag anzuhalten«: Nichts Geringeres als das »Kontinuum der Geschichte«, schrieb Benjamin, wollten die Revolutionäre sprengen, alle Last der Vergangenheit abstreifen.[11] Das alte Regime hatten sie schon hinweggefegt, nun sollte auch die letzte Tyrannei fallen – die Herrschaft der Zeit.
Knapp zwei Jahrhunderte später steht dieser Traum wieder auf der Tagesordnung. Die Wissenschaft hat sich seiner angenommen. Um die Jahrtausendwende beschäftigen sich Forscher aller Disziplinen mit dem Phänomen »Zeit«. Sie führen erstaunliche Experimente durch, von denen viele simpel sind. Aber seit Jahrzehnten war niemand auf die Idee gekommen, sie auszuführen. Wozu auch hätte man das Unvorstellbare versuchen sollen?
Erst mussten ein paar deutsche Physiker mit Rohrstücken Furore machen, die aussehen, als hätte ein Klempner sie im Labor vergessen. Durch diese Stutzen wollen die Forscher, gestandene Professoren, Signale in Überlichtgeschwindigkeit gefunkt und damit die Relativitätstheorie überlistet haben.
In seiner großen Lehre von der Allmacht der Lichtgeschwindigkeit über den Kosmos hatte Albert Einstein solches Treiben mit gutem Grund für unmöglich erklärt: Wer es fertig brächte, mit überlichtschnellen Strahlen in die Welt zu leuchten, der könnte theoretisch die Zukunft erblicken.
Dennoch, ohne letzten Endes zu verstehen, was sie tun, vermessen die Physiker plötzlich Erscheinungen, die alle Züge des Paranormalen tragen: Laserlicht, das sich überlichtschnell ausbreitet; Partikel, für welche die Zeit während des Betrachtens gleichsam einfriert.
An die Stelle der alten Gewissheiten sind Fragen getreten: Sind die Schranken der Zeit überwindbar? Ist die Relativitätstheorie, wie der Astrophysiker Joseph Silk behauptet, nur noch ein »wunderschönes Fossil«? Sind gar manche Sciencefictionfantasien weniger abwegig als gedacht – könnten Zeitreisen dereinst so alltäglich werden wie das Fahren mit der U-Bahn?
Der amerikanische Astrophysiker Carl Sagan sah kurz vor seinem Tod im Jahr 1996 die Wissenschaft »an einem dieser seltenen klassischen Wendepunkte« angelangt, an denen sich die herrschenden Vorstellungen über die tiefsten Mysterien grundlegend wandeln.[12]
Tatsächlich haben die Forscher inzwischen in einem Maße Einsichten über die Zeit gewonnen, wie man es bei einem vermeintlich so esoterischen Gegenstand für unerreichbar gehalten hat. Dabei sind die neuen Erkenntnisse eher Abfallprodukte anderer Disziplinen. Sie entspringen dem beispiellosen Forscherdrang, der seit Beginn des letzten Jahrzehnts der Ergründung von zwei der großen Geheimnisse der Wissenschaft gilt: des Kosmos und des menschlichen Gehirns.
Wie Tunnelbauer auf beiden Seiten eines Bergmassivs nähern sich zwei Forschergemeinden dem Phänomen »Zeit« von entgegengesetzten Ausgangspunkten. Die einen, die Astrophysiker, fangen mit Röntgensatelliten die Signale von Pulsaren auf, von Sternen, die genauer ticken als fast alle irdischen Uhren. Sie vermessen Runzeln in der kosmischen Strahlung und glauben, aus solchen winzigen Unebenheiten des Weltenlaufs die Geschichte der ersten drei Minuten des Universums lesen zu können.
Die anderen, die Biologen, untersuchen den komplexen Vorgang der Zeitwahrnehmung im menschlichen Gehirn. In den USA wurde ein »Clock Genome Project« begonnen: Forscher haben genetisch programmierte Uhren entdeckt, natürliche Chronometer, die jedem Wesen und sogar jeder einzelnen Zelle den Lebenstakt schlagen. Neurobiologen erkennen aus Nervenströmen, die sie Patienten bei Gehirnoperationen ableiten, wie ein kompliziertes Geflecht von Zeitgebern im Kopf das Erleben, das Denken und das Fühlen bestimmt.
»Die Zeit ist die Hintertür zum menschlichen Geist«, behauptet der australische Astrophysiker Paul Davies;[13] die Ergebnisse der Hirnforscher zeigen, dass er mit seiner Einschätzung so falsch nicht liegt – das Kapitel »Abschied vom Ich« berichtet davon.
Damit treffen sich die Erkunder von toter und belebter Materie bei einem neuen Verständnis des Phänomens »Zeit«, das der gewohnten Auffassung zuwiderläuft: Die Wissenschaft hat Abschied genommen vom jahrtausendealten Bild eines Zeitstroms, der ebenmäßig und womöglich gottgegeben dahinzieht. Durch die neuesten Forschungsergebnisse entpuppt sich die Zeit als ein Wesen von dieser Welt. Sie wird erkennbar als Folge und nicht als Urgrund allen Weltgeschehens. Sie erinnert an einen Wildbach, der manchmal wild aufschäumt und manchmal stillsteht. Und sie scheint formbar wie Knetmasse.
Solche Bilder drängen sich auf, wenn die Forscher nun über Rätsel debattieren, welche die Naturwissenschaft längst als hoffnungslos unlösbar beiseite gelegt hatte: Gab es je einen Anbeginn der Zeit? Könnte ihr Fluss dereinst versiegen? Wie wirkt der Zeitstrom auf das Bewusstsein? Und: Was eigentlich ist Gegenwart?
Es sind Fragen, über welche die Menschheit sinniert, spätestens seit in der Steinzeit die ersten Experimente mit dem Schattenlauf der Sonne gemacht wurden. Denn wie kaum ein anderes Phänomen bringt der ständig erfahrbare Zeitlauf den menschlichen Geist an die Grenzen seines Fassungsvermögens. Ratlos bekannte Augustinus von Hippo, einer der größten Denker der Kirchengeschichte, er sehe sich außerstande zu erklären, was das Wesen der Zeit sei: Wenn ihn niemand frage, wisse er es wohl. Doch wenn ihn jemand frage, könne er es nicht sagen.
Allenfalls scheint es möglich, in Verneinungen und Paradoxien über die Zeit zu sprechen: Sie ist ohne Körper und Form, aber unüberwindlich; messbar, aber mit menschlichen Organen nicht spürbar; allem Anschein nach ewig, aber unumkehrbar.
Nur wenige vermochten ihr Erschauern über den Sog der Geschichte so blumig und zugleich schlicht auf den Punkt zu bringen wie der unterkühlte Mister Spock im Raumepos ›Star Trek‹: »Zeit ist das Feuer, in dem wir brennen.«
Vieles lässt sich wegdenken, die Zeit nicht. Eine Ohnmacht versetzt den Menschen in einen Zustand ohne Bewusstsein. Über das Leben ohne Körper spekulieren immerhin religiöse Seelenlehren. Eine Existenz außerhalb der Zeit aber scheint außerhalb allen Vorstellungsvermögens. So gilt das Sein jenseits der Zeit in den Weltreligionen als Attribut des Unergründbaren, Göttlichen. Die indische Bhagavadgita setzt Gott und die Zeit sogar gleich – das heilige Buch aus dem ersten Jahrhundert nach Christus lässt den Erhabenen erklären: »Ich bin die Zeit.«
Unter dem Einfluss der Naturwissenschaften beginnt sich der Nebel um dieses Mysterium nun zu lichten. Denn indem die Biologen in Genen und Gehirnen nach inneren Uhrwerken fahnden, entzaubern sie auch die Zeit. Für sie ist das Zeitgefühl nur das bewusste Korrelat von chemischen Gleichgewichten in den Nervenzellen. Und was berechtigt eigentlich zu glauben, der scheinbar allgegenwärtige Zeitfluss sei mehr als nur ein Schattenspiel der Neuronen, das dem Menschen von Taktgebern im Kopf vorgegaukelt wird?
Solche Fragen muss sich stellen, wer den belgischen Physikochemiker Ilya Prigogine ernst nimmt. Jedes Wesen, behauptet der Nobelpreisträger, lebe nach einer »Eigenzeit«, es folge einem inneren Rhythmus, den es in sich erzeugt. Kein ferner Gott, sondern ein jeder Erdenwurm sei Schöpfer der Zeit. Als Prigogine vor einigen Jahren mit seinen Thesen, damals noch kaum durch experimentelle Befunde untermauert, die Biologen provozierte, hatten sich die Physiker schon verabschiedet von einem anderen beliebten Konstrukt der Religionen: der Ewigkeit.
Diese ist im Standardmodell von Teilchen und Kosmos, der inzwischen gängigen Vorstellung von der Weltentstehung, die im Kapitel »Die Welt aus dem Nichts« beschrieben wird, nicht mehr vorgesehen: Wie alle Materie und alle Naturgesetze, so müsse auch die Zeit einstmals entstanden sein, behaupten die Kosmologen. Sie berufen sich auf Daten, die Röntgensatelliten zur Erde gefunkt haben, und auf Messwerte, die in riesigen Teilchenbeschleunigern gewonnen wurden. Mit solchen Methoden bestätigen die Forscher auf erstaunliche Weise, worüber Augustinus schon im vierten Jahrhundert spekuliert hatte. Gott, so glaubte der Kirchenheilige, habe nicht die Welt in die Zeit gesetzt, er habe vielmehr Zeit und Welt zusammen erschaffen.
In dieser engen Geschwisterschaft von Zeit und Materie erblicken manche Kosmologen eine fantastische Möglichkeit: den Strom der Zeit zu überholen oder in ihm rückwärts zu reisen. Für durchaus denkbar halten es namhafte Astrophysiker, dass sich kosmische Pfade finden ließen, auf denen künftige Generationen in ihre Vergangenheit und in die Zukunft wandeln werden.
Zwar geben die ernst zu nehmenden Verkünder solcher Visionen zu, noch habe niemand die angeblichen Überhol- und Rückwärtsspuren im Universum gesehen und deren technische Erzeugung stehe im Moment nicht in Aussicht.
Dennoch sind solche Denkmodelle dazu angetan, alle Illusionen von der Unveränderlichkeit der Zeit zu erschüttern, die vordem heiligster Glaubenssatz der Wissenschaft waren. »Die Physiker«, kommentierte das Wissenschaftsmagazin ›New Scientist‹[14], »beginnen sich daran zu gewöhnen, dass es Zeitmaschinen doch geben könnte.«
Keine technische Utopie hat die Fantasie der Sciencefictionautoren derart beflügelt wie diese Maschine, ein Gerät, das H.G. Wells im Jahr 1895 in die Literatur einführte. In dem berühmten Roman des Engländers unternimmt ein namenloser Tourist einen Ausflug in das Jahr 802701, berichtet nach seiner Rückkehr seinen alten Freunden von kommenden Zeiten – und bleibt bei einer zweiten Reise in ferne Epochen auf immer verschollen.
Das Filmepos ›2001 – Odyssee ins Weltall‹ verlegt die Zeitreise dagegen ins Innere einer Person: Der Held Bowman trifft bei seiner Weltraumodyssee auf einen schwarzen Monolithen, der ihn erst zum Greisen altern lässt, dann aber in seine eigene Vergangenheit zurückversetzt, bis er schließlich seine Geburt noch einmal erlebt.
Mit solchen Erzählungen aus der Zukunft wurde nur eine Vorstellung wieder aufgenommen, die in alten Kulturen überall auf der Welt lebendig war. In ihrem Drang, dem »Terror der Geschichte«, wie der rumänische Anthropologe Mircea Eliade es formulierte, zu entfliehen, haben sich die Menschen schon früh ein Ideenreich geschaffen, welches die Allmacht der Zeit wenigstens in der Fantasie aufhebt.[15] So entstanden die Mythen der ewigen Wiederkehr – und mit ihnen Vorstellungen, denen etwa die Hindus noch heute anhängen: die Wiedergeburt des Individuums in immer neuen Körpern.
Erst die Ägypter kamen auf die Idee, die Vergangenheit könne auf immer verloren sein. Die Zeit wird von einer Schlange geboren; gefräßige Stundengöttinnen, zwölf an der Zahl, verschlingen sie.
Doch mehr noch als die Mythologie hat eine Erfindung aus dem Alten Ägypten das westliche Zeiterleben geprägt – die Uhr. Die Grabinschrift eines im 15. Jahrhundert vor Christus verstorbenen Gerichtsdieners namens Amenemhet beschreibt ein Wasserchronometer, das dieser Mann ersonnen haben soll: Durch eine senkrechte Reihe von kleinen Löchern fließt Wasser aus einem Toneimer. Bei Sonnenuntergang wird das Gefäß gefüllt; am Sinken des Pegels lässt sich die Tageszeit ablesen.
Die Scherben eines solchen Geräts aus dem 14. Jahrhundert vor Christus fanden Archäologen im Tempel des Pharaos Amun-Re. Elf Jahrhunderte später hatte das antike Uhrmacherhandwerk schon große Fortschritte gemacht: Ctesibius, ein Tüftler in Alexandria, ersann ein Chronometer, in welchem der Wasserfluss allerlei Glocken, bewegliche Puppen und singende Tonvögel antrieb – gleichsam die erste Kuckucksuhr der Menschheit.
Aber erst mechanische Uhren, die im 12. Jahrhundert nach Christus in europäischen Klöstern entwickelt wurden, verhalfen der Zeitmessung zum Durchbruch. Etwa 150 Jahre danach begann Papst Johannes XXII. zu ahnen, in welchem Maße der Takt der Chronometer das Leben der Menschen verändern würde. Er sprach den Bann aus über alle, die sich »mit der Ermittlung von Zeiteinheiten« beschäftigten.[16]
Johannes hatte erkannt, dass Herrschaft über die Zeit Herrschaft über Menschen bedeutet – eine Einsicht, die Revolutionäre aller Couleur fortan auszunutzen versuchten. In der Französischen Revolution hofften die Jakobiner, ihr Kalender mit einer Zehntagewoche würde den Beginn einer neuen Zeit markieren und das Christentum endgültig aus den Köpfen des Volkes verbannen. Und als die Bolschewiken im Oktober 1917 im heutigen Sankt Petersburg die Macht übernahmen, schafften sie alsbald die julianische Zeitrechnung des Zarenreichs ab und installierten den gregorianischen Kalender.
Der beginnende Welthandel in der Epoche des Kolonialismus hatte erstmals minutengenaue Zeitmessung erfordert. Denn Jahrhundertdenker von Galileo bis Newton waren daran gescheitert, die geographische Position eines Schiffs auf dem Ozean durch astronomische Navigation in den Sternen zu finden. Nachdem in einer nebligen Oktobernacht zahlreiche englische Schiffe durch Navigationsfehler auf Felsen vor der Südwestspitze Englands aufgelaufen waren und mehr als zweitausend Seeleute den Tod gefunden hatten, entschloß sich das Londoner Parlament zu einem außergewöhnlichen Schritt. Am 8. Juli 1714 beschied die Regierung der Königin Anna, dass die Abgeordneten eine Prämie von 20000 Pfund für denjenigen ausgelobt haben, der noch nach sechswöchiger Schiffsreise die geographische Länge auf mindestens 30 Meilen genau bestimmen könne.[17],[18] Es war eines der bedeutendsten wissenschaftlichen Probleme seiner Zeit.
Den Preis, nach heutigem Wert mehrere Millionen Mark, erhielt ein Mann, der die Aufgabe mit einem Chronometer löste. John Harrisson aus Yorkshire war dieser geniale Mechaniker; H-1 nannte er seine Uhr, die für damalige Verhältnisse unvorstellbar genau ging: Auf der Schiffsreise zur Erprobung dieses Werks von London nach Lissabon zeigte H-1 eine Abweichung von nicht mehr als ein paar Sekunden pro Tag.
Mit dieser Errungenschaft konnte jeder Navigator fortan leicht seinen Standort bestimmen, indem er den Sonnenstand mit der Uhrzeit verglich, die das Chronometer anzeigte – in dieser Methode kündigte sich zum ersten Mal Einsteins Erkenntnis an, dass Zeit, Raum und Kosmos aufs Engste miteinander verknüpft sind.
Die nachhaltigste Umwälzung der Neuzeit, die industrielle Revolution, wäre ohne einen weiteren technischen Durchbruch bei der Zeitmessung undenkbar gewesen: Nicht Dampfmaschinen, sondern Uhren in der Tasche jedes Arbeiters waren »die Schlüsselmaschinen für das Industriezeitalter«, schreibt der amerikanische Sozialforscher Lewis Mumford. Erst sie erlaubten es, die Menschenscharen in den immer größeren Fabriken zu koordinieren; ohne die Uhr am Fabriktor hätten die Fließbänder nie funktioniert.
So waren, als 1910 die ersten Bänder in den Schlachthöfen von Chicago anliefen, die Menschen bereits an jenen Minutentakt gewöhnt, nach dem die industrialisierte Erde tickt. Denn Eisenbahn, Seefahrt und Telegraf hatten bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine immer genauere Feinabstimmung der Zeit erfordert, schon fünf Jahre nach der Jahrhundertwende hatten Küstenfunkstellen die ersten Zeitzeichen in den Äther gesandt.
Und während Satellitenhandys, Hochgeschwindigkeitszüge und Computernetze inzwischen den Glauben nähren, der Planet sei zu einem globalen Dorf zusammengeschmolzen, scheint die ständige Beschleunigung des Lebens die Gewichte der Weltkoordinaten zu verschieben: Die Zeit entmachtet den Raum. In einer Welt, die vernetzt ist und sich immer rasanter verändert, kommt es nicht mehr so sehr darauf an, ob etwas in Düsseldorf, New York oder Osaka geschieht – per Internet und Fernsehen erfahren ohnehin sekundenschnell alle davon. Nicht mehr der Schauplatz, argumentiert der Philosoph Paul Virilio, bestimme über Wohl und Wehe eines Vorhabens.[19]