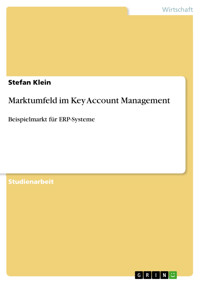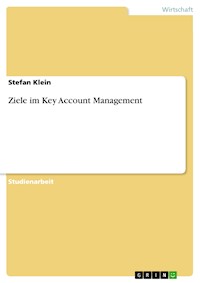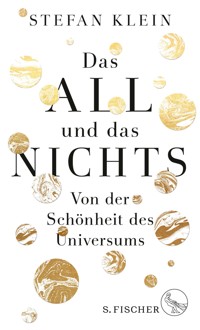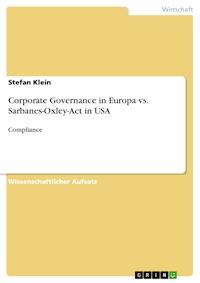8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Bestsellerautor Stefan Klein über das Geheimnis der gefühlten Zeit Erfüllte Augenblicke der Liebe und des Glücks – warum nur erscheinen sie uns immer so kurz und flüchtig? Und warum will die Zeit, wenn wir ungeduldig warten, so gar nicht vergehen? Wie können wir in unserem hektischen Alltag bewusster mit unserer Zeit umgehen? Stefan Klein, Autor der Bestseller ›Die Glücksformel‹ und ›Alles Zufall‹, lehrt uns, unsere Zeit bewusster und besser zu nutzen: Denn nur wenige Leistungen des Gehirns lassen sich so leicht und so schnell verändern wie unser Zeitsinn. Der Film unseres Lebens entsteht im Kopf. Und wir sind seine Regisseure.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Dr. Stefan Klein
Zeit
Der Stoff, aus dem das Leben ist. Eine Gebrauchsanleitung
Über dieses Buch
Erfüllte Augenblicke der Liebe und des Glücks – warum nur erscheinen sie uns immer so kurz und flüchtig? Und warum will die Zeit, wenn wir ungeduldig warten, so gar nicht vergehen? Wie können wir in unserem hektischen Alltag bewusster mit unserer Zeit umgehen?
Stefan Klein, Autor der Bestseller ›Die Glücksformel‹ und ›Alles Zufall‹, lehrt uns, unsere Zeit bewusster und besser zu nutzen: Denn nur wenige Leistungen des Gehirns lassen sich so leicht und so schnell verändern wie unser Zeitsinn. Der Film unseres Lebens entsteht im Kopf. Und wir sind seine Regisseure.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Einleitung
Teil 1 Zeit erleben
1 25 Stunden
Eine verborgene Uhr
Wie lange dauert eine Stunde?
Die Not mit der Zeit
2 Eulen und Lerchen
Selbst Blumen kennen die Zeit
Das Ticken von Millionen Uhren
Die Sonne stellt die innere Uhr
Warum es Morgenmenschen und Abendmenschen gibt
Wann Sex am besten ist
Warum Teenager Nachtvögel sind
Tristesse im Dämmerlicht
Lieber reich und müde als gesund und wach
Zeit für eine Zeit nach Maß
PS.
PPS.
3 Ein Sinn für Sekunden
Im Bann des Bolero
Taktgeber im Gehirn
Zeit ist Bewegung
Verzerrte Minuten
Ein Orchester unter der Schädeldecke
Die Kunst, ein Gulasch zu kochen
Wenn die Welt zu rasen beginnt
Zeit der Dörfler, Zeit der Städter
4 Die längste Stunde
Zwei Minuten auf dem heißen Ofen
Der Rhythmus des Atems
Warum Morde ewig dauern
Missachtete Minuten rasen
Die guten Momente verlängern
PS.
5 Atome der Zeit
Die Zeit im schwarzen Loch
Der Flügelschlag der Mücke
Das Jetzt ist eine Illusion
Das Bewusstsein ist hoffnungslos verspätet
Flugzeuge, die Gedanken lesen
Der längste Augenblick
6 »Twinkies, Granola«
Mit dem Kopf in den Wolken
Stiller Small-Talk
Der Autopilot des Bewusstseins
Drei Minuten Ewigkeit
PS.
7 Geronnene Zeit
Leben ohne Vergangenheit und Zukunft
Mehrerlei Gedächtnis
Wie Gegenwart Erinnerung wird – und umgekehrt
Erinnerung verwandelt uns
Die eigene Geschichte
Keine Uhr, kein Kalender
Die Retusche des Erlebten
Ein Gebäude aus Splittern und Scherben
8 Sieben Jahre wie ein Augenblick
Warum der Rückweg immer kürzer ist
Zeitvernichtungsmaschinen
Eine Stunde ist nicht nur eine Stunde
Die Schwelle des Augenblicks überschreiten
Der Teddybären-Test
Pioniere auf einem leeren Kontinent
Umbau im Kopf
Knappe Zeit
Wie im Rennwagen auf der Zielgeraden
Wie man die Zeit im Alter aufhält
Wo die Jahre nicht zählen
Teil 2 Zeit nutzen
9 Droge Geschwindigkeit
Die drei Zeiträuber
Eine Geißel in der Hosentasche
Drill zur Pünktlichkeit
Schneller!
Das große Rennen
Die Sucht nach Stimulation
Das Leben als Schlacht
Warum wir nicht mehr zuhören können
PS.
10 Des Lebens Überfülle
Der Manager unserer Absichten
Ein Gott mit sechs Händen
Die Trägheit des Verstandes
Die Taube auf dem Dach
Sushimeister und Zappelphilipp
Skat gegen Zerstreutheit
PS.
11 Die Uhr der anderen
Was Stress ist
Mythos Eilkrankheit
Wenn wir den Kopf verlieren
Kontrolle beruhigt
Warum Manager keine Magengeschwüre kriegen
Verfolgt von einer Bade-Ente
Zeitnot ist Ansichtssache
PS.
12 Herren unserer Zeit
Wie wir Last und Lust verwechseln
Warum man immer erst auf den letzten Drücker fertig wird
Die Vorfreude im Bauch
Reiche außer Atem
Der Hunger nach Mehr
PS.
Teil 3 Was Zeit ist
13 Die Entmachtung der Uhren
Eine Seefahrt nach Jamaika
Die Weltuhr
Braucht man eine kosmische Zeit?
Thelma, Louise und die Rakete
Warum bewegte Uhren langsamer gehen
Wer nach Osten reist, lebt länger
Die Kurzweil auf den Dächern
Die Ordnung von Früher und Später
Die Teetasse und der Urknall
An den Grenzen der Physik
Die Überwindung der Zeit
Epilog: Eine neue Kultur der Zeit
Kann man Zeit haben?
Eine neue Kultur der Zeit
Erster Schritt: Souveränität über die Zeit
Zweiter Schritt: Im Einklang mit der Körperuhr leben
Dritter Schritt: Die Muße kultivieren
Vierter Schritt: Die Augenblicke erleben
Fünfter Schritt: Konzentration lernen
Sechster Schritt: Seinen Vorlieben folgen
Take it easy
Bildrechte
Literaturverzeichnis
Danksagung
Sach- und Namenregister
Für Alexandra
Einleitung
Die Entdeckung der inneren Zeit
Es gibt Augenblicke, da scheinen die Gesetze der Zeit ihre Gültigkeit zu verlieren. Dies sind die Momente, die man magisch nennt: Auf dem Gipfel eines Berges oder angesichts der Ozeanbrandung, im Schaffensrausch oder während der Liebe verlieren Pläne, Sorgen, Erinnerung ihre Bedeutung. Die Zeit steht still; der Augenblick umfasst alles, was je war und sein wird. Manche Menschen berichten von der Empfindung, dass sich dabei sogar die Grenzen ihrer Körper auflösten; sie begannen, sich als Teil von etwas Größerem zu fühlen.
Manchmal reicht auch schon ein angeregter Abend mit alten Freunden oder eine Arbeit, in der man ganz aufgeht, und Stunden vergehen, als seien es Minuten. Die letzte U-Bahn ist verpasst, das Mittagessen lange überfällig, und niemand hat es bemerkt im Zauber des Hier und Jetzt.
Doch irgendwann kehrt unvermeidbar die Zeit ins Bewusstsein zurück; es ist ein Gefühl, als sei man aus einem rauschhaften Schlaf erwacht.
Und dann trifft der Blick eine Uhr. Selten ist der Bann, den dieses Instrument über uns ausübt, so schmerzhaft zu spüren. Der Dichter W.G. Sebald beschrieb die Macht der Uhren einmal als das »Vorrücken dieses, einem Richtschwert gleichenden Zeigers, wenn er das nächste Sechzigstel einer Stunde von der Zukunft abtrennt«. Im Sinn hatte Sebald dabei eine riesige Uhr, die über der Halle des Bahnhofs von Antwerpen genau im Schnittpunkt aller Blickachsen thront – dort, wo die Baumeister alter Kirchen einst das Auge Gottes angebracht haben. Alle Reisenden müssen ständig zu diesen Zeigern aufschauen. Umgekehrt ist von der Bühne des Ziffernblatts aus jeder Mensch in der Halle zu erkennen – und alles, was er tut.
Vor den Uhren kann sich niemand in der heutigen Gesellschaft verstecken. Sie sind überall. Das ganze Leben ist nach ihnen ausgerichtet. Wir jagen engen Terminen nach und denken mit Wehmut daran, was wir alles gern täten, wenn wir nur wüssten, wann. Mitunter fühlen wir uns wie in einen Strudel geraten und fürchten, fortgerissen zu werden. Doch der Lohn für die Eile bleibt aus: Ausgerechnet die hektischen Tage hinterlassen am wenigsten Erinnerungen – als wäre diese Zeit spurlos vorübergegangen und für immer verloren.
Wir haben uns an die Herrschaft der Uhren so sehr gewöhnt, dass sie ganz selbstverständlich erscheint. Wir sehen diese Instrumente geradezu als Stellvertreter einer höheren Macht. Nicht nur in der Bahnhofshalle von Antwerpen gehorchen die Reisenden zwei Zeigern hoch über ihren Köpfen. Mehr oder weniger bewusst glauben wir alle, dass der Takt einer geheimnisvollen kosmischen Uhr unser Leben bestimmt. Abzulesen ist dieser Takt am Sekundenzeiger am Handgelenk. Wenn wir die Gegenwart der Uhren einmal vergessen, zweifeln wir später oft insgeheim, ob dieses Erlebnis Traum oder Wirklichkeit war.
»Zeit ist der Stoff, aus dem das Leben besteht«, schrieb der amerikanische Erfinder und Staatsmann Benjamin Franklin. Doch ist die Zeit unseres Lebens wirklich identisch mit dem, was die Uhren anzeigen? Manche Stunden rasen dahin, andere scheinen sich beinahe unendlich zu dehnen. Der große Zeiger aber hat ungerührt wie immer seine Runde gemacht. Es scheint, als sei mit dem Lauf der Uhren eine andere, zweite Zeit verwoben: eine Zeit, die in uns selber entsteht.
Die innere Zeit gehorcht ihren eigenen, geheimnisvollen Gesetzen. Weshalb vergehen ausgerechnet die unangenehmen Situationen so langsam, Glücksmomente dagegen so rasch? Warum ist man gerade in den schönsten Stunden so oft geistesabwesend? Wieso verrinnt das Leben immer schneller, je älter man wird?
Nur eine Erfahrung mit der Zeit ist uns hinlänglich bekannt – dass sie fehlt. Das ist merkwürdig, denn gemessen in Stunden und Jahren sind wir reicher als Menschen es jemals waren. Keiner Generation waren so viel Freizeit und eine so lange Lebensspanne beschert. Dennoch gibt mehr als ein Drittel aller Deutschen an, oft unter Zeitknappheit zu leiden. Und von Umfrage zu Umfrage werden es mehr.
Erschreckend sind diese Zahlen vor dem Hintergrund neuer Ergebnisse aus der Neurobiologie: Das Gefühl, ständig unter Druck zu stehen, bedeutet Stress. Chronischer Stress kann das Gehirn dauerhaft in Mitleidenschaft ziehen; er schadet der Gesundheit und mindert die Lebenserwartung.
Besonders heimtückisch ist die unablässige Hetze, weil sich der Zeitdruck selber nährt. Schnell kommt ein Teufelskreis in Gang: Ist die Furcht, seiner Aufgaben nicht rechtzeitig Herr zu werden, einmal entstanden, lässt sie den Gestressten den Überblick verlieren und schafft sich so immer neue Anlässe. Zeitnot macht kurzsichtig für die Zukunft; man rennt den Ereignissen hinterher, statt sie zu gestalten.
Mit raffinierten Kalendern und Aufgabenlisten allein ist das Problem nicht zu lösen. Denn sie erfassen nur die äußere Zeit der Uhren. Doch das Empfinden der Hetze entsteht im Bewusstsein, und dieses orientiert sich an der inneren Zeit. Es gilt also, die Gesetze der inneren Zeit zu verstehen, um besser mit ihr umgehen zu können.
Besonders auffallend sind die Unterschiede zwischen innerer und äußerer Zeit, betrachtet man den persönlichen Tagesrhythmus: Allein der Takt der Armbanduhr kann nicht erklären, wie sich der Organismus durch den Tag steuert. Manche Menschen müssen sich jeden Morgen neu damit quälen, aus dem Bett und einigermaßen in Fahrt zu kommen; andere sprühen zur selben Stunde vor Energie. Uhrzeit, Sonnenlicht, auch die Kaffeeration sind für alle gleich. Also muss der Gegensatz in uns selbst liegen.
Und warum haben einige Zeitgenossen die Ruhe weg und bewältigen gut gelaunt Termin um Termin, während andere schon über ein oder zwei Verpflichtungen am Tag stöhnen? Berühmt ist das »Rentner-Syndrom«, die Klagen über Zeitmangel im Ruhestand, die sich ganz offensichtlich nur durch das innere, subjektive Zeitempfinden erklären lassen.
Ohnehin ist die äußere Zeit nur ein winziger Ausschnitt aus dem, was wir als Zeit unseres Lebens erfahren. Der Sekundenzeiger kennt einzig die Gegenwart. Vergangenheit und Zukunft erfasst er nicht. Menschen jedoch leben auch in ihrer Erinnerung – sie ist gewissermaßen im Gedächtnis geronnene Zeit. Nach welchen Gesetzmäßigkeiten wandelt sich erlebte Zeit in Erinnerung um? Wie kommt es, dass man im Geiste in die Vergangenheit zurückreisen kann? Und ist es wirklich möglich, dass ein Mensch in einem einzigen Moment der Lebensgefahr sein ganzes Leben an sich vorüberziehen sieht?
Dieses Buch handelt von den verborgenen Dimensionen der Zeit. Sein Thema sind all die Phänomene, die sich nicht ohne weiteres in Minuten und Stunden messen lassen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie das Erleben der Zeit zustande kommt – und wie wir lernen können, achtsamer mit ihr umzugehen.
Das Gefühl für die Zeit ist eine höchst ausgefeilte Tätigkeit des Geistes. Fast sämtliche Funktionen des Gehirns sind daran beteiligt. Körperempfinden und Sinneswahrnehmung; Erinnerung und das Vermögen, Zukunftspläne zu schmieden; Emotionen und Selbstbewusstsein: Sie alle wirken zusammen, und ist auch nur einer dieser Mechanismen gestört, verzerrt sich das Erleben der Zeit oder verschwindet ganz. Dem Entstehen des Zeitgefühls nachzugehen ist eine aufregende Reise durch das Bewusstsein: Wir erkennen dabei nicht nur unsere Natur, sondern auch unsere Kultur im Spiegel. Denn manche Regungen, dank derer wir das Strömen der Minuten und Stunden wahrnehmen, sind angeboren. Viele andere haben wir gelernt.
Wenn wir uns etwa ein Bild von der Zeit machen sollen, sehen wir in Europa die Vergangenheit hinter uns liegen; die Zukunft hingegen kommt von vorn auf uns zu. Doch ein Indianervolk in den Anden denkt genau umgekehrt. Fragt man die Aymara nach der Vergangenheit, deuten sie nach vorne, in Blickrichtung. Schließlich haben sie die Ereignisse der Vergangenheit schon einmal gesehen. Für das Kommende hingegen sind die Menschen blind, weswegen es die Aymara hinter ihrem Rücken vermuten. Diese Erklärungen bekam der amerikanische Kognitionspsychologe Rafael Núñez, als er das Denken dieser Menschen eingehend untersuchte.[1] Und nach ihren Überzeugungen leben die Aymara auch: Weil die Zukunft ihnen unsichtbar erscheint, lohnt es nicht, auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden. Wer sie nach dem Morgen fragt, erntet ein Achselzucken. Und auf einen Bus oder einen verspäteten Freund warten sie halbe Tage lang mit einem für uns unglaublichen Gleichmut.
Damit berührt die Erforschung der Zeit auch das Wechselspiel von Erziehung, Umwelt und Genen, das unsere Persönlichkeit formt. Wie wir über Zeit denken, hat Einfluss darauf, wie wir sie empfinden.
Die Natur bestimmt, wie das Gehirn funktioniert, doch das Wenigste in unserem Erleben der Zeit hat sie fest vorgegeben. Deshalb sind wir nicht nur frei darin zu entscheiden, wie wir unsere Stunden ausfüllen – wir können sogar wählen, wie wir den Rhythmus des Lebens wahrnehmen wollen.
Für die meisten Menschen fließt die Zeit irgendwo außerhalb von ihnen dahin. Sie hat nichts mit ihnen zu tun. Zeit ist einfach da (oder nicht), und sie müssen sich ihr anpassen.
Ich möchte zu einer anderen Sichtweise einladen: Was wir als Zeit erleben, ist nicht nur ein Phänomen der Außenwelt, sondern zugleich unseres Bewusstseins. Diese Empfindung entsteht, indem beide – Umgebung und Gehirn – zusammenspielen. Mit neuen Methoden der Wissenschaft lässt sich heute untersuchen, wie sich die Außenwelt mit unserem Innenleben verzahnt. Einsichten vor allem aus der Hirnforschung können unsere Wahrnehmung und unsere Gewohnheiten verändern.
Mit dieser Sichtweise knüpfe ich an meine früheren Bücher über das Glück und den Zufall an; für mich ist es eine natürliche Fortsetzung meiner Beschäftigung mit diesen Themen: In »Die Glücksformel« habe ich versucht darzulegen, dass Glücksempfinden weit weniger von den äußeren Umständen abhängt, als wir es normalerweise vermuten. Viel entscheidender ist, wie das Gehirn die Geschehnisse deutet. Und diese Gewohnheiten der Deutung können wir ändern. Da das Gehirn des Menschen höchst plastisch ist, was Neurobiologen erst vor vergleichsweise kurzer Zeit erkannt haben, verwandelt sich damit auch das Geflecht der grauen Zellen im Kopf. Mit den richtigen Übungen können wir unsere Glücksfähigkeit also steigern. Oder kurz: Glück kann man lernen. Für einen entspannten und bewussten Umgang mit der Lebenszeit gilt das nicht minder.
Mein letztes Buch »Alles Zufall« ist unter anderem ein Plädoyer dafür, sich auf das Unvorhergesehene einzulassen. Zufälle sind Chancen. Dass wir sie aber als solche erkennen, setzt voraus, mit offenen Augen die Gegenwart wahrzunehmen – ein Thema, das auch in diesem Buch eine große Rolle spielen wird.
An Zufällen spüren wir die Richtung der Zeit. Die Vergangenheit ist uns bekannt, die Zukunft liegt im Dunklen. Deshalb stoßen uns zwangsläufig Überraschungen zu. Das Erleben von Zeit und von Zufällen ist also gar nicht voneinander zu trennen. Mit Grund hat der Philosoph Johann Gottfried Herder einmal geschrieben: »Die zwei größten Tyrannen der Erde: der Zufall und die Zeit.«
Die neuen Einsichten der Wissenschaft zeigen den angeblichen Tyrannen Zufall allerdings in einem ganz anderen Licht: Ohne ihn könnte sich unser Verstand nicht entwickeln. Und auch die Zeit sollte uns eine Freundin sein. Gerade weil das Zeitempfinden eine so hoch entwickelte Leistung des Gehirns ist, haben wir großen Einfluss auf sie. Denn all das, was uns das Vorübergehen der Stunden spüren lässt, haben wir in noch größerem Maße gelernt als beispielsweise die Mechanismen des Glücksgefühls.
So will dieses Buch zeigen, wie sehr es von uns selbst abhängt, wie wir Zeit empfinden. Es gliedert sich in drei Teile, die das Zeitempfinden in immer größeren Zusammenhängen betrachten.
Der erste Teil handelt von der Entstehung der inneren Zeit. Er erkundet die Vorgänge, die im Gehirn für ein Zeitgefühl sorgen. Doch Sie werden nicht nur erfahren, wie wir Zeit erleben, sondern auch, was sich tun lässt, um dieses Erleben zu beeinflussen. Darum enden manche Kapitel mit einer kleinen Nachschrift, die Sie zu Experimenten einladen soll.
Wie reagieren wir auf den Zeittakt unserer Umgebung? Das ist Gegenstand des zweiten Teils. Sein Hintergrund ist das Leben in einer immer schnelleren Welt, doch wirft er auch praktische Fragen auf: Lohnt es sich, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun? Bedeutet knappe Zeit zwangsläufig Stress? Und wenn nein: Wie lässt sich auch unter engen Terminen die Ruhe bewahren?
Der dritte Teil schließlich widmet sich der kosmischen Dimension der Zeit. Indem wir Zeit erleben, spüren wir ganz unmittelbar, wie jeder Mensch in die Entwicklung des ganzen Kosmos eingebunden ist. Darin liegt vielleicht das größte Wunder des Zeitgefühls. Dieser Abschnitt des Buches untersucht, warum wir meinen, dass die Zeit fließt – und ob wirklich alles der Zeit unterworfen ist.
»Zeit ist das Element, in dem wir existieren«, schrieb die amerikanische Dichterin Joyce Carol Oates vor gut zwei Jahrzehnten. »Wir werden entweder von ihr dahin getragen oder ertrinken in ihr.«[2]
Diese Einsicht gewinnt fast täglich an Schärfe. Wie nie zuvor ist unsere Gesellschaft heute besessen von der Idee, jede einzelne Stunde zu nutzen. So beschleunigt sich der Takt des Lebens weiter und weiter, oft bis an die Grenzen unserer Belastbarkeit. Wir alle nehmen teil an einem riesigen Experiment im Umgang mit der Zeit.
Umso dringender gilt es zu erkennen, in welchem Maß die empfundene Zeit an unserer Persönlichkeit hängt. Ob wir uns ruhig oder gehetzt fühlen, ob wir auf erfüllte Jahre zurückblicken oder auf Leere, ist eben nur zum kleineren Teil Folge der Umstände, unter denen wir leben. Der Film unseres Lebens entsteht im Kopf.
Und wir sind seine Regisseure. Denn nur wenige Leistungen des Gehirns lassen sich so leicht und so schnell verändern wie der so genannte Zeitsinn. Von der Natur ist dem Verstand nur fest einprogrammiert, dass wir das Vergehen der Minuten und Stunden empfinden. Doch wie wir es tun, bestimmen wir selbst. Indem wir die eigene Wahrnehmung und Aufmerksamkeit schulen, wandelt sich auch das Empfinden der Zeit. Wir können die Angst hinter uns lassen, im Strudel der Zeit zu ertrinken. Es steht uns frei, das Schwimmen zu lernen – und uns vom Strom der Zeit tragen zu lassen.
Fußnoten
[1]
Núñez und Sweetser 2001
[2]
Oates 1986
Teil 1Zeit erleben
125 Stunden
Was geschieht, wenn nichts geschieht
Wer es noch nie erlebt hat, wird nicht glauben können, wie leicht unser vertrautes Zeitgefühl aus den Fugen zu bringen ist. Mir selbst ist dies in einer Höhle widerfahren, die ich im Frühjahr 1996 auf Einladung rumänischer Wissenschaftler besuchte. In der Erde vergraben und von allem Gewohnten getrennt, wurde mir mit einem Mal deutlich, wie brüchig unsere Orientierung in der Zeit ist. Unser gewohntes Zählen der Minuten und Stunden ähnelt einer Eisschicht: Auf ihr können wir uns mehr oder minder problemlos durch den Alltag bewegen, doch sie trennt uns von einem Meer anderer Möglichkeiten, die Zeit zu erfahren – ein verborgener und doch in jedem Moment gegenwärtiger Reichtum. Diese Einsicht ließ mich nie wieder los.
Höhlen sind wie Orte außerhalb der Zeit. Erstaunlich schnell ist das Verfließen der Minuten vergessen, wenn man den letzten Schimmer Tageslicht hinter sich gelassen hat. Sobald nur noch das Geräusch von Wassertropfen ans Ohr dringt, die gelegentlich eine Felskante herabfallen, verliert das Tempo der Außenwelt seine Bedeutung: Im Lauf eines Menschenalters lassen diese Tropfen einen Stalagmiten um nicht mehr als ein paar Millimeter emporwachsen. Man bewegt sich in einem eigenen Kosmos, dessen Dimension das Erdalter ist. So, wie wir den Raum zwischen uns und einem Vogel im Flug nicht abschätzen können, weil die Luft keinen Anhaltspunkt bietet, verliert in der Ereignislosigkeit einer Höhle das Zeitempfinden sein Maß. Plötzlich ist man in der Ewigkeit angekommen.
Normalerweise freilich sind Speleologen mit dem Erkunden von Abstiegen, Ganglabyrinthen und verborgenen Wasserläufen viel zu beschäftigt, um darauf zu achten, wie Vergangenheit und Zukunft allmählich verschwimmen. Ohnehin ist ein Besuch in der Unterwelt nach ein paar Stunden beendet. Die Uhr mahnt zum Aufbruch, der Brennstoff der Karbidlampen geht zur Neige. Nur selten bringt jemand in der Tiefe eine Nacht zu. Welches Zeitgefühl würde sich einstellen, wenn man länger in einer Höhle ausharren könnte? Wäre die völlige Abgeschiedenheit nicht ein ideales Labor, um mit unserem Empfinden der Zeit zu experimentieren?
Mit dieser Hoffnung im Sinn und viel Mut unternimmt Michel Siffre einen Selbstversuch. Gerade 23 Jahre alt ist der französische Geologe, als er am 16. Juli 1962 ohne Uhr in eine vergletscherte Höhle in den Südalpen absteigt. Er will herausfinden, was geschieht, wenn wochenlang nichts geschieht. 130 Meter tief im Berghang hat er sich ein Domizil eingerichtet, eine Tonne Verpflegung und Material eingelagert, ein Zelt aufgeschlagen. Eine Batterielampe spendet etwas Licht, damit Siffre sich zurechtfinden und Notizen machen kann. Aber Strom ist kostbar. So verbringt der Forscher die meiste Zeit in völliger Dunkelheit sitzend auf einem Klappstuhl.
Das einzige lebendige Wesen, das ihm begegnet, ist eine Spinne. Siffre beginnt, sie als eine Art Freundin zu sehen und sich mit ihr zu unterhalten. Doch als er auf die Idee kommt, sie an seinen Mahlzeiten aus der Konservendose teilhaben zu lassen, verendet das Tier. Nun ist er ganz allein.
Zelt und Kleider sind schon bald völlig durchfeuchtet, das Thermometer zeigt wenig über null Grad an. Die Leiter nach oben haben seine Assistenten zurückgezogen; Siffre will nicht in Versuchung kommen, das Experiment abzubrechen. Ein Feldtelefon bildet seine einzige Verbindung nach außen. Über die Leitung gibt er durch, wann er aufsteht, wann er sich in seinen Schlafsack legt, und wie lange er jeweils im Dunklen gesessen zu haben glaubt.
Siffre verliert die Orientierung über die Zeit. »Wenn ich zum Beispiel nach oben telefoniere und durchgebe, wie spät es meiner Meinung nach ist, und glaube, dass nur eine Stunde zwischen dem Aufstehen und dem Frühstück vergangen ist, kann es genauso gut sein, dass es vier oder fünf Stunden waren«, notiert er in sein Tagebuch. »Und etwas ist schwer zu erklären: Die Hauptsache, glaube ich, ist die Vorstellung von der Zeit, die ich im Augenblick des Anrufs gerade habe. Wenn ich eine Stunde früher angerufen hätte, hätte ich die gleiche Zeit angegeben.« Verstört stellt er fest, dass er nur noch erlebt, wie die Zeit vergeht, dass aber eben dieses Erlebnis ihn trügt: »Ich habe das Gefühl, regungslos zu sein, und doch fühle ich mich vom ununterbrochenen Fluss der Zeit davongerissen. Ich versuche, ihn irgendwie zu erfassen, doch jeden Abend merke ich wieder, dass ich gescheitert bin.«[3]
Aber was heißt schon Abend? In der völligen Dunkelheit sind Tag und Nacht sinnlose Worte. Siffres Dasein hat seinen Rhythmus verloren – zumindest erscheint es dem Höhlenmann so. Wo er zehn Minuten Zeitabstand zwischen dem Moment, in dem er aufgestanden ist, und dem Beginn seines Frühstücks schätzt, ist tatsächlich mehr als eine halbe Stunde vergangen. Einmal fühlt er sich nach einem Essen, das er für sein Mittagsmahl hält, müde und legt sich nieder. Als er wieder zu sich kommt, glaubt er, nur kurz geschlummert zu haben. In Wirklichkeit sind mehr als acht Stunden vergangen.
Ohne Gefühl für die Zeit zu sein, zermürbt ihn. Auf dem batteriebetriebenen Plattenspieler, den er sich mitgebracht hat, legt er Beethoven-Sinfonien auf. Wenn eine LP abgespielt ist, sind 45 Minuten vorüber. Aber auch das hilft ihm nicht wirklich. Sobald wieder Stille einkehrt, fühlt er sich so verloren wie zuvor. Verzweifelt erwägt er sogar, seinen Gaskocher als Uhr zu missbrauchen. Er weiß, dass der Inhalt der Kartusche in einem Zug heruntergebrannt für genau 35 Stunden ausreicht. Dann freilich könnte er sich nicht einmal mehr Tee kochen, um sich zu wärmen.
Am 14. September 1962 bergen Helfer in Feierstimmung den völlig ausgezehrten Michel Siffre aus seiner Höhle. Eine dunkle Brille schützt seine Augen vor dem Licht, das der Forscher 61 Tage lang nicht sah.
Die Vorfreude auf das Einschlafen wird sein einziges Vergnügen – auch wenn er mitunter nicht einmal mehr Schlaf von Wachen abgrenzen kann: »Ich blickte mit weit aufgerissenen Augen in die Dunkelheit und zögerte lange, fragte mich, ob ich schlief oder nicht. Dabei hoffte ich, dass ich noch träumte, aber nach einer Weile ging mir auf, dass ich längst hellwach war. Enttäuscht griff ich nach dem Lichtschalter, beugte mich aus dem Schlafsack und drehte die Wählscheibe des Telefons.«
Aber die Verwirrung existiert nur in Siffres Bewusstsein. In seinem Körper hat sich ein präziser Rhythmus eingestellt. Allerdings bemerken nur Siffres Freunde, die über jeden Anruf Buch führen, wie penibel sein Organismus mit der Zeit haushält. Der Tag des Höhlenmenschen dauert regelmäßig vierundzwanzigeinhalb Stunden, von denen er sechzehn wach verbringt.
Als sich am 14. September eine Strickleiter in die Höhle senkt, die jubelnden Freunde mit Champagner erscheinen und ihm zum erfolgreichen Abschluss des Versuchs gratulieren, protestiert Siffre. Sein Tagebuch zählt erst den 20. August: Er hatte doch mit seinen Freunden vereinbart, dass er viel länger in der Tiefe ausharren würde. Der Forscher kann sich nicht vorstellen, dass ihm 25 Tage einfach entgangen sind. Wo ist die Zeit geblieben?
Eine verborgene Uhr
Siffre hat seinen Versuch mehrfach wiederholt. 1972 blieb er in Texas, beobachtet von NASA-Wissenschaftlern, 205 Tage unter der Erde. Diesmal fehlten ihm nach dem Experiment volle zwei Monate in seiner Erinnerung.
Und er hat Nachahmer gefunden. Unter ihnen war die Französin Véronique Borel-Le Gue, die mit 111 Tagen unter der Erde einen Frauenrekord aufstellte, der tragische Folgen hatte: Die Erfahrung von Isolation und Zeitlosigkeit stürzten die Abenteurerin nach Aussage ihres Psychiaters in tiefe Depressionen, als sie wieder ans Licht kam; ein Jahr später beging sie Selbstmord.
Weniger ungemütlich, auch ungefährlicher waren die Experimente, die zeitgleich mit Siffres erstem Höhlenaufenthalt in einem Bunker in Andechs bei München begannen. Dort hatten Wissenschaftler des nahe gelegenen Max-Planck-Instituts für Verhaltensphysiologie unter der Erde behagliche Appartements eingerichtet, in denen während der folgenden Jahre hunderte Studenten wochenlang in völliger Isolation hausten. (Viele von ihnen hatte die Hoffnung angelockt, es würde ihnen abgeschieden von jeder Ablenkung endlich gelingen, sich auf ihre Prüfungsvorbereitung zu konzentrieren.) Der einzige Kontakt mit der Außenwelt verlief über eine Schleuse, welche die Versuchsleiter zu unregelmäßigen Zeiten mit Nahrung, manchmal auch Briefen befüllten und aus der sie im Gegenzug Urinproben zum Messen der Hormonspiegel entnahmen. Die unterirdischen Betten waren mit Sensoren bestückt, die jede Ruhepause der freiwillig Gefangenen automatisch registrierten.
All diese Versuche ergaben dasselbe wie bei Siffres Unterweltabenteuer: Nach kurzer Eingewöhnungsdauer befolgten die Isolierten, ohne es zu wissen, einen persönlichen Rhythmus. Dessen Tag ist etwas länger als gewöhnlich – bei den meisten Versuchspersonen dauerte er ungefähr 24 Stunden, bei manchen sogar 26 Stunden oder noch mehr. Darum legten sich die Eingeschlossenen seltener zur Nachtruhe nieder als gewöhnlich, und darum schienen ihnen Tage zu fehlen, als sie ihr Gefängnis wieder verließen.[4]
In unseren Köpfen tickt eine verborgene Uhr. Sie steuert alle Vorgänge im Leib, lotst uns präzise durch Tag und Nacht. Die Körperzeit regelt Blutdruck, Hormone und Magensäfte, lässt uns müde werden und wieder erwachen. Sie arbeitet in perfektem Gleichtakt mit den besten mechanischen Uhren, denn das natürliche Chronometer ist ein Wunderwerk an Genauigkeit. Während der Jahrzehnte eines ganzen Lebens geht es um höchstens ein paar Minuten vor oder nach![5] So kennt der Organismus beinahe auf die Sekunde genau die äußere Zeit.
Mit ihren Versuchen hatten Siffre und seine Kollegen diese biologische Uhr des menschlichen Körpers zum Vorschein gebracht. Den wenigsten Forschern ist eine so große Entdeckung vergönnt; allein dieses Ergebnis hätte sie reichlich für die Wochen in Isolation entschädigt.
Doch die Experimente führten zu einer weiteren Erkenntnis, die noch aufregender war: Obwohl die Körperzeit unser ganzes Dasein steuert, ist sie nicht die Zeit, die wir empfinden. Das Bewusstsein erzeugt sich seine eigene Zeit – die innere Zeit. Sie ist gleichsam der Puls unserer Seele. An ihr messen wir alles, was wir wahrnehmen, denken, empfinden.
Die innere Zeit ist unabhängig vom Lauf der mechanischen ebenso wie der biologischen Uhren. Siffres Körperzeit war ja bestens im Takt; dennoch hatte sich sein Zeitempfinden gegenüber dem seiner Freunde völlig verschoben. Auch wir erleben täglich, dass sich das Bewusstsein die Freiheit nimmt, seine eigene Zeit zu schaffen. Wäre es anders, müssten wir uns nicht mit einer Prothese am Armband behelfen, um die Stunde zu erfahren.
Wie lange dauert eine Stunde?
Warum aber besitzt unser Körper ein perfekt geeichtes Instrument zur Zeitmessung, das wir nicht ablesen können? Viele Vorgänge im Organismus entziehen sich dem Bewusstsein. So regelt die Leber den Stoffwechsel höchst wirkungsvoll, obwohl wir selbst nach einem Gelage nicht das Geringste davon bemerken. Schon die Ökonomie der Aufmerksamkeit verlangt, dass die meisten Vorgänge im Körper jenseits unserer Kontrolle ablaufen müssen. Wir würden den Verstand verlieren, müssten wir ständig die Daten hunderttausender biochemischer Reaktionen irgendwo im Körper zur Kenntnis nehmen. Auch hinter der Körperzeit steht, wie wir sehen werden, Biochemie.
Vielleicht eignet sich der Taktgeber, der den Rhythmus unserer Tage bestimmt, aber auch gar nicht dazu, Minuten zu zählen. Diese Vermutung mag sonderbar scheinen, weil wir beim Gedanken an Zeit sofort an ein Ziffernblatt denken, auf dem sich Minuten und sogar Sekunden ebenso gut ersehen lassen wie die Tageszeit. Doch für diese verschiedenen Aufgaben haben Armbanduhren mehrere Zeiger. Eine Turmuhr ist unbrauchbar, um die Siegerzeit beim 100-Meter-Lauf zu bestimmen; eine Stoppuhr hingegen kennt keinen Unterschied zwischen Vormittag und Abend.
Ähnlich verhält es sich mit den Zeitmessern des Körpers und des Bewusstseins: Wir brauchen – und haben – mehrere Maßstäbe, um uns in der Zeit zu orientieren. Wenn wir einen Augenblick erleben, interessieren uns Sekunden. Um sich auf Tag und Nacht einzustellen, braucht der Organismus hingegen eine Uhr, die mindestens 24 Stunden lang läuft.[6]
Und schließlich messen die Uhren des Leibes und des Bewusstseins die Zeit auf völlig verschiedene Weise. Die Körperuhr bestimmt die Zeit automatisch. 16 Stunden nach dem Erwachen werden wir müde, ob es uns passt oder nicht. Ihr Maßstab steht fest. Er ist uns angeboren.
Die innere Zeit hingegen hängt davon ab, womit sich das Bewusstsein gerade beschäftigt. Sie zu erleben ist eine höchst komplizierte Leistung des Hirns. Vor allem aber haben wir den Maßstab der inneren Zeit gelernt. Wie lange dauert eine Stunde? Die Frage ist nur vermeintlich trivial. Denn wirklich beantworten können wir sie erst, wenn wir diese Spanne anhand von Erlebnissen messen: Eine Stunde, die wir auf eine Straßenbahn warten, scheint ewig; eine Stunde im Wartezimmer eines Arztes gerade noch annehmbar; eine Stunde Aufenthalt auf einem Flughafen vor einem Interkontinentalflug ist eine rasche Verbindung. Dahinter steht die Erinnerung an Stunden, die wir an Haltestellen, in Arztpraxen, auf Flughäfen zugebracht haben. Um uns von solchen Zeitdauern ein Bild zu machen, brauchen wir das Gedächtnis. Wenn es ausfällt, verlieren wir auch unser Empfinden für die innere Zeit.
Michel Siffre hat nicht das Gedächtnis, wohl aber alle Maßstäbe verloren. Töne klingen anders in einer Höhle, selbst die Gerüche sind unvertraut. Und was zu sehen ist, erscheint nur als Schatten im Grubenlicht. Vor allem erscheint der Strom der Ereignisse, der sich normalerweise über uns ergießt, aufs Äußerste verdünnt. Minutenlang geschieht gar nichts, dann ist ein Wassertropfen zu hören; wieder Stille. In dieser Umgebung muss die Berechnung der Zeitspannen scheitern, die wir uns für das Leben am Tageslicht angewöhnt haben. Das war Siffres verstörende Erfahrung.
Die Not mit der Zeit
Der Rhythmus von Tag und Nacht ist dem Menschen von Geburt an einprogrammiert, doch im Alltag richten wir uns nach Minuten und Stunden. Nach ihnen bemessen wir, wann wir uns verabreden oder wie lange wir für eine Arbeit brauchen. Doch Minuten und Stunden sind keine natürlichen Maße der inneren Zeit. Ausgerechnet für die Zeitspannen, die uns im Alltag die wichtigsten sind, fehlt uns ein angeborener Sinn. Hätte die Natur uns damit ausgestattet, wäre das Leben leichter: Wir würden keine Züge versäumen, könnten uns den Arbeitstag mühelos einteilen und erschienen ebenso pünktlich zu Verabredungen wie mittags der Magen knurrt.
Warum enthielt uns die Evolution eine Uhr für Minuten und Stunden vor? Wie über alle Fragen nach dem Warum der Naturgeschichte, so lässt sich auch über diese nur spekulieren. Wahrscheinlich bestand in der Vergangenheit einfach kein Grund, ein Chronometer für solche Zeitspannen einzurichten. An die Rhythmen von Tag und Nacht muss sich ein Geschöpf anpassen, beispielsweise, um auf Nahrungssuche zu gehen, wenn die Fressfeinde schlafen. Es kann über Leben und Tod entscheiden, ob ein Tier in der Morgendämmerung oder im Mittagslicht seinen Bau verlässt. Ob es aber um genau 4 Uhr 17 die ersten Nüsse sammelt oder eine Viertelstunde später, ist ohne Belang.
Minuten und Stunden haben in der Wildnis keine Bedeutung. Auch menschliche Stammesgesellschaften kommen ohne sie aus; in den Sprachen mancher Naturvölker finden sich nicht einmal Worte für solch kurze Zeitabschnitte.[7] Erst in hoch entwickelten Gesellschaften haben Menschen diese Zeitmaße festgelegt – der englische Naturphilosoph Gerald Whitrow spricht von der »Erfindung der Zeit«. Diese Erfindung war notwendig, damit sich Menschen in einem immer komplizierteren Geflecht von Beziehungen aufeinander abstimmen konnten. Doch sie geschah wider die menschliche Natur. Darum haben wir bis heute unsere Not mit der Zeit, darum bricht die Kontrolle über Minuten und Stunden schon in viel alltäglicheren Schlamasseln als beim Leben in einer Höhle zusammen.
Gewöhnlich denken wir uns die Zeit wie einen gleichförmigen Brei, von dem jeder Löffel so schmeckt wie der Rest auf dem Teller. Wir stellen uns vor, dass 60 Sekunden eine Minute ergeben, 60 Minuten eine Stunde, 24 Stunden einen Tag. Und jede Einheit ist nichts weiter als ein Bruchteil der nächstgrößeren.
Doch unser Zeiterleben funktioniert anders. Was uns einen Augenblick wahrnehmen lässt, hat nichts mit den Vorgängen zu tun, dank derer wir eine Stunde im Wartezimmer als unerträglich empfinden oder die uns mittags Magenknurren verspüren lassen. Wenn wir uns in eine fremde Welt wie die einer Höhle begeben, werden diese Unterschiede rasch offenbar. Im Alltag entgehen sie uns, weil unser Blick im Zweifel sofort auf eine Uhr schweift, die alle Zeiten auf gleiche Art misst. Damit aber setzen wir uns ungewollt und meistens auch unbewusst in Gegensatz zu unserer Natur. Auch darum muss uns das Gleichmaß der Uhren wie eine tyrannische Macht erscheinen.
Wir haben die Freiheit, uns eine viel reichere Erfahrung der Zeit zu gestatten. Eine Stunde ist oft mehr, manchmal auch weniger als die Summe ihrer Minuten. Und ein Tag besteht nicht einfach nur aus 24 Stunden.
Fußnoten
[3]
Siffre 1963
[4]
Die gegenüber dem Sonnenlauf längere Periode der inneren Uhr alleine kann allerdings nicht die Fehlzeit von 25 Tagen erklären, die Siffre in seiner Höhle erlebte. Hinzu kommt die Trägheit des Gehirns, die wir auch ganz alltäglich erleben: Wenn wir erwachen, stehen wir nicht sofort auf, wenn wenn wir müde werden, gehen wir nicht gleich schlafen. Wir folgen dem Rhythmus der inneren Uhr also stets etwas verspätet. Wenn das Sonnenlicht oder andere Zeitgeber fehlen, verstärkt sich dieser Effekt – und führt auf Dauer dazu, dass sich Wach-Schlaf-Perioden noch weiter verlängern.
[5]
Dunlap, Loros und DeCoursey 2004
[6]
Allerdings gibt es Hinweise darauf, dass sich mit einem verlängerten Tagesrhythmus (etwa in einem Schlaflabor) das subjektive Empfinden einer Stunde etwas verkürzt. Die Zeit scheint also schneller zu laufen. Die Schätzung verändert sich dadurch aber nicht. Siehe Aschoff 1995, Nichelli 1993
[7]
Whitrow 1991
2Eulen und Lerchen
Eine innere Uhr steuert uns durch den Tag
Ich bin meiner Frau immer voraus – um mindestens eineinhalb Stunden. Wenn ich sie im Morgenlicht zu etwas Frühsport ermuntern will, verkriecht sie sich apathisch unter der Decke. Wenn ich das Haus in Richtung Schreibtisch verlasse, lugt sie gerade erst hinter der Zeitung hervor. Wenn sie jedoch am Abend über die Ereignisse des Tages diskutieren will, fallen mir die Augen zu. Alle Versuche, unsere Rhythmen aufeinander abzustimmen, sind gescheitert. Selbst reichlicher Kaffeekonsum hat weder sie morgens noch mich abends munterer gemacht. So leben wir nun als Nachteule und Morgenvogel glücklich nebeneinander.
Für viele hat die Morgenstund' nicht das mindeste Gold im Mund, denn niemand kann gegen seine Natur an. Die innere Uhr, auf die der Höhlenforscher Siffre gestoßen ist und die uns durch den Tag navigiert, gibt jedem seinen eigenen Takt vor. Sie folgt weder Sprichwörtern noch den Befehlen des Bewusstseins, schon gar nicht denen des Gatten. Wie das Programm des Körpers abläuft, bestimmen die Gene.
Die Körperzeit, von der dieses Kapitel handeln soll, legt die Bühne für alle Handlungen fest. Nach ihr steuert der Organismus den Blutdruck, die Verdauung und vor allem, wie leistungsfähig wir zu welcher Tageszeit sind. Nach ihrem Reglement fühlen wir uns zu manchen Stunden gut und zu anderen abgespannt, haben wir mehr oder minder Lust auf die Liebe. Die innere Uhr beeinflusst sogar, wie fest ein Händedruck oder wie geduldig man ist; wann man einen Drink verträgt oder ob der Alkohol einen Kater auslöst.
So gibt es für jedes Vorhaben einen richtigen Zeitpunkt. Wer gegen seinen persönlichen Rhythmus lebt, braucht für viele Dinge mehr Zeit als eigentlich nötig. Vor allem fühlt er sich matt und niedergeschlagen – oft ohne den wahren Grund zu kennen. Körper und Seele nehmen auf Dauer Schaden, zwingt man sie zu sehr, gegen ihren eigenen Rhythmus anzukämpfen. Erst in den letzten Jahren begannen Mediziner zu erkennen, wie viele körperliche und psychische Leiden von einer falschen Tagesroutine zusätzlich befördert oder sogar ausgelöst werden.
Sogar wann unser Leben begonnen hat und wann es enden wird, folgt der inneren Uhr. Babys kommen am wahrscheinlichsten gegen vier Uhr morgens zur Welt. Der Tod hat seine mächtigste Stunde morgens um fünf.
Selbst Blumen kennen die Zeit
So sehr die Körperzeit das ganze Leben bestimmt, so sehr missachten wir sie. Vielleicht liegt es daran, dass wir sie nicht direkt mit den Sinnen empfinden. Michel Siffre hat es in seiner Höhle eindringlich erlebt, wie unfähig ein Mensch ist, seine innere Uhr abzulesen. Nur ob man sich gerade angeregt fühlt oder erschöpft, gibt Aufschluss über die Zeit des eigenen Körpers.
In unserer Kultur wird seit Jahrhunderten Zeit einzig mit dem gleichgesetzt, was ein mechanisches Ziffernblatt anzeigt; vielleicht trug auch dies dazu bei, wie sehr man die Zeit in uns selber verkannte. Jedenfalls erschien es nüchtern denkenden Menschen lange als viel zu phantastisch, dass ein natürliches Chronometer alle Vorgänge im Organismus aufeinander abstimmen könnte.
Dabei waren Naturforscher schon vor drei Jahrhunderten den ersten Hinweisen darauf begegnet, dass innere Uhren jedes Lebewesen durch den Tag steuern. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wunderte sich der französische Astronom Jean Jacques de Mairan über seine Mimosen: Die Pflanzen auf dem Fensterbrett reckten sich stets zur gleichen Zeit nach der Sonne. Eine Wirkung des Lichts? Mairan stellte die Mimosen in eine dunkle Kammer. Doch unbeirrt rollten sich Blätter morgens aus und abends wieder ein. Als gründlicher Forscher wiederholte Mairan seine Versuche immer wieder. Stets kam er zum selben Ergebnis. Erst im Jahr 1729 ließ er in den Verhandlungen der Pariser Akademie der Wissenschaften über seine Experimente berichten. Seine Veröffentlichung zog einen kühnen Schluss: »Die Aktivität der Pflanze steht in Verbindung mit jenem feinen Sinn, der Kranke, die ans Bett gefesselt sind, den Unterschied zwischen Tag und Nacht spüren lässt.« Seinerzeit waren die meisten Spitäler dunkle Gewölbe.
Mairans Entdeckung machte sogar die Runde. Bald darauf pflanzte der Naturforscher Carl von Linné, der ähnliches Verhalten bei anderen Gewächsen festgestellt hatte, eine Blumen-Uhr in seinen Garten. Zwölf verschiedene Blüten zeigten mit ihrem Öffnen und Schließen die Zeit angeblich auf eine halbe Stunde genau an.
Freilich hatten Mairan und Linné nicht die geringste Vorstellung davon, auf welchen Mechanismen die Zeitmessung der Pflanzen beruhte. Schon gar nicht konnten sie ahnen, dass sie mit der biologischen Uhr eine der frühesten Erfindungen der Natur aufgespürt hatten. Man findet sie bereits bei einem so simplen Geschöpf wie dem Augentierchen Euglena. Dieser Winzling bevölkert die Erde seit mehr als einer Milliarde Jahre – viel länger, als es Blütenpflanzen gibt. Wenn irgendwo auf einem Teich eine dicke grüne Brühe schwimmt, so hat sich der Einzeller dort in Massen angesiedelt. Im Stammbaum der Natur ist Euglena ganz am Ursprung der langen Ahnenlinie des Tierreichs zu finden, obwohl es noch viele Eigenschaften der Pflanzen besitzt; etwa kann es mit seinem grünen Farbstoff Fotosynthese betreiben.
Wo Flüsse ins Meer münden, ist oft ein eigenartiges Schauspiel zu beobachten: Bei Niedrigwasser färben Schwaden von Augentierchen, die nach oben ans Licht steigen, den Wasserlauf leuchtend grün. Sobald aber die Flut heranrückt, ist nichts mehr zu sehen. Euglena hat sich im Schlamm eingegraben, damit es nicht vom Wasser weggespült wird. Wenn sich das Meer wieder zurückzieht, steigt der Einzeller wieder empor – das Spektakel beginnt von Neuem. Spürt das primitive Geschöpf das Herannahen von Ebbe und Flut? Nein, denn Euglena vollführt sein Auf und Ab auch ohne Einfluss der Gezeiten. Füllt man die Einzeller mit etwas Schlamm aus einer Flussmündung in ein Glas und bringt sie ins Labor, steigen sie weiter alle sechs Stunden auf und sinken alle sechs Stunden nieder. Und obwohl das Augentierchen sehr wohl ein simples Sinnesorgan für Licht besitzt, dem es seinen deutschen Namen verdankt, löst nicht der Wechsel von Hell und Dunkel seine Wanderung aus. Wie die Mimose übt es seine regelmäßige Bewegung auch in völliger Dunkelheit aus.[8] Euglena muss den Takt seines einfachen Lebens also in sich selbst erzeugen.[9] Und tatsächlich birgt selbst dieser winzige Organismus ein biologisches Uhrwerk.
Das Ticken von Millionen Uhren
Der menschliche Körper besteht aus bis zu 100 Billionen Zellen, von denen jede etwa so groß wie ein Augentierchen ist. Und so unglaublich es klingt: Jede Zelle besitzt ihre eigene innere Uhr.
Dieses Chronometer funktioniert nach dem Prinzip einer Sanduhr. Bestimmte Gene mit Namen wie »Clock« und »per« (für »Periode«) sorgen dafür, dass die Zelle Eiweißstoffe herstellt. Doch wenn die Menge dieser Proteine eine bestimmte Schwelle überschreitet, werden die Gene blockiert. Das Uhrglas ist voll, der Mechanismus stoppt. Nun wird die Sanduhr umgedreht und die Zelle gewissermaßen entleert: Die Proteine zerfallen. Nach einer Weile beginnt das Spiel von neuem. Die Produktion kommt wieder in Gang. Solch ein voller Durchlauf dauert genau 24 Stunden und wenige Minuten.
Die Erkenntnis, dass eine solche Uhr in jeder Zelle tickt, verdankt die Molekularbiologie ihrem liebsten Versuchstier: der Taufliege.[10] Drosophila lässt sich leicht züchten und genetisch manipulieren. Auf der Suche nach dem Takt des Lebens schleusten Wissenschaftler im vergangenen Jahrzehnt den Fliegen ein Gen der Glühwürmchen ein, das diese zum Leuchten bringt. Das Gen für den Leuchtstoff mit dem schönen Namen Luciferin verknüpften die Forscher in den Fruchtfliegen mit anderen Genen, welche für die Steuerung der inneren Uhr verantwortlich sind.
Weil nun die Uhrwerksgene mit den Glühwürmchengenen verbunden waren, begannen die Fliegen überall dort, wo eine Uhr in Gang war, zu funkeln. Und das taten sie an den unwahrscheinlichsten Stellen: Nicht nur die Köpfe glitzerten, sondern auch die Antennen, die Beinchen, sogar der Darm. Bald entdeckten Biologen Uhren auch in allen möglichen Zellen von Säugetieren – in den Augen, in der Leber, selbst in den Zellen, welche die Knochen aufbauen.[11]
Dafür gab es nur eine Erklärung: In jeder Zelle ist ein Mechanismus zum Zeitmessen verborgen. Weil die Zellen von Fliege und Mensch grundsätzlich gleich aufgebaut sind, trägt auch der Mensch Billionen Uhren in sich.
Aber warum? Vielleicht sind die im ganzen Körper versprengten Chronometer ein längst überflüssig gewordenes Relikt der Evolution – wie der menschliche Blinddarm. In einfachen Mehrzellern, die noch kein Nervensystem besaßen, musste schließlich jede Zelle selbst für ihr Ruhen und Wachen sorgen. Wahrscheinlicher aber hat dieser Überfluss nach wie vor seinen Sinn: Den Organismus durch den Tag zu steuern ist eine so wichtige Aufgabe, dass die Natur sie vermutlich sicherheitshalber an vielen Stellen angesiedelt hat. Tatsächlich regeln einige Organe ihren Tageslauf offenbar selbst.[12] Die Leber etwa besitzt sogar Sensoren, die es ihr ermöglichen, Information über die Zeit mit anderen Organen auszutauschen.[13] Der amerikanische Chronobiologe Jay Dunlap vergleicht den menschlichen Körper mit einem riesigen Uhrengeschäft, in dem manche Zeitgeber vernehmbarer ticken, andere hingegen verhalten.
Doch dieses Durcheinander schafft ein neues Problem: Selbst die genauesten Uhren geraten irgendwann außer Takt, wenn man sie nicht immer wieder stellt. In höheren Tieren übernimmt ein eigenes Zentrum im Zwischenhirn diese Arbeit. Beim Menschen besteht diese Zentraluhr aus einem Paar reiskorngroßer Nervenknoten, die in jeder Hälfte des Gehirns zwei Finger breit hinter der Nasenwurzel sitzen und suprachiasmatischer Nucleus heißen. Fast der ganze Körper steht unter der Kontrolle dieser Zentraluhr. Ist sie durch einen Hirntumor zerstört, gerät die tägliche Routine der Patienten völlig durcheinander; sie essen, schlafen und erwachen zu beliebiger Zeit und machen sich mitten in der Nacht an die Arbeit.[14]
Der gesunde suprachiasmatische Nucleus arbeitet mit bewundernswerter Präzision. Solange Menschen nämlich nicht dem Einfluss des Tageslichts ausgesetzt sind, gibt der Schrittmacher mit einer Periode von etwas mehr als 24 Stunden wiederkehrende elektrische Signale von sich. Wie lang genau der biologische Tag dauert, ist offensichtlich angeboren; bei einigen Menschen beträgt die Schwingungsdauer 24 Stunden und 5 Minuten, bei anderen 30 Minuten länger. Und dabei bleibt es: Im Lauf eines ganzen Lebens beträgt die Gangabweichung, wie gesagt, höchstens ein paar Minuten.[15]
Selbst nach dem Tod läuft die innere Uhr unbeirrt weiter. Trennt man ihn aus dem Gehirn heraus und bewahrt ihn in einer Nährlösung auf, gibt der suprachiasmatische Nucleus noch tagelang Impulse von sich.[16]
Die Sonne stellt die innere Uhr
Um ein paar Minuten hinkt die innere Uhr eines jeden Menschen also dem Wechsel von Tag und Nacht hinterher. In der Natur ist das kein Problem, denn alle Geschöpfe benutzen die Sonne, um ihr Chronometer zu stellen. Dafür hat schon Euglena sein Auge mitbekommen – nicht, um damit zu sehen. Indem es Helligkeit wahrnimmt, registriert das Augentierchen, wo oben ist, vor allem aber den Wechsel von Tag und Nacht. Denn auch seine biologische Uhr geht etwas falsch (anders als bei den Säugetieren allerdings um etwa 20 Minuten zu schnell)[17]. Wenn jedoch ein neuer Morgen anbricht, wird die Uhr in der Zelle auf die richtige Stunde gestellt. Dies geschieht, indem die Lichtsignale Botenstoffe aktivieren, welche die Reaktionen in der Zelle und damit den Lauf der chemischen Sanduhr verzögern oder beschleunigen.[18]
Beim Menschen liegt die Zentraluhr keineswegs zufällig an der Stelle, wo sich die beiden Sehnerven von den Augen kommend kreuzen. So wird dem suprachiasmatischen Nucleus gemeldet, wann das Morgenlicht auf die Lider fällt. Während Sie in den späten Phasen des Schlafs liegen, sind spezielle Sensoren im Auge besonders lichtempfindlich.[19] Die noch schwache Helligkeit führt aber nicht dazu, dass Sie sofort aufwachen. Sie brauchen das Morgenlicht vielmehr als Zeitsignal, um die Körperzeit mit dem Lauf der Sonne abzustimmen. Ganz sich selbst überlassen, würde die innere Uhr von Tag zu Tag immer mehr nachgehen.
Müsste die Körperzeit dann nicht zu rasen beginnen, wenn der Sommer naht und die Sonne immer früher aufgeht? Damit Sie der Wechsel der Jahreszeiten nicht um den Schlaf bringt, wird die Uhr abends noch einmal gestellt. Jetzt hat das Licht den umgekehrten Effekt: Ist es länger hell als nach dem inneren Takt zu erwarten, verlangsamt die biologische Uhr ihren Lauf. Morgens wird die Uhr vorgestellt, abends wieder zurück – so gleichen die beiden Effekte einander aus. Die Ruhezeit des Körpers beträgt gleichbleibend etwa acht Stunden, auch wenn sich die Tageslänge ändert.
Warum es Morgenmenschen und Abendmenschen gibt
An freien Tagen zeigt sich, ob Sie ein Morgen- oder ein Abendmensch sind. Wenn am Wochenende der Wecker nicht klingelt, springen die einen trotzdem vergnügt aus dem Bett. Die anderen ziehen sich noch einmal das Kissen über den Kopf, sind erleichtert darüber, dass sie ausnahmsweise nicht in tiefer Nacht aus dem Schlaf gerissen werden, und freuen sich, während sie wieder einnicken, auf ein Frühstück im Bett zur Mittagszeit.[20] Die natürlichen Unterschiede sind riesig: Würde man die Menschen ohne äußeren Zwang ihrem eigenen Rhythmus überlassen, würde ein Teil von ihnen erst um eine Zeit schlafen gehen, zu der ein anderer Teil schon wieder erwacht. Nur gibt kaum einer seine Veranlagung so offen zu wie Oscar Wilde. Als ein Bekannter den irischen Dichter bat, ihn um 9 Uhr zu besuchen, antwortete Wilde: »Sie sind ein erstaunlicher Mensch! Solange würde ich nie aufbleiben. Ich bin um 5 Uhr schon im Bett.«[21]
Zu welcher Art Mensch Sie gehören, hängt davon ab, in welchem Tempo Ihre innere Uhr tickt.[22]