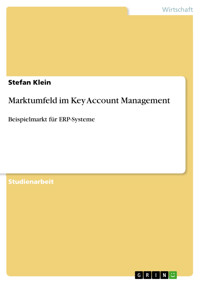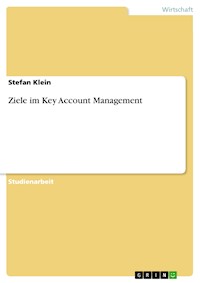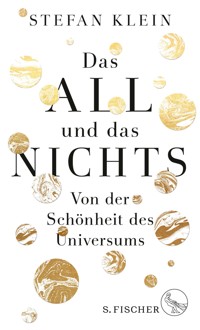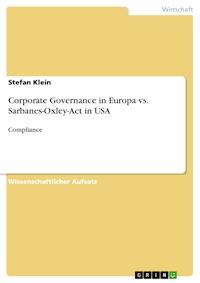9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Brauchen wir einen Glauben? Sind Gene unser Schicksal? Woher kommt der Mensch? Für das ZEIT-Magazin führt Bestsellerautor Stefan Klein regelmäßig Gespräche mit weltweit führenden Wissenschaftlern zu den großen Themen, die uns alle bewegen: Liebe, Erinnerung, Gerechtigkeit, Empathie. Die durchweg spannenden und glänzend geführten Unterhaltungen versetzen uns an die vorderste Front der Forschung – und zeigen die derzeit klügsten Köpfe nicht zuletzt auch als Menschen mit den gleichen Fragen wie wir alle.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Stefan Klein
Wir alle sind Sternenstaub
Gespräche mit Wissenschaftlern über die Rätsel unserer Existenz
Über dieses Buch
Brauchen wir einen Glauben? Sind Gene unser Schicksal? Woher kommt der Mensch? Für das ZEIT-Magazin führt Bestsellerautor Stefan Klein regelmäßig Gespräche mit weltweit führenden Wissenschaftlern zu den großen Themen, die uns alle bewegen: Liebe, Erinnerung, Gerechtigkeit, Empathie. Die durchweg spannenden und glänzend geführten Unterhaltungen versetzen uns an die vorderste Front der Forschung – und zeigen die derzeit klügsten Köpfe nicht zuletzt auch als Menschen mit den gleichen Fragen wie wir alle.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Coverabbildung: Babak A. Tafreshi/TWAN
Erschienen bei FISCHER E-Books
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2010
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403202-3
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Vorwort
Die Poesie der Moleküle
Wir alle sind Sternenstaub
Erinnern Sie sich?
Die Liebe erwächst aus der Erkenntnis
Die Gesetze der Hingabe
Der Hunger nach Gerechtigkeit
Allein gegen alle
Die Anderen im Kopf
Die stärkste Empfindung von allen
Die weibliche Seite der Evolution
Im Spiegelsaal der Illusionen
Das widerspenstige Zebra
Die Einheit der Welt
Danksagung
Abbildungsverzeichnis
Namen- und Sachregister
Vorwort
Vom Mut, ein Leben lang auf der Suche zu sein
Wissenschaft bestimmt wie nie zuvor unser Leben. Aber über die Menschen, die mit ihrer Forschung unsere Welt verändern, wissen wir wenig. Daran, dass sie persönlich nichts mitzuteilen hätten, kann es kaum liegen. Viele der Wissenschaftler, die ich für die Gespräche in diesem Buch traf, blicken auf erstaunliche Lebensgeschichten zurück. Sie haben ungewöhnliche Interessen und denken weit über den Horizont ihres Fachs hinaus. Kurz, sie sind als Menschen allemal so interessant wie die Schauspieler, Fußballer oder Politiker, von deren Befindlichkeiten wir bis ins Kleinste erfahren.
Wenn viele Zeitgenossen im Wissenschaftler noch immer den genialen, doch leider lebensuntüchtigen Einstein vermuten, der der Welt die Zunge herausstreckt, so liegt es zum einen an den Forschern selbst: Sie versuchen, sich als Person zu verleugnen. Wissenschaft will objektiv sein, der Mensch soll außen vor bleiben. In einer wissenschaftlichen Veröffentlichung das Wort »ich« zu gebrauchen, ist ein Sakrileg. Und weil Forscher natürlich nicht minder nach Anerkennung gieren als alle anderen Menschen auch, stricken sie mit an dem Mythos, der sie umgibt: Wenn man schon seine eigene Persönlichkeit nicht allzu sehr ausleben darf, so schmeichelt es zumindest der Eitelkeit, als ein Gelehrter zu gelten, der über den alltäglichen Dingen schwebt.
Dass Denken und Fühlen der Forscher der Öffentlichkeit fremd sind, hat aber noch einen zweiten, tieferen Grund: Unsere Gesellschaft sieht die Wissenschaft mit einem Tunnelblick. Zu Recht erscheint Forschung als eine Quelle ökonomischen Reichtums, hat sie uns doch wirksame Medikamente, Computer und Tausende andere Annehmlichkeiten beschert. Das Treiben der Forscher in ihren Labors ist offenbar nützlich, auch wenn man es nicht immer versteht. Aber mit dem, was uns wirklich bewegt, mit den existenziellen Fragen unseres Lebens, hat es in den Augen der meisten Menschen nichts zu tun.
Wer so denkt, übersieht allerdings, dass Wissenschaft ein Teil unserer Kultur ist – wie unsere Bücher, unsere Musik, unsere Filme. Seit ihren Anfängen hat sich die Naturwissenschaft mit den Rätseln unseres Daseins befasst. Und gerade in den letzten Jahren hat sie viele Einsichten gewonnen, die uns klarer sehen lassen, wer wir sind, woher wir kommen, und was es heißt, Mensch zu sein.
Für dieses Buch habe ich einige der Frauen und Männer getroffen, denen wir solche Erkenntnisse verdanken. Versammelt sind Gespräche, die ich (von zwei Ausnahmen abgesehen) in den Jahren 2007 bis 2009 mit Forschern aus Europa, den USA und Indien geführt habe und die in gekürzter Form zuerst im »ZEIT-Magazin« erschienen sind. Jeder der Gesprächspartner genießt Weltruf in seinem Fach, und jeder hat sich damit hervorgetan, seine Forschung in einen größeren Rahmen zu stellen. Unter ihnen sind ein Chemienobelpreisträger, der sich auch als Lyriker einen Namen gemacht hat; ein Kosmologe, der öffentlich Wetten über das Schicksal der Welt in den nächsten Jahrzehnten abschließt; ein Physiologe, der zugleich in den Urwäldern Papua-Neuguineas den Ursprung der Zivilisationen erforscht. Ich habe versucht, Forscher mit möglichst vielen verschiedenen Interessen zu Wort kommen zu lassen; mit einem Geographen und einer Anthropologin sind auch die Geistes- und Sozialwissenschaften vertreten. Im Übrigen ist die Auswahl hemmungslos subjektiv. Ich habe Menschen zu einem Gespräch gebeten, die ich kennenlernen wollte – weil mir ihre Beiträge oder auch das, was ich über ihre Persönlichkeit wusste, als außerordentlich erschienen.
Der Einwand, dass in diesem Band weiße Männer über Gebühr vertreten sind, trifft zu: Jeweils nur zwei meiner Gesprächspartner sind Frauen, und nur zwei stammen nicht aus Europa oder Amerika. Doch diese Mischung ist eine Momentaufnahme unserer Zeit. Ich suchte nach Wissenschaftlern mit einer umfassenden Lebensleistung und einem weiten Überblick, wie man sie gewöhnlich erst in der zweiten Hälfte einer Karriere erreicht. Unter den Forschern dieses Alters sind Frauen sowie Menschen aus Asien, Lateinamerika oder Afrika noch rar. Heute ist der Nachwuchs in den Labors zum Glück vielfältiger zusammengesetzt, und so würde denn auch die Mischung meiner Gegenüber in zwei Jahrzehnten anders aussehen.
Fast allen Gesprächspartnern begegnete ich zum ersten Mal. Meist verabredete ich mich zweimal mit ihnen an aufeinanderfolgenden Tagen, stets an einem Ort ihrer Wahl. Oft redeten wir in ihren Arbeitszimmern, manchmal auch auf langen Spaziergängen, in Restaurants, Museen oder in ihrem Sommerhaus. Das Einzige, was ich den Forschern schon im Voraus abverlangte, war Zeit. In der Regel dauerten unsere Unterhaltungen fünf Stunden, aus denen ich für dieses Buch die interessantesten Passagen herausdestillierte.
Ich verfolgte zwei einfache Ziele: Ich wollte erfahren, wer mein Gegenüber ist und was er tut. Eigentlich sind beides für mich nur zwei Umschreibungen einer einzigen Frage, denn an die Fiktion, dass ein Wissenschaftler bei der Arbeit seine Person außer Acht lassen kann, habe ich niemals geglaubt. Und dass die Lebensgeschichte eines Forschers und nicht zuletzt seine kulturellen Wurzeln seine Interessen bestimmen, erscheint fast trivial. Für die meisten Gesprächspartner aber war meine Herangehensweise höchst ungewohnt. Gemessen daran ließen sich erstaunlich viele auf meine persönlichen Fragen ein, nachdem wir etwas Zutrauen zueinander gefasst hatten. Litten sie selbst darunter, dass »ich als Individuum in der Forschung nicht zähle«, wie es die Neurowissenschaftlerin Hannah Monyer ausdrückte? Andere hatten ihre Mühe mit mir. Gelehrte von Weltruf und in den höchsten akademischen Ämtern, die andauernd Vorträge vor ihren Studenten und auf Fachkonferenzen halten, verloren plötzlich all ihre Beredsamkeit, als sie von sich selbst sprechen sollten. Dabei genossen sie ein wenig Selbstdarstellung durchaus. Nur taten sie es offensichtlich mit einem schlechten Gefühl – als hätte ich sie zu etwas Ungehörigem verleitet. Zu tief saß die Angst, sich mit einem unbedachten Satz eine Blöße zu geben.
Dass gerade die Gespräche mit Nobelpreisträgern zu denen gehörten, die in einer völlig entspannten Atmosphäre verliefen, ist sicher kein Zufall. Dabei war meine Nervosität besonders vor dem Treffen mit dem Physiker Steven Weinberg nicht gerade gering, hatte dieser beinahe legendäre Forscher mit seinen Aufsätzen und Büchern doch gut 20 Jahre meines eigenen Berufswegs begleitet. Auf der ganzen Welt gibt es wohl wenige Physiker meiner Generation, die Weinberg nicht als eine höchste Autorität verehren würden. So schoss ich auf meinem gemieteten Fahrrad kopflos über den Campus der Universität von Austin, Texas, und mehrmals an seinem Institut vorbei, bis ich ihm endlich gegenübersaß, verschwitzt und verspätet. Nach der Begrüßung gestand ich meine Befangenheit. Ich erzählte, wie sehr und wie früh seine Arbeiten mich beeinflusst hatten – und schämte mich gleich darauf für diese Worte, die er tausend Mal zuvor gehört haben musste. Doch Weinbergs Augen leuchteten auf: »Das freut mich.« Von da an war der Bann gebrochen. Selten habe ich einen Menschen mit weniger Allüren erlebt, und selten einen, der die eigenen Fehler, Versäumnisse und Zweifel so ehrlich eingestand. Wer alles erreicht hat, muss niemandem mehr etwas beweisen.
Respekt nötigte mir jeder meiner Gesprächspartner ab. Was mir Achtung einflößte, war allerdings weniger eine überragende Intelligenz, die Wissenschaftlern von Rang so oft nachgesagt wird. Gewiss hatte ich es mit Frauen und Männern von äußerst regem Verstand zu tun, doch ein unerreichbares Denkvermögen vermutete ich bei den wenigsten. »Nobelpreisträger sind auch nicht klüger als andere Menschen«, bemerkte in unserem Gespräch der Chemiker Roald Hoffmann, der selbst einer ist. Ich würde ergänzen: Und wenn sie doch Höhenflüge unternehmen, die anderen unmöglich sind, dann nicht, weil sie mit überlegenen Gehirnen auf die Welt kamen – sondern weil sie ihre grauen Zellen besser trainieren. Ihre Intelligenz war nicht immer schon da; sie muss sich auf einem Weg entwickelt haben, den alle meine Gesprächspartner verfolgten: Jeder von ihnen hatte sein Leben dem Ziel verschrieben, ein paar Mosaiksteine der Welt zu erkennen. Es war diese Fähigkeit zur Hingabe, die in jedem Gespräch aufschien, die ich bewunderte und die mich oft angerührt hat. Hingabe kann Menschen die höchsten Glücksmomente bescheren, doch sie fordert einen hohen Preis. Wie viel ihr Einsatz für die Spitzenforschung sie kostete, davon berichten allerdings nur die beiden Wissenschaftlerinnen in diesem Gesprächszyklus. Dass allein sie und nicht die Männer sich auf dieses Thema einließen, will mir ebenfalls kaum als ein Zufall erscheinen.
Während die Medien nur die Erfolgsmeldungen der Forschung verkünden, wissen die wenigsten Außenstehenden, mit wie unendlich viel mehr Misserfolgen, mit wie vielen Enttäuschungen jeder einzelne Triumph bezahlt ist. Denn die Rätsel der Natur sind wie ein Labyrinth: Die Lösung zeigt sich erst, wenn jeder Irrweg mindestens einmal ausprobiert ist. Und selbst wer, ohne es zu wissen, auf der richtigen Spur ist, muss sich Jahre, mitunter jahrzehntelang mit Kleinarbeit plagen, bis er ein wesentliches Problem gelöst hat. Nicht Intelligenz ist der wichtigste Charakterzug eines Wissenschaftlers, sondern Beharrlichkeit – eine an Sturheit grenzende Ausdauer, mit Rückschlägen, Selbstzweifeln und vor allem mit der Konkurrenz fertig zu werden. Der Genforscher Craig Venter schilderte seine Kollegen als vom Grundsatz »fressen oder gefressen werden« besessen, weil Biologen als Darwinisten ein besonders enges Verhältnis zum gnadenlosen Wettbewerb hätten. Freilich ist der Kampf um die Ehre einer ersten Entdeckung in anderen Disziplinen nicht minder hart. Den mitunter dämonisierten Venter schätzte ich nicht zuletzt für die Aufrichtigkeit, mit der er sich zu seiner eigenen Jagd nach Anerkennung und zu seinem nicht immer kooperativen Handeln bekannte.
Was nun bringt Menschen zur Forschung, was hält sie dabei? Ebenso wenig, wie Wissenschaftler mit genialen Gehirnen zur Welt kommen, werden Menschen mit einer Berufung zum Forschen geboren. Im Gegenteil erzählten fast alle Gesprächspartner, welche Zufälle sie zu ihrem heutigen Interessengebiet, letztlich auch zu ihren Erfolgen brachten: Sarah Hrdy wollte als Schriftstellerin einen Erstlingsroman über das Volk der Maya verfassen, entdeckte bei ihren Recherchen die Anthropologie und blieb dabei. Ernst Fehr, heute einer der weltweit einflussreichsten Wirtschaftswissenschaftler, beabsichtigte, Priester zu werden. Und Raghavendra Gadagkar wäre kaum zu einem der führenden Verhaltensforscher aufgestiegen, hätten nicht die in seinem indischen Studentenwohnheim allgegenwärtigen Wespen seine Aufmerksamkeit geweckt. Bei anderen war es die Begegnung mit einem charismatischen Lehrer, die ihrem Leben eine völlig neue Richtung gab. Im Licht dieser Biographien stellt sich die Hoffnung, Karrieren seien planbar, als weltfremd heraus. Nicht weitsichtiges Denken brachte die späteren Spitzenforscher voran, sondern ihr Selbstvertrauen, gegen Widerstände eigene Wege zu gehen.
Diesen Mut haben sie sich bis heute erhalten. Aber es ist nicht die Kühnheit, die Götter herauszufordern, sondern vielmehr eine Bereitschaft, ein Leben lang auf der Suche zu sein. So zeigten sich viele meiner Gesprächspartner mit einer eigentümlichen Mischung von Persönlichkeitszügen – als leistete sich ein ausgeprägtes Ego den Luxus einer mindestens ebenso starken Unsicherheit. Jenseits der Eitelkeit, jenseits des Wunsches, mit einem bahnbrechenden Forschungsergebnis den eigenen Namen unsterblich zu machen, schien ein Antrieb in ihnen allen zu wirken: eine Freude daran, unterwegs zu sein und genau zu wissen, dass man nie ankommen wird.
Eine der schönsten Antworten auf die Frage, was Forscher bewegt, ist zugleich eine der ältesten. Sie stammt von Leonardo da Vinci, der als Urvater der modernen Naturwissenschaften diesem Buch mit einem Interview aus Originalzitaten eine historische Perspektive gibt. Für Leonardo war der Wissensdrang eine Form der Liebe zur Natur und damit zum Leben: »Die Liebe erwächst aus der Erkenntnis, und wird umso inniger, je sicherer die Erkenntnis ist.« Was wir wirklich verstehen, das lernen wir schätzen. Und weil wir durch genaues Hinschauen letztlich uns selbst verändern, war für Leonardo buchstäblich jeder Gegenstand einer intensiven Beschäftigung wert – die Strömung um einen Kieselstein im Bach ebenso wie der Lauf der Gestirne.
Leonardo war ein Pionier auf einem unbekannten Kontinent. Er untersuchte einzelne Phänomene, jedes für sich, von den Beziehungen zwischen ihnen konnte er bestenfalls ahnen. In mehr als 500 Jahren Naturforschung seither haben Wissenschaftler viele Zusammenhänge sehen gelernt, sie wissen etwa, dass die Gesetze der Strömung um einen Kiesel im Fluss auch die Entstehung von Sternen im Kosmos bestimmen. So weist jede Erkenntnis im Kleinen über sich selber hinaus, wie ein Ritz in einer Holzwand den Blick auf eine ganze Landschaft freigeben kann. Mehrere Gesprächspartner beschrieben eine solche Erfahrung in beinahe übereinstimmenden Worten als »diesen wunderbaren Moment, in dem plötzlich alles zusammenpasst«. Oft führen die unscheinbarsten Probleme auf ein viel größeres Rätsel – und manchmal liefern sie sogar den Schlüssel, um es zu lösen. Von großen Fragen, die sich in kleinen verstecken, handeln die hier versammelten Gespräche.
Die Poesie der Moleküle
Der Chemiker und Dichter Roald Hoffmann über Schönheit
»Zeigen Sie diesen Chemiker bloß nicht so steif«, mahnte der Bildredakteur. »Keine Sorge«, antwortete die junge Fotografin, die mich zu Roald Hoffmann begleiten sollte. »Er ist doch ein Dichter.«
Sie hatte recht. Schon in Hoffmanns Zimmer an der Cornell Universität, weit abgelegen in den Wäldern des amerikanischen Bundesstaats New York, erinnert wenig daran, dass hier ein weltberühmter Wissenschaftler arbeitet. Indianische Masken und eine Statue des Hindugottes Krishna beim Flötenspiel zieren den Raum. Pinienzapfen und Ausgaben des Talmuds liegen herum. Von der Decke hängt ein Netz aus Vogelfedern. »Ein indianischer Künstler aus der Umgebung hat es geschaffen«, erklärt Hoffmann, »es ist ein Traumfänger«.
Hoffmann wurde 1937 als Kind einer jüdischen Familie in einer Kleinstadt nahe dem damals polnischen, heute ukrainischen Lemberg geboren. Die deutsche Besatzung überlebte er in einem Dachverschlag versteckt. Nach dem Krieg studierte er an der Universität Harvard Chemie. Mit nicht einmal 27 Jahren machte er seine erste bahnbrechende Entdeckung. Gemeinsam mit seinem Kollegen Robert Woodward fand er Regeln, mit denen sich chemische Reaktionen vorhersagen lassen. Dies trug ihm den Nobelpreis ein.
Wissenschaftler verweisen gern auf die Menge ihrer Veröffentlichungen. Hoffmanns Liste ist 500 Titel lang und wächst weiter. Doch zwischen den Fachartikeln finden sich Essays über Schönheit, Kunst, jüdische Geistesgeschichte – und vier von der Kritik gelobte Gedichtbände. Gerade arbeitet Hoffmann an seinem dritten Theaterstück.
Professor Hoffmann, haben Sie ein Lieblingsmolekül?
Hämoglobin – der rote Farbstoff des Bluts. Es ist ein Molekül von geradezu barocker Pracht.
An die 10000 Atome, die meisten Wasserstoff und Kohlenstoff, sind zu vier Ketten verbunden, die einander umschlingen. Das Ganze ähnelt vier Bandwürmern beim Liebesakt.
Ziemlich verworren …
Ja, aber nur auf den ersten Blick. In Wirklichkeit herrschen da Unordnung und Ordnung zugleich. Denn die meisten Kurven haben sehr wohl einen Sinn. So sind zwischen die Windungen der Ketten vier Scheiben eingeklemmt, die Häme. Genau in deren Mitte sitzt ein einsames Eisenatom. Daher auch die rote Farbe. An das Eisen bindet sich der Sauerstoff, den wir atmen. Doch jedes Häm nimmt nur ein, zwei Atome Sauerstoff auf.
10000 Atome, um ganze acht Sauerstoffatome zu verpacken? Was für eine Verschwendung.
Aber wunderschön. Finden Sie nicht?
Frauen können schön sein, Eiskristalle sind schön. Wir können sie sehen. Hämoglobin dagegen zeigt sich noch nicht einmal unter dem Mikroskop.
Musik sehen Sie auch nicht, schön ist sie trotzdem.
Wir hören sie. Philosophen seit der Antike fanden die Sinneswahrnehmung zentral für unser Schönheitsempfinden.
Viel entscheidender als die Sinneswahrnehmung ist, welches Interesse Sie für einen Gegenstand empfinden. Das Empfinden der Schönheit entsteht aus einer Spannung zwischen Ihrem Verstand und dem Objekt. Doch Sie haben recht: Irgendwoher muss das Interesse kommen. Eine sinnliche Anziehung steht immer am Anfang.
Bei einem attraktiven Körper vielleicht. Aber Chemie? Ich habe Ihre Wissenschaft sozusagen vom ersten Tag an eingesogen. Vater Chemiker, Mutter und Großmutter Chemikerinnen, und schon mein Urgroßvater leitete eine chemische Versuchsanstalt bei Wien. Trotzdem ist Chemie unter allen Wissenschaften bis heute diejenige, die mich am wenigsten fesselt.
Hatten Sie als Junge ein kleines Chemielabor?
Nein.
Sehen Sie: Die sinnliche Seite ist Ihnen entgangen. Chemie ist interessant, weil es raucht, knallt und stinkt. Die Anziehung kommt daher.
Aus dieser jugendlichen Anziehung wird später ein sehr intellektuelles Vergnügen. Spricht uns hingegen ein Bild oder eine Skulptur an, denken wir meistens kaum nach. Die Empfindung ist unmittelbar – das Herz geht uns über. Später kann eine intellektuelle Beziehung zu dem Werk hinzukommen, aber sie ist nicht unbedingt nötig. Kann also ein Molekül wirklich auf die gleiche Weise schön sein wie ein Kunstwerk?
Die Gewichte sind unterschiedlich. Bei Kunst spielt die Emotion, in der Wissenschaft der Verstand eine größere Rolle. Sehen Sie sich zum Beispiel das Bild da über meinem Schreibtisch an. Es zeigt ein Idol von den Kykladen, 5000 Jahre alt. Wenn ich diesen Frauenkörper aus Marmor ansehe, denke ich wenig darüber nach, welchen Einfluss die ägyptische und die kykladische Kunst aufeinander ausgeübt haben. Schon wenn ich die Statue sehe, bekomme ich ein warmes Gefühl. Aber jetzt betrachten Sie das ekstatische Frauengesicht auf dem Bild daneben. Es ist die heilige Theresa, eine Skulptur des Barockkünstlers Bernini. Da spielt der Verstand schon eine größere Rolle. Theresa spricht mich nicht nur wegen ihres Aussehens an, sondern auch, weil sie als christliche Nonne einen jüdischen Großvater hatte und mich weibliche Visionen interessieren. Schließlich war dies die einzige Weise, auf die sich Frauen in einer männlichen Kirche ausdrücken konnten.
Die Skulptur erzählt mir eine Geschichte. Da ist eine Spannung zwischen dem Kunstwerk und mir.
Das Hämoglobin …
… erzählt ebenfalls eine Geschichte. Die Ketten sind so gewickelt, dass sich zwischen ihnen eine Art Tasche bildet, in die Sauerstoff in der Lunge perfekt hineinschlüpfen kann. Wenn der Fahrgast Platz genommen hat, ändert das Molekül seine Form, es klappt gewissermaßen zu. Dadurch wechselt die Farbe, das Blut wird hellrot. Im Gehirn oder in einem Muskel gibt das Hämoglobin den Sauerstoff frei, indem die Ketten wieder ihre frühere Form annehmen. Darum ist Venenblut purpurrot. Wie dieses Molekül durch die Adern reist und sich dabei ständig verwandelt, finde ich spannend wie die Geschichte des Odysseus.
Allerdings steht diese Art von Schönheit nur den wenigsten offen. An einem Bild kann sich jeder freuen, der es betrachtet, an einem Musikstück jeder, der es hört. Gefallen an der Schönheit des Hämoglobins findet nur, wer Chemie studiert hat.
Man muss beides ja nicht gegeneinander ausspielen. Ich behaupte ja nicht, dass die Schönheit von Molekülen größer oder wichtiger sei als die eines Kunstwerks. Aber Schönheit ist eben auch in Bereichen zu finden, in denen wir sie gewöhnlich nicht vermuten – in der Forschung beispielsweise. Und indem wir uns das klar machen, dass das tiefe Verstehen eines Moleküls auch ein ästhetisches Gefühl auslösen kann, gewinnt die Naturwissenschaft eine neue Dimension. Sie erscheint menschlicher.
Manche Wissenschaftler lassen sich in ihrer Forschung von der Suche nach Schönheit leiten. Albert Einstein zum Beispiel wurde ganz unruhig, wenn er eine Gleichung als hässlich empfand. Die Wahrheit in der Natur, so dachte er, sei einfach und schön.
Daran glaube ich nicht. Die Welt ist kompliziert. Warum eigentlich sollte die Natur einen Hang zum Einfachen haben? Es ist einzig unser Verstand, der das Einfache sucht, weil er es leichter bewältigen kann.
Sie finden offenbar am Komplizierten Gefallen. Auch das Einfache hat seinen Zauber. Sprechen die perfekten Proportionen des Parthenons Sie nicht an?
Oder Moleküle, die wie vollkommene Würfel aussehen? Solche Ideale hatte ich früher. Doch je älter ich werde, umso mehr fasziniert mich Komplexität. Es mag auch mit unserer Zeit zu tun haben. Es gibt Epochen wie die griechische Antike, die einfache Formen bevorzugen. In anderen Phasen hingegen gilt gerade das Komplizierte als schön. So war es etwa im Barock, und so ist es heute. Viele Menschen finden beispielsweise die aufgebrochenen Bauten Frank Gehrys weit schöner und interessanter als die Bauhauskuben der Nachkriegszeit. Ich jedenfalls habe mich am zu Einfachen satt gesehen. Es erzählt keine Geschichte.
Warum erleben Menschen überhaupt Schönheit?
Kategorien wie schön und hässlich sind zum Teil genetisch bedingt. Vermutlich fanden Menschen ursprünglich schön, was ihnen nützt. So mögen sich unsere Vorfahren nicht nur zu bestimmten essbaren Pflanzen hingezogen gefühlt haben, sondern zur ganzen lebendigen Natur. Denn keine Art kann für sich allein überleben. Ich stelle mir vor, dass aus diesem Grund die Freude am Lebendigen, am Unregelmäßigen unser Schönheitsempfinden bis heute bestimmt. Auch deswegen mögen wir Blumen, und Holz lieber als Plastik.
Solch eine genetische Programmierung mag es geben. Aber mit ihr wird sich kaum erklären lassen, welche Mode oder welche Musik uns gefällt. An den Tönen eines Streichquartetts oder einer E-Gitarre ist gar nichts natürlich.
Mit der Entwicklung der Sprache und der Kultur wurde das Schönheitsempfinden natürlich sehr viel komplizierter, und man kann es nicht mehr allein biologisch erklären. Heutige Menschen haben viele ästhetische Urteile im Lauf ihres Lebens erlernt.
Und doch können wir uns über Schön und Hässlich oft erstaunlich gut einigen. Die Mona Lisa bewundert jeder.
Aber gerade deswegen, weil wir sie nicht mehr unvoreingenommen betrachten können! Jeder hat das Bild tausende Male gesehen und unzählige Urteile darüber gehört oder gelesen.
Das Rätsel ist doch, wie eine Mona Lisa überhaupt zu solchem Ruhm kam. Schon die ersten, die vor 500 Jahren Leonardos Werk sahen, priesen es. Außer der Vorliebe für die Natur muss es also weitere Prinzipien geben, nach denen wir Schönheit beurteilen.
Kommen wir noch einmal auf die Frage nach kompliziert und einfach zurück. Unser Verstand ist darauf programmiert, Muster zu suchen. Er bevorzugt eben das Einfache. Wir fühlen uns wohl, wenn wir etwas – ein Bild, ein Gebäude, ein Molekül – sofort verstehen. Aber dann wird die Sache schnell langweilig. Wir brauchen etwas, um das Interesse weiter zu fesseln.
Kennen Sie den Park Güell in Barcelona? Der Architekt Gaudi hat dort eine große Terrasse geschaffen, die über einem Abhang auf Säulen schwebt. Die Terrasse endet in einer Sitzbank, die sich in einer völlig regelmäßigen Wellenlinie vom Hang entfernt und dann wieder auf ihn zu läuft. Das ist einfach. Man versteht sofort, welche Form die Terrasse begrenzt …
… und nur so kann es zur sinnlichen Anziehung kommen. Wäre der erste Eindruck zu kompliziert, würden wir abgeschreckt.
Möglicherweise. Aber damit fängt die Geschichte eben erst an. Die Bank ist nämlich völlig unregelmäßig mit bunten Keramikfliesen bestückt. Keinerlei Muster ist da zu erkennen; das ist kompliziert. Tatsächlich sind die Größen und Farben der Fliesen zufällig zusammengesetzt. Weder Ordnung noch Unordnung allein empfinden wir als ästhetisch. Schönheit entsteht aus Spannungen: zwischen Ordnung und Unordnung, zwischen einfach und kompliziert.
Wir erleben Schönheit, wo noch ein Rätsel zu lösen ist. Und wir müssen glauben, dass wir es lösen können.
Kant hat sich da sehr geirrt. Er meinte, Schönheit sei »interesseloses Wohlgefallen«: Ein Urteil über das Schöne steht uns seiner Meinung nach nur für das zu, womit uns gar keine Absicht verbindet.
Nach Kant dürfte ich eine Frau nicht zugleich schön finden und begehren.
Jede Frau?
Meine Frau. Im Übrigen konnte ich den Typ Claudia Schiffer nie sonderlich schön und auch nicht anziehend finden. Gut finde ich eine Juliette Binoche …
… weil Sie in ihr ein Geheimnis vermuten.
Schönheitsempfinden beruht Ihrer Meinung nach auf Interesse und Nutzen. Folglich ist es eine Form des Begehrens – ein Verlangen, das Rätsel zu lösen. Vielleicht sind die größten Kunstwerke gerade die, die diese Sehnsucht wecken, aber niemals erfüllen.
Ja, aber da ist noch mehr. Das Vergnügen eines Museumsbesuchs liegt für mich darin zu spüren, wie meine Sinneserfahrung und mein Verstand zusammenwirken, um sich einem Kunstwerk zu nähern. Ich erfahre die Einheit meiner eigenen inneren Welt. Mehr noch, ich fühle mich mit allem verbunden, was mich umgibt. Und ich werde an die gute Seite im Menschen erinnert.
Kann etwas Schreckliches schön sein?
Denken Sie an Goyas Radierungen über die Schrecken des Krieges. Er zeigt Verstümmelungen, Erschießungen, Folter mit einer vorher nie da gewesenen Genauigkeit. Die Werke sind meisterhaft – sicher ein Grenzland der Schönheit. Aber für mich dennoch schön.
Sie selbst haben Gedichte über Ihre Erlebnisse unter der deutschen Besatzung geschrieben.
Ich wurde oft gefragt, ob ich diese Gedichte, jetzt verstreut in vier Bänden, in einem eigenen Holocaust-Band herausbringen will. Das habe ich immer abgelehnt: Diese Erfahrungen gehören mit all meinen anderen zusammen – mit meinen Gedichten über die Liebe oder auch über Chemie.
Eines dieser Gedichte heißt »Juni 1944« und behandelt die Zeit nach Ihrer Befreiung durch die russischen Truppen. Sie beschreiben sich darin als einen Sechsjährigen, der in seinem Versteck vergessen hat, was der Wind ist. Der Junge sah durch ein Loch nach draußen auf die spielenden Kinder, und »deren Gekicher/hüpfte herein, doch kein Wind,/denn das Loch in der Mauer war klein.«
Ein ukrainischer Dorfschullehrer hielt uns versteckt: Meine Mutter, zwei Onkel, eine Tante und mich. Ich war das einzige Kind. Am strengsten verboten war es, zu weinen. Das Kind meiner Tante war damals erst zwei. Seine Eltern mussten es an eine polnische Familie abgeben, denn sein Weinen hätte uns verraten. Die Deutschen haben es ermordet. Mein Onkel hatte ein Gewehr in unserem Versteck. Hätten die Deutschen uns entdeckt, hätte er uns alle und sich selber erschossen. Ich kann mich aber nicht erinnern, ob ich dies damals schon wusste, oder ob es mir meine Mutter später erzählt hat.
Wo war Ihr Vater?
In einem Arbeitslager. Doch in diesen Lagern gab es kaum deutsche Aufseher. Die Wächter waren vor allem ukrainische Kollaborateure. Die konnte man mit Zigaretten, Schokolade oder was auch immer bestechen. Und da mein Vater Bauingenieur war, konnte er sich ohnehin ziemlich frei im Land bewegen. Er sollte für die Deutschen zerstörte Brücken reparieren.
Warum nutzte er seine Freiheit nicht, um zu seiner Familie zu kommen?
Das hätte er können. Aber er nutzte seine Freiheit, um Waffen ins Lager zu schmuggeln. Sie planten, in einer großen Gruppe auszubrechen und sich bis zum Eintreffen der Russen in die Wälder zu flüchten. Wäre die Sache gut gegangen, wäre er zu uns gestoßen. Der Aufstand schlug fehl, die Wächter haben ihn umgebracht. Er war ein Held.
Sie haben den Holocaust gegen alle Wahrscheinlichkeit überstanden. »80 von 12000 Juden unserer Stadt überlebten«, heißt es in einer Zeile von Ihnen. Mit welchen Gefühlen hören Sie heute Deutsch?
Ich habe keine Schwierigkeiten mit Deutschland. Wenn ich dort bin, frage ich mich mitunter, was manche der Älteren im Dritten Reich taten und ihren Kindern verschwiegen. Andererseits fand meine Forschung gerade in Ihrem Land besondere Resonanz, und dadurch kamen viele junge Deutsche als Mitarbeiter an mein Institut. Manche von ihnen sind im Lauf der Zeit wie ein Teil meiner Familie geworden. So sind für mich neue, starke Bindungen an Deutschland entstanden. Übrigens empfanden wir – besonders meine Mutter – schon damals eine viel größere Abneigung gegenüber den Ukrainern. Von ihnen mussten wir schließlich befürchten, dass sie uns verraten. Obwohl die Mörder natürlich Deutsche waren. Verrückt, nicht?
Ist die Erinnerung an die Gefahr in Ihnen noch immer lebendig?
Sicher. Und sie führt zu merkwürdigen Reaktionen: In Restaurants fürchte ich mich vor den Kellnern, weil sie eine Uniform tragen. Und nachts kann ich bis heute nicht vor einem Fenster stehen; von draußen kam schließlich die Bedrohung. Natürlich ist die Erinnerung nach mehr als sechzig Jahren unter vielen Schichten verborgen. Darum bin ich im letzten Sommer in die Ukraine gereist. Da habe ich meine Heimatstadt und unser Versteck zum ersten Mal wieder gesehen.
Wie war es?
Der Dachboden war größer, als ich ihn erinnerte. Weil es da oben sehr kalt war, verbrachten wir den zweiten Winter in einem Raum im Erdgeschoss. Wenn Deutsche in der Gegend waren, verkrochen wir uns in eine Höhle, die wir unter den Fußbodenbrettern gegraben hatten. Während wir da kauerten, hörten wir manchmal die Stiefel der Soldaten über unseren Köpfen. Heute wird der Raum als Klassenzimmer genutzt. Und wissen Sie, was an der Wand hängt? Es ist ein Periodensystem. Sie nutzen das Zimmer für den Chemieunterricht. Und unter dem Periodensystem steht ein Zitat des russischen Chemikers und Dichters Lomonossow, auf Ukrainisch: »Die Chemie breitet ihre Arme aus zum Wohle der Menschheit.«
Man will es kaum glauben, so unwahrscheinlich klingt das.
Für mich war es wie ein Schock, als ich da hineingeführt wurde. Die Schulkinder hatten natürlich keine Ahnung, was zwischen diesen Mauern einmal geschah.
Glauben Sie an ein Schicksal?
Nein. Aber manchmal ist es schwer, es nicht zu tun. Wissenschaftler sind da auch nicht anders als andere Menschen. Sie wissen genau, dass nach fünfmal Rot beim Roulette die Wahrscheinlichkeit auch nicht größer ist als sonst, dass beim sechsten Mal Schwarz kommt. Eine Roulettekugel hat schließlich kein Gedächtnis. Und dennoch setzten sie im Casino auf Schwarz – wenn keiner hinschaut.
Weshalb sind Sie Naturwissenschaftler geworden?
Ein Unfall … jedenfalls empfand ich keine besondere Berufung zur Chemie. Auf Wunsch meiner Mutter und meines Stiefvaters bereitete ich mich lustlos auf das Medizinstudium vor.
In den Semesterferien hatte ich Jobs in Forschungslabors, das gefiel mir; immerhin hatte ich schon als Junge Chemieversuche angestellt. So ging ich in die chemische Forschung. Eigentlich jedoch liebäugelte ich damals mit Kunstgeschichte. Ich hatte ein paar Seminare in Kunst und Literatur besucht, und da tat sich eine ganze Welt vor mir auf. Aber ich wagte nicht, es meinen Eltern zu sagen. Es waren harte Zeiten für Einwanderer, mein Stiefvater war arbeitslos. Also blieb ich bei der Chemie.
Bereuen Sie es?
Manchmal. Andererseits macht mir Chemie Spaß, und ich glaube, ich konnte meiner Wissenschaft und besonders meinen Studenten viel geben. Und die Möglichkeit, mich künstlerisch auszudrücken, habe ich ja. Allerdings begann ich erst mit vierzig Jahren, Gedichte zu schreiben.
Wie schalten Sie um vom Forscher zum Dichter und wieder zurück?
Ich muss den Ort wechseln, am besten in die Natur gehen. Zwei Tage brauche ich, um die Wissenschaft hinter mir zu lassen; dabei plagt mich oft Kopfweh. Dann geht es, und ich schreibe ungefähr ein Gedicht jeden Tag.
Schreiben und Forschen hat vieles gemeinsam: Man sucht sich ein Thema und versucht zu gehen, wohin noch niemand war.