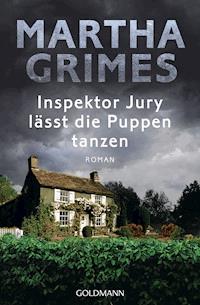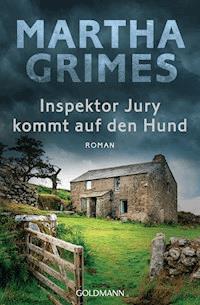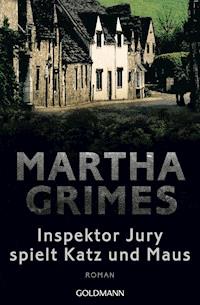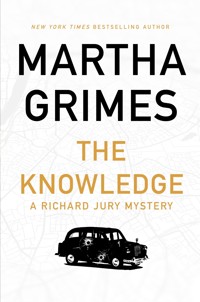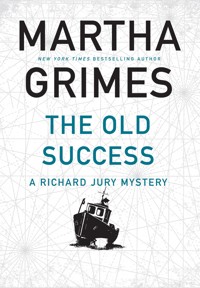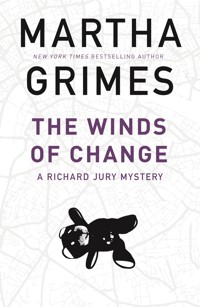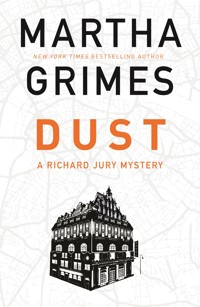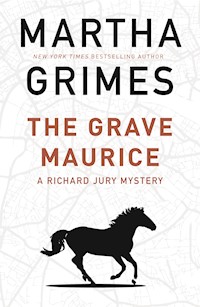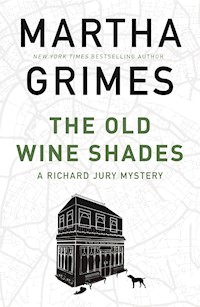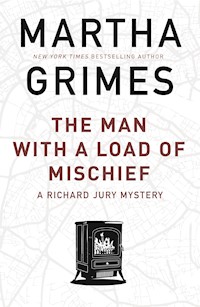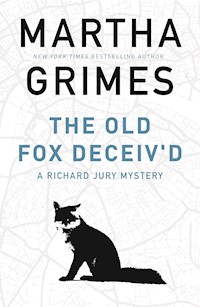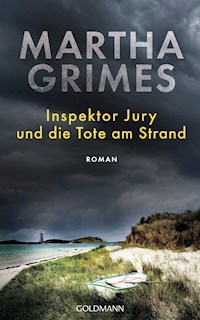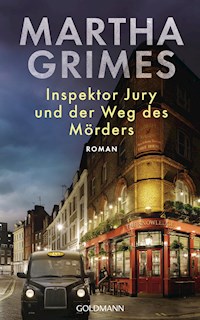8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Inspektor-Jury-Romane
- Sprache: Deutsch
Unter mysteriösen Umständen verschwindet in der ländlichen Idylle von Cambridgeshire die 15-jährige Nell Ryder. Zwei Jahre später fehlt von ihr und ihrem wertvollen Rennpferd noch immer jede Spur, doch ihr Vater Roger ist davon überzeugt, dass seine Tochter noch am Leben ist. Gemeinsam mit seinem Freund Melrose Plant nimmt Inspektor Jury die hoch angesehene Familie Ryder unter die Lupe und stößt schon bald auf Ungereimtheiten. Doch welche Abgründe dort wirklich lauern, wird ihm erst klar, als man auf dem Ryderschen Anwesen die Leiche einer unbekannten Frau entdeckt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 640
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Martha Grimes
Auferstanden von den Toten
Roman
Deutsch
Buch
Vor zwei Jahren verschwand in der ländlichen Idylle von Cambridgeshire, dem Mekka des englischen Reitsports, unter mysteriösen Umständen die 15-jährige Nell Ryder. Von ihr und ihrem kostbaren Pferd fehlt seither jede Spur, und die Vermutung liegt nahe, dass das Mädchen von dem Gestüt ihres Großvaters entführt wurde. Merkwürdigerweise tauchte aber nie ein Erpresserbrief auf, und so liegt Nells weiteres Schicksal völlig im Dunklen. Nur ihr Vater Roger ist überzeugt, dass seine Tochter noch am Leben ist. Inspektor Jury, der durch Zufall von den Ereignissen erfährt, beginnt sich für den Fall zu interessieren. Und schnell finden er und sein Freund Melrose Plant heraus, dass es in der hoch angesehenen Familie Ryder einige Ungereimtheiten gibt. Doch welche Abgründe dort wirklich lauern, wird ihnen erst klar, als man auf dem Ryder’schen Gestüt die Leiche einer unbekannten Frau entdeckt …
Autorin
Martha Grimes zählt zu den erfolgreichsten Krimiautorinnen unserer Zeit. Sie wurde in Pittsburgh geboren und studierte an der University of Maryland. Lange Zeit unterrichtete sie kreatives Schreiben an der Johns-Hopkins University. Martha Grimes lebt heute abwechselnd in Washington, D.C. und in Santa Fe, New Mexico.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2002 unter dem Titel »The Grave Maurice« bei Viking, New York
Copyright © der Originalausgabe 2002 by Martha Grimes By arrangement with Peter Lampack Agency, Inc. 551 Fifth Avenue, Suite 1613 New York, NY 10176-0187 USA Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2005 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Covergestaltung: UNO Werbeagentur
unter Verwendung von Bildmaterial von FinePic®, München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
Dem kleinen Will Holland und seinen Großeltern Virginia und Scott
He told where all the running water goes, And dressed me gently in my little clothes.
Do memories plague their ears like flies? They shake their heads. Dusk brims the shadows. Summer by summer all stole away, The starting gates, the crowds and cries – All but the unmolesting meadows, Almanacked, their names live; they
Have slipped their names, and stand at ease, Or gallop for what must be joy, And not a fieldglass sees them home, Or curious stop-watch prophesies: Only the groom, and the groom’s boy,
Prolog
Von weitem sah das Pferd weiß aus, aus größerer Nähe konnte man aber sehen, dass es ein fahles Weiß war, eher von der Farbe einer Morgendämmerung im Winter, ein schattiges Weiß wie eisiger Schnee.
So früh am Morgen war der Junge am liebsten hier draußen.
Er mochte alle Pferde im Stall, dieses aber ganz besonders.
Das helle Pferd sah dem Jungen zu, wie er sich näherte, mit Zaumzeug und Sattel über dem Arm durch den Dunst auf ihn zukam. Nicht er! Was war aus dem Jockey geworden, der ihn reiten konnte wie kein anderer? Wo waren die Siege, die Preise, die Rufe und Jubelschreie geblieben? Oder das Mädchen, das besser mit ihm umgehen konnte als der Junge, deren Finger sich sanft wie Chrysanthemenblättchen um die Zügel schlangen. Wenn es etwas gab, was das Pferd kannte, dann waren es Hände – die des Jungen, des Trainers, des Jockeys, des Mädchens. Sie war bestimmt ein verkleidetes Stutenfohlen, sie konnte kein Menschenkind sein. Irgendwie ging das nicht.
Der Junge trat auf ihn zu, streichelte ihm den Hals und gab ihm ein paar Stückchen Zucker. Dann warf er ihm die buntkarierte Decke über und führte ihn zwischen den Bäumen hindurch quer über die Weide zur Trainingsbahn. Der Junge trug immer noch den Sattel, wollte erst aufsteigen, wenn sie die Bahn am Fuß eines sanft ansteigenden Hügels erreicht hatten. Dieser frühmorgendliche Galopp auf der Trainingsbahn des Gestüts war für beide der Höhepunkt des Tages.
Deines Tages.
Der Junge und das Pferd lagen altersmäßig bloß ein paar Jahre auseinander – vierzehn und sechzehn –, aber das Pferd (wusste der Junge) war unendlich begabter als er, auch wenn es seine Renntage längst hinter sich hatte. Insgeheim hoffte er, das Pferd möge ihn überleben. So wie es seinen Vater überlebt hatte, der bei einem Rennen ums Leben gekommen war. Wenn er an seinen Vater dachte, konnte der Junge ihn sich nur schwer anders vorstellen als in seinem blaugoldenen Jockeydress. Sein Vater war berühmt gewesen. Samarkand, sein Pferd, war jedoch sagenumwoben.
Der Junge, Maurice hieß er, fragte sich oft, ob Samarkand die Rennbahn wohl vermisste, das hektische Hufeschlagen, die Schreie und Jubelrufe an den Sommernachmittagen, die Aufregung im Führring.
Er konnte sich noch gut an jenen Tag erinnern, als sein Vater auf Samarkand in Ascot den Goldpokal gewonnen hatte. Maurice und seine kleine Cousine Nell waren damals vor Freude auf und ab gehüpft wie zwei Korken, die von Champagnerflaschen knallten. Im Jahr zuvor hatte Samarkand sie in Newmarket zum ersten Mal allesamt das Staunen gelehrt. Auf der Gegengeraden hatte das Pferd plötzlich losgelegt. Pfeilschnell war es davongeschossen und hatte sämtliche anderen Teilnehmer in einer Staubwolke siebzehn Achtelmeilen hinter sich gelassen.
Die Überraschung über diesen völlig unerwarteten Sieg stand seinem Vater selbst dann noch ins Gesicht geschrieben, als sie sich anschließend alle wieder im Führring versammelt hatten. Der Besitzer des Gestüts – Maurice’ Großvater – wusste überhaupt nicht, was er sagen sollte. Der Trainer war der Einzige, der es relativ ungerührt aufnahm, als hätte er von Samarkand gar nichts anderes erwartet. Doch auch er wehrte ab, als die Leute ihm anerkennend auf den Rücken klopften und ihn ausgiebig lobten, so als sei es nicht sein Verdienst. Andere ergriffen die Hand des Jockeys, während Blumenkränze auf Pferd und Jockey herunterregneten.
Wer im Führring am wenigsten stolzgeschwellt war und am meisten Würde zeigte, war Samarkand selbst.
Samarkand war nicht einfach bloß ein Pferd, er war eines der großartigsten Pferde in der Geschichte des Reitsports, wurde in einem Atemzug genannt mit Red Rum oder mit diesem amerikanischen Hengst Forego, einem Gewichtträger, der, egal wie viel man ihm auflud, immer gewann.
Vergiss es.
Samarkand war jedes hoch dotierte Rennen gelaufen, das es überhaupt gab, hatte fast jede bedeutende Siegprämie gewonnen. Nicht bloß in seinem Heimatland, auch in Amerika – in Churchill Downs, New York, im großen Kentucky-Derby, in Belmont und im wunderschönen Hialeah Park.
Maurice fragte sich oft, was es mit Thoroughbreds auf sich hatte. Prägte sich ihnen das Geschehen ins Gedächtnis ein? Die Starts, die Rennen, der Führring? Es ging nicht nur darum, ob Samarkand sich die alltäglichen Runden merkte, sondern ob er wichtige Dinge im Gedächtnis behielt, ob sich ihm gewisse Bilder unauslöschlich einbrannten? Momente voller Glückseligkeit, der Anblick von Heu? Erinnerungen an Newcastle oder New York, Doncaster, Cheltenham, Hialeah, die Farben, der Dress des Jockeys, die Rosen?
… die rosafarbenen, staksenden Vögel, die schillernden Sonnenstrahlen und Farben, die auf ihn zuströmten, seinem Blick hinter Scheuklappen teilweise verborgen, ein ganzer Reigen von Farben und Gesichtern, Jubelrufen und Schreien. An die Bande gedrängt (wie er das hasste) wartete er ab, bis sich eine Lücke bot, und fegte dann direkt hindurch.
Freiheit. Nichts vor sich haben, nichts neben sich haben. Selbst die Jubelrufe verebbten, bevor sie an seine Ohren drangen.
Jetzt ritten sie im Galopp. Maurice wusste, dass Samarkand die Runde in knapp über einer Minute schaffen konnte, er hatte es bereits bewiesen.
Als sie aus der Gegengeraden kamen, sah Maurice eine Gestalt mit Fernglas auf dem Hügel stehen. Der Gestütstrainer war es nicht, der kam so früh nicht heraus. Es musste Roger sein. Sein Onkel Roger kam manchmal her und sah ihm zu, bevor er nach London ins Krankenhaus fuhr.
Nicht Roger. Die falschen Hände.
DAY TRADER
1
Zwanzig Monate später
Melrose Plant blickte sich in der recht düsteren Umgebung des Grave Maurice um und überlegte, ob das Pub wohl vom Personal des Royal London Hospital frequentiert wurde, das direkt gegenüberlag. Offenbar war dem tatsächlich so, denn Melrose erkannte einen der Ärzte, der am anderen Ende des langen Tresens stand.
Während Melrose sich noch in der Nähe der Tür hielt, leerte der Arzt sein halbes Pint, griff nach seinem Mantel und wandte sich zum Gehen. Auf dem Weg nach draußen kam er an Melrose vorbei und nickte ihm mit einem zerstreuten Lächeln zu, als wüsste er nicht recht, ob oder woher er ihn kannte.
Melrose trat an den Platz, den der Arzt frei gemacht hatte, und musterte die Frau neben sich. Sie war von einer überwältigenden Schönheit – glänzendes, dunkles Haar, hohe Wangenknochen, Augen, deren Farbe er nicht recht ausmachen konnte. Sie waren groß und strahlend. Sie unterhielt sich mit einer anderen Frau, einer dunkelblonden, die Melrose den Rücken zugewandt hatte und etwas Helles trank, vermutlich einen Chardonnay, dessen Allgegenwart – zusammen mit den Weinbars, in denen er ausgeschenkt wurde – Melrose ein Rätsel war. Die Dunkelhaarige trank Stout. Braves Mädchen! Der Barmann, ein bärtiger Inder, stellte Melrose eine unverständliche Frage, hinter der dieser nur eine Abwandlung von »Was darf’s denn sein, Kumpel?« vermuten konnte. Er bestellte sich ein Old Peculier.
Das Grave Maurice konnte man mit Fug und Recht einen »düsteren Schuppen« nennen. Melrose sah sich genau um und fällte erfreut sein Urteil. Irgendwie kam es, dass er für düstere Schuppen immer etwas übrig hatte. Er fühlte sich so recht behaglich darin. Der unverständliche Barmann, das notdürftig geflickte Fenster, das angeknackste Tischbein, der verschmierte Spiegel, die Kundschaft. Die beiden Frauen neben ihm sahen etwas gepflegter aus als der Rest der Gäste. Sie waren gut gekleidet, die Dunkelhaarige sogar recht modisch in einem figurbetonten schwarzen Kostüm und dezentem Schmuck. Die Blonde, auf deren Profil Melrose einen flüchtigen Blick erhascht hatte, schien den Barmann mit seinem schlampig geschlungenen Turban zu kennen (ihn gar zu verstehen). Nachdem er ihnen lächelnd nachgeschenkt, Melrose sein Getränk gebracht und sich dann verzogen hatte, nahm die dunkelhaarige Frau das Gespräch wieder auf. Die Blonde hörte ihr zu.
Es ging um irgendjemanden namens Ryder, worauf Melrose sogleich die Ohren spitzte, denn so hieß der Arzt, der eben hinausgegangen war und den die eine Frau vermutlich erkannt hatte. Einigermaßen überrascht vernahm er dann aber, wie sie ihn als »armen Kerl« bezeichnete. Die andere, die eine leise, unaufdringliche Stimme hatte, wollte von der Dunkelhaarigen wissen, was sie damit meinte.
Melrose wartete auf die Antwort.
Leider gingen die Einzelheiten in dem Stimmengewirr unter, das Wort verschwunden schnappte er jedoch auf. Die Dunkle senkte den Kopf zu ihrem Glas hinunter und sagte noch etwas, was Melrose aber entging.
Dann hörte er plötzlich: »Seine Tochter. Es stand in allen Zeitungen.«
Die Blonde schien entsetzt. »Wann war denn das?«
»Vor fast zwei Jahren, aber es wird dadurch ja nicht …«
Der Rest der Bemerkung entging Melrose.
Die Frau zuckte am Ende unmerklich die Schultern, jedoch nicht abwertend, eher müde, überdrüssig. Womöglich des Unglücks überdrüssig. Falls sie ebenfalls Ärztin war, konnte Melrose das Gefühl von Überdruss durchaus nachvollziehen.
Dann sagte sie: »… Bruder war mein … umgekommen …«
Die Blonde seufzte voller Mitgefühl. »Wie furchtbar! Hat …«
Wenn sie doch bloß aufhören würden, erst deutlich zu sprechen und dann wieder zu flüstern! Melrose, der sich immer wieder einredete, ihm bliebe ja gar nichts anderes übrig, als diesem Gespräch zu lauschen, hätte mit seinem Bier natürlich auch an einen Tisch gehen können. Doch er wollte mehr über die Tochter dieses Arztes erfahren, denn es klang faszinierend. Der Ausdruck »armer Kerl« deutete wohl auf eine unglückselige Geschichte hin, und für so etwas war er immer zu haben. Da war man doch froh, nicht in der Haut eines anderen zu stecken. Schauerlich!
Dann vernahm er etwas über eine Versicherung, und die Dunkle ließ sich über Südamerika und wärmere Gefilde aus.
Offenbar plante sie eine Reise. Das interessierte ihn nun gar nicht, er wollte lieber mehr über die Person erfahren, die verschwunden war. Gelegentlich drehte sich die Blonde herüber, um ihre Zigarette aufzunehmen, und Melrose konnte Gesprächsfetzen aufschnappen.
»… die Tochter dieses Arztes?«
Die Frau ihm gegenüber nickte. »Dann hört es für ihn also nie auf … einen Schlusspunkt setzen.«
»Den Ausdruck hasse ich«, versetzte die Blonde mit leisem Lachen.
(Melrose war bereit, sie vom Fleck weg zu heiraten. Innerlich zollte er ihr Beifall. Er hasste den Ausdruck ebenfalls.)
»Es bedeutet doch bloß, dass etwas nicht abgeschlossen ist, unbeendet. Sagt man denn nicht so?«
Der Blonden war nicht nach Wortklauberei zumute. »Das gibt es doch sowieso nie«, sagte sie und glitt von ihrem Barhocker.
»Was?« Die Dunkelhaarige war verwirrt.
»Einen Schlusspunkt. Irgendwie bleibt doch immer alles unbeendet.«
Die Dunkle seufzte. »Vielleicht. Der arme Roger.«
Roger Ryder, dachte Melrose. Als die Blonde Melrose beim Lauschen ertappte, lächelte sie ihn etwas betrübt an. Er tat, als merkte er es nicht, obwohl es schwer war, diesen Mund und dieses Haar nicht zu bemerken. Melrose bezahlte sein Bier und rutschte vom Barhocker.
Seine Tochter. Vor zwei Jahren war ihr etwas zugestoßen, aber nicht der Tod. Der Tod wäre ein endgültiger Abschluss gewesen. Das Mädchen war verschwunden. War etwas in Südamerika passiert? Nein, dachte er, das musste eine ganz andere Geschichte sein. Andererseits, dass Ryders Tochter verschwunden war – das
2
Letzte Woche hatte Melrose mehr Zeit in Jurys Krankenhauszimmer verbracht als anderswo. Sechsunddreißig Stunden lang hatte Jury im Koma gelegen, in das er, kurz nachdem Melrose ihn auf dem Bootssteg gefunden hatte, gefallen war, so als brauchte er selbst nicht mehr so sehr an seinem Leben festhalten, da dies ja jetzt jemand anderes für ihn tat. Eigentlich hatten Melrose und Benny ihn gefunden. Melrose und Benny und der Hund Sparky. Na, in jedem Fall Sparky! Und weil Sparky Jury quasi das Leben gerettet hatte, war Sparky der Hund des Tages, der Hund aller Hunde, der Held aller Helden. Hätte Benny nicht am Victoria Embankment nach Sparky gesucht, wäre Richard Jury jetzt tot.
»Gar keine Frage«, hatte Dr. Ryder gesagt. »Zwanzig Minuten später – und …?« Den Rest hatte der Arzt schulterzuckend offengelassen.
Schwester Bell, Jurys Krankenschwester, hatte (mehr als einmal) gesagt: »Haben Sie ein Glück gehabt, mein Junge«, und Jury dabei resolut die Kissen in seinen Rücken geschubst, um sie aufzuschütteln.
Was übrigens in den Augen von Melrose das Einzige war, wozu sie taugte. Melrose fand dieses »Glückspilz«-Gerede einfach fürchterlich. Wären Jurys Gliedmaßen in tausend Stücke zerfetzt worden und bloß ein Arm – nein, nein, sagen wir, bloß ein Armstumpf übrig geblieben, würde Schwester Bell immer noch behaupten: »Haben Sie ein Glück, dass Sie wenigstens noch Ihren Stumpf haben. Hätte ja schlimmer kommen können.«
Sobald sie sich in ihrer vor Wäschestärke knackenden Schwesterntracht davongemacht hatte, trat Melrose ans Bett und wurstelte die Kissen wieder durcheinander.
»Was zum Teufel soll das?«, sagte Jury verdrießlich. »Nicht genug, dass diese alberne Schwester hier ständig herumtanzt!«
»Ich will sie nur ein bisschen ent-schütteln. Bitte sehr!«
In alter Frische ließ sich Sergeant Wiggins von seinem Stuhl herüber vernehmen: »Dann kommt sie bloß wieder und schüttelt sie noch mal auf.«
»Mist!« Melrose kehrte zu seinem Klappstuhl zurück. Wiggins hatte den einzigen halbwegs bequemen Stuhl mit Armlehnen ergattert und kostete dies genüsslich aus, während er einen Früchtekorb durchwühlte, den Scotland Yard mit den besten Genesungswünschen geschickt hatte.
»Warum«, fragte Jury, »sind Sie eigentlich so schlecht gelaunt? Sie sind doch nicht angeschossen worden.«
Melrose schaute aus dem Fenster. »Wenn ich Ihre Krankenschwester sehe, fällt mir immer eins meiner Kindermädchen ein.«
»Und dann verfallen Sie wieder in Ihr kindisches Getue. Ich muss schon sagen, sehr erwachsen!«
Wiggins’ gelinde Herablassung rührte daher, dass er vor nicht allzu langer Zeit selbst im Krankenhaus gelegen hatte (er hatte allerdings vorher nicht im Kugelhagel gestanden). Nun überreichte er Jury ein Taschenbuch mit den Worten: »Das hat Mr. Plant mir persönlich gebracht, als ich im Royal Chelsea lag.« Er sagte es, als sei es ein Familienerbstück. »Ich glaube, es wird Ihnen gefallen. Es handelt mehr oder weniger von unserer misslichen Lage.«
Unserer?, wunderte sich Jury und dankte Wiggins. »Alibi für einen König«, sagte er. »Von Josephine Tey.« Er betrachtete den Umschlag und fragte sich, inwiefern es von »unserer« misslichen Lage handeln sollte. »Wissen Sie beide eigentlich, dass Sie viel mehr Profit aus meinem Krankenhausaufenthalt schlagen als ich?« Er blickte zunächst Melrose an. »Sie kommen mit Ihren Kindheitsaggressionen ins Reine, und Sie« – er wandte sich an Wiggins – »durchleben noch einmal Ihr Krankenhausabenteuer in South Ken.«
»Na, na –« Schwester Bell war schon wieder da. »Wir dürfen uns doch nicht aufregen und ärgern.« Sie reichte Jury einen Plastikbecher mit Strohhalm. »Damit fühlen Sie sich gleich viel, viel besser.«
»Ich fühle mich doch schon viel, viel besser.« Beim Anblick des Bechers verzog er das Gesicht.
»Als ich drei war«, sagte Melrose, »hatte ich genau so einen Becher. Bloß konnte ich ohne Strohhalm trinken.«
»Ach, und jetzt haben Sie auch noch Besuch von Ihren Freunden –«
Jury blickte sich suchend im Zimmer um. »Wo, wo?«
Schwester Bell machte sich wieder über die Kissen her. »Sie bringen Ihre Kissen ja ordentlich durcheinander, was?« Sie ging.
An Wiggins, der mit dem Kopf – doch ungeköpft – immer noch im Tower von London war, waren die letzten fünf Minuten unbemerkt vorübergegangen. Er war wieder bei Josephine Tey und Alibi für einen König. »Sie wollen doch bestimmt was, an dem Sie sich die Zähne ausbeißen können, solange Sie hier liegen. Um nicht ganz einzurosten –«
»Wie kommen Sie denn darauf? Was soll bei mir denn überhaupt einrosten?«
Wiggins ging einfach darüber hinweg: »Also, es geht darum, der Detective Inspector in diesem Buch muss im Krankenhaus liegen, und eine Freundin bringt ihm ein paar Bücher, unter anderem eins über Richard den Dritten und die Prinzen im Tower. Die Geschichte kennen Sie doch noch, oder?«
»Sie werden lachen, ja. Die ist ja auch ziemlich bekannt.«
»Dieser Detective« – er deutete auf das Buch – »liest das also und kommt irgendwann zu dem Schluss, dass die ganze Geschichte von wegen, dass Richard seine Neffen hat umbringen lassen, lauter Blödsinn ist. Er recherchiert also und recherchiert, lässt sich von seiner Freundin Bücher bringen und kommt am Ende auf eine völlig andere Lösung. Clevere Idee, finde ich.«
»Wenn ich eine Freundin hätte, käme ich vielleicht auch drauf.« Jury blätterte die letzten Seiten durch. »Wie endet es?« Weil er Detektivgeschichten nicht mochte, besonders die nicht, in denen der Hochadel eine Rolle spielte, kam er ohne Umschweife gleich zur Sache.
Wiggins ließ sich darauf jedoch nicht ein. »Sie müssen es einfach lesen!« Wiggins lächelte ihn an, wie man ein eigensinniges, ans Bett gefesseltes Kind anlächeln würde. »Ich könnte Ihnen aber auch Unterlagen über einen unserer Fälle bringen, dann könnten Sie sich daran die Zähne ausbeißen.«
3
Maurice war immer früh auf, im ersten Morgengrauen, wenn die Welt allmählich erwachte. Es war kalt, Raureif auf den Scheiben, Krusten von altem Schnee an den Wurzeln der Bäume, das steif gefrorene Gras glich mehr Eisscherben als einer Pferdeweide – doch er liebte diese Stimmung. Obwohl er gestehen musste, dass er eigentlich nur zu so früher Stunde hinausging, weil er dann niemanden sehen, mit niemandem reden musste und von niemandem gesehen oder angesprochen wurde. Selbst seinem Onkel Roger, der gelegentlich über Nacht dablieb und dann gern zur Rennbahn herüberkam und zusah, wie Maurice die Pferde trainierte, war es zu früh.
Vor ein paar Tagen beim Abendessen hatte Roger gesagt: »Ich habe da einen interessanten Patienten, er ist Superintendent bei der Polizei. Noch dazu bei Scotland Yard. Und … da dachte ich mir« – er lachte etwas gekünstelt –, »ich könnte ihm doch die Geschichte erzählen. Es kann natürlich sein, dass er sie schon kennt … und es ist ja auch schon zwei Jahre her –«
»Erzähl ihm«, unterbrach ihn Maurice, »die Geschichte.«
Man darf nicht aufgeben, dachte Maurice jetzt. Man darf nicht aufgeben, es zu versuchen. »Stimmt’s, Sam?« Er warf dem Pferd die Decke über, dann das Zaumzeug und den Sattel. Samarkand stupste ihn an der Schulter, als wollte er sagen: »Los, gehen wir«, und Maurice führte ihn aus seiner Box. Dieser Spaziergang vom Stall zur Bahn war für Maurice so ungefähr mit das Schönste am ganzen Tag – ausgenommen natürlich das Reiten selbst.
Keine Schule, weil immer noch Weihnachtsferien waren, die aber bald zu Ende sein würden. Eigentlich hatte er nichts gegen Schule, Disziplin war ihm noch nie schwergefallen. Es kam wahrscheinlich daher, dass er mit Pferden umging, dass er George Davison, den Ausbilder, beobachtete, dass er den Trainergehilfen und Jockeys zusah wie früher seinem Vater, damals auf Samarkand. Dieses Pferd und Dan Ryder – Sportjournalisten hatten die beiden damals »das Traumgespann des Pferderennsports« genannt.
Er dachte an seinen Vater. In jeder anderen Hinsicht war Danny Ryder kein »Traum« gewesen. Ein Pech, dass er kein Pferd ist, mit was anderem kann er nicht umgehen, hatte er die Trainergehilfen sagen hören. Kein Wunder, dass sie ihm davongelaufen ist. Maurice hatte sich lange Zeit bemüht, seine Mum nicht zu hassen. Eine schwache Frau war sie nicht gewesen, sie hätte sich gegen seinen Vater behaupten können, wenn sie es gewollt hätte. Sie war – Maurice suchte nach dem passenden Ausdruck – vage gewesen, unbestimmt. Vage, ja. Sie schien sich nie sicher gewesen zu sein, was sie eigentlich wollte. Ein seltsamer, vielleicht sogar gefährlicher Charakterzug, dachte er. Seine Mutter war klein und hübsch gewesen, Amerikanerin. Sie hatte sich ebenso wenig entscheiden können, ob sie ein Kind haben wollte, wie sie sich nicht entscheiden konnte, ob sie New York verlassen oder ein bestimmtes Restaurant oder Kleid wählen sollte. Marybeths Devise war definitiv das Abwarten-und-Teetrinken, sie war ein eher fauler als bedächtiger Mensch. Aber ganz sicher nicht leichtfertig. Nein, Leichtfertigkeit war eine Eigenschaft seines Vaters.
Fast schien es so, als wäre es ihr nicht schwergefallen, von hier wegzugehen. Als wäre er, Maurice, nicht mehr als eine schlechte Stimmung, der sie entfliehen wollte. Etwas in der Richtung hatte er den Gesprächen zwischen seinem Großvater und seinem Onkel entnommen. Maurice empfand Mitgefühl mit Roger. Er war nett. Etwas distanziert, aber nett. Und während der vergangenen zwanzig Monate war diese Distanziertheit weiß Gott verständlich. Maurice spürte selbst eine gewisse Distanz zu den anderen. Und auch weil die Schuld so schwer auf ihm lastete, hätte er, nachdem Nell verschwunden war, zu niemandem gehen können, um Trost zu suchen.
»Irgendwie seltsam, Dr. Ryder. Wieso hat Ihre Kleine hier draußen geschlafen?«
Die Haut um Rogers Mund war sehr weiß, papierdünn und verkniffen, und als er den Atem einsog, klang es mehr wie ein Keuchen, als wüsste er nicht mehr, woher er den Sauerstoff nehmen sollte.
Maurice war seinem Onkel Roger und den Ermittlungsbeamten in den Stall gefolgt. Er war hinten an der Tür stehen geblieben und hatte zugehört, hatte ihren Namen hören wollen, als könnte ihn dessen Erwähnung aufmuntern und sie zurückholen.
In der Nacht hatte sein Großvater mit Roger zusammengesessen, hatte seinem Sohn den Arm um die Schulter gelegt.
4
»Sie sehen heute Morgen bemerkenswert gut aus, Superintendent.« Dr. Roger Ryder warf erneut einen Blick auf Jurys Krankenblatt und lächelte. »Sie sind wirklich nicht unterzukriegen.«
»Gut«, sagte Jury, »aber sagen Sie mir jetzt nicht, ich hätte Glück gehabt, dass ich überhaupt noch lebe. Schwester Bell erinnert mich ein Dutzend Mal am Tag daran.«
Ryder lachte. »Nein, irgendwie setze ich drei Schusswunden nicht gleich mit Glück. Sie fühlen sich aber doch recht gut, nicht? Ich meine, emotional und auch körperlich?«
»Absolut. Wann wollen Sie mich denn wieder in den Hexenkessel der Polizeiarbeit schmeißen?«
»Ach. Was Ihre Entlassung betrifft, denke ich, zwei bis drei weitere Tage sollten eigentlich reichen. Aber was die Polizeiarbeit angeht, na, na …« Dr. Ryder hob mahnend den Zeigefinger. »Das muss noch ein paar Wochen warten. Ist Ihnen denn langweilig?«
Jury hielt Alibi für einen König in die Höhe. »Ich habe ja hier was zur Unterhaltung. Darin geht es um einen Polizisten, der im Krankenhaus liegt und sich mit dem historischen Fall von Richard dem Dritten befasst, der seine beiden Neffen ermordet haben soll. Weil er ihn aber leider löst, bleibt mir nichts mehr zu tun.« Dr. Ryder schien zu zögern. Er sah immer wieder zur Tür, ging aber nicht hinaus. »Stimmt etwas nicht?«
»Ich dachte mir nur …«, Ryder lächelte und versuchte, seine Aufregung im Zaum zu halten, »ob Sie sich vielleicht Gedanken über einen echten Fall machen möchten. Über Fakten, nicht Fiktion. « Ryder ging zu dem einzigen intakten Stuhl hinüber und legte das Krankenblatt auf dem Boden ab.
»Natürlich. Erzählen Sie.«
»Es geht um meine Tochter. Sie haben vielleicht davon gelesen oder gehört. Es geschah vor fast zwei Jahren. Sie ist verschwunden.«
Jury schloss einen kurzen Moment die Augen. Zwar hatte ihm Melrose Plant von dem Gespräch erzählt, das er im Pub belauscht hatte, doch es kam trotzdem unvorbereitet. Verschwunden. Gab es denn ein Wort, in irgendeiner Sprache, das einem mehr zu Herzen ging als dieses? Es ließ ihn frösteln. »Mein Gott. Wie alt ist sie?« Er nahm sich vor, von dem Mädchen in der Gegenwartsform zu sprechen.
»Heute wäre sie siebzehn. Damals war sie fünfzehn. Nell ist aber nicht davongelaufen.« Mit einer Stimme, die bestimmt immer zitterig klang, wenn er von ihr sprach, berichtete ihm Ryder, was damals geschehen war. »Es war vorher schon schlimm genug, wurde aber noch schlimmer, als man keine Lösegeldforderung stellte. Das brachte uns völlig zur Verzweiflung.«
»Das kann ich verstehen. Was ist mit … Könnte ich etwas Wasser haben? Mein Mund ist immer so trocken.«
»Das liegt an den Medikamenten. Das geht bald vorbei.«
»Was ist mit ihrer Mutter? Wo war sie?«
»Ihre Mutter ist tot.«
»Das tut mir leid.« Jury zögerte. »Sind Sie sich ganz sicher, dass Ihre Tochter nicht aus eigenem Entschluss weggegangen ist?«
»Von zu Hause weggelaufen, nein.« Mit einer nervösen Geste rieb Roger sich über die Wange. »Ich weiß, das sagen alle Eltern, aber Nell war wirklich ein sehr zufriedenes Kind. Im Gegensatz zu Maurice – das ist Dannys Sohn –, der es nie verwinden konnte, dass seine Mutter ihn im Stich gelassen hat. Aber wieso sollte Nell nicht glücklich gewesen sein? Für Kinder ist so ein Gestüt doch – ein Idyll.«
Ein Idyll, dachte Jury, hat die böse Eigenschaft, sich an der Realität empfindlich zu stoßen, falls es überhaupt je ein Idyll war. Roger Ryder schien als Arzt alles kritisch zu hinterfragen, als Vater jedoch vermutlich nichts. Solche wohlmeinenden, ihre Kinder über alles liebenden Eltern waren nichts Ungewöhnliches und eigentlich konnte man es ihnen nicht anlasten, dass sie nicht wussten, was in den Köpfen und Herzen ihrer Kinder vor sich ging.
Roger stand auf und ging zum Fenster hinüber, wo er den Arm gegen den Rahmen stützte und den Kopf zur Scheibe neigte, als hoffte er aus seinem Spiegelbild irgendeine Erkenntnis zu schöpfen, sagte jedoch nichts.
»Wie hat Nell den Tod ihrer Mutter aufgenommen?«
»Sie hat es akzeptiert, war relativ gelassen.«
Nein, war sie nicht. Sie wirkte nur so.
»Ihr Bruder wurde von seiner Frau verlassen.«
Roger nickte. »Dass Marybeth davongelaufen ist, hat mich nicht direkt überrascht. Um ehrlich zu sein, ich glaube auch nicht, dass es Danny überrascht hat. Sie war wohl so eine Art Vorzeigefrau – Sie wissen schon, ein schönes Geschöpf, das dekorativ bei Rennen herumsteht, Blumen in Empfang nimmt, sich huldvoll verneigt und dann geht. Danny hatte immer eine Menge Frauen um sich geschart. Er hatte so eine Ausstrahlung, die auf Frauen anziehend wirkte. Er war ein Draufgänger, wahrscheinlich wollte er so die innere Leere ausfüllen, wie wir anderen meistens mit Essen, Alkohol und Zigaretten. Das alles muss ein Jockey sich ja versagen, jede nur erdenkliche Schwäche, die der Mensch so haben kann. Danny musste ständig daran denken, das eine oder andere überschüssige Pfund abzunehmen. So ein Leben ist die Hölle, und da hält man sich eben auf andere Art und Weise schadlos. Marybeth schien Maurice gegenüber völlig gleichgültig, dabei war er ein wirklich süßer Junge, ist er immer noch. Bloß furchtbar traurig. So traurig, dass es einen schon nerven kann.«
Unterschwellig glaubte Jury etwas ganz anderes als »süß« und eher in Richtung »nervend« heraushören zu können. Es konnte Eifersucht sein oder Neid oder gar geschickt im Zaum gehaltene Wut. Sein eigenes Kind, Nell, war verschwunden, während das Kind seines draufgängerischen, exaltierten Bruders noch da war. All diese Gefühle waren ins düstere Gewand von Scham oder Schuldgefühl gehüllt. »Ihre Tochter lebte bei ihrem Großvater?«
»Es war seine Idee. Er konnte sich nichts Schöneres vorstellen, als seine Enkelkinder um sich zu haben. Danny lebte in Chiswick, aber Maurice war fast ständig auf der Farm. Unsere beruflichen Verpflichtungen erlaubten es uns beiden einfach nicht, genug zu Hause zu sein, und das Gestüt ist ja eine so wunderbare Umgebung für Kinder.«
»Und Sie?«
Roger schüttelte den Kopf. »Ich muss wegen meiner Arbeit in London wohnen. Aber fast jedes Wochenende fahre ich auf die Farm.« Roger lächelte. »Vernon nennt mich immer einen Glückspilz.«
»Vernon?«
»Mein Stiefbruder.«
»Wie meint er das?«
»Dass Dad seinen Söhnen die Verantwortung abgenommen hat. Aber eigentlich hat er es anders gemeint.« Ohne beleidigt zu wirken, lächelte Roger und sah erneut aus dem Fenster. »Vernon kam sozusagen als Dreingabe, als Dad wieder heiratete. Felicity Rice, eine äußerst sympathische, aber merkwürdig farblose Frau. Unsere Mutter war eine Schönheit gewesen. Ich habe die Geschichte mit Felicity und Dad nie verstanden. Eins kann ich Dad aber bescheinigen, eine Midlifecrisis war es nicht. Felicity war schließlich keine blonde Sexbombe. Sie ist jetzt auch schon tot.«
»Sie sagen es mit einem Lächeln. Warum?« Hinter der Maske des Arztes sah Jury den halbwüchsigen Jüngling hervorlugen.
»Nicht wegen Felicity. Wegen Vernon. Der kann Sachen sagen, ohne einen dabei bloßzustellen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Vernon ist sehr clever, sehr ehrgeizig und sehr reich. Er wohnt in einem vornehmen Penthouse in den Docklands. Und großzügig ist er. Vor einiger Zeit bekam Dad ein Darlehen von ihm. Dad wollte einen Einjährigen verkaufen, ein Fohlen, das ihm anderthalb Millionen einbringen sollte. Doch dann machte der Käufer plötzlich einen Rückzieher, und Dad brauchte Geld, um sich so lange über Wasser zu halten, bis er einen neuen Käufer gefunden hatte.«
Jury unterbrach ihn. »Anderthalb Millionen für ein Pferd, das sich noch gar nicht bewährt hat?«
Roger lachte. »Ach, das ist noch gar nichts. Diese Rennen mit Vollblutpferden sind ein lukratives Geschäft. Und das Fohlen war ein Nachkomme von Beautiful Dreamer. Haben Sie von dem schon mal gehört? Wenn Sie ein bisschen was über Pferderennen wissen, ist er Ihnen ein Begriff. Es stand außer Zweifel, dass dieser junge Hengst einmal Ausgezeichnetes leisten würde.«
»Hört sich nach einem verdammt riskanten Spiel an.«
5
»Tonbandaufnahme des Gesprächs mit Dr. Ryder«, sagte Jury und schob die Akte, die Wiggins ihm mitgebracht hatte, auf sein Tabletttischchen. »Durchgeführt von Detective Chief Inspector Gerard, Distriktspolizei Cambridgeshire. Kurz zusammengefasst: Nell Ryder, fünfzehn Jahre alt, wurde in der Nacht des 12. Mai 1994 vom Gestüt Ryder entführt. Also vor zwanzig Monaten. Das Mädchen schlief in der Box eines Pferds namens Aqueduct, das krank war, Fieber hatte. Nell Ryder übernachtete oft im Stall, wenn es einem Pferd nicht gut ging.
DCI GERARD: Sie sind ein vermögender Mann, nicht wahr, Dr. Ryder?
RYDER: Na, ich habe ein gutes Auskommen.
DCI GERARD: Oder sagen wir, das Gestüt Ryder. Ihr Vater ist ziemlich vermögend.
RYDER: Eigentlich schon. Kommt darauf an, wie man es betrachtet. In puncto Liquidität, ich meine, ob er Geld herumliegen hat, nein. Hinsichtlich seiner Zuchtpferde – der Thoroughbreds – sehr.
DCI GERARD: Wäre es leicht für ihn, Geld zu beschaffen?
RYDER: Keine Ahnung. Wahrscheinlich schon. Ich weiß, dass sein Stiefsohn viel Geld hat, und der würde ihm bestimmt helfen.
DCI GERARD: Wir sollten mit einer Lösegeldforderung rechnen.
»Dann Fragen, wo sich der Arzt in der betreffenden Nacht aufgehalten hatte. Er war im Bett und schlief, es gibt allerdings keine Zeugen dafür. Ist natürlich höchst verärgert darüber, dass man ihn für einen Verdächtigen hält. Fragen zu Nells Mutter. Sie ist tot. Über seinen Bruder, Danny Ryder, ebenfalls tot.
DCI GERARD: Ihr Bruder war doch dieser berühmte Jockey, nicht wahr?
RYDER: Ja. Einer des besten. Er ist jedes wichtige Rennen geritten. Er war ein großartiger Jockey.
DCI GERARD: Er ist ums Leben gekommen –
RYDER: In Frankreich, auf einer Rennbahn in der Nähe von Paris. In Auteuil. Sein Pferd hat ihn abgeworfen.
DCI GERARD: Ein verrücktes Leben ist das. Man ist entweder Hansdampf in allen Gassen oder denkt nur ans Essen, Essen, Essen. Lester Piggott hat sich von Champagner und einem Salatblatt ernährt. (Pause) Sie müssen entschuldigen, Dr. Ryder. Ich gerate eben manchmal ins Schwärmen.
Jury hob lächelnd den Blick. »›Ins Schwärmen.‹ Das gefällt mir. Anscheinend kennt sich Gerard bei Jockeys ein wenig aus. Die Beschreibung gefällt mir. Fragen zu den Ehefrauen der Ryders. Die des Arztes ist tot, ihr Name ist Charlotte. Die des Jockeys – Marybeth – lebt irgendwo in Amerika. Das heißt, seine erste Frau. Später heiratete er wieder. Eine Frau aus Paris. Keiner der Ryders hat sie je gesehen, deshalb weiß man auch nicht, ob sie Pariserin ist oder möglicherweise Engländerin.« Jury klappte die Akte zu und lehnte sich in seine Kissen zurück.
Melrose fragte: »Und das Lösegeld? Was war damit?« Er hatte sich den einzigen anständigen Stuhl gesichert, so dass Wiggins sich mit dem grausam unbequemen Holzstuhl begnügen musste.
»Wurde anscheinend nie gefordert.«
»Was?«
»Sie haben sie einfach so mitgenommen. Schluss, aus! Jedenfalls soweit die Polizei von Cambridgeshire Bescheid wusste. Die hat zwar eifrig nach ihr gesucht, bloß ohne Erfolg.«
»Dann«, meinte Melrose, »ging es vielleicht um das Pferd. Wie heißt es?«
»Aqueduct. Ziemlich wertvoll, speziell für Zuchtzwecke. Darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht. Wenn ein Tier zusammen mit einem Menschen vermisst wird, nimmt man doch an, dass sie es auf den Menschen abgesehen haben.«
»Die hatten nicht damit gerechnet, dass bei dem Pferd noch ein Mädchen dabei war. Glauben Sie, die mussten sie zwangsläufig mitnehmen, damit sie den Mund hielt?«
»Sehr gut möglich.« Jury sah wieder den Bericht der Polizei von Cambridgeshire durch. »Zahlreiche wertvolle Thoroughbreds: Beautiful Dreamer, Criminal Type –«
»Criminal Type. Das gefällt mir. Seltsamer Name für ein Pferd.«
»Wie Seabiscuit auch«, sagte Wiggins. »Wissen Sie, wie der Name entstanden ist? Ich meine, Seabiscuit?«
Dass Wiggins bei allem, was mit biscuit zu tun hatte, wusste, woher es stammte, sah ihm ähnlich. Er verspeiste gerade einen.
»Es gab einmal ein Pferd namens Hard Tack, also Schiffszwieback, diese Notverpflegung für Seeleute. Verstehen Sie? Hard Tack – Seemann.«
Jury und Melrose musterten ihn bloß stumm.
»Sea also bezogen auf Seemann und biscuit im Sinn von einer minderwertigen Sorte Schiffszwieback. Ziemlich clever.«
Jury und Melrose musterten ihn immer noch unverwandt und sparten sich den Kommentar.
Wiggins konsultierte mehrere Seiten in seinem Notizbuch. »Das Gestüt Ryder hat seit Nell Ryders Verschwinden ziemlich an Prestige eingebüßt. Es ist fast, als wäre sie Herz und Seele des Ganzen gewesen. War sie vielleicht auch, jedenfalls für ihren Großvater. Und dann auch noch diese Sache mit Danny Ryder. Nicht bloß ein persönlicher Verlust, sondern auch finanziell ein echter Schlag. Wenn der auf Samarkand saß, waren sie buchstäblich unschlagbar.«
»Was ist ihre Haupteinnahmequelle? Die Siegprämien?«
»Nein. Der Zuchtbetrieb. Ryder hat einen ganzen Stall voller Thoroughbreds, ehemalige Rennpferde, die aber sehr wertvolle Zuchttiere abgeben.«
»Stutenbesitzer bringen ihre Tiere also zum Gestüt Ryder und bezahlen für das Vergnügen?«
»Bezahlen einen Haufen Geld für das Vergnügen, für einen Hengst wie etwa Samarkand. Es ist allgemein übliche Praxis, habe ich gehört, Anteile zu verkaufen. Ein Besitzer zahlt, sagen wir, zwischen einhunderttausend und einer Viertelmillion für das Privileg, einmal pro Jahr eine seiner Stuten bringen zu dürfen.«
Melrose fuhr verblüfft auf. »Eine Viertelmillion? Für den Preis täte ich es selber.«
»Wer würde Ihnen schon so viel bezahlen?«, fragte Jury. »Und wie hoch wäre dann der mit den Zuchthengsten erzielte Gewinn pro Jahr?«
Erneut blätterte Wiggins in seinem Notizbuch und meinte dann: »1992 belief er sich zum Beispiel auf gut fünf Millionen.«
Jury fuhr verblüfft auf. »Was? Und das ist bloß aus der Zucht?«
Wiggins nickte. »Ja, bloß aus der Zucht.«
»Und wie viel aus Siegprämien?«
»Von Samarkand allein – das war vor zehn Jahren – 1,8 Millionen.«
»Kein Wunder, dass man es den königlichen Sport nennt«, sagte Melrose.
»Wenn man sich natürlich die andere Seite der Rechnung anschaut«, meinte Wiggins, »ist es ein außergewöhnlich kostspieliges Unternehmen. Die Leute, die für einen arbeiten, müssen zum größten Teil sehr gut ausgebildet sein. Jockeys, Tierärzte, Ausbilder, Pferdepfleger – die sind ja nicht billig zu haben. Arthur Ryder wollte nur die Besten. Allein sein Ausbilder bekam pro Jahr eine Viertelmillion, und das ist für so einen noch wenig. Es ist teuer und sehr krisenanfällig, wie die Landwirtschaft, allerdings müssen Landwirte nicht für jede Kuh und jeden Kohlrübenacker eine Versicherung abschließen. Die Versicherungssumme allein für Samarkand belief sich auf zwei Millionen. Aber seit sein Sohn Danny und dann seine Enkelin Nell fehlten, lief es bei Arthur Ryder nicht mehr so richtig. Finanzielle Widrigkeiten, Unfälle mit den Pferden, Probleme aller Art schienen Arthur Ryder heimzusuchen.«
Jury lehnte sich zurück und schloss die Augen. »›Wie einzelne Späher nicht, nein, in Geschwadern.‹«
»Sir?«
»Wenn Unheil naht. Claudius, König von Dänemark.«
Wie zur Untermauerung des Gesagten kam Schwester Bell herein.
Doch einzelne Späher nur, dachte Jury. Ein Segen!
»Ich würde sagen, Sie beide« – dabei verschränkte sie die Arme und funkelte Melrose und Wiggins böse an – »haben für heute genug Besuch gemacht. Habe ich Ihnen nicht eingeschärft, dass er« – das ungnädige Lächeln, mit dem sie Jury bedachte, war eher ein höhnisches Grinsen – »nichts von Polizeiarbeit hören darf? Er soll sich ausruhen, nicht Ihnen beiden zuhören. Ihnen ist wohl nicht klar, dass er dem Tod gerade noch mal von der Schippe gesprungen ist, und obwohl wir ihn diesmal wieder hingekriegt haben – noch mal haben wir vielleicht nicht so viel Glück.«
Wenn sie noch einmal sagte, wie nah er doch dem Tode gewesen war, würde er ihr eine Ohrfeige verpassen, schwor sich Jury. »Sie sind noch nicht ganz über den Berg, mein Junge«, meinte sie. »Sprechen Sie also heute Abend ein Extragebet.«
Melrose sagte: »Das ist doch lächerlich! Gesünder hat er nie ausgesehen. Man merkt ihm kaum an, dass er angeschossen wurde. Das kommt von Ihrer ausgezeichneten Pflege.«
6
Dass Vernon Rice Geld »machte«, konnte man wohl behaupten. Er besaß eine eigene Anlagefirma in der City, in der er jede Menge Geld hin und her bewegte, sowohl für sich selbst wie für seine Geschäftspartner. Start-ups, also junge, neue Firmen, hatten es ihm besonders angetan, doch obwohl er seine Klienten vor stark schwankenden Unternehmen warnte, nahmen sie seinen Rat nicht immer an. Ihn wunderte bloß, wie sorglos manche Leute mit ihrem Geld umgingen, wie leicht sie sich davon trennten, wenn sie nur Wind von etwas bekamen, das vielversprechend aussah (es vermutlich aber nicht war). Wie Hunde auf der Fuchsfährte führten sie sich auf.
Vernons Tage (und viele seiner Nächte) drehten sich ums Geld. Am meisten warf seine kleine Investmentfirma in der City ab, bestehend aus ihm selbst, seiner Empfangssekretärin und seinen beiden jungen Assistenten Daphne und Bobby. Die beiden beobachteten für ihn das tägliche Finanzgeschäft, informierten ihn über wichtige Transaktionen und erledigten selbstständig Tagesgeschäfte. Er hatte die beiden mehr oder weniger von der Straße weg bei sich eingestellt und es nie bereut.
Daphne hatte etwas verloren ausgesehen, als Vernon ihr damals nicht weit von der Börse an der Kreuzung Threadneedle und Old Broad Street begegnet war. Sie war ihm aufgefallen, weil sie einfach dort stand und keine Anstalten machte weiterzugehen. Ihr dunkles Haar quoll in Löckchen unter einer engen, grauen Wollmütze hervor, von der zwei kleine graue Ohren abstanden. Mit ihren Locken, dem glatten, ovalen Gesicht, den staunenden braunen Augen und – natürlich – diesen Öhrchen schätzte Vernon sie auf irgendetwas zwischen zwölf und zweiunddreißig.
Obwohl sie vermutlich glauben würde, er wollte sich an sie heranmachen, ging er das Risiko ein, denn er konnte weder ihrer offensichtlichen Zwangslage noch den Ohren an der Wollmütze widerstehen. »Verzeihen Sie, denken Sie jetzt nicht, ich will Sie aufreißen oder so, aber Sie haben anscheinend Schwierigkeiten, äh, von der Stelle zu kommen. Ich meine, es ist wohl weniger das übliche Problem ›welche von den beiden Straßen ist eigentlich die richtige?‹ als das Dilemma ›Was suche ich eigentlich hier?‹. Und da dachte ich mir, vielleicht kann ich Ihnen behilflich sein.« In dem Stil redete Vernon weiter und konnte gar nicht mehr aufhören, ihr sowohl ihre schwierige Lage als auch sein Hilfsangebot auseinander zu setzen. Endlich verstummte er einfach, während sie ihn stumm anstarrte, während die Passanten von der London Bridge her in alle Richtungen strömten – und viel zu viele an der Zahl, jedenfalls laut T.S. Eliot.
Er brachte T.S. Eliot sogar in seinem Sermon unter, bevor er schließlich aufhörte.
Sie blinzelte abwartend zu ihm hoch. Dann sagte sie: »Sind Sie fertig, ja? Haben Sie’s jetzt? War’s das für Sie? Durch? Zu Ende? Vorbei? Finito? Wär’s das dann?«
Er nickte, wollte schon wieder etwas sagen und hielt inne, als sie die Hand hob. »Nein, jetzt ist der Rest der Welt auch mal dran. Vor einer halben Ewigkeit haben Sie mich gefragt, glaub ich jedenfalls, dass Sie mich gefragt haben, wieso ich nicht hier rüber oder da rüber gehe. Die Antwort lautet: Hier rum oder da rum bleibt sich gleich, und ich seh nicht ein, wieso ich mich entscheiden soll. Also kann ich nicht auf die andere Seite rüber. Es ist sozusagen ein existentieller Wendepunkt. Ich kann weder hier hin noch da hin.«
»Hmm.« Er überlegte, ob er darauf etwas erwidern sollte. Da sie ihn nicht vor einen herannahenden Doppeldeckerbus geschubst hatte, als er hmm gemacht hatte, könnte er es vielleicht wagen. »Wie wär’s, wenn Sie keine der beiden Straßen überqueren?«
»Wie wär’s –?« Wieder blinzelte sie ihn an, als fände sie ihn unfassbarer als eine Heiligenerscheinung. »Entschuldigen Sie mal, aber das hab ich doch gerade die ganze Mittagspause lang erklärt.«
»Nein, nein. Ich meine, wieso gehen Sie nicht einfach zurück?« Vernon warf einen Blick über die Schulter. »Wieder auf dem Gehweg zurück, auf dem Sie schon sind. Da hinten ist ein Coffeeshop, wo ich uns beiden gern einen Espresso oder einen Latte spendieren würde.«
Sie überlegte. »Das Gesöff hasse ich. Aber einen ganz normalen Kaffee könnte ich schon gebrauchen.«
»Dann gehen wir!«
Sie saßen an der Theke und tranken schlichten Kaffee, sie mit (er zählte) fünf Stückchen Zucker, und Vernon fragte Daphne, wo sie wohnte. »In Disneyland?«
»In Clapham. Kommt aufs Gleiche raus.«
»Und wo arbeiten Sie?«
»Nirgends. Sie kennen doch die Schauspieler, die sagen, sie ›machen eine schöpferische Pause zwischen zwei Stücken‹? Ich ›mache eine schöpferische Pause‹ zwischen Barbedienung im George und Aushilfsverkäuferin bei Debenham’s.«
»Kennen Sie sich ein bisschen mit dem Aktienmarkt aus?«
»Na klar. Mein Portfolio ist in fünfzehn Bereiche gesplittet.«
»Macht Sie dieses Leben als das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern so sarkastisch?«
Die Vorstellung gefiel Daphne offensichtlich. Sie lachte auf eine Art, in der manche Leute niesen, ein Ah-ha-ah-ha-ah-ha, das dann in einen knappen Knall überging.
»Ich frage, weil ich Sie vielleicht brauchen könnte.«
»Das bezweifle ich.« Sie trank ihren Kaffee und starrte die nachgemachten Jahrhundertwende-Plakatschilder an.
Vernon ignorierte diese Antwort. »Wenn Sie, sagen wir, ein Köpfchen für Zahlen haben?« Was er beim Anblick des Köpfchens mit den zwei Öhrchen allerdings bezweifelte.
Die Tasse in beiden Händen, musterte sie ihn etwas skeptisch. »Ehrlich gesagt, darin bin ich gut. Mein Mathestudium an der Uni habe ich mit sehr gut abgeschlossen.«
»An welcher?«
»Oxford.«
Vernons Augenbrauen schossen fast bis zum Haaransatz hoch. »Oxford? Sie?«
Sie wandte sich zu ihm hin und blinzelte ihn wieder so typisch an. »Denken Sie, ich bin blöd, bloß weil meine Mütze Ohren hat?«
Vernon bot ihr auf der Stelle einen Job an. Auf der Stelle lehnte sie ab.
Schließlich überredete er sie dazu, für ihn zu arbeiten, wobei er sich bewusst war, dass sie sich auch als Katastrophe entpuppen könnte und wahrscheinlich versuchen würde, seine Anteile an British Telecom loszuschlagen, sobald der Kurs ein bisschen in den Keller ging. Doch ihren scharfen Sinn für Humor fand er erfrischend. Und die verdammte Mütze unwiderstehlich.
Bei Bobby verhielt es sich dagegen ganz anders.
Bobby (der ebenfalls alles zwischen zwölf und zweiunddreißig sein konnte) rammte ihn mit dem Skateboard. Bobby behauptete, er müsse als »Kurier« in Vernons Gebäude ein Dokument ausliefern. (Dabei hielt er wie zum Beweis einen großen braunen Umschlag in die Höhe.) Er hatte Vernon unten im Foyer umgenietet, ihm aufgeholfen und gleich einen Schwall von Entschuldigungen losgelassen. Eine Dialektik der Entschuldigungen, konnte man es nennen, sozusagen als Basis für künftige Entschuldigungen, falls diese notwendig sein sollten.
»Sie gehören zu einem Kurierdienst, bei dem man Skateboards benutzt?«
»Nein. Aber mein Fahrrad ist kaputt und jetzt nehm ich so lange einfach das hier. Aber sagen Sie denen nichts!«
»Ich? Und wenn sie mir heiße Schürhaken in die Augen bohrten, ich würde nichts verraten.«
Dann wollte Bobby wissen, für welche Firma er arbeitete. Als Vernon sagte, für seine eigene Investmentfirma, fragte Bobby, ob er ihm vielleicht einen guten Hedgefond empfehlen könnte und was er denn von dieser neuen Firma namens Sea ’n’ Sand hielte?
»Woher wissen Sie Bescheid über Sea ’n’ Sand?« Es war ein nagelneues Reiseunternehmen, das sich ausschließlich mit Kreuzfahrten und Strandurlaub befasste. Seine steigende Beliebtheit schrieb Vernon hauptsächlich der erstklassigen Werbe- und Anzeigenabteilung zu, denn im Hinblick auf Zielorte und Service bot es eigentlich nichts Neues.
»Wahrscheinlich daher, woher Sie’s auch wissen«, meinte Bobby achselzuckend. »Ich persönlich glaube, die werden erst groß rauskommen und dann im Sand versickern.«
Und Bobby redete weiter. Er wies Vernon darauf hin, dass der Dow-Index wahrhaftig kein Stimmungsmesser war und keinen Einfluss auf das hatte, was so lief. Er beruhte nämlich zu stark auf Industriewerten. »Ich meine, wo ist denn Yahoo!? Wo ist Macintosh? Wo sind denn die Hightechfirmen?« Bobby war ein Tageshändler, »immer mit einem Auge auf den Finanzwerten. Immer.« Finanzgurus vom Schlage Hortense Stud (deren Nachname, also Hengst, ihren Konkurrenten Zündstoff für endlose Spitznamen lieferte) ließ er links liegen, die sei doch, sagte er, ein Michelin-Reifen mit einer großen undichten Stelle.
Während die dringende Nachricht im braunen Umschlag bereits Moos ansetzte, redete Bobby wie ein Buch. Er fragte Vernon, was er von SayAgain hielte, einer angeblich total angesagten neuen Firma im Mobiltelefonkrieg, die Geräte für extrem Schwerhörige vertrieb. Sie sollte mit CallBack fusionieren, hieß es – »Darüber wissen Sie ja Bescheid, oder? Auch wenn es – pst! – noch ganz geheim ist?« Vernon hatte keinen blassen Schimmer. Er biss sich in den Hintern, weil er nicht daran gedacht hatte. Verdammt! Bobby sagte, er hätte einen Blankoverkauf vor, wenn die Fusion stattfand, denn wenig später bekämen die Imagedoktoren von CallBack bestimmt Ärger wegen Anzeigen, in denen Mummelgreise mit diesen Telefonen hantierten. »Erinnern Sie sich«, sagte Bobby, »an Planet Hollywood?« Dabei vollführte er mit der Hand eine Abwärtsspirale.
»Abserviert!«, sagte Vernon.
Bobby redete, sein Skateboard und den Umschlag fest an sich gedrückt, wie ein Wasserfall. Er war genau so schlimm wie Vernon damals, als er Daphne begegnet war. Also bot Vernon ihm auf der Stelle einen Job an. Im Gegensatz zu Daphne nahm Bobby ihn auf der Stelle an.
Vernon hätte mit Leichtigkeit jedem ein eigenes Büro zur Verfügung stellen können, doch sie bestanden darauf, zusammenzubleiben. Er nannte sie Daffy, sie nannte ihn Bobby. Sie stritten sich über alles – über Kleinaktien, Börsengänge, Blankoverkäufe. Oft artete es in Raufereien aus. Na und?, sagte Vernon zu Samantha. Sollen sie raufen. Sie sind jedenfalls Spitze.
Im Gegenzug beteten die beiden Vernon förmlich an. Er hatte sie davor bewahrt, mit dem Skateboard Leute umzunieten und unschlüssig an Straßenecken herumzustehen.
Vernon lebte allein in einer Penthouse-Wohnung mit Themseblick, weißen Wänden und drei offenen Kaminen, ausgestattet mit eckigen Möbeln von Le Corbusier, Mies van der Rohe und anderen wichtigen europäischen Designern. Er hatte nie geheiratet. Er war sechsunddreißig Jahre alt. Er genoss die Gesellschaft von Frauen, von gleich zweien, von denen eine Janet hieß, eine attraktive Brünette, die es in den Karten oder den Sternen zu lesen glaubte, dass sie heiraten würden. Wie sie darauf kam, wusste er nicht, da er es nie vorgeschlagen hatte und auch nie vorschlagen würde. Bei der anderen Frau handelte es sich um eine Luxusnutte namens Taffy, die er Janet eigentlich vorzog, jedenfalls auf sexuellem Gebiet – was sich auch so gehörte, verständlicherweise, immerhin legte er für die zwei Stunden, die sie ihm widmete, fünfhundert Pfund hin. Taffy machte ihrem Namen alle Ehre – glatt und weich und golden wie Sahnekaramell. Sie schmeckte auch so und streckte sich ebenso in die Länge. Obendrein besaß sie Fantasie (nun, wie gesagt, für den Preis sollte sie die auch haben).
Vernon gefiel sein Leben. Es gefiel ihm, nach Hause zu kommen in seine weiße Wohnung mit den eleganten Möbeln, den blank polierten Fußböden, dem Aquarium, das er sich für dreißigtausend Pfund in eine Wand hatte einbauen lassen, flankiert von Bildern von Pollock und Hockney. Sein Kater fungierte als Aufseher über dieses ganze Arrangement. Er wusste, dass Barneys scheinbar entspannte Haltung – Schwanz um den Oberkörper geschlungen, Pfoten in den Brustkorb geringelt – einen wachen Geist verbarg, der nur darauf sann, ins Aquarium zu gelangen. Vernon hatte Barney damals aufgelesen, als der in der Nähe des Town of Ramsgate Pub am Fluss entlanggeschlichen war. Vermutlich erinnerte sich das Tier an bessere Zeiten, als die Hausdurchgänge noch voller Mülleimer standen und täglich eingelegter Aal auf dem Speiseplan stand. Was Vernon an Katzen bewunderte, war ihre Eigenständigkeit. Sie bellten einen nicht dauernd an, damit man sie Gassi gehen ließ. Barneys »Gassi« war der Patio, wo er die nächtliche Stimmung über der Themse betrachten konnte. Der Patio war etwas ganz Prächtiges und Exotisches mit Palmen, Hibiskusbüschen und Obstbäumchen. Vernon war zwar kein Gärtner, kümmerte sich aber liebevoll um alles, und die Pflanzen und Bäume gediehen üppig. Bestimmt lag es am Londoner Regen, dachte er, der meist als schwerer Dunst oder Nieselregen herunterkam und die Pflanzen eher mit Wasser umwehte als peitschte.
Janet mochte keine Katzen, sie fand sie verschlagen. »Im Gegenteil«, sagte Vernon, »sie sind vollkommen offen in ihrer Missachtung von Regeln oder wenn sie einem die Shrimps vom Teller stibitzen.«
»Du weißt schon, was ich meine.«
Eigentlich wusste er es nicht. Es ärgerte ihn maßlos, dass sie »du-weißt-schon-was-ich-meine« für eine Antwort hielt.
An diesem Punkt seines abendlichen Heimkehrrituals mixte er sich immer eine Karaffe Manhattans, wenn er in Art-Deco-Stimmung war, oder Martinis, wenn ihm nach einem richtigen Drink zumute war. Eben war er dabei, die Zutaten zehn zu eins zusammenzurühren. Er ließ den Rührstab gegen die Karaffenwand klicken, schenkte den Drink in ein Stielglas, in das er ein hauchdünnes Stück Zitronenschale gegeben hatte, und nippte: kalt und knapp, scharf wie eine Messerkante.
In den letzten Wochen hatte er sich beim Genuss dieses Heimkehr-Martinis immer eine neue Internet-Firma ausgedacht. Er hatte bereits an ein paar Treffen der Anonymen Alkoholiker teilgenommen, nicht weil er es nötig hatte, sondern weil er sehen wollte, was sie verkauften und vor allem wie sie ihre Sache verkauften! Kein Wunder, dass diese Organisation so erfolgreich war. Was dort angeboten wurde, war Folgendes: erstens Erlösung, zweitens überall Freunde – in jeder Stadt, jedem Land auf dem Erdball – und drittens die Rückkehr der Kindheit. Zumindest diese drei Dinge und noch eine Menge andere dazu. Wahrscheinlich hörten die Mitglieder deswegen auf zu trinken, weil sie überhaupt keine Zeit mehr dafür hatten.
Würde er denn auf seine zwei Martinis vor dem Abendessen verzichten und über sich bestimmen lassen? Nein, würde er nicht, im Gegensatz zu vielen anderen Leuten. Das konnte man bei den AA haben, zusätzlich zu endlosen Abenden voller Verständnis und Akzeptanz, bei denen niemand versuchte, auf einen loszugehen, einen übers Ohr zu hauen oder auf einem herumzureiten. Da bekam man in Gestalt eines wohlmeinenden Vereins seinen Daddy zurück, für Vernon eine absolut furchterregende Vorstellung, nicht weil er seinen Vater nicht wiederhaben wollte, sondern weil er auf jegliche Unterstützung verzichten konnte.
Er fand es interessant, dass jeder beliebige Alkoholiker auf die Frage »Was wünschen Sie sich am meisten auf der Welt?« mit größter Freude antworten würde: »Einen Drink!« Doch das war Selbsttäuschung, denn etwas anderes wollten sie noch viel mehr: Erlösung, Daddy, bedingungslose Akzeptanz – eines davon oder alle drei, wobei Vernon vermutete, dass sie sich miteinander vermischten wie Stolichnaya und trockener Vermouth.
Seiner Start-up-Firma verpasste er den Namen SayWhen.
Geld vermittelte Vernon das gleiche prickelnde Gefühl, von dem er wusste, dass Arthur Ryder es verspürte, wenn er Aqueduct dabei zusah, wie er den Goldpokal in Cheltenham gewann, und zwar nicht ein-, sondern zweimal, und beim zweiten Mal auch noch mit dreiundzwanzig Pfund zusätzlichem Gewicht. Trotzdem konnte er Arthur nicht begreiflich machen, dass sich die Zuchtprämien vervierfachen würden, wenn er das Gestüt Ryder als Aktiengesellschaft eintragen ließe, an die Börse ginge und Kapitalemissionen anbieten würde, indem er etwa Zuchtanteile von Beautiful Dreamer und Samarkand verkaufte. »Es würde Millionen einbringen, Art.«
»Ich will aber keine Millionen, Vernon.«
Vernon war viel zu nett, seinen Stiefvater darauf hinzuweisen, dass er vor zwei Monaten noch sehr gern wenigstens eine knappe Million gehabt hätte.
»Jetzt hör zu, Art. Schau doch mal, was sie in den Staaten mit Pferden wie Seattle Slew gemacht haben. Bloß für eine Paarungssaison haben sie eine Dreiviertelmillion eingestrichen. Multiplizier das mit der Anzahl von Deckungen bei einem Pferd wie Aqueduct. Dann multiplizierst du es noch mal mit der Anzahl der Hengste, die du zur Zucht hast.«
Arthur setzte seinen abendlichen Stallrundgang fort, Vernon begleitete ihn. »Vernon, damit verdienst du dir deinen Lebensunterhalt? « Er schüttelte den Kopf. »Wieso spielst du nicht einfach Poker?«
»Weil das hier mehr Spaß macht. Ich will dir doch nur helfen. Was ist mit Fohlenanteilen? Das wird auch immer beliebter.«
»Fohlenanteile? Du liebe Güte.« Arthur schüttelte bloß den Kopf.
Es stimmte, dass Vernon ihm helfen wollte. Ihm lag sehr daran, die Geldsorgen seines Stiefvaters zu mildern. Darüber hinaus würde es ihm natürlich Spaß machen, Pferde vom Gestüt Ryder an der Börse zu handeln. In den vergangenen zwanzig Monaten hatte es noch ein zwingenderes Motiv gegeben: Vernon hatte Arthur, und wenn es auch nur für kurze Zeit war, vom Gedanken an Nell ablenken wollen.
Denn er hatte Arthur Ryder vorher noch nie so im absoluten Stillstand verharren sehen. Das hatte nicht einmal der Tod seines Sohnes Danny fertig gebracht – ihn zu Stein erstarren lassen, ihn handlungsunfähig gemacht. Auch Roger – obgleich der täglich mit dem Tod zu tun hatte und oftmals auf äußerst schockierende Weise – kam mit Nells Verschwinden einfach nicht zu Rande. Alle beide, Arthur und Roger, hatten allzu lange in die gleiche Leere geblickt. Sich miteinander auszutauschen, dachte Vernon, verschaffte ihnen vielleicht einen gewissen Trost oder Erleichterung.
Vernon hatte versucht, die Dinge in die Hand zu nehmen. Dazu gehörte unter anderem der Großteil der polizeilichen Befragungen, da Arthur und Roger ganz am Anfang unfähig gewesen waren, etwas anderes als ja, nein und schon möglich zu antworten. Außerdem hatte Vernon den besten Privatdetektiv von London engagiert, einen gewissen Leon Stone, der dafür bekannt war, sich wie ein Chamäleon seiner Umgebung anpassen zu können. Vor neunzehn Monaten hatten sie in Vernons Wohnung gesessen, und Vernon hatte ihm die Geschichte erzählt. »Geld wollen sie anscheinend nicht«, sagte er zu Stone. »Es ist jetzt fast einen Monat her.«
»Nicht unbedingt«, hatte Leon Stone gesagt. »Vielleicht hatte man es ursprünglich auf Lösegeld abgesehen, aber dann geschah etwas, wodurch sie es sich anders überlegt haben.«
Vernon beugte sich zu Stone herüber, der in dem tiefen Ledersessel auf der anderen Seite des Couchtischs aus Glas und Mahagoniholz Platz genommen hatte. Er sagte: »Wir müssen in die Suche also alle Umstände einbeziehen, die zur Änderung ihres Plans beigetragen haben könnten. Verdammter Mist. Das ist unmöglich.«
Stone hob abwehrend die Hand. »Ich hätte hinzufügen sollen, es ist unwahrscheinlich, dass sie es sich anders überlegt haben. Wenn sie kein Geld verlangt haben, wollen sie wahrscheinlich auch keines, wie Sie schon sagten.« Er fragte Vernon, ob es eventuell einen Grund gab anzunehmen, Vater oder Großvater des Mädchens könnten beteiligt sein.
Vernon war entsetzt, vielleicht weil er es ebenfalls erwogen hatte. »Sie meinen, ob sie es vielleicht inszeniert haben? Selbstverständlich nicht!«
»So was kommt vor.« Stone zuckte die Achseln.
Während der letzten anderthalb Jahre hatte Leon Stone zweifellos sorgfältig gearbeitet und sich sein stattliches Honorar durchaus verdient. Er hatte sämtliche Gestüte in Cambridgeshire aufgesucht und auch welche in anderen Gegenden. Cambridgeshire war jedoch das Zentrum des Rennsports und der Pferdezucht.
»Wieso glauben Sie, dass dieser Schurke eventuell ein Gestüt hat?«
»Zunächst mal weil es einfach viele Pferdefarmen in dieser Gegend gibt. Und dann, weil er sich offensichtlich bei Arthur Ryder auskennt. Und weil es möglicherweise böses Blut gibt zwischen Ryder und anderen Besitzern. Mr. Rice, es könnte doch so gewesen sein: Einer oder mehrere Schurken gehen nachts zum Gestüt Ryder – nein, besser gesagt, sie waren vielleicht tagsüber dort oder irgendwann in letzter Zeit, um die Lage zu peilen, bevor sie zuschlagen. Oder der Betreffende war früher dort angestellt – als Stallbursche, Trainergehilfe, Ausbilder. Dann wäre da noch der Tierarzt. Ich habe eine Liste dieser Leute gemacht. Also, jemand kommt an diesem Abend in den Stall, warum, wissen wir nicht genau –«
»Sie meinen, sie hatten es gar nicht auf Nellie abgesehen?«
»Schon möglich. Es ist so – wenn das Zielobjekt tatsächlich das Mädchen war, dann muss der Betreffende gewusst haben, dass Nell die Angewohnheit hatte, im Stall zu schlafen, wenn ein Pferd krank war. Das würde jedenfalls den Kreis der Verdächtigen auf Familie, Freunde und Mitarbeiter eingrenzen, nicht wahr?«
Vernon nickte.
»Das ist die eine Möglichkeit«, fuhr Stone fort. »Die andere ist, die Schurken waren aus einem ganz anderen Grund dort, und Nell kam ihnen in die Quere. Weil sie etwas sah. Sie mussten sie mitnehmen, weil sie eine Bedrohung darstellte.«
»Sie glauben, die kamen wegen des Pferdes?«
Leon Stone zuckte wieder die Schultern. »Auch das ist möglich. Und zwar nicht unbedingt, um das Pferd mitzunehmen, sondern um etwas mit ihm oder den anderen Pferden anzustellen. Es sind ja höchst wertvolle Zuchthengste.«
7
Immer wenn er draußen war und nicht mehr auf festem, vertrautem Boden stand, überkamen ihn Angstattacken. Sooft das geschah, holte sich Maurice ein Pferd, irgendein Pferd, das aufs Galoppieren erpicht war oder bloß die Feldwege entlangtraben wollte, die sich meilenweit um die Farm wanden.
Nach Samarkand fiel Maurice’ Wahl auf Beautiful Dreamer, einen anmutigen Hengst, der die Mähne schüttelte und den Kopf reckte, als wollte er sich seines Reiters entledigen, ob es nun Maurice oder ein anderer war, außer Nell. Die Pferde liebten Nell.