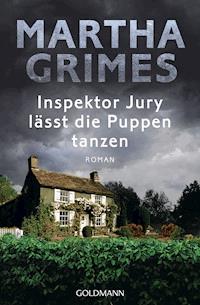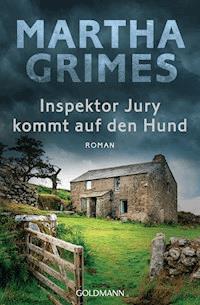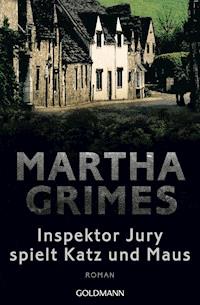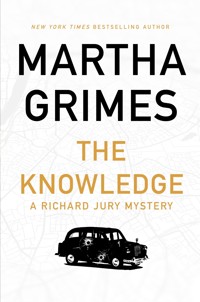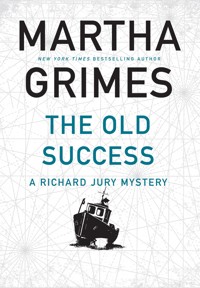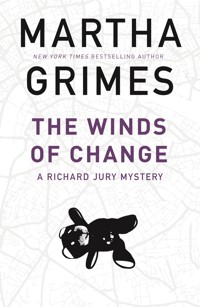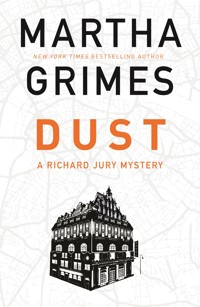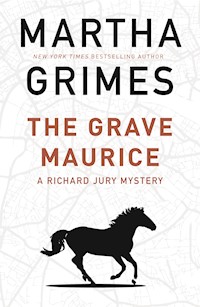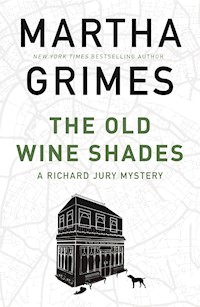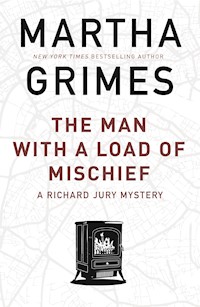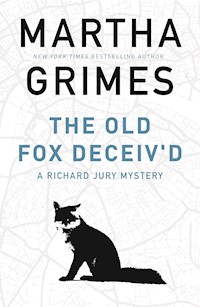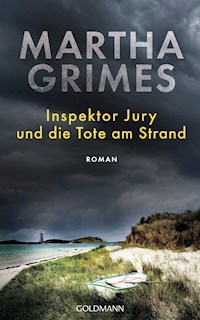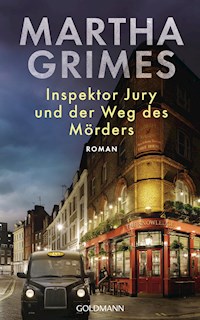8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Emma-Graham-Romane
- Sprache: Deutsch
Eine geheimnisvolle Hotelruine, ein verschwundenes Baby und eine junge Ermittlerin.
Die zwölfjährige Emma ist in ihrem Heimatort La Porte am Spirit Lake eine kleine Berühmtheit. Sie hat zwei Kriminalfälle aufgedeckt und verfolgt bereits eine neue heiße Spur. Vor vielen Jahren verschwand während einer Ballnacht im Luxushotel „Belle Rouen“, das mittlerweile verfallen ist, das Baby eines amerikanischen Ehepaares spurlos. Doch es wurde kein Lösegeld gefordert und der Fall nie polizeilich weiterverfolgt. Sehr merkwürdig, findet Hobbydetektivin Emma, und begibt sich mit Feuereifer auf die Spur des verschollenen Kindes …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 582
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Martha Grimes
Die Ruine am See
Roman
Deutsch
Buch
Die zwölfjährige Emma ist in ihrem Heimatort La Porte am Spirit Lake eine kleine Berühmtheit. Das kecke, aufgeweckte Mädchen hat zwei Kriminalfälle gelöst und verfolgt bereits eine neue heiße Spur. Die Ruine des einstigen Luxushotels »Belle Rouen« birgt nämlich so manches Geheimnis. So erzählt man sich in La Porte von einer mysteriösen Entführung, die sich vor vielen Jahren im Belle Rouen zutrug: In einer rauschenden Ballnacht verschwand das Baby eines amerikanischen Ehepaares spurlos – ohne dass jemals Lösegeld gefordert oder der Fall polizeilich weiterverfolgt wurde. Die Ungereimtheiten häufen sich, und Hobbydetektivin Emma kann sich des Verdachts nicht erwehren, dass es entweder gar kein Kind gab, oder dass die Eltern bei der Entführung ihre Finger mit im Spiel hatten. Mit Feuereifer begibt sich Emma auf die Spur des verschollenen Mädchens und schafft es sogar, den Sheriff der Stadt für den ungelösten Kriminalfall zu interessieren …
Autorin
Martha Grimes zählt zu den erfolgreichsten Kriminalautorinnen unserer Zeit. Sie wurde in Pittsburgh geboren und studierte an der University of Maryland. Lange Zeit unterrichtete sie Kreatives Schreiben an der Johns-Hopkins-University. Mit ihren Inspektor-Jury-Romanen erlangte sie internationalen Ruhm. Martha Grimes lebt heute in Washington, D.C., und in Santa Fe, New Mexico. Weitere Informationen zur Autorin unter
Die Originalausgabe erschien 2005 unter dem Titel »Belle Ruin« bei Viking, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
1. Auflage Taschenbuchausgabe Juni 2011 Copyright © der Originalausgabe 2005 by Martha Grimes All rights reserved By arrangement with Peter Lampack Agency, Inc. 551 Fifth Avenue, Suite 1613 New York, NY 10176-0187 USA Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2009 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Dem kleinen Scott Holland und seiner Mutter Travis. Und dem Weg zurück nach Hause.
If, as they say, some dust thrown in my eyesWill keep my talk from getting overwise,I’m not the one for putting off the proof.Let it be overwhelming, off a roofAnd round a corner, blizzard snow for dust,And blind me to a standstill if it must.
Inhaltsverzeichnis
1
»Nicht kann sie Ruhm hinwelken, täglich Sehn an ihr nicht stumpfen/Die immerneue Reizung.«
Dwayne zitierte Shakespeare oder jedenfalls behauptete er, es sei von Shakespeare. Eigentlich müsse es »Alter« heißen und nicht »Ruhm«, meinte er. Das habe er aber geändert, weil das besser auf mich passte. »Alter« (sagte er) könnte ja wohl keine Bedrohung darstellen für ein Mädchen, das zwölf Jahre alt ist (»und das schon lange«, hätte er nicht extra hinzufügen müssen, fand ich). Meine jüngste Heldentat hat in Spirit Lake tatsächlich mächtig Aufsehen erregt. So etwas ist hier, nun ja, noch nie passiert. Dwayne sagte, Shakespeare würde in den Zeilen Kleopatra beschreiben, die zu ihrer Zeit ebenfalls berühmt war, fast genauso berühmt wie ich. Das erzählte er mir, während er unter Bobby Stucks altem Studebaker lag. Dwayne ist nämlich Meistermechaniker.
Ich saß auf einem Stapel neuer Reifen in Abel Slaws Autowerkstatt. Eigentlich durfte ich gar nicht hier drin sein bei den ganzen Autos und Werkzeugen und Hebekränen. Also wartete ich immer ab, bis Abel Slaw sich ins Büro verdrückte, und schlich mich dann in die Werkstatt. Ich hab noch nie jemanden gesehen, der so viel an der Strippe hängt wie der.
Dwayne schob sich auf so einem flachen Ding mit Rollen dran unter dem Studebaker hervor und guckte unter die Kühlerhaube. Das Dumme ist, dass ich Dwayne in der Werkstatt nie richtig ins Gesicht schauen kann. Wenn er unter dem Auto ist, sehe ich gar nichts von ihm, und wenn er sich unter die Kühlerhaube beugt, sehe ich ihn nur von der Seite. Ich kann also nicht erkennen, ob er sich insgeheim schieflacht über mich. Er witzelt immer ganz schön herum, und ich weiß deshalb nie so recht, woran ich bin, wenn ich sein Gesicht nicht sehe.
Ich weiß, es hört sich so an, als wäre ich schon ewig zwölf Jahre alt. Das liegt aber bloß daran, dass in den letzten paar Wochen eine Menge passiert ist und ich so viele Details in meine Geschichte reinpacken muss, zum Beispiel, dass Dwayne »Meister«-Mechaniker ist. Ein Detail, das ich wahrscheinlich doch wieder beiseitelassen werde, was ich ihm auch gesagt habe.
»Na, so ein Glück.«
So viel von Dwayne, mit dem Kopf unter der Kühlerhaube des Studebaker.
Ich will die Ereignisse mal kurz zusammenfassen, nicht die ganze Geschichte (die Sie ja schon kennen sollten, wenn Sie richtig aufgepasst haben), sondern bloß das Ende, wo ich zu Ruhm und Ehren komme. (Aus den Zeitungsartikeln über mich habe ich mir ein paar schlaue Ausdrücke zugelegt.) Mein Ruhm ist das, was »im Nachhinein« geschah. Das Verbrechen und sein Nachspiel. Das Verbrechen war wirklich Wahnsinn, mit Blut und Schießerei und allem. Doch manchmal glaube ich fast, das, was danach kam, ist sogar noch wichtiger als das Verbrechen selbst.
Bei dem Nachspiel saßen die Reporter vor dem Hotel Paradise auf der Veranda, wippten in den dunkelgrünen Schaukelstühlen, tranken Kaffee oder Martinis (je nachdem, wer die Gastgeberin war, meine Mutter oder Lola Davidow), als wären sie zahlende Hotelgäste, und stellten mir Fragen über das, was im Bootshaus am Spirit Lake geschehen war, und ob ich keine Angst gehabt hätte und so weiter.
Damit will ich sagen: Die Reporter waren meinetwegen da. Für meine Mutter und Mrs. Davidow und deren un-berühmte Tochter Ree-Jane – ganz besonders für Ree-Jane – war das schwer zu glauben. Es war schwer zu glauben, weil ich in meinen ganzen zwölf Jahren nie großartig Aufmerksamkeit geerntet hatte. Dass all diese Zeitungsgeschichten von mir handelten, na, das war einfach zu viel. Meine Mutter freute sich, dass ich berühmt war, Lola Davidow freute sich über einen Anlass, eine Flasche Gordon’s Gin aufzumachen, und Ree-Jane freute sich ganz und gar nicht.
Da saßen wir also auf der Veranda, die Reporter, meine Mutter, Mrs. Davidow, Ree-Jane und ich. Mein Bruder Will war nicht dabei. Der ist prinzipiell nie bei irgendwas dabei. Der steckt die ganze Zeit nur in der großen Garage mit seinem besten Freund, dem Musikgenie Brownmiller (den wir »Mill« getauft haben), und die beiden denken sich Songs und Bühnenbilder für ihr Theaterstück aus. Mein Bruder ist viel zu beschäftigt, um sich um so was wie Ruhm zu scheren, nicht mal um seinen eigenen, was wahrscheinlich viel über ihn aussagt. Ich teile diese Haltung nicht. Ehrlich gesagt, für meinen Geschmack könnte ich gar nicht berühmt genug sein.
Die Details häuften sich, was, wie man mir sagte, eins der Probleme bei dieser Geschichte ist. Sie ertrinkt in Details. Wie Mary-Evelyn Devereau im Spirit Lake ertrunken ist. Wie ich dort fast auch ertrunken wäre.
Ree-Jane meinte, ich würde mich völlig verzetteln und kein Ende finden; dass es langweilig sei, jedes noch so kleine Ding zu erwähnen, und dass ich genauso langweilig sei und das nicht kapiere.
Aber wie gesagt: Es ist meine Geschichte. Es geht um das Hotel Paradise und um Ben Queen und Cold Flat Junction. Es könnte eine unendliche Geschichte werden, die wie ich kein Ende findet. Ich könnte nämlich ewig so weitermachen, unverwelkt und immer neu gereizt wie Kleopatra. Nicht, dass ich mich vergleichen will.
»Pass aber auf, wenn du im Wald bist. Die Jäger sind hinter den Hirschen her«, sagte Dwayne, den Kopf fast auf gleicher Höhe mit dem Motor.
Ich inspizierte gerade die Profile an dem Stapel Reifen unter mir. Als ob ich ein Auto hätte. »Für Hirsche hat die Jagdsaison doch noch gar nicht begonnen.«
»Für Waschbären auch nicht, aber das hält manche Leute bekanntlich nicht davon ab.« Er piekste eine Dose Sinclair-Öl auf, als wäre es ein Bier, und jetzt endlich konnte ich sein Gesicht sehen. Im Schatten der Kühlerhaube sah er sogar noch attraktiver aus.
»Wen denn wohl«, fragte ich scheinheilig.
Er musterte mich. »Warst du wieder in der Schonzeit unterwegs?«
»Ich nicht. Du.«
So hatte ich ihn nämlich kennengelernt. In einem anderen Teil des Waldes, nicht im Hirschgehege, sondern in der Nähe vom Lake Noir. Es war schwer zu sagen, wo ein Wald aufhörte und ein anderer anfing. Damals hatte ich Brokedown House ausgekundschaftet, wenn man auf einen Baum klettern als »auskundschaften« bezeichnen kann. Ich hatte Zweige hochschnellen und Blätter rascheln hören, als ob jemand auf mich zukäme, und hatte mich zu Tode erschrocken. Es hatte sich herausgestellt, dass es Dwayne war mit seiner Schrotflinte und einem Sack mit toten Kaninchen. Nacht war es gewesen, so pechschwarz und finster, dass man nicht erkennen konnte, wo der Baum aufhörte und ich anfing oder wo der Erdboden aufhörte und Dwayne anfing.
»Dieses alte Hotel«, sagte ich und deutete über die Werkstatt hinaus in Richtung Highway. »Eines Nachts ist es abgebrannt, mit Stumpf und Stiel, bloß ein Teil vom Erdgeschoss ist übrig geblieben. Der frühere Ballsaal. Dieses Hotel war viel größer als das Hotel Paradise, viel größer. Es hieß Belle Rouen. Das ist französisch.« Falls er das nicht wusste.
Dwayne schaute auf die Öltülle und wischte sich die Hände an einem ölverschmierten Lappen ab, so einem, wie ihn anscheinend alle Automechaniker in der hinteren Hosentasche stecken haben.
»Ich habe viel darüber herausgefunden, von der Frau bei der historischen Gesellschaft. In La Porte.«
»Mädchen, eher seh ich einen Hirsch auf einen Baum klettern als dich im Museum beim Geschichtsstudium.«
»Was? Ich weiß eine Menge über Geschichte.«
»Du kennst ja nicht mal die Geschichte von eurem eigenen Hotel, geschweige denn von einem anderen.« Er steckte den öligen Lappen wieder in die Tasche.
Ich sprang beleidigt von den Reifen herunter. »Und ob ich die kenne! Mein Urgroßvater war der Besitzer, vor meinem Großvater und meiner Mutter (und, woran ich aber nicht denken wollte, Lola Davidow). Eigentlich gehört es Aurora Paradise und ihrer Schwester.« Aurora Paradise war einundneunzig und wohnte oben im dritten Stock.
Dwayne schmiss die leere Ölbüchse in eine große Mülltonne und knallte die Motorhaube zu. »Das meine ich gar nicht. Sondern was dort wirklich so passiert ist?«
Ich saß wieder auf dem Reifenstapel und blinzelte, als ob ich dadurch besser begreifen könnte, was er meinte. »Na, woher sollte ich das wissen?« Ich hatte keine Ahnung, was sich dort zugetragen hatte. »Niemand redet von früher, also, meine Mutter redet ab und zu über die schrecklichen Paradises – sie ist ja selbst keine, weißt du, sie hat da bloß eingeheiratet. Aber das ist auch schon alles …« Meine Stimme verlor sich. Mir wurde allmählich bange (dank Dwayne), als hätte ich die Familiengeschichte die ganze Zeit vernachlässigt, als wäre ich für die Familiengeschichte zuständig. Keine Ahnung, vielleicht war es ja so.
Dwayne hatte bei einem anderen Auto die Motorhaube gelüftet und klemmte den dünnen Stab fest, damit sie offen stehen blieb. Er schaute mich durch das Dreieck an, das die Haube bildete. »Du bist ja ganz weiß. Was ist los?«
»Nichts.«
Dwayne schaute mich weiter unverwandt an, und ich muss wohl erst weiß und dann rot geworden sein, denn er machte einen Rückzieher. Ich muss zugeben, das kann er richtig gut: einen Rückzieher machen, wenn er meint, etwas setzt einem zu sehr zu. Er sagte: »Also, erzähl weiter von diesem Ballsaal.«
»Aber nur, wenn du nicht dauernd unterbrichst.« Jetzt war ich eingeschnappt. Dabei war ich nicht besonders gut im Eingeschnapptsein, weil das bei mir sowieso nie jemand bemerkte. Das gilt übrigens auch für Traurigkeit, Wut und Kummer.
Er lächelte unmerklich. »Sorry«, sagte er und wischte sich die Finger an dem Lappen ab, den er wieder aus seiner Hosentasche gezogen hatte. Das tat er so behutsam, dass man hätte meinen können, der Lappen wäre gerade frisch aus der Wäsche gekommen.
Allzu oft habe ich von einem Erwachsenen noch nicht das Wörtchen »sorry« gehört. Das war auch so was, was ich an Dwayne mochte. Ich ging jedoch locker drüber hinweg. »Ach, schon gut. Na jedenfalls gab es im Hotel diese Bälle – es war eigentlich mehr als nur Tanzen – sehr elegant, das Orchester im Smoking, und die Frauen trugen mit Perlen und Pailletten bestickte Kleider, und der Tanzboden war auf Hochglanz poliert und glänzte. Da waren vielleicht zweihundert Leute – was guckst du so?« Er wirkte skeptisch.
»Das sind ja eine Menge Details.« Er schwang den öligen Lappen über die Schulter und beugte sich zum Motor hinunter.
Ich redete weiter. »Zweihundert Tänzer oder fast jedenfalls. Ich vermute mal, das war in den Dreißigern« (eine Zeit, die kaum für mich existierte, weil ich damals noch nicht auf der Welt war), »als sie Musik spielten wie ›Bye Bye Blackbird‹ und ›When the Swallows Come Back to Capistrano.‹« Unvermittelt fing ich an zu singen: »Hier kann keiner mich lieben noch verstehn –« Einen Augenblick lang schlüpfte ich in ein anderes Ich, dessen Gefühle unergründlich waren.
»Oh, was für ein Peeech, und das ausgerechnet miiir.«
Das Gesinge kam von Dwayne. Er versuchte, mich zurückzuholen, aus einer unbestimmten Traurigkeit vielleicht. Fast so, wie Ben Queen mich vorm Ertrinken gerettet hatte. Ich hätte heulen können vor lauter Erleichterung, dass jemand das versuchte. Ich hielt mein Gesicht gesenkt, beguckte meine Füße. Dwayne begann wieder seine dumpfen Schläge mit dem Schraubenschlüssel oder irgendeinem anderen Werkzeug.
»Also weiter«, sagte er.
Ich räusperte mich – was man in den Hals kriegt, sind übrigens keine Frösche, sondern Erinnerungen. »Es gab dort auch einen kleinen Teich, an den Hirsche zum Trinken kamen. Auf einem Bild ist ein Kitz und sein Dad zu sehen, du weißt schon, mit einem Geweih.«
»Hmm. Ein Kitz mit Bock? Normalerweise halten die sich an ihre Mütter.«
»Vielleicht, weil du geholfen hast, all die Muttertiere umzubringen.« Ich konnte auch sarkastisch sein.
»Ich jage so gut wie keine Hirsche und würde niemals eine Hirschkuh abschießen.«
»Du solltest auf überhaupt nichts schießen. Auch die haben ein Recht auf Leben, genauso wie du und ich.« Besonders ich.
»Au weia, jetzt spielst du aber den Moralapostel.«
Er machte sich mit dem Schraubenschlüssel unter der Motorhaube zu schaffen.
Im Grunde verschwendete ich nicht viele Gedanken an die Sache mit dem Jagen. Das einzige Mal, wo ich daran gedacht hatte, war damals, als Dwayne mit dem Sack voller Kaninchen dahergekommen war.
2
Was ich Dwayne gesagt hatte, stimmte, denn vom Belle Rouen hatte ich im kleinen Museum der historischen Gesellschaft erfahren. Es war in einem Haus untergebracht, das ehemals der Familie Porte gehört hatte, die früher praktisch ganz La Porte besessen hatte. Es war ein hübscher alter Backsteinbau, und was mir daran besonders gefiel, war, dass es so klein war und man beim Herumgucken nicht müde wurde. Dwayne hatte recht: Geschichte an sich war mir schnurzegal, aber als Hintergrundstory für einen Kriminalfall gefiel sie mir. »Hintergrundstory« – auch so ein Ausdruck aus der Zeitungssprache, den ich toll fand.
Das Museum wurde von elf Uhr bis drei Uhr von Miss Alice Llewelyn beaufsichtigt, deren wehendes weißes Haar an Wilde Möhre erinnerte und die immer in rosa, blaue oder grüne Pastelltöne gekleidet war. Auch ihr Gesicht war pastellfarben, mit rosigem Teint. Natürlich hätte so einen Job ohnehin nur ein älterer Mensch machen können; jemand, der nach vollziehen konnte, dass die Vergangenheit wie Staub an den Dingen haftete.
Als ich sie nach dem alten Hotel im Hirschpark fragte, sagte sie: »Ah, das Belle Rouen«, wobei sie den R-Laut sanft im Hals rollte, statt ihn herauszubellen, wie Ree-Jane es immer tat. Miss Llewelyn sagte, sie hätten in der Tat einige »Exponate« aus dem Belle Rouen, und führte mich zu einem der verglasten Schaukästen hinüber.
Dort befanden sich eine Reihe von Fotografien des Hotels, und einige waren auch als Postkarten gestaltet. Auf einer war das Hotel in der Sonne zu sehen, auf einer anderen im Schnee. Dann war da noch eine, die mir wirklich gefiel, auf der die Hirsche im Winter aus dem Teich tranken. Und noch eine, vermutlich eine Luftaufnahme, zeigte das Hotel und das Gelände – den Golfplatz, das Schwimmbecken, einen Stall und viele Fußwege, die in den Wald führten. »Es war ja riesengroß«, sagte ich.
Miss Llewelyn nickte. »Es hatte weit über zweihundertfünfzig Gästezimmer und dann natürlich die Gesellschaftsräume, unter anderem einen riesigen Ballsaal, wo am Samstagabend immer getanzt wurde. Nicht einen, sondern zwei Golfplätze, wenn du dir das vorstellen kannst.«
Ich versuchte es gar nicht erst, denn Golf war ein Zeitvertreib, den ich fast genauso langweilig fand wie eine Lektion von Vera, unserer Chefserviererin, über Tischgedecke. »Nun, sie hatten viel mehr Gäste als das Hotel Paradise.« Was kein Kunststück war. Das Gerichtsgefängnis hatte auch viel mehr Gäste als das Hotel Paradise.
Ich beäugte eins der Fotos, auf dem ein Grüppchen zu sehen war, das gerade einem großen Wagen entstieg, unter einem Hotelvordach, das dreimal so groß war wie unseres. Dort hatten sechs oder sieben Autos gleichzeitig Platz. Sie fuhren vor, und die Fahrgäste stiegen aus, assistiert von mehreren Pagen. Das sollte ich Will mal zeigen, zur Veranschaulichung, wie sein Leben aussehen könnte, wenn die Leute ihm gegenüber nicht so nachsichtig wären. Die Koffer und Reisetruhen ähnelten denen von Aurora Paradise. Ich fand auch die Garderobe der Damen irgendwie reizend. Die weiblichen Fahrgäste trugen ausladende wippende Hüte oder solche, die aussahen wie die Helme der Gladiatoren in Filmen, die in Rom spielten, wo Christen von Löwen angegriffen wurden. (Ich fragte mich, wie sie die Filmlöwen eigentlich davon abhielten, die Christen aufzufressen. Da Ree-Jane Davidow ebenfalls vorhatte, eine berühmte Schauspielerin zu werden, fände ich das eine gute Startbasis für sie.)
»An dem vielen Gepäck, das sie dabeihaben«, sagte Miss Llewelyn, die mir über die Schulter schaute, »kannst du sehen, dass sie die Saison über bleiben wollen.«
Die Saison. Stellen Sie sich mal vor, jemand würde »die Saison über« im Hotel Paradise bleiben. Normalerweise dauert es bloß ein Wochenende, bis sie eines Besseren belehrt sind. »Hat es denn viel gekostet?«
»Ja, ich glaube, es war sehr teuer. Nachdem das Baby entführt worden war, kamen aber keine Leute mehr.«
Erschüttert über diese Mitteilung, trat ich einen Schritt zurück. »Ein Baby? Entführt?«
Miss Llewelyn nickte, die Augen geschlossen, als wollte sie die Szene im Geiste noch einmal nachempfinden. »Es war so eine wunderschöne Vollmondnacht. Alles wirkte so romantisch, die Nacht und der Tanzball. Das Baby war ihr einziges Kind, und es wurde direkt aus der Wiege geholt, während die Eltern unten tanzten. Der Vater war übrigens von hier – Morris Slade, ein stadtbekannter Playboy.«
Trotz meiner beschränkten Erfahrung mit Playboys weiß ich, dass die immer schöne Sachen trugen, Mädchen nachliefen, Champagner tranken und in Sportwagen herumsausten. Sie waren attraktiv und flatterten von Blume zu Blume. Nicht begreifen konnte ich, wie ein Playboy in La Porte leben konnte, und noch weniger, wie einer hier hatte aufwachsen können. Was für Playboysitten hätten sie von ihren Vätern denn lernen können? Soviel ich wusste, gab es in La Porte keine alten Playboys, außer vielleicht Jamie Makepiece, der eine Romanze mit den Schwestern Devereau gehabt hatte. Ich war mir aber nicht sicher, ob Jamie in die »Playboy«-Kategorie gehörte.
Dann fiel mir mein Cousin wieder ein, viel älter als ich, der immer mal wieder aus der Stadt auf Besuch kam. Er trug weiße Leinenanzüge und brachte Geschenke mit. Aus den Geschenken machte ich mir nichts, aber aus ihm. Er war, man könnte sagen, »exotisch«. Ich achtete immer darauf, dass ich ihn als Letzte, nicht als Erste begrüßte. Ich schaute aus meinem Fenster im zweiten Stock, das auf den Cocktailgarten hinter dem Hotel hinausging, während die anderen hinausliefen, um ihm Guten Tag zu sagen; alle außer Will, aber bei dem konnte man sich sowieso schwer vorstellen, dass er hinauslief, um jemanden zu begrüßen, außer es handelte sich um Spike Jones oder Medea. Ich hielt mich also zurück und ging dann hinunter und schlenderte zum Cocktailgarten und tat richtig lässig, als würde ich die Begrüßung gähnend gelangweilt hinter mich bringen. Der Schuss ging natürlich nach hinten los, als er sagte: »Na, Emma, hast du dich endlich auch zu mir herausbequemt?« Das meinte er nicht als Witz. Er war echt verärgert. Aber was sollte ich dazu sagen?
Außer ihm kannte ich keinen potentiellen Playboy. Ewig saß er mit Lola Davidow herum und trank Martinis. Ich glaube aber kaum, dass man die als Playgirl bezeichnen konnte.
Das alles ging mir durch den Kopf, während mein Blick auf dem Foto mit den Gästen des Belle Rouen haftete, den Frauen in ihren helmartigen Hüten, modisch gekleidet bis hinunter zu den Schuhen. Die Männer trugen Sommeranzüge und steif aussehende weiße Kragen. Aber alle sahen irgendwie glücklich aus, fast strahlend vor Glück. Das machte mich sogar noch trauriger als die Seltenheit von Playboys in meinem Leben. Ich habe nie irgendwelche Leute das Hotel Paradise betreten sehen, die glücklich aussahen, außer sie waren betrunken.
Es musste am Belle Rouen selbst gelegen haben; es war wohl so glückversprechend, dass seine Gäste jeden Preis bezahlt hätten und von überall hergekommen wären, nur um glücklich zu sein.
Ich schaute mir auch noch andere Bilder an, einige vom Inneren des Hauses. Dieser Speisesaal! Der war doppelt so groß wie unserer. Die Tische waren überladen mit Gedecken, Silber, Wasserkelchen, Weinkelchen, schneeweißen Servietten und frischen Blumen. Vielleicht sollte ich eine Blüte in eine hohe, schlanke Vase stellen für Miss Bertha. Ich wusste, wogegen sie allergisch war.
Eine andere Aufnahme zeigte den Ballsaal mit den Musikern im Smoking und den Tanzgästen in Abendkleidung. Sie schwangen herum und drehten sich im Kreis, als würde ein Wind sie vor sich hertreiben. Die Abendroben der Damen waren um so viel raffinierter als das Tüllkleid, das Ree-Jane zu ihrem sechzehnten Geburtstag getragen hatte, dass sich jeglicher Vergleich verbot. Schätzungsweise waren sie auch raffinierter gekleidet gewesen als die Serviererinnen, aber damals hatte das Dienstpersonal ja auch auf einem ganz anderen Niveau gelebt.
Beim Anblick des Luftbildes überlegte ich, ob Miss Llewelyn vielleicht eine Zeichnung vom Hotel hatte, eine Art Schaubild. Ich fragte sie.
»Nein. Nein, das haben wir nicht. Wieso willst du denn das?«
Ich glaube nicht, dass sie naseweis war, sie war einfach überrascht. »Dann könnte ich es mir besser vorstellen. Ich wüsste einfach gern, wie die Zimmer – ich meine die im Untergeschoss, die Sie Gesellschaftsräume nannten – wie die angeordnet waren. Einfach um mir ein besseres Bild machen zu können.«
»Ach so.« Sie legte den gekrümmten Finger ans Kinn und schien zu überlegen. »Weißt du, wir könnten es wahrscheinlich zusammenkriegen, mit dem Luftbild und den Fotos und Postkarten.«
Das war eine gute Idee. Sie holte ein Lineal und einen spitzen Bleistift, und wir machten uns ans Werk. Sie zeichnete kleine Quadrate und Rechtecke ein – Foyer, Küche, Lesesaal, Ballsaal, Wintergarten.
Ich ließ mich derart von ihrer Begeisterung anstecken, dass ich glatt vergaß, die Sache mit dem entführten Baby weiter zu vertiefen. Ich überlegte, ob es irgendwelche Zeitungsberichte darüber gab. Im Schaukasten hatte ich keine gesehen.
Als ich Miss Llewelyn fragte, ob sie an dem Tanzabend damals teilgenommen hatte, als das Baby gestohlen wurde, verneinte sie, ihre Version konnte ich also nicht hören. Das machte aber nichts, denn die einzige Version, auf die ich überhaupt etwas gab, war meine eigene.
Während sie das Schaubild für mich zusammenrollte und mit einem Gummiring fixierte, sagte sie: »Ich hörte bloß, dass die Babysitterin ein Weilchen aus dem Zimmer gegangen war. Und als der Vater dann vom Tanzen nach oben kam, war das Baby weg. Kannst du dir das vorstellen? Wie furchtbar das für die Eltern gewesen sein muss?«
Für die Babysitterin hörte es sich auch nicht so gut an.
»Die Polizei nahm an, dass es womöglich jemand gewesen war, der im Hotel wohnte.«
»Und das Baby hat man nie gefunden?«
Sie schüttelte den Kopf und schwieg. »Die meisten Leute konnten den Namen ›Rouen‹ nicht richtig aussprechen, und so wurde daraus das Belle Ruin. Wir nennen es ja inzwischen alle so. Es passt, findest du nicht?«
Ich nickte. Und dann geriet es beinahe in Vergessenheit. Es war ein Ort, an den man erinnert werden musste: »Ach, das Belle Rouen! Ja, daran erinnere ich mich.« Bloß stimmte das ja eigentlich nicht. Denn man musste daran erinnert werden: an das Belle Ruin.
3
Die Gäste, jedenfalls die paar, die im Hotel Paradise absteigen, haben alle Halbpension, was bedeutet, dass Frühstück und Abendessen im Zimmerpreis enthalten sind. Wie sie sich mit dem Mittagessen behelfen, ist ihre eigene Sache. Das heißt nicht, dass wir kein Mittagessen servieren, was wir natürlich tun, und wofür man mich zum Bedienen braucht. Wer Mittag essen will, muss vielmehr extra dafür bezahlen.
Halbpension würde sich anbieten in diesen Kurhotels, wo es außerhalb der Hotelanlage so viel zu tun gibt, beispielsweise nach Antiquitäten stöbern oder einkaufen gehen oder reiten oder nacheinander die Museen abklappern oder die historischen Stätten besichtigen. Hier gibt es gar nichts zu tun, außer man will die zehn Meilen bis zum Lake Noir fahren. Der Spirit Lake, nach dem das Dorf benannt ist, erstickt unter Seerosen, und obwohl es ein Bootshaus gibt, fährt niemand mehr mit den Ruderbooten hinaus. Es ist ein sehr kleiner See, etwa eine Meile vom Hotel entfernt. Das Mittagessen an sich kann also ein Ereignis sein, das den Gästen ihren langweiligen Tag ausfüllt.
Wir haben nur zwei Vollzeitgäste, Miss Bertha und ihre Freundin Mrs. Fulbright. Mrs. Fulbright ist süß wie Zuckerwatte – der sie bisweilen ähnelt, mit ihrem langen Hals und der weichen weißen Haarwolke. Damals zu ihrer Zeit war sie wohl eine Schönheit gewesen (was auch die Zeit von Aurora Paradise war, aber da hört die Ähnlichkeit auch schon auf). Ich kann mir Mrs. Fulbright vorstellen, wie sie ein rosa Sonnenschirmchen in der Farbe ihrer Wangen wirbelt und all die Männer sich um sie scharen.
Wenn ich im Speisesaal bin und kalte Butterstückchen aus meiner geeisten Schüssel auf die Brotteller platschen lasse, denke ich darüber nach. Dann knalle ich ein Stückchen auf Miss Berthas Teller, und die rosa Sonnenschirme verflüchtigen sich augenblicklich. Stellen Sie sich ein Eichhörnchen vor, die Backentaschen voller Walnüsse. So sieht Miss Bertha aus, bloß nicht so niedlich. Sie ist klein und hat einen gekrümmten Rücken mit einem Buckel, was von irgendeinem Knochenproblem herrührt (sagt meine Mutter). Wie beim Glöckner von Notre-Dame?, frage ich. Meine Mutter schaut mich bloß vielsagend an.
Wenn man so einen Gast hat, pingelig und völlig uneinsichtig und schwierig, dann wird es zur Herausforderung, sich zu überlegen, auf welche Art man sie in den Wahnsinn treiben kann. Ich bin schon auf ein paar recht gute Einfälle gekommen. Miss Bertha trägt ein großes beigefarbenes Hörgerät – und da bietet sich ja so einiges an! Mein Bruder Will ist, was Miss Bertha betrifft, allerdings noch einfallsreicher. Will macht den Mund auf und tut so, als würde er was zu ihr sagen, und wenn sie ihn nicht hören kann, schiebt sie es auf das Hörgerät (»Verdammt, blödes Gelumpe!«) und knallt es auf den Tisch.
Eines Tages erwischte ihn meine Mutter dabei, als sie in den Speisesaal kam, um die Kaffeemaschine zu überprüfen. Sie sagte zu ihm: »Manchmal glaub ich, du bist noch schlimmer als deine Schwester.«
Was? Hat meine Mutter denn die leiseste Ahnung, was für eine krumme Tour der Kerl fährt? Nein, weil Will für die Gäste dieses kriecherische, schmierige Lächeln aufsetzt und mit ihnen über ihre Reise quatscht, während er ihnen die Taschen trägt. Alle meinen, er täte ihnen einen Gefallen, dabei ist er bloß der Hoteldiener, der das Gepäck tragen soll. Er streicht üppige Trinkgelder ein, die er mit seinem Freund Mill drüben bei Greg’s am Flipperautomaten und für Orange Crush und MoonPies verpulvert.
Der Speisesaal ist groß und selten überfüllt. Irgendwie wirkt diese Leere noch größer, da lediglich ein Tisch besetzt ist, nämlich der von Miss Bertha und Mrs. Fulbright, direkt inmitten des Raumes.
Heute sollte es zum Mittagessen spanisches Omelette geben (oder die einfache Art, falls man nicht abenteuerlustig war).
»Spanisch? Warum heißt das denn so?«
Das fragte Miss Bertha immer, wenn spanisches Omelette serviert wurde. »Weil es tomatig und sch –« Ich konnte mich gerade noch fangen, bevor ich »scharf gewürzt« sagte, und verstummte. Miss Bertha hasst alles scharf Gewürzte abgrundtief und beklagt sich ständig, wenn zu viel davon im Essen ist, was gar nicht der Fall wäre, wenn ich nicht ein paar Prisen Cayennepfeffer oder ein paar Stückchen von diesen kleinen grünen Pfefferschoten dazutun würde, die Will und Mill einmal Paul (dem Sohn der Aushilfstellerwäscherin) zu essen gegeben hatten. Als Paul daraufhin schreiend umherrannte, gaben sie ihm Wasser, was es, wie sie wussten, nur noch schlimmer machen würde.
Anstatt »scharf gewürzt« sagte ich also »schmackhaft«.
»Was ist denn daran so schmackhaft?« Sie wollte bloß streiten.
Mrs. Fulbright seufzte. »Bertha, nimm doch einfach ein wenig Soße in einem Extratellerchen. Dann kannst du probieren und sehen, ob es dir schmeckt.« Sie wandte sich zu mir herüber. »Das kannst du doch machen, oder?«
Ich kaute auf der Lippe. Selbstverständlich konnte ich es machen – ich hatte nur eben keine Lust. Dann würde Miss Bertha die Soße vielleicht gar nicht anrühren, und für mich war das Zutun von Cayennepfeffer reine Zeitverschwendung. Trotzdem sagte ich, die Extramühe würde ich mir gern machen. Das betonte ich extra.
Miss Bertha hieb mit ihrer grobknochigen Hand auf den Tisch. »Ich will ein getoastetes Käsesandwich mit Relish und Tomate.«
»Wir haben keinen –« Aber wir hatten natürlich Käse. Meine Gedanken verweilten bei dem Relish. »Okay, können Sie haben.« Ich lächelte, damit sie merkte, dass das Hotel jede Mühe auf sich nehmen würde. Was gar nicht zutraf: Die Gäste hatten Glück, wenn Will mal zufällig da war, damit er ihnen das Gepäck tragen konnte. Und von Lola Davidow war bekannt, dass sie jemandem schon mal ein Zimmer verweigerte, wenn ihr sein Aussehen nicht behagte.
Ich verließ den Tisch und ging durch die Schwingtür in die Küche.
»Die alte Närrin –«, sagte meine Mutter, als ich ihr das mit dem getoasteten Käsesandwich erzählte.
Von Walter, unserem Tellerwäscher, ertönte eine Art schnaubendes Gelächter, von ganz hinten aus den dunklen Gefilden, wo die Geschirrspülmaschine stand. Walter fand es köstlich, wenn meine Mutter Miss Bertha eine alte Närrin nannte.
»– und ich versuche hier, zeitig wegzukommen!« Behutsam hob sie die geschlagenen Eidotter unter den Eischnee. Obwohl sie es eilig hatte, tat sie dies höchst sorgfältig. Eine gusseiserne Bratpfanne stand zum Erhitzen bereit auf dem Herd.
»Ach, das mach ich schon«, sagte ich voll echter Begeisterung. »Ich kann doch wohl noch ein getoastetes Käsesandwich fabrizieren.« Konnte ich auch.
»Ich helf dir«, rief Walter.
Meine Mutter sah skeptisch drein, während das Omelette in der Pfanne aufging.
Ich sagte: »Walter hat viel geholfen, als ihr in Miami Beach wart.« Ich sah zu, wie das Omelette zusammengeklappt wurde. Die Unterseite, jetzt oben, war goldbraun. Es war gute sieben Zentimeter hoch. Das weiß ich, weil ich es mal mit einem Lineal abgemessen habe.
»Na gut … in Ordnung. Gib einfach die Soße drüber, wenn es fertig ist, also in einer halben Minute. Und bring es gleich rein, damit es nicht zusammenfällt.«
Sie sollten mal ihre Soufflés sehen.
Sie band sich ihre Kochschürze ab und hängte sie an einen Nagel neben der Anrichte. Dann strich sie ihr Haar glatt, das sie auf beiden Seiten zu einer Rolle aufgedreht trug, was ihre hohen Wangenknochen betonte.
»Wangenknochen«, sagte sie oft, »lassen auf eine gute Kinderstube schließen.« Nicht auf Schönheit, sondern auf gutes Benehmen. Meine Mutter hat es ziemlich mit der guten Kinderstube. Aber was Wangenknochen betrifft, bin ich mir sicher, dass sie sich irrt, weil Walter nämlich ebenfalls ziemlich ausgeprägte hat, und ich glaube nicht, dass sie besonders große Stücke auf Walters Manieren hält. Walter ist, wie man so sagt, ein bisschen »langsam«. Ich schau aber überhaupt nicht auf ihn herunter; er tut mir nämlich oft einen Gefallen. Selbst Aurora Paradise mag Walter, und wenn das kein Freifahrschein in den Himmel ist, dann weiß ich auch nicht.
Sobald meine Mutter durch die knallende Fliegengittertür aus der Küche verschwunden war, bat ich Walter, den Relish aus dem Kühlschrank zu holen, klatschte Käse aufs Weißbrot, ließ das Omelette aus der Pfanne auf einen gewärmten Teller gleiten und gab das Sandwich in die Pfanne. Dann schob ich eine Tomatenscheibe von Mrs. Fulbrights Salat in das Sandwich.
Ich war gerade damit beschäftigt, die Pepperoni kleinzuschnippeln, als Walter das Glas mit dem Relish vor mich hinstellte. Er ließ sein seltsames abgehacktes Lachen ertönen.
»Das is für die alte Närrin, nehm ich an.«
»Richtig.« Der Käsetoast war auf einer Seite fertig. Ich hob die andere an und streute schwungvoll den Relish mit den scharfen Pfefferschoten hinein. Dann begoss ich das Omelette mit spanischer Sauce. Die Teller kamen aufs Tablett, und hurtig beförderte ich das Essen in den Speisesaal, servierte es ihnen, kehrte dann in die Küche zurück und wartete ab.
Ein Schrei ertönte aus dem Speisesaal. Dann kippte offenbar ein Stuhl um. Ich verzog mich schleunigst an den hinteren Küchenausgang und sagte: »Ich fahr jetzt nach La Porte, Walter. Kannst du dich drum kümmern?« Ich deutete mit dem gekrümmten Daumen über die Schulter.
Er lachte schniefend. »Klar doch«, erwiderte er, während er das Geschirrtuch weglegte und sich auf seine typische gemächliche Art in Richtung Speisesaal bewegte.
Walter war wirklich gut, wenn es drum ging, den Sündenbock zu spielen.
Knapp zwanzig Minuten später tauchte jemand von Axels Taxifirma auf. Am Telefon im hinteren Büro hatte ich angefragt, ob Axel selbst fahren könnte, und erfahren: »Klar, Schätzchen, er is gleich da.« Die Frau in der Zentrale – als ob die eine bräuchten, wo sie bloß zwei Taxis hatten – sagte das immer, obwohl Axel selber nie auftauchte.
Nun fuhr ich also, von Delbert chauffiert, nach La Porte hinein. Wenn ich Axel nicht ab und zu hätte fahren sehen, hätte ich geglaubt, es gäbe ihn überhaupt nicht, oder er wäre vielleicht gestorben, und die vom Taxibetrieb hielten damit bloß hinterm Berg.
Eigentlich war es schon ziemlich merkwürdig mit Axel und seinem Taxi – immer dem kastanienbraunen Chevy. Denn sooft ich ihn vorbeigleiten sah, wenn ich zum Beispiel den Highway entlanglief, hatte Axel nie einen Fahrgast auf dem Rücksitz. Mir war das schleierhaft: Ob er nun kam oder ging – keine Fahrgäste. »Kriegst du Axel eigentlich oft zu sehen?«, fragte ich Delbert.
»Jeden Tag seh ich den. Wieso?«
Delberts Augen suchten mich im Rückspiegel. Ich rutschte ganz tief in den Sitz. »Ich frag mich bloß, wieso der mich nie fährt. Ich verlang jedes Mal nach ihm. Nichts gegen dich, aber …« Dabei meinte ich das Gegenteil.
»Axel ist eben immer beschäftigt.«
»Na ja, der könnte mich doch trotzdem abholen. Damit könnte er ja wohl auch beschäftigt sein, Delbert.« Aber Delbert begriff das nicht und zuckte die Achseln.
»Wen fährt er denn dann?«
»Wen? Jeden.«
Ich verdrehte genervt die Augen, obwohl Delbert das im Spiegel nicht sehen konnte. »Er fährt aber nicht jeden. Mich fährt er nicht. Hab ich das nicht gerade gesagt?«
»Wenn er dich fahren würde, dann wär er ein Dutzend Mal am Tag zwischen Spirit Lake und La Porte unterwegs. Ich schwör, wegen dir is bestimmt schon bald ’ne Furche in der Straße, so wie du andauernd hin und her kutschierst.« Er ließ ein paar Mal sein ersticktes Lachen ertönen. Er fand sich ja so witzig. Ich verdrehte wieder die Augen und dachte, wenn Delbert sie schon nicht sehen konnte, dann vielleicht Gottvater. Aber ER scheint sich nie groß Gedanken über Delberts Beschränktheit zu machen. Mit Axel dagegen hatte Er womöglich Großes vor.
Mr. Gumbrel würde ich ebenfalls einen Besuch abstatten müssen. Ich schrieb für den Conservative gerade meinen eigenen Bericht über das, was am Spirit Lake geschehen war. Da packte ich alles hinein und sogar noch ein bisschen mehr. Ich gebe zu, dass ich etwas übertrieb, aber das war das, was ich eine Reporterin, die mich interviewte, als »künstlerische Freiheit« hatte bezeichnen hören. Ich sagte ihr, ich hoffte bloß, dass sie sich für meine Story keine künstlerische Freiheit erlaubte, worauf sie lachte und sich einen kleinen Vermerk über meinen Sinn für Humor auf ihrem Block machte, was mir sehr behagte.
Der Sheriff hatte sich mit Maud Chadwick im Rainbow Café über die erste Folge meiner Geschichte unterhalten und seine Zweifel an meiner Version angemeldet. Dass auf jemanden immer und immer wieder geschossen wurde, »wie Emma sagt« (ich hatte direkt danebengesessen und alles mitgehört), »kann nicht so recht stimmen, oder? Hör mal: ›Um mich herum regneten die Kugeln hernieder, prasselten auf den See und das Ruderboot.‹ Irgendwie schwierig, wenn man bedenkt, dass die Schützin einen Revolver benutzte, der immer wieder nachgeladen werden müsste – und zwar schnell, wohlgemerkt –, da es sich nicht um eine Maschinenpistole oder etwa einen Selbstlader oder eine Halbautomatik handelt, die schnell hintereinander eine Kugel nach der anderen abfeuern können. Was?«
Maud ließ bloß den Kopf in die Hände sinken. »Meine Güte, Sam! Für einen erwachsenen Mann führst du dich ganz schön kindisch auf!«
Der Sheriff schüttelte die Zeitung aus und sagte: »Erwachsener Sheriff nicht zu vergessen, und wenn ich nicht den Unterschied zwischen einem Revolver und einer Maschinenpistole erkennen kann, dann landen wir womöglich alle mitten im Spirit Lake so wie Emma, und um uns herum prasseln die Kugeln hernieder.«
Maud wurde ungehalten. »Du bist der Zwölfjährige, nicht Emma!«
Als mir das wieder einfiel, musste ich schmunzeln.
Als Delbert den Stadtrand von La Porte erreichte, bat ich ihn, mich am Rainbow abzusetzen.
»Zur Abwechslung, meinst du? Da fährst du doch zehnmal am Tag hin.«
Weil er versuchte, meinen Blick im Rückspiegel zu erhaschen, rutschte ich wieder ganz nach unten. Das brachte ihn richtig in Rage, und er reckte sich in seinem Sitz sogar ein wenig hoch. »Wieso eigentlich?«
Ich seufzte und bezahlte ihm die Fahrt, entschied mich aber gegen Trinkgeld. Ich wollte Delbert nicht auch noch dafür belohnen, dass er mich ins frühe Grab brachte (noch so ein Lieblingssatz meiner Mutter). »Weil ich es so toll finde, von dir chauffiert zu werden.« Rasch stieg ich aus.
So dumm ist Delbert, dass er glaubte, ich meinte es ernst. Er grinste wie ein Halloween-Kürbis, mit Zahnlücken und allem.
4
Das Rainbow Café war das beliebteste Lokal in La Porte für Frühstück und Mittagessen. Hier arbeitete Maud Chadwick seit Jahren als Kellnerin, und ich fragte mich oft wieso, da sie so viel schlauer war als jede andere Frau, die ich kannte (mit Ausnahme meiner Mutter und, zugegeben, Lola Davidow). Ich fragte sie, wieso sie nicht in der Highschool unterrichtete, wo sie doch einen College-Abschluss hatte. Sie sagte, das wolle sie nicht, es sei ihr zu »chaotisch«.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!