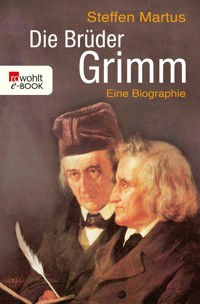17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Zeitalter auf der Suche nach einer neuen Ordnung: Steffen Martus zeigt, wie dramatisch die Aufklärung das Deutschland des 18. Jahrhunderts verändert hat. Seine Darstellung reicht von der Neuordnung der politischen Landkarte um 1700 über die Erschütterung Europas durch das Erdbeben von Lissabon bis zum Vorabend der Französischen Revolution. Eine Epoche, die uns nähersteht, als wir glauben: Man schwärmt von Frieden und Freiheit, aber auch vom «Tode fürs Vaterland», und ausgerechnet Friedrich der Große, Musterbild des aufgeklärten Monarchen, beginnt einen Siebenjährigen Krieg, der zum ersten Weltkrieg wird. Vor allem aber entdeckt die Aufklärung, dass der Mensch keineswegs souverän, sondern zutiefst unmündig ist: Gefühle und Gewohnheiten wirken mächtiger als die Vernunft. Steffen Martus zeigt das 18. Jahrhundert in neuem Licht. Er erzählt die Geschichte der Leidenschaften, der Politik, Kultur und Wissenschaft, er schildert den Alltag in den Universitäten, den Städten, bei Hofe und zeichnet eindringliche Porträts von Diplomaten, Dichtern und Gelehrten bis hin zu Kant, der Chancen und Grenzen der Erkenntnis erkundete. Ein einzigartiges Geschichtswerk über jene kritische Epoche, in der unsere Gegenwart beginnt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1446
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Steffen Martus
Aufklärung
Das deutsche 18. Jahrhundert - ein Epochenbild
Über dieses Buch
Ein Zeitalter auf der Suche nach einer neuen Ordnung: Steffen Martus zeigt, wie dramatisch die Aufklärung das Deutschland des 18. Jahrhunderts verändert hat. Seine Darstellung reicht von der Neuordnung der politischen Landkarte um 1700 über die Erschütterung Europas durch das Erdbeben von Lissabon bis zum Vorabend der Französischen Revolution. Eine Epoche, die uns nähersteht, als wir glauben: Man schwärmt von Frieden und Freiheit, aber auch vom «Tode fürs Vaterland», und ausgerechnet Friedrich der Große, Musterbild des aufgeklärten Monarchen, beginnt einen Siebenjährigen Krieg, der zum ersten Weltkrieg wird. Vor allem aber entdeckt die Aufklärung, dass der Mensch keineswegs souverän, sondern zutiefst unmündig ist: Gefühle und Gewohnheiten wirken mächtiger als die Vernunft.
Steffen Martus zeigt das 18. Jahrhundert in neuem Licht. Er erzählt die Geschichte der Leidenschaften, der Politik, Kultur und Wissenschaft, er schildert den Alltag in den Universitäten, den Städten, bei Hofe und zeichnet eindringliche Porträts von Diplomaten, Dichtern und Gelehrten bis hin zu Kant, der Chancen und Grenzen der Erkenntnis erkundete. Ein einzigartiges Geschichtswerk über jene kritische Epoche, in der unsere Gegenwart beginnt.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, November 2015
Copyright © 2015 by Rowohlt·Berlin Verlag GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung Frank Ortmann
Umschlagabbildung akg/Bildarchiv Monheim
ISBN 978-3-644-12161-4
Anmerkung: Die Seitenzahlen im Register und Bildnachweis dieses E-Books beziehen sich auf die Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe.
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Einleitung: Die Entdeckung der Unmündigkeit
Teil I 1680–1726: Die Anfänge der Aufklärung
1. Im Fürstenstaat: die höfische Gesellschaft und ihre Projekte
Die Krönungszeremonie
«Er war klein und verwachsen …»
Der Spanische Erbfolgekrieg und das Gleichgewicht der Mächte
Höfe der Aufklärung
Höflinge der Aufklärung
Der Hof als Gesellschaftsmodell
Die Policey der Aufklärung
Die Berliner Akademie der Wissenschaften: Hofpolitik und Policeyeinsatz
2. In der Gelehrtenrepublik: die Universität als Staatsprogramm
Der Vater der (akademischen) Aufklärung
Die Universität als politisches Experiment
Für und wider den Stand der Gelehrten
Die Innenpolitik der Universität
Die Außenpolitik der Universität
Francke macht Anstalten
Pietistische Innovationen
3. Zwischen Stadt und Reich: Hamburger Patriotismus
Eskalationen
Der große Rezess
Der Sturm auf die katholische Kapelle
Die Stadt der Aufklärung
Aufklärung als Verbürgerlichung?
Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation
Das Reich der Unruhe
Die Macht der Patrioten
Flugschriftengestöber
Das Naturrecht des Medienbetriebs
«Patriotische» Medienpolitik
Irdisches Vergnügen in Gott
Vergnügter Sterben
Teil II 1721–1740: Aufklärung ohne Grenzen
4. «Ich habe das nit wuhst, das der Wolf so gottlose ist»
Die praktische Weisheit der Chinesen
Regierungsweisheit
Der Fall «Wolff»
5. Die «Art der heutigen Welt»
Modestadt Leipzig
Die Verbreitung einer schädlichen Philosophie
Johann Christoph Gottsched: eine Frage des guten Geschmacks?
Die «Deutsche Gesellschaft» wendet sich an die deutsche Gesellschaft
Patronage in unsicheren Verhältnissen
«Critische Dichtkunst» und Gesellschaft
Die Inszenierung einer Reform
Dramatische Einheit
Opernhafte Politik: das Zeithainer Lager
6. Die Natur der Aufklärung
Popularisierung?
Experimente
Vorsichtige Erfahrung
Eine Welt ist nicht genug
«Unendlichkeit! Wer misset dich?»
Physikotheologie
Esoterik
7. Weibliche Aufklärung
Sind Frauen auch nur Menschen?
Die Frauen der Moralischen Wochenschriften
«Eine tolle Dichterin mißbraucht iezt eurer Mannheit Zeichen»
Von der «gelehrten» zur «verständigen» Frau
Die «Gottschedin»
8. Die radikale Aufklärung des Buchmarkts
Radikale Aufklärung
«Consequentien-Macher»
Die Wertheimer Bibel verteidigt die Offenbarung und sorgt für einen Skandal
Buchmärkte
Zensur, Öffentlichkeit und Autorschaft
Ein Universallexikon aller Wissenschaften und Künste
Roi philosophe
Teil III 1740–1763: Aufklärung im Widerstreit
9. Politik für Newtonianer?
«Antimachiavel»
Zonen der Macht
Familienpolitik und der Beginn der Schlesischen Kriege
«Die mit der Newtonianischen Philosophie schwanger gehen»
10. Jeder gegen jeden
Thomasianer und Wolffianer
Von der Ästhetik zur heiligen Poesie
Der Dichterkrieg
Wo liegt eigentlich das Problem?
Der Sound der Aufklärung
11. Scherzende und empfindsame Aufklärung
Anakreontische Ästhetik
Witz und Wissenschaft
Empfindsame oder reizbare Tiere?
Ein Moralist «im Munde des Volks»: Gellert
Die Komödie der Empfindungen: Lessings «Freygeist»
Die Tragödie der Empfindungen: Lessings «Miss Sara Sampson»
12. Strukturen der Empfindung
Demographie und Heiratsfurcht
Regieren mit Herz: Friedrich II. und Maria Theresia
Produktive Missverständnisse
Die Königin der Herzen reformiert die Strukturen
Tiepolo und die katholische Aufklärung in Würzburg
Das Erdbeben von Lissabon erschüttert die Welt, aber nicht die Weltbilder
Der Wille zum Leben
13. Das «Spiel des Zufalls»: der Siebenjährige Krieg
Naturgeschichte der Politik
Der Beginn des ersten Weltkriegs
Schlachtbeschreibungen
Die Poesie des Kriegs
Patriotismus?
Die Religion des Kriegs
Nachkriegszeit
Soldatenglück
Teil IV 1763–1784: Das Ende eines «Zeitalters»?
14. «Zeitverwandte»
Winckelmanns Griechen
Die Kunst der Nation?
Stilprobleme der deutschen Politik
Patriotische Phantasien
Ein Bund für die deutsche Freiheit, von Studenten
Das Vaterland als Buchmarkt
Ein Bund für die deutsche Freiheit, von Fürsten
Ein Gartenreich
15. Die Individualität der Aufklärung
Die Individualität des Autors
Menschliche Kriminalität
Die Schwäche allgemeiner Gesetze
Die Individualisierung des Verbrechers
Des einen Leid, des andern Freud’: Werther
Philosophische Ärzte
Medicinische Policey
Die Geburt der Aufklärung
Erfahrungsseelenkunde
«Vom Schicksal verwahrlost und beschädigt»: Anton Reiser
16. «Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?»
Kants Philosophie: «das Zeichen unserer Zeit»?
Kants Probleme
Beantwortung der Frage: Was ist jüdische Aufklärung?
Haskala
«Hans Affe ist des Nachruhms werth»: Kant gegen Herder
Das krumme Holz des Menschen
Epilog: Aufklärung für unruhige Zeiten
Anhang
Literatur
Personen
Zeittafel
Dank
Bildnachweis
Einleitung: Die Entdeckung der Unmündigkeit
Im September 1783 machte ein anonymer Autor in der Berlinischen Monatsschrift den Vorschlag, «die Geistlichen nicht mehr bei Vollziehung der Ehen zu bemühen». Vermutlich handelte es sich um den Herausgeber der Zeitschrift, Johann Erich Biester, den Privatsekretär des preußischen Kultusministers. Biester wusste genau, was er tat. Er wollte provozieren. Zwar stellte Biester fest: «[F]ür aufgeklärte bedarf es doch wohl all der Ceremonien nicht!»[1] Er fügte jedoch gleich hinzu: Allenfalls in «unmerklicher Ferne» werde sich die Ehe von kirchlicher Bevormundung befreien.[2]
Der Berliner Prediger Johann Friedrich Zöllner, der sich unter anderem mit einem mehrbändigen Lesebuch für alle Stände um die Volksaufklärung verdient machte, antwortete umgehend: Die Ehe sei eine viel zu wichtige Institution, um sie ohne den Segen der Kirche zu schließen.[3] Während Biester also nicht daran glaubte, dass sich sein Reformvorschlag mit der Kraft des vernünftigen Arguments in absehbarer Zeit durchsetzen würde, misstraute Zöllner der menschlichen Gefühlssicherheit und Gefühlsgewissheit. Worauf sollte die Aufklärung dann noch gründen, wenn weder auf den Kopf noch auf das Herz Verlass war?
Die Berlinische Monatsschrift war zu Beginn des Jahres erstmals erschienen und wurde von Biester gemeinsam mit Friedrich Gedike, dem Direktor des Friedrichswerderschen Gymnasiums, herausgegeben. Im Hintergrund stand die «Mittwochsgesellschaft» von zunächst zwölf, dann vierundzwanzig einflussreichen Männern, die sich einmal wöchentlich trafen, eine Abhandlung lasen und dann darüber debattierten. Wie das Journal zeigte auch der Gesprächskreis «Eifer für die Wahrheit, Liebe zur Verbreitung nützlicher Aufklärung und zur Verbannung verderblicher Irrthümer».[4] Die Männer setzten auf Einigkeit in allgemeinen Grundsätzen. Jenseits davon störte sie Meinungsvielfalt nicht, solange eine halbwegs gute Idee zu einer besseren anregte.[5]
Kontroversen wie die zwischen Biester und Zöllner waren also gewollt. Das intellektuelle Leben der ganzen Aufklärung wurde von Streitigkeiten rhythmisiert, die ebenso vehement wie unversöhnlich geführt wurden. Die Diskussion um die Zivilehe änderte zwar wie so viele gut gemeinte Debatten des 18. Jahrhunderts wenig an der gesellschaftlichen Realität, war aber in einer anderen Hinsicht folgenreich. Zöllners Replik zeichnete ein eigentümlich dekadentes Bild seiner Gegenwart, und zwar nicht als Effekt mangelnder, sondern als Folge übermäßiger Aufklärung: «In unsern Zeiten, wo die Ausschweifungen so mächtig um sich greifen, wo man von abscheulichen Lastern mit Lächeln spricht, […] wo man die Libertinage auf Grundsätze gebracht zu haben glaubt, […] wo fast keine vaterländische Sitte mehr übrig ist, die von französischen Alfanzereien noch verdrängt werden könnte – in unsern Tagen sollte es überflüssig sein, für äußerliche Heiligkeit der Ehe zu sorgen; und sollte man hoffen, daß die innere durch Gewohnheit, Tradition, u.s.w. bleiben werde?»[6] Diese Art der «Aufklärung» verwirre die «Köpfe und Herzen der Menschen», untergrabe die «ersten Grundsätze der Moralität» und setze den «Werth der Religion» herab.
Hier nun formulierte Zöllner ganz nebenbei, in einer Fußnote, die entscheidende Frage: «Was ist Aufklärung?» Man solle doch, so meinte er, füglich eine Antwort finden, «ehe man aufzuklären anfinge!».[7] Und so führte die eine Debatte zur nächsten, denn den Vorwurf mangelnder Aufklärung über die Aufklärung ließ man nicht lange auf sich sitzen. Zunächst reagierte Moses Mendelssohn, sein Beitrag erschien im September 1784. Die geradezu klassisch gewordene Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? kam dann drei Monate später von Immanuel Kant. Wer sechs Groschen übrig hatte, konnte diesen Essay in «allen Hauptorten Deutschlands» entweder in den «ansehnlichsten Buchhandlungen» erwerben oder, wo keine Buchhandlungen existierten, auf dem Postamt.
Wie kein anderer Beitrag dieser einstmals berühmten Monatsschrift hat Kants Aufsatz die Zeit des 18. Jahrhunderts überdauert, und dies liegt auch am unnachahmlichen Schwung seines ersten Absatzes. Nie wieder wurde so glänzend und pointensicher über die Aufklärung geschrieben: «Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Muthes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. Sapere aude! Habe Muth, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.»[8]
Kant erwies sich als begnadeter Werbetexter. Er hatte den Slogan für die Aufklärung gefunden. Seine Sätze stehen für die Epoche und fehlen in keinem Lehrbuch. Es scheint, als habe das Projekt der Aufklärung damit eine bündige Definition erfahren. Der Mensch wirft die Ketten von sich, in die ihn Politik, Religion und Gesellschaft gelegt haben. Er hebt den Kopf mit einer souveränen Geste der Selbstermächtigung, macht sich seine eigenen Gedanken, beansprucht Autonomie für seine Ideen und Meinungen, befreit den Geist vom Gängelband der Vorurteile, Autoritäten und Traditionen. Diese Zeilen sind unsterblich geworden.
Seine Zeitgenossen verhielten sich Kant gegenüber sehr viel skeptischer. Als Philosoph war er 1784 höchst umstritten. Drei Jahre zuvor war die Kritik der reinen Vernunft erschienen; Kant selbst glaubte fest daran, dass er die Metaphysik damit von Grund auf revolutioniert hatte. Diese philosophische Revolution geschah jedoch zunächst im Stillen. Das Publikum reagierte zurückhaltend. Einige nahmen das Buch schlicht nicht zur Kenntnis; andere registrierten das Werk mit einer gewissen überforderten Abneigung; wieder andere bedachten es mit überheblichem Tadel. Die Göttinger Anzeigen von gelehrten Sachen, eine der renommiertesten Zeitschriften der Epoche, machten im Januar 1782 den Anfang. Die Kritik der reinen Vernunft, so lautete der zentrale Vorwurf kurz und knapp, widerstreite dem «gesunden Menschenverstand».[9] Man hatte Kants Pointe nicht verstanden, oder man wollte sie nicht verstehen.
Die ersten Leser reagierten deswegen so verständnislos auf die Kritik der reinen Vernunft, weil Kant die Aufklärung mit seinem gesamten intellektuellen Habitus brüskierte. Die Aufklärung bediente sich aus vielen Quellen, da sie dem Prinzipiellen zunehmend misstraute; Kant entfaltete seine grundlegenden Argumente mit dem gnadenlosen Willen zum System. Der Aufklärung genügte in der Regel der common sense als Versicherung gegen jede Form der gedanklichen Radikalität; Kant blickte abschätzig auf den gesunden Menschenverstand. Die Aufklärung hatte die Sinnlichkeit und die Erfahrung philosophisch geadelt; Kant interessierte sich für den Eigensinn der Verstandeskräfte. Und während die Aufklärung mit dem Versprechen angetreten war, dass der Mensch von Natur aus dazu neige, die allgemeine Glückseligkeit zu fördern, erkannte Kants Pflichtethik die Größe des Menschen darin, dass dieser sich gegen seine Neigungen zu entscheiden vermöge.[10] Somit fiel den Zeitgenossen die destruktive Komponente an Kants «Kritik» sehr viel mehr auf als die konstruktive – nicht umsonst nannte Moses Mendelssohn ihn den «alles zermalmenden».[11]
In einem Punkt schwenkte Kant jedoch auf die Linie der Aufklärung ein: Er erkannte das Problem, dass vernünftige Argumente nicht notwendigerweise von sich aus überzeugen. Daher arbeitete er am Gedankenmarketing und machte sich populär.[12] Mit seinen Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können reagierte er im April 1783 auf die schleppende Rezeption seiner ersten «Kritik» und versuchte, sein Anliegen in einer überschaubaren, leichter fasslichen Form darzubieten. Zu weiteren Popularisierungsmaßnahmen zählten dann auch die Beiträge, die Kant seit 1783 parallel zu den Prolegomena regelmäßig in der Berlinischen Monatsschrift veröffentlichte. Seine Beantwortung der Aufklärungsfrage machte mit der Polemik gegen intellektuelle Bequemlichkeit gewaltig Stimmung zugunsten der «kritischen» Philosophie: Wer sich bei der Lektüre der Kritik der reinen Vernunft zu wenig Mühe gab und kapitulierte, der musste sich nun den Vorwurf gefallen lassen, zu den «faulen» Denkern zu zählen. Kant klagte seine Zeitgenossen an, weil sie sich wie dummes «Hausvieh» behandeln ließen, und dies auch noch gern: «Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurtheilt, u.s.w. so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen.»[13]
Kant zog über Schriftsteller und Gelehrte, Theologen und Ärzte her. Aber waren dies nicht genau jene Berufsgruppen, die die Berlinische Monatsschrift mit Beiträgen versorgten? Die meisten Aufklärer wären vermutlich schon froh gewesen, wenn die Menschen sich tatsächlich in der von Kant angeprangerten Unmündigkeit eingerichtet hätten: wenn sie gern ein gutes Buch zur Hand genommen hätten, das ihnen im Leben weiterhalf; wenn sie Teil einer Gemeinde gewesen wären, deren Pfarrer die Seelenruhe nicht mit Donnerworten störte, sondern von einer angenehmen und nützlichen Schöpfungsordnung predigte; wenn sie sich an den Ratschlag eines kenntnisreichen Arztes gehalten hätten, der für ihr körperliches Wohlbefinden sorgte. Diese Aufklärung orientierte sich an den natürlichen Bedürfnissen der Menschen und hielt es daher für ein gutes Zeichen, wenn diese Freude und Vergnügen empfanden, zufrieden waren und sich wohl fühlten.
Ganz anders Kant: Das intellektuelle Leitbild der Aufklärung war die offene Bewegung des Spaziergangs in anmutiger Umgebung, dasjenige der Kant’schen Philosophie die akkurat geplante Reise auf «dornichtem Weg».[14] Diese Marschroute wirkte nicht auf Anhieb attraktiv. Dass Kant rhetorisch so sehr auftrumpfte, war also nicht nur seiner Leidenschaft für die Sache geschuldet. Er reagierte auf den Überzeugungsnotstand, unter dem seine philosophische Revolution anfangs litt, weil er verstanden hatte, dass Argumente nur dann verfangen, wenn die Menschen dafür bereit sind: wenn ein Problem überhaupt gesehen wird und den Eindruck erweckt, dass es sich mit einer gewissen Dringlichkeit stellt; wenn der Bedarf an neuen Lösungen erkannt und anerkannt wird; und wenn man willens ist, Zeit und Aufmerksamkeit zu investieren, um sich auf ein Gedankenangebot einzulassen. Für all dies konnten Argumente selbst nicht sorgen.
Kant gab seinen Formulierungen daher jenen eleganten Schwung, der gerade die Beiträge zur Berlinischen Monatsschrift auszeichnet; er popularisierte seine Überlegungen und machte Zugeständnisse an die Neigungen seiner Zeitgenossen, an ihre Gewohnheiten und Vorlieben; er drehte an den Stellschrauben des Medienbetriebs, lancierte Rezensionen oder haute selbst unliebsame Gegner in die Pfanne, um für gute oder schlechte Stimmung zu sorgen; und er verfolgte über Jahre hinweg eine Strategie der kleinen Maßnahmen, bis sich das Meinungsklima zu seinen Gunsten verändert hatte. Dieser Zeitpunkt war 1784 mit der Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? erreicht. Von da an konnte man Kant nicht mehr ignorieren. Man musste ihm gegenüber Stellung beziehen.[15] Ob er freilich als Sieger vom philosophischen Kampfplatz gehen würde, war nach wie vor offen. Noch immer stellte sich die Frage, die das ganze 18. Jahrhundert insgeheim bewegt hatte: Wie klärt man die Menschen so auf, dass sie aufgeklärt sein wollen?
Diese Leitfrage hat mich als Epochenproblem fasziniert. Georg Christoph Lichtenberg formulierte sie in seinen Sudelbüchern mit einem beinahe schon verzweifelten Nachdruck: «Man spricht viel von Aufklärung, und wünscht mehr Licht. Mein Gott was hilft aber alles Licht, wenn die Leute entweder keine Augen haben, oder die, die sie haben, vorsätzlich verschließen?»[16] In den aktuellen Kulturkonflikten stellt sich das Problem mehr denn je. Wir sehen tagtäglich, dass Argumente, die uns triftig erscheinen, anderen Menschen gar nicht einleuchten. Wir stellen fest, dass unser Lebens- und Denkstil, unsere Lebens- und Denkhaltung nicht per Anweisung, Belehrung oder Gesetz übertragen werden können. Wir verstehen, dass wir für unsere grundlegenden Einstellungen werben müssen und dass wir dafür viel Zeit, Geduld und nicht allein gute, sondern auch attraktive und interessante Ideen benötigen. Im 18. Jahrhundert drängten sich diese Einsichten auf, weil die Gesellschaften der Aufklärungsepoche vor einer inneren Zerreißprobe standen. Begreift man diese Situation nicht nur als vorübergehend, als Phase des «noch nicht» und des Übergangs, sondern als historische Lage mit eigenem Recht, dann ist die Aufklärung gerade in ihren Ambivalenzen ein zwar «ferner», aber doch guter Spiegel unserer Zeit.[17]
Kants Beitrag war mehr als ein weiteres Scharmützel in der langen Streitgeschichte der Aufklärung. Anders als in der verbreiteten Erzählung vom Königsberger Philosophen als Speerspitze der Aufklärung ging er inhaltlich auf radikalen Konfrontationskurs mit seinen Zeitgenossen. Im Schwung seiner Gedanken jedoch, im Takt seiner Sätze und Formulierungen nahmen seine populären Texte den Rhythmus der Aufklärung auf und überboten an Eindringlichkeit alles, was die Epoche bislang über sich selbst zu sagen wusste. Seine Aufklärung machte eine so gute Figur, dass sie alles Vorherige bald in den Schatten stellte.
Als ich mit der Arbeit an diesem Buch begonnen habe, war mir daher klar, dass meine Geschichte der Aufklärung bei Kant anfangen und enden, aber nicht auf ihn zulaufen würde. Es hat mich immer wieder enttäuscht, wenn ein Beitrag zur Aufklärung mit der knackigen Formel vom «Ausgang aus der selbst verschuldeten Unmündigkeit» so anmoderiert wurde, als verstehe sich diese Wendung von selbst und als wäre damit schon beinahe alles gesagt. Daraus hat sich der Arbeitstitel für dieses Buch ergeben: Die Entdeckung der Unmündigkeit.
Mich interessiert am 18. Jahrhundert nicht die noch immer gern erzählte Fabel vom Aufstieg des Bürgertums, das sich aus der Knechtschaft des Adels befreite, oder von der Entfesselung der Vernunft, die endlich die Bande der Dogmen und Traditionen abstreifte, sondern der kleine Nachsatz, mit dem Kant seine Leitparole erläuterte: «Selbst verschuldet ist diese Unmündigkeit», so erklärte er, «wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen.» Wie aber fasst der Mensch seine Entschlüsse – und warum fasst er bisweilen auch dann falsche Entschlüsse, wenn es ihm nicht an Verstand mangelt? Woraus bezieht er seinen gedanklichen Mut? Und ist es wirklich vorteilhaft, «ohne Leitung eines andern» zu denken, wenn es so überaus kluge Menschen wie beispielsweise Kant gibt?
Bis zu diesem Zeitpunkt war ich gewohnt, die Aufklärung als Literaturwissenschaftler zu betrachten; und auch dieses Buch verbirgt die Vorliebe für die ästhetischen Seiten der Aufklärung nicht. Ich wollte jedoch eine Epochengeschichte schreiben, in der die literarischen Phantasien und Strategien der Aufklärung nur ein wichtiges Element neben Politik, Wissenschaft oder Religion sind. Es kam mir darauf an, wie und warum Dichter, Politiker, Wissenschaftler oder Theologen ihre Gedanken ins soziale Spiel brachten. Will man sich nur die guten und frischen Ideen der Aufklärung vergegenwärtigen, genügt es, in den Jahrzehnten «um 1700» zu verweilen, in denen «eine neue Ordnung der Dinge» gedanklich ihren Anfang genommen hat.[18] Wie aber verhielten sich die Ideen zu Ereignissen, Akteuren, Institutionen oder Gesellschaftsstrukturen? Und lässt sich davon so erzählen, dass die Vielstimmigkeit weder zum Schweigen gebracht wird noch in Einzeldiskurse von Politik, Religion, Wirtschaft, Wissenschaft oder Kunst zerfällt?[19]
Ich glaube, dass es sehr gute allgemeine Antworten auf solche Fragen gibt. Nähert man sich jedoch dem Material und will es anschaulich vermitteln, wird es schwierig, eine abstrakte Perspektive konsequent durchzuhalten. Die Aufklärer teilten daher überwältigend große Probleme in handhabbare und «merkwürdige» Fälle auf, an denen sich möglichst viel beobachten ließ. Ich bin dieser Anregung gefolgt. Eine vollständige Auflistung aller bedeutenden Namen war nicht mein Ziel. Einige meiner Lieblinge kommen in diesem Buch namentlich gar nicht vor. Die Herausforderung bestand vielmehr darin, mich Details und einzelnen Ereignissen so zu widmen, dass Strukturen und übergreifende Problemzusammenhänge erkennbar werden. Auch deswegen interessiere ich mich für die Lokalität der Aufklärung und konzentriere mich auf ein Epochenbild des deutschen 18. Jahrhunderts: Die Höfe, Universitäten und Städte des Alten Reichs boten so unterschiedliche Bedingungen, dass die Aufklärung als Pluralisierungseffekt gut erkennbar wird.[20]
Aus der Perspektive vor Ort fiel mir vor allem auf, wie vielfältig die Aktivitäten der Aufklärung waren: wie virtuos unterschiedlichste Akteure versucht haben, ihre Ideen zu einem Teil des gelebten Alltags zu machen, und wie groß die Widerstände waren, auf die sie dabei gestoßen sind. Je genauer man einsah, wie Wissen entsteht, sozial etabliert oder vermittelt wird, desto rätselhafter wurde das animal rationale. So zeichnete sich das zunehmend tiefgründige Bild eines Menschen ab, der gerade als Individuum auf andere angewiesen ist, dessen Gedanken nur auf Umwegen zirkulieren, der keine souveräne Entscheidungsmacht über sich selbst hat, der vielmehr von seinem Körper, seiner Erziehung, seiner gesellschaftlichen Umgebung und den kulturellen Bedingungen seiner Zeit abhängt. Der Mensch der Aufklärung ist demnach ganz wesentlich auch ein Gewöhnungs- und Gefühlstier, ein Mängelwesen, das viel Pflege, Nachsicht und Verständnis benötigt. An diesem Zustand hat sich bis heute wenig geändert. Die Bedeutung der Aufklärung für uns liegt daher weniger im Aufruf zur rationalen Ermächtigung als vielmehr darin, uns unsere Unmündigkeit einzugestehen und mit ihr produktiv umzugehen.
Teil I1680–1726: Die Anfänge der Aufklärung
Fürstenstaaten, Gelehrtenrepublik, Städte und das Alte Reich definierten die sozialen und lokalen Bedingungen der Aufklärung. Jeder von diesen «Orten» hatte eine Seite, die sich der Aufklärung zuwandte, und eine, die sich von ihr abkehrte: Der Fürstenstaat kämpfte gegen das undurchdringliche Geflecht ständischer Privilegien – aber er konservierte traditionelle Vorstellungen von Autorität. Die Gelehrtenrepublik lobte Freiheit und Gleichheit – aber als Ideale eines gelehrten Standes mit eigenen Vorrechten. Die Stadt war ein Biotop von Pluralität und Innovation – aber sie wehrte sich dagegen und wünschte sich überschaubare Ordnung. Das Alte Reich dynamisierte mit seinen vielfältigen Bündnischancen, Ausweichmöglichkeiten und überraschenden Koalitionsofferten das politische und intellektuelle Leben – aber es war auch der überaus stabile Hort einer Gesellschaft von Ungleichen.
Überwölbt, durchdrungen, gequert und verbunden, man könnte auch sagen: delokalisiert wurden diese «Orte» der Aufklärung von ganz unterschiedlichen Formen eines Medienverkehrs, der sich der räumlichen Logik einer Kommunikation unter Anwesenden verweigerte. Akten, Aktien, Aushänge, Beschlüsse, Briefe, Bücher, Broschüren, Einzeldrucke, Flugschriften, Geld, Gesetze, Gutachten, Mandate, Policen, Quittungen, Rechnungen, Schuldscheine, Verordnungen, Verträge, Werbung, Zeitungen und Zeitschriften und viele andere Formate kursierten in unterschiedlichen Kreisen, mit unterschiedlichen Funktionen, mit unterschiedlichen Reichweiten, Verlässlichkeiten und Verbindlichkeiten. Eines aber war ihnen gemeinsam: Sie alle trugen dazu bei, dass die Aufklärung sich auf soziale Verhältnisse einstellte, die nicht mehr primär vom «Ansehen» ausgingen und stattdessen für eine Gesellschaft von Abwesenden entworfen wurden.[1]
Weder die Universität noch die Höfe, die urbane Umgebung, das komplizierte Gefüge von Territorialstaaten und Landeshoheiten oder die Welt der Medien allein boten die Grundlage der Aufklärung, sondern ihr kompliziertes Zusammenspiel. Um solche Symbiosen soll es im Folgenden gehen und vor allem darum, wie sich durchaus ungleiche Interessen so miteinander verbunden haben, dass bereits Zeitgenossen den Eindruck einer epochalen Wende gewinnen konnten.
«Aufklärung» findet sich also nicht allein dort, wo philosophisch bedeutsame «Grundideen» entstehen.[2] Es geht vielmehr um Effekte, die sich aus dem Zusammenwirken von unterschiedlichen Personen mit ganz eigenen Absichten ergaben. Fürsten «verabsolutierten» ihre Macht; Beamte suchten ihre Position im Patronagesystem des Hofs; Gelehrte strebten nach einer Professur und rückten dabei ihr Fachgebiet ins Zentrum der politischen Aufmerksamkeit; Stadtpolitiker wollten mit größter publizistischer Raffinesse für Ruhe auf den Straßen und erfolgreichen Handel im Reich sorgen. Sie alle teilten ein Problembewusstsein, das es nicht erlaubte, einfach so weiterzumachen wie bisher. Sie benötigten «Aufklärung» über die strukturellen Bedingungen von Menschlichkeit und Gesellschaft.
1.Im Fürstenstaat: die höfische Gesellschaft und ihre Projekte
Am 17. Dezember 1700 machte sich der brandenburgische Kurfürst von Berlin aus auf den Weg zu seiner Krönung in Königsberg. Das rund sechshundert Kilometer entfernte Ziel lag außerhalb des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation. Der Kaiser hatte dort nichts zu sagen. Hier wollte Friedrich III. sich zum Souverän erklären.
Die Familie und der Hof waren mit von der Partie. Die Reisegesellschaft teilte sich in vier Gruppen, die jeweils den Umfang eines Kriegsheers hatten. Das Gefolge des Kurfürsten bestand in einer recht groben Schätzung aus «zwey bis dreyhundert Carossen und Rüst-Wagen».[1] Allein den Wechsel der Pferde zu organisieren, war eine gewaltige Aufgabe. Insgesamt benötigte das Unternehmen mehr als dreißigtausend Tiere. Keine Armee hätte sich im Winter aus dem Quartier getraut, der Kurfürst verstieß gegen alle Regeln der Mobilisierungskunst. Es herrschte Tauwetter, die Weichsel führte Hochwasser, und die Reisegesellschaft musste einen Umweg über Danzig nehmen. Dennoch verlief alles nach Plan. Für die Fahrt waren zwölf Tage berechnet; obwohl man nur am Vormittag reiste, traf Friedrich III. pünktlich kurz vor dem Jahreswechsel am 29. Dezember am Zielort ein. Man sollte sehen: Dieser Herrscher kann kalkulieren, er setzt sich durch, und das auch unter widrigen Bedingungen.
Die hektische Betriebsamkeit mitten in der ungemütlichen Winterzeit, die wahrlich keine günstigen Voraussetzungen für ein großes öffentliches Fest unter freiem Himmel bot, hatte ihren guten Grund. Die Leistungen, die Friedrich III. im vergangenen Jahrzehnt für die Verteidigung des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation erbracht hatte, waren so wenig wie die seines Vaters anerkannt worden. Selbst Emporkömmlinge wie die Niederlande hatten das Kurfürstentum erniedrigt:[2] Bei einem Treffen in Den Haag im Jahr 1696 wollte Wilhelm von Oranien Friedrich III. zumuten, auf einem einfachen Stuhl Platz zu nehmen, wohingegen er sich einen Armlehnstuhl gönnte – der Oranier war vor noch nicht allzu langer Zeit in England zu königlichen Würden aufgestiegen und ließ seinen nahen Verwandten auf diese Weise körperlich spüren, wie es um die Rangverhältnisse stand. Um die Situation zu deeskalieren, führte man die Konversation nach einigem Hin und Her schließlich im Stehen.[3]
Die Großmächte hatten in den vergangenen Jahren immer wieder über den Kopf des brandenburgischen Kurfürsten hinweg entschieden, ihn gekränkt, ihm Befehlsgewalt vorenthalten oder seine Truppen für besonders riskante Aktionen eingesetzt. Die Könige und der Kaiser demonstrierten dem Kurfürsten, dass er eine Liga unter ihnen spielte: In entscheidenden Verhandlungen erkannten sie ihn schlicht nicht als Gesprächspartner an, so etwa beim Friedenskongress von Rijswijk, mit dem 1697 der Pfälzische Erbfolgekrieg gegen den Sonnenkönig Ludwig XIV. beigelegt wurde.[4] Ob man Friedrich III. im Kreis der europäischen Großmächte hörte oder nicht, hing weniger von militärischer Stärke als vielmehr von seinem Status ab. Politische Größen, die wie der Kaiser, der französische oder englische König per definitionem als «souverän» galten, gestanden nur einem anderen Souverän das Mitspracherecht zu.
Friedrich beobachtete seine Rivalen und die kommenden Veränderungen genau und sah, dass etwa Braunschweig-Lüneburg sein Territorium erweiterte, dass Hannover sich auf dem Sprung ins Königshaus von Großbritannien befand, dass die bayerischen Wittelsbacher sich ebenfalls – allerdings vergeblich – um die Königswürde bemühten und dass August der Starke den Wettinern in Sachsen 1697 die polnische Krone errungen hatte.[5] Das System befand sich in Unruhe und Bewegung. Um 1700 wurden die politischen Strukturen des Aufklärungszeitalters definiert.
An der Jahrhundertwende stand ein weiterer großer Krieg bevor.[6] Am 1. November 1700 war Karl II., der letzte spanische Habsburger, gestorben. Alle wussten, dass es zu einem Streit um die Erbfolge kommen würde. Je ungünstiger sich dabei die Lage für den Kaiser entwickelte, desto wahrscheinlicher wurde seine Zustimmung zur Rangerhöhung des brandenburgischen Kurfürsten, denn er benötigte wie so oft Hilfe im Kampf gegen Frankreich: Am 16. November 1700 wurden die Ergebnisse der Verhandlungen zwischen Leopold I. und Friedrich III. im sogenannten Krontraktat festgeschrieben. Der Kurfürst sicherte dem Kaiser Truppen für den kommenden Krieg und den Habsburgern Stimmen bei künftigen Kaiserwahlen zu. Leopold akzeptierte die Krönung. Am 4. Dezember wurde der Vertrag endgültig ratifiziert.[7]
Friedrich III. hatte seine Krönung seit 1692 vorbereitet[8] und einen sehr langen Atem bewiesen. Fast seine ganze bisherige Regierungszeit hatte ihn dieses Projekt begleitet. Nun musste alles ungeheuer schnell gehen. Der Weg nach Königsberg und damit nach Preußen sollte für ihn und die Hohenzollern der Weg in ein neues Zeitalter werden. Als Johann Gottfried Herder kurz nach der Wende zum 19. Jahrhundert fasziniert auf die Anfänge seiner Gegenwart zurückblickte, datierte er sie kalendarisch genau: «Man sehnte sich», so schrieb er 1802, «nach dem Jahr 1701 als nach einer neuen Epoche in Ordnung der Dinge zum Heil der Menschen; der Zahlen 1600 war man müde.» Die Zeit habe sich damals in «Gährung» befunden. «In einer solchen Krisis der Zeiten nahm Friedrich die Krone […].»[9]
Tatsächlich kündigte sich eine «Krisis der Zeiten» nicht durch das Jahr 1700 oder 1701 an, sondern dadurch, dass man an dieser Jahrhundertwende mehr als zuvor bereit war, den Wechsel eines Säkulums als historischen Einschnitt zu werten und damit die geistige Unruhe in eine epochale zu übersetzen.[10] Bis weit ins 18. Jahrhundert dominierte der Zyklus von Krisen und Krisenbewältigung das Selbstbewusstsein der frühneuzeitlichen Mangelgesellschaft. Verteilt wurde eine beschränkte Menge von Gütern; es stand kein Überschuss zur Verfügung, mit dem man Neues hätte planen können. Dennoch bahnte sich in der Aufklärung die eigentlich merkwürdige Idee der Unerschöpflichkeit den Weg. Die Bewahrung des Status quo stand nicht mehr unumstritten an oberster Stelle der Agenda. Als vormodern erschienen aus Perspektive der «Neuerer» jene Gesellschaften, die sich an längst vergangenen Ursprüngen orientierten und ihre Werte darauf gründeten. Gesellschaften erwiesen sich nun als modern, wenn sie ihre Ziele in der Zukunft bestimmten und Werte als etwas verstanden, was es nicht in erster Linie wiederzugewinnen, sondern zu realisieren galt.[11]
Man sollte sich für einen Augenblick die Leistungen einer gleichsam in Zyklen geborgenen Kultur verdeutlichen, bevor man wie selbstverständlich auf die innovationsversessene Seite der Aufklärung tritt: Was sollte so schlecht daran sein, die überlieferten Güter zu bewahren, zu sammeln, zu differenzieren und zu vertiefen? Warum sollte man in einen Prozess der intellektuellen Innovation eintreten, der notwendigerweise vieles verdrängen und dem Vergessen anheimgeben würde? Bedeutete es wirklich ein so geringes Verdienst, sorgsam und ehrfurchtsvoll mit den Gedankenlandschaften der Tradition umzugehen, sie urbar zu machen und sich in ihnen wohlig einzurichten?
Vielen erschien es um 1700 zunächst geradezu widersinnig,[12] dass Jahrhunderte von nun an – anfangs noch mit einem nur schwachen Epochenbewusstsein, dann mit immer stärkerer Emphase des Bruchs und der Zäsur – etwas Besonderes bedeuten sollten: als wechsle der Kalender an einem bestimmten Datum die Physiognomie der Geschichte aus, als fließe die Zeit nicht einfach dahin, als folgten nicht einfach Tag auf Tag, Woche auf Woche, Monat auf Monat und Jahr auf Jahr und als kümmerten sich die Ereignisse, die intellektuellen Neuerungen und sozialen Veränderungen darum, mit welchen Zahlen sie von Menschen willkürlich bedacht werden.
Selbst in der Welt der Politik schienen sich seit dem ebenso dynamischen wie stabilen System des Westfälischen Friedens die Gewichte zwar mal in die eine, mal in die andere Richtung zu verschieben; Ziel aber war während der Aufklärungsepoche die Bewahrung der Balance. Die Erfahrung bestätigte diese Haltung. Der Siebenjährige Krieg (1756–1763), in dem einige den ersten Weltkrieg sahen, führte nach jahrelangen erbitterten Kämpfen, nach der Verwüstung von Städten und dem Tod unzähliger Soldaten lediglich dazu, dass staatspolitisch die Vorkriegsverhältnisse zementiert wurden. Die entscheidende Frage an der Epochenwende zur Aufklärung war jedoch: Wer bestimmt über das Gleichgewicht?
Um 1700 wurde der Rahmen für jenes Balance-Denken gestiftet, das dann die fiebrige Bündnis- und Militärpolitik der Aufklärungsepoche beschränkte. Es gab zwar viele gute Gründe, die Jahrhundertwende mit einem gewissen Gleichmut zu betrachten, weil man die Wiederkehr von Bekanntem erwarten durfte. Wer jedoch in dieser Situation kein Gespür für das sich ankündigende Neue entwickelte, verspielte seine Möglichkeiten. Friedrich III. hatte dies erkannt. Er nutzte die Chance, seine Rangerhöhung als Zeitensprung zu verkaufen, um auf diese Weise entscheidend in das Machtgefüge der Politik eingreifen zu können. Eine der vielen zur Krönung in Auftrag gegebenen Predigten schärfte am 18. Januar 1701 in Magdeburg der Gemeinde emphatisch ein, «daß wir / durch die Barmhertzigkeit Gottes / erlebet den Eingang in ein neues seculum»: Dieser Tag verkündige «Unserm geliebten Vaterlande Verbesserung deß Staats / und Vemehrung des Glücks».[13]
Die Krönungszeremonie
Die Verhandlungen über einen Allianzvertrag zwischen Leopold I. und Friedrich III. im November 1700 fanden nicht einmal zwei Wochen vor der Reise des Berliner Hofs in Richtung Osten statt. Dem brandenburgischen Kurfürsten war klar, dass seine Rangerhöhung der Öffentlichkeit Europas mit einem aufsehenerregenden Spektakel dargeboten werden musste. Nur so konnte ein neuer Herrscher in der höfischen Beeindruckungskultur seinen Anspruch auf Mitsprache untermauern.
Der Aufsteiger riss die Staatskasse für das Jahrhundertereignis weit auf: Bis zu sechs Millionen Taler soll der feierliche Eintritt in das neue Zeitalter gekostet haben. Das Spektakel verschlang weit mehr, als sein Land in einem Jahr einnahm. Zum Vergleich ein Blick auf das übliche Budget der Hofhaltung: 1697 verausgabte Friedrich III. 302000 Taler, 1706 waren es 376000 Taler, und schon damit griff er tief in die Tasche – für den gesamten bürokratischen Apparat, die Justiz sowie das Kirchen-, Bildungs- und Schulwesen wandte man im selben Jahr lediglich 420000 Taler auf.[14]
Die Feierlichkeiten organisierte der Zeremonienmeister Johann von Besser. Entworfen aber, so betonte es die offizielle Krönungs-Geschichte, habe das Zeremoniell der Kurfürst höchstpersönlich: Hier zeigte einer, dass er sich nicht das Heft aus der Hand nehmen ließ. Um die Gestaltungskraft des Monarchen zu beglaubigen, kehrte Besser in der Krönungs-Geschichte immer wieder den Neuigkeitswert des Vorgangs heraus: Die vom Kurfürsten an der Schwelle zur Monarchie «neugestiftete Krone Preussens / ist wohl eine der allergrössten und seltsamsten Begebenheiten / die man bey vieler Menschen Andencken erlebet» – ein «Wunder des neuangefangenen Seculi».
Diese Innovationsemphase könnte angesichts der Krönung des sächsischen Kurfürsten im Jahr 1697 überraschen. Aber es stimmt: August der Starke hatte ja nur die bereits existierende polnische Krone angenommen; Friedrich III. hingegen stiftete jene Krone selbst, mit der er sich dann zu Friedrich I. erklärte – der Kaiser hatte unter dem Druck des kommenden Krieges zugestimmt, dass er die preußische Krone lediglich anerkannte, nicht aber kreierte, sodass kein Schatten auf die Souveränität der neuen Königswürde fiel. Der Gekrönte machte sich damit «den Größten dieser Welt gleich», und dies nicht in einem gewaltsamen Umsturz, nicht durch Erbfolge oder sonstige Machtübertragung, nicht durch Wahl oder Ernennung, «sondern durch einen gantz neuen Weg: durch seine eigene Tugend und Stifftung». Dieser Herrscher war «Uhrheber Seines Reiches und Trohnes», und damit hatte er «seine Erhöhung keinem / als Sich Selbsten zu dancken».[15]
Friedrich III. erhob mit diesem Akt also einen sehr zeitgenössischen Erneuerungsanspruch, und er knüpfte zugleich an eine Innovationstradition seines Herrscherhauses an: Der Kampf um die Souveränität war innenpolitisch ein Streit um die Zulässigkeit der Erneuerung entgegen jenen historischen Privilegien, auf die die Landstände sich beriefen, ein Streit auch um die Frage, ob es erlaubt war, Politik im Blick auf die Zukunft sowie auf Erwartungen und nicht aus der Vergangenheit heraus zu betreiben.[16] Friedrich zählte mithin zu den «Neuerern» nach innen und außen, und als solcher setzte er sich gegen alle Widerstände durch, selbst gegen seine unmittelbare Umgebung: Ratgeber, die Familie bis hin zur Kurfürstin und dem Kurprinzen waren von seinen Plänen alles andere als begeistert.[17] Die Fürsten des Alten Reichs verwehrten sich den Ambitionen Friedrichs wie im Grunde auch der Kaiser, der eben «keine neuerungen liebet», wie einer seiner Vertrauten in der Anbahnungsphase des Krönungsprojekts kolportiert hatte.[18]
Wie bildete sich so etwas wie ein Sinn, ein Faible, eine Kompetenz für das Neue aus? Seit Humanismus und Renaissance wurden immer wieder Debatten um den Status einer «neuen Zeit» geführt, und sie dauerten bis zum Ende des 18. Jahrhunderts an.[19] Gerade um 1700 florierten die novitas-Traktate. Nicht wenige bestritten, dass es überhaupt Innovationen gab. Es fiel jedoch zunehmend auf, dass einige Menschen nicht nur ein mehr oder weniger großes Interesse für das Neue, sondern eine richtiggehende «Neusüchtigkeit» ausprägten.
In Königsberg war alles auf den Punkt genau vorbereitet worden. Die Feuerwerker hatten ihre Arbeit erledigt, die Räumlichkeiten waren für die Festlichkeiten eingerichtet, die Häuser reich geschmückt, und die Festtagsgarderobe lag bereit. Nach und nach traf der Hofstaat aus Berlin ein. Nun wurde auch die weitere Öffentlichkeit einbezogen: Der Kurfürst ließ in Zeitungen über die Vorbereitungen der Zeremonie berichten und verkündete mit dem 6. Januar voreilig einen falschen Termin, der um zwölf Tage verschoben werden musste.[20] Am 18. Januar war es dann so weit. Der brandenburgische Kurfürst Friedrich III. verwandelte sich in König Friedrich I. in Preußen: «Und damit Sie an Ihrer Krone gar nichts fremdes hätten / so haben Sie auch solche Sich von andern weder bereiten noch aufsetzen lassen; sondern eintzig und allein von Ihrer eigenen Souverainität und Ernennung angenommen.»[21]
Friedrich I. befand sich mit seiner Meinung, dass er nicht von der Kirche, sondern von Gott höchstpersönlich berufen worden sei, in der guten Gesellschaft Ludwigs XIV.; Vorbilder für die Selbstkrönung gab es in Dänemark und Schweden.[22] Große Distanz hingegen bewahrte er zum «religiösen Kern des Habsburger und spanischen Protokolls». Erst sechs Wochen nach der Inthronisierung besuchte der neue König das kirchliche Abendmahl. Man achtete empfindlich auf derartige Abweichungen; und so konnte man darauf zählen, dass die europäischen Höfe die zeremoniellen Allianzen und Abgrenzungen bemerken würden.[23]
Friedrich I. richtete die Selbstkrönung direkt gegen konkurrierende Herrschaftsinstanzen. So reklamierte er in einem ersten Schritt Unabhängigkeit von den weltlichen Gewalten: Er ließ sich die königlichen Insignien nicht von Vertretern der Stände übergeben, sondern trug «Purpur/Kron und Zepter» selbst.[24] Bei seiner Ankleidung im Audienzsaal setzte er sich eigenhändig die Krone aufs Haupt und griff zum Zepter, bevor er «mit einer liebreichen Freudigkeit» seine Ehefrau krönte.[25] Als er in vollem Ornat erschien, war jeder beim «Anblick eines so grossen Glantzes / alsofort von einer rechten Bestürtzung gerühret».[26]
Die weltlichen Gewalten durften die neue Würde bestätigen, und auch den Geistlichen gab Friedrich I. nur die Chance, seine Königswürde anzuerkennen, nicht aber sie zu stiften. Die Krönung wurde in der Regel nach der kirchlichen Salbung vollzogen.[27] Friedrich hingegen zog den Krönungsakt vor, um seine Eigenständigkeit zu demonstrieren. Insgesamt wurde dabei die kirchliche Zeremonie auf ein Mindestmaß reduziert. Bereits vor der eigenhändigen Salbung ließ sich die neue «Majestät» vom Bischof als König ansprechen. Dann übernahm Friedrich die Reichsinsignien, «weilen Seine Majestät die dadurch angedeutete Königliche Würde / vermittelst der Salbung nicht erst erlangen; sondern nur kund machen und bestätigen / oder vielmehr eintzig und allein von GOtt dem HErrn annehmen wollten».[28]
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurden die Positionen im System der europäischen Großmächte festgelegt. Mit seiner Selbstkrönung beanspruchte Friedrich I. politische Mündigkeit: Er wollte mit souveränen Herrschern wie dem Kaiser auf Augenhöhe verhandeln.
Nach den Vertretern der weltlichen und geistlichen Stände wandte sich Friedrich I. der Menge zu. «Zeichen der Wohltätigkeit» wurden im wahrsten Sinn des Wortes in Form von Krönungsmünzen ausgestreut. Ein Weinbrunnen stand bereit und auch ein üppig gefüllter Ochse, der «Sr. Majestät sich über alles erstreckende Herrschaft und Uberfluß» verkörperte. Der neue König gründete zwei Armenhäuser, erhob einige Personen und berief andere in eigens gegründete Ämter. Es folgten Freudenfeuer, Illuminationen und Feuerwerke, eine Jagd und eine reformierte Kirchweihe. Man hielt Reden, überreichte Gedichte, erfreute sich an Maskeraden, Musik und Mahlzeiten. Während die fremden Minister, die in Königsberg zu Gast waren, dies alles registrierten, feierten die Gesandten des Königs an anderen Höfen Freudenfeste. In allen Provinzen des neuen Königreichs wurden Lichter angesteckt.[29]
Auf der Rückreise nach Berlin zwang das schlechte Wetter zur Umkehr – schnell wurde die Abreise zur Rundreise deklariert; es durfte keine Pannen geben, die die Planungskompetenz des neuen Königs schon zu Beginn seiner Regentschaft in Frage gestellt hätten. Als der Zug dann wirklich in Berlin ankam, wiederholten sich die Freudenfeierlichkeiten, die hier noch bombastischer und aufwendiger ausfielen. «Berlin schimmerte nicht; sondern brante gleichsam in allen Gassen von Lichtern/Lampen/Fackeln und Freuden-Feuren» – aus dem lateinischen Namen der Stadt «Berolinum» wurde durch Versetzung der Buchstaben «Lumen orbi», das Licht der Welt.[30] Die Königsberger Festlichkeiten mussten noch übertrumpft werden, um das Königtum aus dem abgelegenen Preußen ins Zentrum des Landes zu überführen.
«Er war klein und verwachsen …»
Das öffentliche Bild Friedrichs I. litt lange Zeit unter der Darstellung des Königs durch seinen Enkel. In den Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Hauses Brandenburg (Mémoires pour servir a l’histoire de la maison de Brandebourg, 1748) prägte Friedrich II. das Bild seines Großvaters als eines körperlich verkümmerten, eitlen, verschwendungssüchtigen Monarchen. Es lohnt sich, die virtuosen Bösartigkeiten des Enkels ein wenig ausführlicher zu zitieren:
«Er war klein und verwachsen; seine Miene war stolz, seine Physiognomie gewöhnlich. Seine Seele glich den Spiegeln, die jeden Gegenstand zurückwerfen. Er war äußerst bestimmbar. Daher konnten diejenigen, die einen gewissen Einfluß auf ihn gewonnen hatten, seinen Geist nach Gefallen erregen oder beschwichtigen. Ließ er sich fortreißen, so geschah es aus Laune; war er sanft, so kam das von seiner Lässigkeit. Er verwechselte Eitelkeiten mit echter Größe. Ihm lag mehr an blendendem Glanz als am Nützlichen, das bloß gediegen ist. 30000 Untertanen opferte er in den verschiedenen Kriegen des Kaisers und der Verbündeten, um sich die Königskrone zu verschaffen. Und er begehrte sie nur deshalb so heiß, weil er seinen Hang für das Zeremonienwesen befriedigen und seinen verschwenderischen Prunk durch Scheingründe rechtfertigen wollte. Er zeigte Herrscherpracht und Freigebigkeit. Aber um welchen Preis erkaufte er sich das Vergnügen, seine geheimen Wünsche zu befriedigen! Er verschacherte das Blut seines Volkes an Engländer und Holländer, wie die schweifenden Tartaren ihre Herden den Metzgern Podoliens für die Schlachtbank verkaufen.»[31]
Man konnte sich leicht darüber lustig machen, dass Friedrich I. die Krümmung seines Körpers durch eine überlange Perücke zu kaschieren versuchte,[32] oder aber mit Respekt zur Kenntnis nehmen, welche Anstrengungen dieser Mann auf sich nahm, um die körperlichen Strapazen der Feldzüge, Regierungssitzungen, diplomatischen Verhandlungen oder Schauveranstaltungen so durchzustehen, dass man ihm seine Königswürde abnahm. Im Jahr 1748, kurz nach den beiden ersten Schlesischen Kriegen, erschien die Strategie Friedrichs II., seinem Großvater nicht nur die Vergeudung des Finanz-, sondern auch des Humankapitals vorzuwerfen, bereits recht kühn; später, nach dem Massensterben des Siebenjährigen Kriegs (1756–1763), hätte diese Kritik am verschwenderischen Umgang mit Soldatenleben dann geradezu rhetorischen Selbstmord bedeutet. Es scheint, als hadere Friedrich II. bei der despektierlichen Darstellung seines Großvaters mit seiner Nachrangigkeit. Bei allen Anstrengungen zur «Größe» konnte er eines nicht mehr erreichen: sich selbst eine Königskrone aufs Haupt zu zwingen. Diese fiel ihm von Familiengnaden einfach zu. Friedrich I., so betonte Besser, habe als «Stiffter der Königreiche» die «unbeschreibliche Mühe des Erfindens und Anlegens» der Monarchie auf sich genommen: «Nach einer Krone kann man es nicht höher treiben.»[33]
Friedrich II. jedenfalls baute in solchen abschätzigen Passagen sein Gegenbild zu einem älteren Monarchentypus auf. Er erhob damit einen eigenen Innovationsanspruch gegen eine «Neuerung», die er nicht mehr überbieten konnte. Und so entschied er sich dazu, den Herrscher zu verkörpern, der als der «erste Diener» agierte – und man wird sagen dürfen: Er wollte als Erster dieser königliche Diener seines Staates sein. Hier inszeniert sich der Staatsbeamtenkönig, der den gesamten Haushalt zum Wohl des Volkes verwendet, ganz im Unterschied zum Begründer der preußischen Monarchie: «Die Freigebigkeit, die Friedrich I. liebte, war nicht von solcher Art, vielmehr nur Vergeudung, wie ein eitler und verschwenderischer Fürst sie übt.»[34]
In diesem Stil macht Friedrich II. sich weiter über die Hofhaltung seines Großvaters her und stellt sie genüsslich an den Pranger als ein Beispiel «von asiatischem Prunke» – im Unterschied zu «europäischer Würde». Man kann sich dem hinreißenden Schwung seiner Zeilen nur schwer entziehen. Der Rhythmus stimmt. Die Pointen sitzen. Auch wenn er über seinen Großvater das abschließende Urteil fällt: «Alles in allem: er war groß im Kleinen und klein im Großen. Und sein Unglück wollte es, daß er in der Geschichte seinen Platz zwischen einem Vater und einem Sohne fand, die ihn durch die Überlegenheit ihrer Begabung verdunkeln.»[35]
Mochte Friedrich I. auch im Schatten seiner Nachkommen verschwinden: Berlin klärte sich nach der imposanten Krönung zunächst auf und verwandelte sich in eine prachtvolle Residenzstadt. Der Schlosskomplex in Charlottenburg mit seinen wunderschönen Gartenanlagen entstand, auf den Plätzen der Stadt wurden Skulpturen errichtet, die Straßen gepflastert. Überhaupt brachte man die Metropole architektonisch auf den Stand der Dinge, sodass sich Berlin in den folgenden Jahren den Namen eines «Spree-Athen» verdiente.[36] Der neue König sandte Signale an seine Untertanen, vor allem aber an die Konkurrenten im Ausland: Es ging um die Repräsentation von Stärke, Einheit und Verkehrstüchtigkeit. Der Umbau Berlins stand stellvertretend für das ganze Land; die Stadt bildete ein Modell für ein Herrschaftsgefüge insgesamt, eine überschaubare Variante jener Infrastrukturen, auf die Friedrich I. seinen Reformwillen richtete und die er außenpolitisch in die Waagschale warf. Vor allem aber: Berlin wurde so gestaltet, dass es beständig an die Krönung erinnerte. Die Residenzstadt verlängerte gleichsam die Raumordnung des Krönungszeremoniells und verschaffte ihm allgemeinere Geltung.[37] Kein Wunder, dass Friedrich II. sich nach Potsdam zurückzog.
Der Enkel des ersten Königs in Preußen verweigerte dem Kalkül Friedrichs I. sein Verständnis. Denn tatsächlich wusste Friedrich II. ganz genau, welche ungeheure historische Leistung sein Großvater im Rahmen der zeitgenössischen Verhältnisse erbracht hatte. Bevor er in den Denkwürdigkeiten mit seinem Vorgänger abschließend ins Gericht ging, ihn lächerlich machte und verhöhnte, formulierte er genau jene Einsicht, die in der Forschung zu einer radikalen Kehrtwende im Blick auf Friedrich I. geführt hat. Ich zitiere noch einmal eine längere Passage aus den Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Hauses Brandenburg:
«Dem Kurfürsten Friedrich III. schmeichelten in der Tat nur die Äußerlichkeiten des Königtums, das Gepränge der Repräsentation und eine gewisse Wunderlichkeit der Eigenliebe, die sich darin gefällt, andere ihren geringeren Stand fühlen zu lassen. Was aber in seinem Ursprung das Werk der Eitelkeit war, erwies sich in der Folge als ein Meisterwerk der Staatskunst. Durch die Königswürde entzog sich das Haus Brandenburg dem Joch der Knechtschaft, unter dem der Wiener Hof damals alle deutschen Fürsten hielt. Friedrich III. warf damit seiner ganzen Nachkommenschaft eine Lockspeise hin, die zu sagen schien: ‹Ich habe euch einen Titel erworben; zeigt euch seiner wert! Ich habe die Fundamente eurer Größe geschaffen; nun ist es an euch, das Werk zu vollenden!› Er wendete alle Hilfsmittel der Intrige an, setzte alle Triebfedern der Politik in Bewegung, um seinen Entwurf zur Reife zu bringen.»[38]
Aus Perspektive der neueren Friedrich-Forschung darf man die abschätzige Behandlung Friedrichs I. durch seinen Enkel mit einiger Skepsis betrachten. Weder hat Friedrich Wilhelm I. lediglich eine galante Höflingstruppe durch einen kalten Militärstaat ersetzt noch Friedrich II. seinen Landeskindern so haushälterisch und geradezu bürgerlich gedient, wie seine Werbebroschüre in eigener Sache es gern hätte.[39] Beide haben vielmehr ihr eigenes Verhältnis zu den Erfordernissen des Repräsentationsapparats entwickelt, und dies schon deswegen, weil sie sich nicht erlauben konnten, das zeremonielle Vokabular der Selbstdarstellung einfach so zu wechseln: Dies hätte ein Ausscheren aus den politischen Kommunikationssystemen Europas bedeutet. Eine der Pointen des Zeremoniells lag darin, dass es auf Anerkennung angewiesen war und daher nicht eigensinnig verändert werden konnte.[40]
Zudem zählte es zu den Gepflogenheiten beim Antritt eines Herrscheramts, mit der Hofkultur des Vorgängers in bestimmten Belangen zu brechen, um eigene Akzente zu setzen, um alte Verbindlichkeiten aufzulösen und neue Verbindlichkeiten zu erzeugen.[41] Friedrich Wilhelm I. folgte dieser Tradition ebenso wie sein Sohn, der sich gegen Vater und Großvater gleichermaßen abgrenzte. Es ging darum, Herrschaft zu bewahren und neu zu zentrieren: Die Macht sollte nicht im arrivierten Regierungsapparat versanden, neue Loyalitäten mussten aufgebaut werden. Entsprechend bietet die Darstellung Friedrichs II. keinen Anlass, vom «Niedergang» der Höfe in der Aufklärung zu reden, sondern dazu, nach der spezifischen Funktion und dem spezifischen Profil der Höfe im 18. Jahrhundert zu fragen.
Das Zeremoniell war in der Frühen Neuzeit und auch im 18. Jahrhundert weit mehr als nur eine Nebensächlichkeit. Die kalkulierte Opulenz war vielmehr ein elementarer Bestandteil der Aushandlung von Machtbeziehungen, mithin von Politik, und zwar vor allem im Verkehr der Höfe untereinander.[42] Sie bildete bis zur verfassungsmäßigen Konsolidierung von Herrschaftsverhältnissen während des 19. Jahrhunderts nicht allein Rechts- und Regierungszustände ab, sondern sie konstituierte diese. Ihre Wirkung war «zugleich ordnungsstiftend und ordnungssymbolisierend».[43]
Der Spanische Erbfolgekrieg und das Gleichgewicht der Mächte
Das Zeremoniell blieb während der Epoche der Aufklärung von elementarer Bedeutung. Die Deutschen, die unter dem Ruf litten, es mangle ihnen an geschmeidigem Umgang, standen damit vor einer nicht nur ästhetischen Herausforderung. In der internationalen Konkurrenz ergaben sich, sobald man Unsicherheit im Verhalten zeigte, gewaltige Nachteile. Dies jedenfalls behauptete Michael von Loen, der nach seinem Studium bei Christian Thomasius in Halle auf langjährigen Reisen die europäischen Residenzen erkundete und 1740 mit dem Roman über den Redlichen Mann am Hofe einen der klassischen Staatsromane der Aufklärung verfasst hat. In einem Vergleich der Höfe in Wien, Berlin und Dresden meinte er im Blick auf den Kaiserhof: «Überhaupt haben wir Teutschen ein gewisses, steiffes und hochgeschraubtes Wesen, welches uns bey fremden Völkern keine Hochachtung erwirbt. / Es ist bekannt, wie schädlich diese Aufführung zu Ende des verwichenen Jahrhunderts denen hohen Gerechtsamen des Erzhauses in Ansehung der spanischen Erbfolge gewesen ist […].» Loen vermisste im verzettelten Alten Reich das Nation Branding. Die «Deutschen» verfügten über zu wenig von jenem symbolischen Kapital, mit dem in diplomatischen Verhandlungen gern bezahlt wurde. Dies unterschied sie fundamental von den Franzosen, die «der Sache in Madrid einen ganz anderen Schwung zu geben wußten».[44]
Mit der «Sache in Madrid» spielte von Loen auf die diplomatisch hochkomplizierte Lage an, die ab 1701 zum Spanischen Erbfolgekrieg geführt hat, der mehr als zehn Jahre andauern sollte:[45] Dies war der Krieg, der die Grundstrukturen Europas für das 18. Jahrhundert, also für die Epoche der Aufklärung, festgelegt hat. Nur vor dem Hintergrund dieser Auseinandersetzungen war es Friedrich III. möglich, als Friedrich I. zum König in Preußen aufzusteigen.[46]
In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts war Brandenburg zunächst einmal bedrohtes Gebiet.[47] Polen, Schweden und Frankreich traten als Gegner auf. Zudem musste das Land nach dem Dreißigjährigen Krieg wiederaufgebaut werden. Dies geschah unter dem «Großen Kurfürsten» Friedrich Wilhelm, der die Regierungsgeschäfte von 1640 bis 1688 führte. Er gewann, vorerst noch unterstützt von Frankreich, durch den Westfälischen Frieden Land hinzu, denn Ludwig XIV. sammelte Verbündete im Kampf gegen Österreich. Nach dem Herrschaftsgebiet der Habsburger wurde das Territorium des Großen Kurfürsten so das größte im Alten Reich und überragte damit erstmals auch den sächsischen Nachbarn.[48]
Der Aufstieg Brandenburgs zu einem Territorialstaat und schließlich zu einer europäischen Macht gründete auf der stehenden Armee, die unter dem Großen Kurfürsten eingerichtet wurde. Politik und Militär bündelten ihre zentralistischen Interessen und versuchten – oftmals vergeblich –, die regionalen Gewalten auszuhebeln. Im Juni 1675 schlug Friedrich Wilhelm die europäische Großmacht Schweden bei Fehrbellin in jener spektakulären Schlacht, die den Hintergrund von Heinrich von Kleists Drama Prinz Friedrich von Homburg bildet. Wie konnte es geschehen, dass ein Zwergenstaat dem barocken Imperium des Nordens die Stirn bot? Es war offenkundig Bewegung im politischen Spiel. Diese Unruhe nutzte kein anderes Land des Alten Reichs konsequenter und geschickter als das aufstrebende Kurfürstentum. Mit «Fehrbellin» setzte Brandenburg ein weithin sichtbares Zeichen. Dieser Sieg verlieh dem Kurfürsten das Attribut «groß».[49]
Als nachgeordneter Teilnehmer konnte Brandenburg im Spiel der Mächte gleichwohl nur insoweit mithalten, als das Land geschickte Allianzpolitik betrieb. Dem Großen Kurfürsten mangelte es gewissermaßen an Initiativmacht. Seine Territorien lagen verstreut: Dies zwang ihn geradezu zu einer aktiven und kreativen Außenpolitik, machte ihn aber auch als Bündnispartner für viele Seiten attraktiv. So wechselte Friedrich Wilhelm munter die Parteien, hielt einmal zu Österreich, ein anderes Mal zu Frankreich. Das war und blieb für diese Zeit an sich nicht ungewöhnlich, bezeichnend aber ist die geradezu irrlichternde Unruhe, mit der Brandenburg in Koalitionen eintrat und sie wieder verließ.[50] Augenscheinlich handelte es sich beim Kurfürsten um keinen souveränen Herrscher; er agierte lediglich als das Zünglein an der Waage. Auf diese Weise errang der Große Kurfürst 1660 im «Frieden von Oliva» immerhin den Status eines «souveränen» Herrschers im Herzogtum Preußen. Das Herzogtum bot daher später den idealen Platz außerhalb des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation, um sich formal auf Augenhöhe mit dem Kaiser und anderen Souveränen zu begeben. Hier übte der brandenburgische Kurfürst «unumbschränckte Gewalt» aus, weshalb sich der Kaiser bis 1694 weigerte, diese Herrschaftsrechte zu akzeptieren.[51]
Die außenpolitische Bedeutung Preußens war nur die eine Seite. Auf der anderen hatte der Kurfürst mit innenpolitischen Abhängigkeiten zu kämpfen. Auch dafür stand Preußen geradezu symbolisch: Die Regierung im Herzogtum übernahm Friedrich Wilhelm gegen den erbitterten und anhaltenden Widerstand der Bevölkerung, da die Staatsidee des Großen Kurfürsten mit den Interessen der Stände kollidierte. Diese wollten ihre lokale Identität nicht für die Idee eines Ganzen opfern, das keine Tradition hatte und für sie ungreifbar blieb. Sie sahen keinen Vorteil in einer einheitlichen politischen Führung, einer entsprechenden Steuerpolitik und einem von provinziellen Absichten unabhängigen Militär. Allerdings kämpften die preußischen Stände langfristig auf verlorenem Posten. Friedrich Wilhelm stärkte das stehende Heer, besetzte Schlüsselpositionen mit Calvinisten und entmachtete dadurch die regionalen lutherischen Eliten; er rekrutierte ausländische und bürgerliche Beamte, die sich als Fürstendiener verstanden.[52] Exemplarisch führte er vor, wie nur ein ganzes Bündel von Maßnahmen die Verhältnisse allmählich strukturell veränderte.
Nach der Krönung trieb Friedrich I. energisch die Renovierung Berlins voran. Auch der Umbau des veralteten Renaissanceschlosses, das im Norden «Cöllns» am Ufer der Spree lag, wurde nach Plänen Andreas Schlüters fertiggestellt. So entstand eine Residenz von europäischem Format.
Die quecksilbrige Bündnispolitik Brandenburg-Preußens war typisch für die Verhältnisse bis weit ins 18. Jahrhundert. Die Aufklärungsepoche etablierte eine eigentümliche Form politischer Stabilität; ihre Besonderheit lag darin, dass sie in der Unruhe permanenter militärischer Konflikte gesichert wurde. Wenn die Frühe Neuzeit auch in der Phase der Aufklärung etwas zu bieten hatte, dann «besonders viel Krieg». Dies war einer der großen Wachstumsbereiche des 18. Jahrhunderts: Die Kriege dehnten sich aus und intensivierten sich, die Kosten stiegen, die Armeen wuchsen, die Zahl der Schlachten erhöhte sich – und entsprechend größer fiel die Opferrate aus. «Friedlosigkeit» prägte die Epoche, weil sich die Struktur der politischen Ordnung tiefgreifend veränderte und moderne Staatlichkeit anbahnte.[53] Diesem Trend folgte auch das Krönungsprojekt Friedrichs III., der seiner Herrschaft einen gleichberechtigten Platz im System der Leitmächte sichern wollte.
Den Anfang der Epochenkonflikte machten der Spanische Erbfolgekrieg (1701–1714) und der Große Nordische Krieg (1700–1721). Es folgten die Auseinandersetzungen um die polnische Thronfolge (1733–1735) sowie um die österreichische Erbfolge (1740–1748), deren Problemlagen schließlich im ersten Weltkrieg mündeten: dem Siebenjährigen Krieg (1756–1763). Es handelte sich um ideologisch abgekühlte Konflikte – dies machte die Auseinandersetzungen bei aller unmenschlichen Brutalität gewissermaßen zivilisierter und zu einem rationalen Mittel der Politik. Die europäischen Fürsten setzten ebenso berechnend wie berechenbar Soldaten als Instrument dynastischer Herrschaft ein, während die Koalitionen je nach Großwetterlage wechselten, teils in atemberaubender Geschwindigkeit.[54]
Im Spanischen Erbfolgekrieg sollte der Herrschaftsbereich Karls II. zerlegt werden. Eine friedliche Lösung wäre denkbar gewesen: Die Kernlande hätten an die bayerischen Wittelsbacher gehen können, weil diese keine Gefahr für andere Großmächte darstellten; der Rest wäre zwischen den Bourbonen in Frankreich und den Habsburgern in Wien verteilt worden. Doch der Deal platzte, und es kam zum Krieg. Eine wesentliche Leistung der Akteure, und hier eben vor allem Brandenburg-Preußens, bestand darin, den Krieg so einzuhegen, dass er sich nicht mit dem anderen großen Konflikt, dem im Jahr 1700 ausgebrochenen Nordischen Krieg, verband – dies hätte ganz Europa von England bis Russland verwüstet und einen Rückfall in die Zeit des Dreißigjährigen Kriegs bedeutet.[55] Alle Bemühungen, die sich auf eine neue Zukunft richteten, wären umsonst gewesen und hätten doch wieder in den alten Krisenzyklus geführt.
Für die Koalitionen des Erbfolgekriegs gab Wilhelm III. die Parole aus, als er der englischen Politik die Maxime einer «balance of power» zugrunde legte. Großbritannien verstand sich als das Gewicht, das die Waage austarierte, und stieg zunächst in eine Koalition mit Österreich (und auch Brandenburg-Preußen) ein, um Frankreichs Ambitionen auf den spanischen Thron entgegenzuwirken. Als die Habsburger Aufwind erhielten, zog sich die Insel ab 1710 aus dem Bündnis zurück und schloss umstandslos einen Friedenspakt mit dem bereits geschwächten Sonnenkönig Ludwig XIV. Dies löste eine Serie weiterer Friedensschlüsse aus. Zunächst wollte Kaiser Karl VI. auch ohne England seine Ziele gegen Frankreich durchsetzen. 1714 war er schließlich zu einem Friedensschluss bereit und gab die spanische Herrschaft verloren.[56]
Die Großmächte verteilten in den Verträgen von Utrecht, Rastatt und Baden (1713/14) Schlüsselpositionen: Philipp V. von Anjou übernahm Spanien mit seinen Kolonien, verzichtete dafür aber auf die französische Krone; Habsburg erhielt die südlichen Niederlande, Mailand, Mantua, Neapel und Sardinen (welches 1720 mit Savoyen gegen Sizilien getauscht wurde). Die Holländer besetzten strategisch wichtige Stellungen im heutigen Belgien und verschafften sich damit gegenüber Frankreich Luft. England hatte sich 1704 mit Gibraltar ein Gebiet mit hohem Symbolwert angeeignet und blieb dabei; zugleich erkannten Frankreich und Spanien die hannoveranische Linie an und entzogen den Stuarts damit die Unterstützung; schließlich baute England seine Position als Seemacht aus, unter anderem durch Monopole im Sklavenhandel.[57]
Für die Verhandlungspartner hing Herrschaft an Personen, nicht an Territorien. Im Frieden von Utrecht, diesem «Höhepunkt und Meisterstück der Allianzdiplomatie», die auf eine Balance der Kräfte abzielte, gingen die Herrscher offenkundig recht freizügig mit Kronen und Ländern um. Das moderne Prinzip der Territorialstaatlichkeit bestimmte die Politik durchaus, aber nicht konsequent. Die räumliche Festlegung des Staats sollte vor allem für die Zukunft von Bedeutung sein, denn sie sorgte für jene tiefe Identifikation von Land und Bevölkerung, mit der im 19. Jahrhundert der Nationalstaat Politik machte.[58]
Mit dem Spanischen Erbfolgekrieg bildete sich für die Aufklärungsepoche ein System von «Leitmächten» heraus. Die Kriegskonstellationen des 18. Jahrhunderts waren verwirrend, dynamisch, abwechslungsreich. Dennoch gab es eine konstante Menge an tonangebenden Mächten: Frankreich, England und der Wiener Kaiserhof als eher traditionelle Größen; Russland als aufstrebendes Reich. Die alten Imperien Schweden, Spanien und die Niederlande sahen sich auf die hinteren Plätze verwiesen.[59] In der symbolischen Ordnung standen Wien und der Kaiserhof auf der einen Seite, Frankreich und Versailles auf der anderen; es bildeten sich höfische «Gegenmodelle» und Alternativen: Versailles setzte auf Apoll und die Sonnensymbolik, Wien und Schönbrunn auf die Sichel des Mondes und Herkules sowie auf den Wettbewerb um den Platz an der Sonne, deren Symbolik nicht einfach dem Rivalen überlassen wurde.[60]
Nur in diesem Kräftesystem wurde der König in Preußen unter den Souveränen als Gesprächspartner toleriert: Wien erkannte die Rangerhöhung unmittelbar vor Kriegsausbruch an, gefolgt von England, das dadurch Punkte gegen den Sonnenkönig sammelte, sowie von Dänemark, Russland und Schweden. Polen verhielt sich zögerlich. Frankreich intrigierte gegen das Krönungsprojekt und erzielte Teilerfolge bei den bayerischen Wittelsbachern und in Kurköln. Diese Länder ließen sich wie Ludwig XIV. mit der Anerkennung bis zum Frieden von Utrecht Zeit. Einige Reichsstände leisteten noch Widerstand. Besonders weit trieb es der Vatikan, der sich nicht dazu bereitfand, die «Schandtat» und das «gottlose Attentat» der Krönung zu würdigen. Bis 1787 war der preußische König für den Vatikan nach wie vor der Markgraf von Brandenburg.[61] Der «Uhrsprung der Preußischen Krone» lag, wie Zeremonienmeister Besser ganz zutreffend bemerkte, in einer eigentümlichen Mixtur von «Macht und Independenz» auf der einen Seite sowie «Beyfall und Hochachtung» von den übrigen Souveränen auf der anderen.[62]
Was Friedrich II. im Rückblick als Marotte eines geltungssüchtigen, prunkverliebten kleinen Krüppels darstellte, nämlich die Hofhaltung, die prächtige Krönung und andere Zeichen seiner Ambitionen, war in Wirklichkeit ein von seinem Großvater mit langem Atem und aller Finesse verfolgter politischer Plan. Die Umsetzung nahm beinahe ein Jahrzehnt in Anspruch, bis die ersten Fürsten zur Anerkennung bereit waren; es bedurfte mehr als eines weiteren Jahrzehnts, um auch die letzten größeren Herrscher ins Boot zu holen. Es handelte sich um ein Krönungsprojekt, mit dem sich Friedrich III. unter die großen «Projektenmacher» der Aufklärungsepoche einreihte.[63] Er zählte zu denen, die auf die Zukunft setzten: zum historischen Typus des «Neuerers».