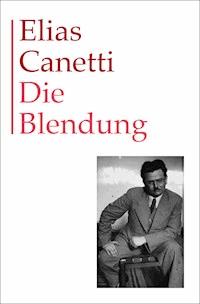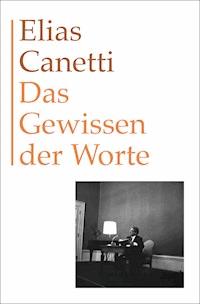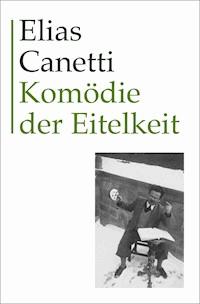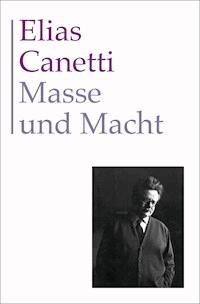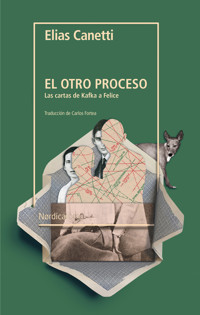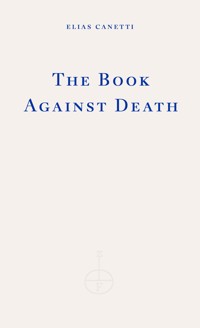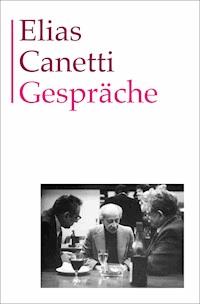Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In seinen Aufsätzen und Reden hat sich Elias Canetti vielfältig mit den Künsten auseinandergesetzt: mit der Literatur – von Johann Peter Hebel über Gottfried Keller bis zu Franz Kafka, Marcel Proust und James Joyce –, mit der Bildhauerei und Malerei – von Georg Merkel über Fritz Wotruba bis zu Alfred Hrdlicka – und immer wieder mit dem Theater. Diese Sammlung ergänzt den von ihm selbst zusammengestellten Band "Das Gewissen der Worte".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
In seinen Aufsätzen und Reden hat sich Canetti vielfältig mit den Künsten auseinandergesetzt, mit der Literatur von Johann Peter Hebel über Gottfried Keller bis zu Franz Kafka, Marcel Proust und James Joyce, mit der Bildhauerei und Malerei von Georg Merkel über Fritz Wotruba bis zu Alfred Hrdlicka, und immer wieder mit dem Theater. Diese Sammlung ergänzt den von ihm selbst zusammengestellten Band
Elias Canetti
Aufsätze
Reden
Impressum
ISBN 978–3–446–25350–6
Text nach Band X der Canetti-Werkausgabe
© 2005, 2016 Elias Canetti Erben Zürich, Carl Hanser Verlag München
Umschlaggestaltung: S. Fischer Verlag / www.buerosued.de
Cover: Elias Canetti bei der Verleihung des Nobelpreises, Stockholm 1981
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de. Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Inhaltsverzeichnis
Aufsätze und Reden
Upton Sinclair wird fünfzig Jahre alt
(Der Querschnitt VIII, Heft 10, Oktober 1928, S. 736)
Proust – Kafka – Joyce
Ein Einführungsvortrag
(Vortrag in englischer Sprache, gehalten in der Bryanston Summer School, August 1948; Erstdruck; Manuskript im Besitz des Marie-Louise von Motesiczky Charitable Trust, London; deutsche Übersetzung von Karen Lauer)
Jenseits von Groll und Bitterkeit
Brief an H. G. Adler
(1952. In: H. G. Adler: Buch der Freunde. Köln 1975, S. 72f.)
Über Fritz Wotruba
(Elias Canetti: Fritz Wotruba. Wien 1955. Auch in: Wortmasken. München/Wien 1995, S. 107-118)
Zu ›Masse und Macht‹
(Elias Canetti: Welt im Kopf. Eingeleitet und ausgewählt von Erich Fried. Graz und Wien 1962, S. 18-20)
Dankrede für den Preis der Stadt Wien
(1966; Erstdruck)
Unsichtbarer Kristall
Aus der Rede bei der Verleihung des Großen Österreichischen Staatspreises am 25. Jänner 1968
(Literatur und Kritik, Heft 22, Salzburg 1968. Auch in: Wortmasken. München/Wien 1995, S. 119-122)
Der Gegen-Satz zur ›Hochzeit‹
(Programmheft Schauspielhaus Zürich, Spielzeit 1969/70, Heft 4, S. 8-9. Auch in: Wortmasken. München/Wien 1995, S. 123-124)
Tagebuch schreiben
(Mündliche Äußerung von Elias Canetti in einem Fernsehgespräch am 27. Dezember 1972. Sprache im Technischen Zeitalter 94, Juni 1985)
Das Chaos des Fleisches
Alfred Hrdlickas Radierungen zu ›Masse und Macht‹
(Canetti/Hrdlicka/Diemer, Galerie Valentien, Stuttgart 1973, S. 19-35. Auch in: Wortmasken. München/Wien 1995, S. 125-139)
Grazer Rede
zur Verleihung des Franz-Nabl-Preises der Stadt Graz im Jahr 1975
(Kurt Bartsch, Gerhard Melzer, Johann Strutz [Hg.]: Über Franz Nabl. Aufsätze, Essays, Reden. Graz 1980)
Sprache und Hoffnung
Dankrede zur Verleihung des Nelly-Sachs-Preises der Stadt Dortmund am 14. Dezember 1975
(Ansprachen und Dokumente zur Verleihung des Kulturpreises der Stadt Dortmund, Nelly-Sachs-Preis, am 14. Dezember 1975. Dortmund 1975, S. 23-26)
Laudatio auf Georg Merkel
(Wiener Kunsthefte 7–8/1976. Auch in: Herbert Giese und Harald Schweiger [Hg.]: Georg Merkel. Wien 1986, S. 7-12)
Kleine Dankrede
zur Verleihung des Gottfried-Keller-Preises der Martin-Bodmer-Stiftung am 19. Dezember 1977 in Zürich
(Elias Canetti: Über die Dichter. München/Wien 2004)
Zur Entstehung der ›Komödie der Eitelkeit‹
(Komödie der Eitelkeit, Programmheft Burgtheater, Saison 1978/79, Heft 7. Wien 1978)
Hebel und Kafka
Rede bei der Verleihung des Johann-Peter-Hebel-Preises am 10. Mai 1980 in Hausen im Wiesental
(Elias Canetti: Hebel und Kafka. München 1980 [Bogen 1]. Auch in: Wortmasken. München/Wien 1995, S. 140-142)
Kleiner Dialog über die Plastik
(Akzente, 27. Jahrgang 1980, Heft 3, S. 193-194. Auch in: Wortmasken. München/Wien 1995, S. 105-106)
Dank in Stockholm
Rede bei der Verleihung des Nobelpreises für Literatur am 10. Dezember 1981
(Elias Canetti: Die Blendung. Ausgabe zum Nobelpreis. Zürich 1981. Auch in: Wortmasken. München/Wien 1995, S. 143-144)
Nachwort zu Rudolf Hartung: ›In einem anderen Jahr‹
(Rudolf Hartung: In einem anderen Jahr. München 1982, S. 177-180)
Über Cilli Wang
(Zauber der Verwandlung. Cilli Wang in ihren Gestalten. Österreichisches Nationalmuseum, Wien 1982, S. 13-15)
Vorwort zu Veza Canetti: ›Die Gelbe Straße‹
Upton Sinclair wird fünfzig Jahre alt
Naivität, zu simple Darstellung längst als kompliziert erkannter Vorgänge, unbeirrbare Gleichgültigkeit den »Mysterien« des einzelnen gegenüber sind die Hauptvorwürfe, mit denen ein ästhetisiertes Europa Upton Sinclair abtut. Amerikas Antipathie gegen ihn hat sehr reale und direkte Ursachen. Ein Europäer, also Zyniker, sieht Sinclair einfach hohnlächelnd zu und schlägt aus diesem seltenen harten Stein seine Geistesblitze: »Schmutz ist uninteressant. Aufgewirbelt verpestet er auch noch die Luft. Und was erreicht man schon!« Der Amerikaner, also Praktiker, findet ganz im Gegenteil, daß damit genug erreicht wird, jedenfalls mehr, als ihm lieb ist. Er verbietet drum ›Petroleum‹ wegen unsittlicher Szenen, wobei sogar er ahnen dürfte, daß die Liebesszenen das wenigst Aufreizende an Sinclairs Werk sind.
Im dritten Weltteil, Rußland, entspricht die Verbreitung der Bücher Sinclairs fast jener der Bibel in den angelsächsischen Ländern. Der Russe, das heißt der kraftvolle Schwächling, zu dem im Westen die kraftlosen Schwächlinge beteten, stirbt zum Glück in Rußland aus. Die Bolschewisten, bekanntlich Dogmatiker – aber praktische –, finden den friedfertigen Materialisten Sinclair geeignet genug, um obigen Russen zur Strecke zu bringen.
Die Wirkung Sinclairs auf Europa wird mit seinem größten Roman ›Boston‹, der den Fall Sacco-Vanzetti behandelt, ihren Kulminationspunkt erreichen. Wem es bisher nicht klar war, der wird an diesem Werk erkennen, wie elementar Sinclairs Naivität ist. Man hat sie also ebenso ernst zu nehmen, wie sie sich gibt. In einer Zeit, wo die wissenschaftliche Entdeckung des Unterbewußtseins sich allzu bewußt in der Kunst breitmacht, werden die einfachsten, primärsten und notwendigsten Tatsachen nicht mehr der Aufnahme für wert gehalten. Welcher Hochmut der aufstoßenden Komplexe! Welch gefährliche Rache der aufgedrängten Verdrängtheiten! Sinclair weiß sehr gut um den analytischen Spuk, das heißt er nahm ihn zur Kenntnis und ließ sich nicht von ihm vergewaltigen. Wer könnte das hier von sich behaupten?
Proust – Kafka – Joyce
Ein Einführungsvortrag
Drei Dinge sind es, die den menschlichen Geist heute vor allem beschäftigen. Das erste ist unser Erbe. Ein Mensch, der von nichts weiß und die Augen öffnet, sieht eine Welt, die voll ist von gegebenen Gegenständen und Traditionen. Sie alle haben für eine Reihe von Menschen eine Bedeutung; ohne sie könnten diese Menschen nicht leben. Es gibt in dieser Welt alte Städte und Kathedralen, Landschaften und Familien, Pflanzen, die der Mensch seit Ewigkeiten kultiviert, Tiere, die es gewohnt sind, mit ihm zusammenzuleben, Hochzeitsbräuche und Begräbnisse, uralte Werkzeuge und Trachten, Glaubenssätze, Namen, schöne Melodien und Geschichten. Dies alles als Ganzes zu erleben, im Laufe eines einzigen Lebens, darin ein zusammenhängendes Muster zu erkennen, das mit Bedeutung gefüllt ist statt mit verwirrenden Widersprüchen, ihm eine Einheit zu geben, nicht durch Verwerfung und Ausschluß, sondern indem man lernt, wie man es aufnehmen, wie man dafür Platz schaffen kann – das ist wahrlich eine notwendige und dabei sehr schwierige Aufgabe. Um dies zu erreichen, kann es nicht genügen, sich bloß umzusehen und die Dinge auf die übliche rationale Art kennenzulernen. Es gibt zuviel kennenzulernen und zu sehen. Die spezialisierte, systematische Beschäftigung mit der Vergangenheit, die Wissenschaft der Geologie, der Archäologie, der Geschichte oder das vergleichende Studium der Mythologien und Religionen – sie alle sind in sich zu eng definiert. Sie nehmen einen einzelnen Gegenstand aus seiner komplexen, lebendigen Umgebung heraus, isolieren ihn, multiplizieren ihn, vergleichen ihn mit anderen. Sie machen zweifellos Entdeckungen und kommen zu wichtigen Schlüssen, niemand könnte es sich träumen lassen, ohne sie auszukommen, aber sie haben keinen Weg gefunden, sich mit der Vergangenheit als Ganzem zu befassen. Was sie untersuchen, erscheint alles in einem gleich grellen Licht. Ein simples, auf Wiederholung gründendes numerisches System von Jahren soll vermitteln, was nicht gefühlt werden kann. Durch den Hang zur Objektivität wird alles seines wesentlichsten Inhaltes beraubt. – Es ist die subjektive Erinnerung des einzelnen, die uns ein angemesseneres Verfahren zeigt. Lerne alles kennen, was deine individuelle Erinnerung dir geben kann, laß sie sich erst anfüllen, und dann erforsche sie und brauch sie auf; schaffe so etwas wie eine Wissenschaft deiner eigenen Erinnerung, und du wirst ein intellektueller Meister der Vergangenheit werden. Dies ist, kurz gesagt, das, was Marcel Proust getan hat.
Das zweite, was die Menschen beschäftigt, ist dieser Augenblick in unserem eigenen Leben, unsere eigene Zeit sozusagen – unsere eigene Zeit, losgelöst von allen anderen Zeiten. Nichts kann Ihnen eine bessere Vorstellung davon geben, was hier gemeint ist, als ein Spaziergang durch die geschäftigen Straßen einer modernen Stadt. Dieses Chaos von widerstreitenden Tendenzen und Beschäftigungen, Zielen und Aktivitäten, Stimmen und Schweigen, Triumphen, Klagen, Niederlagen; die Farbigkeit und Doppeldeutigkeit des Ganzen; seine Unbekümmertheit gegenüber der Vergangenheit; der Eindruck, daß alles auf einmal geschieht, eine Simultaneität, als ob nichts davor oder danach von Bedeutung wäre; wie klein und zerrissen die Dinge und Ereignisse wirken, während doch in allen so viel Energie steckt; wie alles sich seinen Weg bahnt, in die eine oder andere bestimmte Richtung, mit einem winzigen eigenen Willen und Widerstand gegen alles andere – das ist der tierische Aspekt unserer modernen Welt, ein Leben, das für sich selbst besteht, ohne eine Vergangenheit und eine Zukunft, der schnelle und immer mehr anschwellende Fluß der Gegenwart. James Joyce hat eine Methode entwickelt, sich damit zu befassen. Er hat den Fluß der Gegenwart in der gegebenen Einheit einer Stadt, Dublin, und eines bestimmten Tages, dem 16. Juni 1904, eingefangen.
Das dritte, was die Menschen beschäftigt, das Furchterregendste von den dreien, ist das, was kommen wird. Hier ist nichts gegeben, nichts bekannt. Es liegen keine Gegenstände herum, von denen man mit Gewißheit sagen kann, sie würden die Zukunft bilden. Diese Kathedrale hier, mit ihren achthundert Jahren, kann heute nacht zu Staub zerfallen, und der morgige Tag wird sie nicht mehr sehen. Diese Stadt hier, die vor Leben überquillt, könnte in der nächsten Viertelstunde in sich zusammenstürzen, und die kommende Nacht müßte ohne sie auskommen. Alle Zerstörungen gehören der Zukunft an, so wie alle Überreste der Vergangenheit angehören. Es gibt keine Angst, die nicht wahr werden könnte; jede Äußerung kann in gewisser Hinsicht als prophetisch gelten. Hundert verschiedene Zukunften sind möglich, tausend, wer immer sich mit der Zukunft beschäftigt, hat sie alle im Kopf, eine schreckliche Last. Zweifel und Sorge um das Kommende sind untrennbar miteinander verbunden. Angst ist der Vorbote der Zukunft. Von allen modernen Schriftstellern ist Kafka der einzige, der die Zukunften, wenn man so sagen kann, in seinen zitternden Gliedern spürt. Er versucht nicht, sie los zu werden. Er arbeitet sie geduldig aus, einmal auf diese Art, einmal auf jene. Sein Mut erscheint gewaltig, und sein Mut bringt ihn um. Während die Völker Europas gehorsam ihren ersten Weltkrieg führen, schlägt er standhaft seine scheinbar privaten Schlachten mit der Zukunft. Er merkt nicht einmal, wie mutig er ist. Da er es nicht versteht, sich seinen Weg durch die geschäftigen Straßen der Gegenwart zu bahnen, gelangt er zu einer ziemlich schlechten Meinung von sich. Er kann nicht mit den Fäusten kämpfen, er ist kein Boxer; er kann nicht mit Worten schmeicheln, er ist kein geselliger Mensch. Als kleiner Angestellter bei einer Versicherung trug er die Last von jedermanns Zukunft. Kafkas Werke sind wie Pläne und Blaupausen, aber nicht von Häusern und Fabriken, auch nicht von Schlachten, es sind die Pläne von individuellen und unbekannten Ereignissen.
Am interessantesten und wichtigsten von den wenigen Dingen, die unsere drei Schriftsteller gemein haben, ist vielleicht der autobiographische Charakter, der einen Großteil ihrer Werke auszeichnet. Jeder von ihnen hat ein neues, ureigenes Bild von der Welt. Jeder von ihnen spürt, wie notwendig es ist, sein eigenes Leben zu erfassen, ebenso wie das Leben anderer; daß das eine durch das andere interpretiert werden muß; daß diese zweifache Art der Erforschung nichts Willkürliches hat und nichts von zügelloser Selbstbezogenheit. Bei Proust ist es der Erzähler seines Romans, der von sich selbst als »ich« spricht; bei Joyce ist es Stephen Dedalus, der in zwei seiner Hauptwerke auftritt: ›Ein Porträt des Künstlers als junger Mann‹ und ›Ulysses‹; bei Kafka ist es Joseph K. im ›Prozeß‹ und K. im ›Schloß‹: K, der Anfangsbuchstabe des Namens seines Helden, ist Kafkas eigener Anfangsbuchstabe. Für die, die etwas über das Innenleben dieser Autoren erfahren wollen, ist dies ein sehr glücklicher Zufall. Ihre Konflikte und Kämpfe, ihre Vorurteile und Überzeugungen, ihre ganze Entwicklung sind hier klar und deutlich zu erkennen. Biographien, die später von anderen Autoren geschrieben wurden, haben dem nichts Wesentliches oder Unentbehrliches hinzugefügt. Sie haben vielleicht versucht, noch ein oder zwei Tatsachen aufzudecken; doch was für armselige Dinge sind Tatsachen in dem Leben von Menschen mit solch ungeheuer lebendiger Einbildungskraft. Alles in allem kann man, ohne ungerecht zu sein, wohl sagen, daß diese Biographien nichts weiter getan haben, als die Komplexität und Feinheit der eigenen Forschungen unserer Autoren auf das einfachere und leichter zugängliche Niveau eines gewöhnlichen Empfindungsvermögens zu reduzieren. Für die Interpretation ihrer Werke, die so schwierig und vielseitig sind, wird immer Raum bleiben. Über ihr Leben wird es nichts zu sagen geben, das sie nicht selbst schon besser herausgefunden haben.
Das erste, was es am Leben eines großen Schriftstellers zu verstehen gilt, sind die Art und das Ausmaß der Einsamkeit, die er für sich hat herstellen können. Es gibt viele Methoden, erstickende Bande zu zerreißen. Die Gewalt der Rebellion, für den einen eine absolute und unbestreitbare Notwendigkeit, kann für den andern ein sehr gefährliches Gift sein. Bei dem einen können alle Anstrengungen und Vorsichtsmaßnahmen darin bestehen, die kleinsten Gewohnheiten der Kindheit und Jugend zu schützen, während der andere auf Leben und Tod um ihre völlige Vernichtung kämpfen kann. Es gibt unendlich viele Arten von Menschen; und schaffende Künstler unterscheiden sich voneinander noch mehr als andere Menschen. Um ein einfaches, leicht überprüfbares Beispiel zu wählen: Es besteht zweifellos ein auffallender Unterschied zwischen den Beziehungen unserer drei Schriftsteller zu ihren Familien.
Proust hat seine Familie nie aufgegeben. Seine Zärtlichkeit für sie blieb zeit seines Lebens unverändert. Während der langen Zeit seiner Krankheit lebte er bei seiner Mutter, in demselben Haus, in dem er den Großteil seiner Jugend verbracht hatte. Sie tat, was sie konnte, um ihm seine Leiden zu erleichtern; alles um ihn herum war auf seine Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt. Sein Verhältnis zu seiner Mutter war das Wichtigste in seinem Leben. Die Atmosphäre, die sie für ihn schuf, ist oft beschrieben worden, am besten aber von ihm selbst.
Als er noch ein Kind war, kam seine Mutter jeden Abend, bevor er einschlief, auf sein Zimmer und gab ihm einen Kuß. Ohne diesen Kuß konnte er nicht einschlafen. Er fürchtete sich vor den Abenden, an denen sie Gäste zum Essen da hatten, denn dann gab seine Mutter ihm seinen Kuß im Speisezimmer, in Gegenwart der Gäste, und schickte ihn allein in sein Zimmer hinauf. Aber selbst dieser öffentliche Kuß im Speisezimmer war ihm unentbehrlich. Ohne ihn auskommen zu müssen bedeutete eine schlaflose, qualvolle Nacht. Eines Abends schickte ihn sein Vater ein wenig ungeduldig geradewegs nach oben, ohne ihm Zeit zu lassen, seine Mutter zu küssen. Die Qual, die ihn danach, als er allein in seinem Zimmer war, befiel, wird in dem ersten, einem sehr wichtigen Kapitel seines Buches beschrieben. Es ist der Keim des Ganzen, und was drückt es anderes aus als den Schmerz der Trennung von dem, was man liebt, verhinderte Zärtlichkeit, eine Trennung, die schon für alle späteren Trennungen steht und für das letzte Ende, den Tod.
Auch als er erwachsen war, schien Proust nicht ohne seine Mutter leben zu können. Er war vierunddreißig Jahre alt, als sie starb. Unmittelbar nach ihrem Tode begann er sein gewaltiges Werk; es hielt ihn die restlichen siebzehn Jahre seines Lebens beschäftigt. Wir haben allen Grund anzunehmen, daß ihm die Trennung von ihr die nötige Spannung und Konzentrationsfähigkeit für seine Arbeit gab. Nur etwas unermeßlich Großes und Tiefgründiges konnte sie allmählich ersetzen und ihm den Willen und die Kraft zum Leben verleihen. Früher, als er noch in der Gesellschaft verkehrte, blieb sie, wenn er abends ausging, auf und wartete, bis er nach Hause kam. Nun, da sie nicht mehr warten konnte, verließ er kaum noch das Haus. Seine Krankheit war das stärkste Band zwischen ihm und ihr gewesen, jetzt war es das stärkste Band zwischen ihm und seiner Arbeit. Tagsüber schlief er; nachts, wenn seine Asthmaanfälle weniger abscheulich schienen, arbeitete er.
Aber es wäre nicht richtig, nur von Prousts Mutter zu reden, wenn man von seiner Familie spricht. Sein Werk zeugt davon, daß ihm auch all seine anderen Verwandten sehr viel bedeuteten. Da wären sein Vater, seine Großmutter, sein Großvater, ein Onkel, etliche Tanten. Abgesehen vielleicht von seinem Vater, der ein wenig kalt wirkt, sind sie alle mit ungewöhnlicher Zärtlichkeit gezeichnet. Der erste Eindruck, den der Leser von Prousts Werk gewinnt, ist der einer überquellenden, aber gut geschützten Zärtlichkeit. In seinem Leben wie in seinem Werk scheint Proust stets innerhalb seiner Familie zu bleiben. Nie tauchte auch nur entfernt der Gedanke auf, sich von ihr zu trennen, nie irgendein anhaltender Grund zur Unzufriedenheit.
Wie erstaunlich anders ist die Haltung von Joyce! Es gibt ein wertvolles Dokument über seine Jugend, wenn Dokument nicht ein zu armseliges Wort für ein Kunstwerk ist. ›Ein Porträt des Künstlers als junger Mann‹ beschreibt die ersten zwanzig Jahre seines Lebens in Dublin. In ›Stephen Hero‹, einer früheren Fassung dieses Buches, die Joyce nicht selbst veröffentlichte, wird das Umfeld des Helden, die Geschichte seiner vielköpfigen Familie, sehr viel ausführlicher behandelt. Der Tod von Stephens Schwester etwa fehlt in der späteren Fassung ganz. Für unsere Zwecke genügt es jedoch, das ›Porträt des Künstlers‹ heranzuziehen, da es nicht sehr bekannt ist, und zu sehen, welche Informationen über Joyce' Verhältnis zu seiner Familie wir daraus entnehmen können. Stephen Dedalus steht hier immer für James Joyce.
Sein Vater, Simon Dedalus, ein keinerlei Vorsorge tragender Mann mit einer sehr großen Familie, nimmt Stephen mit nach Cork, wo er irgendeinen Grundbesitz verkaufen will.
»Er reiste mit seinem Vater per Nachtzug nach Cork … Er hörte ohne Anteilnahme seinem Vater zu, der Cork und Szenen seiner Jugend heraufbeschwor, eine Erzählung, die von Seufzern oder Zügen aus seinem Flachmann unterbrochen wurde, wann immer das Bild eines toten Freundes darin auftauchte oder wann immer dem Beschwörer plötzlich der Zweck seines diesmaligen Besuchs einfiel. Stephen hörte, aber konnte kein Mitleid fühlen. Die Bilder der Toten waren ihm alle fremd … Er wußte jedoch, daß seines Vaters Grundbesitz verauktioniert werden sollte, und in der Art, wie man auch ihn hier enterbte, spürte er die Welt rüd seine Phantasie Lügen strafen.«
In Cork »ging Stephen weiter an der Seite seines Vaters, hörte Geschichten, die er schon kannte, hörte wieder die Namen der in alle Winde zerstreuten und toten Zechgenossen, die seines Vaters Jugendgefährten gewesen waren. Und eine leise Übelkeit seufzte in seinem Herzen. Er erinnerte sich an seine eigene fragwürdige Stellung in Belvedere« – das Jesuiten-College, in dem er zur Schule ging – »ein Schüler mit Freiplatz, ein Führer, der vor seiner eigenen Autorität Angst hatte, stolz und sensibel und argwöhnisch, im Kampf gegen die Dürftigkeit seines Lebens und das Tumultuarische seines Geistes …«
»Die Stimme seines Vaters hörte er immer noch. – Wenn du dich erst mal freigeschwommen hast, Stephen – was du ja eines Tages wohl mal wirst – merk dir, egal was du tust, aber verkehre mit Gentlemen. Als ich ein junger Bursche war, das sag ich dir, da hab ich meinen Spaß gehabt. Ich hab mit anständigen prima Burschen verkehrt. Jeder von uns konnte was Spezielles. Einer hatte eine gute Stimme, ein anderer war ein guter Schauspieler, ein anderer konnte ein gutes Witzlied singen, ein anderer war ein guter Ruderer oder ein guter Rakettspieler, ein anderer konnte eine gute Geschichte erzählen und so fort. Bei uns war immer was am Laufen und wir haben unsern Spaß gehabt und ein bißchen was vom Leben gesehn und keinem von uns hats geschadet. Aber wir waren alle Gentlemen, Stephen – wenigstens hoffe ich, daß wirs waren – und verdammt gute und ehrliche Iren dazu. Mit dieser Art von Burschen möcht ich, daß du dich zusammentust, Burschen, die das Herz am rechten Fleck haben. Ich rede zu dir als Freund, Stephen. Ich halt nichts davon, daß ein Sohn Angst haben soll vor seinem Vater. Nein, ich behandle dich, wie dein Großvater mich behandelt hat, als ich ein junger Kerl war. Wir waren mehr wie Brüder als wie Vater und Sohn …«
Aber der neben ihm hergehende Stephen fühlt sich nur »müd gemacht und niedergeschlagen von der Stimme seines Vaters«.
»Am späteren Nachmittag des Tages, an dem der Grundbesitz verkauft wurde, folgte Stephen seinem Vater sanftmütiglich von Kneipe zu Kneipe durch die Stadt … Sie hatten sich früh am Morgen von Newcombes Kaffeehaus aus aufgemacht, wo die Tasse von Mr. Dedalus geräuschvoll auf der Untertasse geklappert hatte, und Stephen hatte versucht, dies schandbare Zeichen von seines Vaters Zecherei die Nacht zuvor zu vertuschen, indem er seinen Stuhl rückte und hustete. Eine Demütigung war auf die andere gefolgt: das falsche Lächeln der Markthändler, das Scharwenzeln und Äugeln der Schankmädchen, mit denen sein Vater poussiert hatte, die Komplimente und aufmunternden Worte der Freunde seines Vaters …«
»Stephen sah zu, wie die drei Gläser von der Theke in die Höhe gehoben wurden und sein Vater und seine beiden Kumpane auf ihre Vergangenheit tranken. Schicksal oder Temperament trennte ihn von denen abgrundtief. Sein Bewußtsein kam ihm älter vor als ihrs: es schien kalt auf ihre Reibereien und ihre Glücklichkeit und ihre Enttäuschungen wie ein Mond auf eine jüngere Erde. Nicht Leben noch Jugend regten sich in ihm, wie sie sich in denen geregt hatten. Er hatte weder die Vergnügungen der Kameradschaft noch die Potenz ungeschlachter männlicher Gesundheit noch Sohnespietät erfahren … Seine Kindheit war tot oder verloren gegangen und mit ihr seine einfacher Freuden fähige Seele, und er trieb jetzt durchs Leben wie die unfruchtbare Schale des Monds.«
In seiner ganzen Haltung während des Aufenthalts in Cork liegt ein wilder Widerstand gegen die Vergangenheit. Er mißtraut den Geschichten seines Vaters – welchen Wert kann eine Vergangenheit haben, die nichts weiter gebracht hat als die Erbärmlichkeit, das Elend und die Erniedrigungen dieser Gegenwart. Er fühlt sich einsam unter seines Vaters Freunden; er will nicht wie einer von ihnen werden. Cork kommt ihm noch enger vor als Dublin. Schon hier zeigt sich bei ihm eine rigorose Ablehnung der Lebensweise seines Vaters.
Als er wieder in Dublin ist, leidet er unter »der Unordnung … der Mißwirtschaft und dem Durcheinander im Haus seines Vaters«. All dieses Gerede darüber, daß er ein Gentleman sei – und dann die Art von Zuhause, die ihnen sein Vater gibt! Hier ist eine Beschreibung von diesem Zuhause, als Stephen einmal aus seiner Jesuitenschule zu Besuch kommt.
»Der schwache saure Gestank von Kohl kam ihm von den Küchengärten … entgegen …
Er stieß die Haustür, die kein Schnappschloß hatte, auf und ging durch den nackten Flur in die Küche. Seine Brüder und Schwestern saßen in einer Gruppe um den Tisch. Die Teezeit war fast vorbei, und nur der Rest des zweiten Teeaufgusses stand am Grund der kleinen Glaskrüge und Marmeladentöpfe, die als Teetassen herhalten mußten. Weggeworfene Krusten und Brocken gezuckerten Brots, die von dem Tee, den man über sie gegossen hatte, braun geworden waren, lagen auf dem Tisch verstreut. Kleine Teelachen standen hier und da auf dem Holz und ein Messer mit zerbrochenem Elfenbeingriff steckte im Bauch eines ramponierten Auflaufs …
Er setzte sich neben sie an den Tisch und fragte, wo Vater und Mutter wären. Jemand antwortete:
– Weg um ein Haus anzukucken.
Wieder ein Umzug! Ein Junge in Belvedere namens Fallon hatte ihn oft mit dümmlichem Lachen gefragt, warum sie so oft umzögen. Ein höhnischer Zug verdunkelte kurz seine Stirn, als er wieder das dümmliche Lachen des Fragers hörte.
Er fragte:
– Warum ziehen wir denn schon wieder um, wenn man mal fragen darf?
– Weil der Wirt uns an die Luft setzt.«
Nichts haßte er mehr als diese ewigen Umzüge. Eine Reihe von Möbelwagen und eine Schachtel Pfandscheine neben seinem Ellbogen, als er sich zu Hause hinsetzte, waren ein Symbol für die völlige Sinnlosigkeit all dessen, was sein Vater tat.
Stephen sah, wie töricht seine Absicht gewesen war. »Er hatte versucht, einen Damm der Ordnung und Eleganz gegen die ekle Drift des Lebens um ihn herum zu bauen und, durch Verhaltensregeln und aktive Interessen und neue Sohnesbeziehungen, das mächtige Branden der Driften in seinem Innern einzudämmen. Zwecklos. Von draußen wie von drinnen war das Wasser über seine Schranken geflossen …
Klar sah er auch seine eigene nichtige Isolation. Nicht einen Schritt war er dem Leben derer, die er zu erreichen gesucht hatte, näher gekommen, noch hatte er eine Brücke über die rastlose Scham und die Erbitterung, die ihn von Mutter und Bruder und Schwester trennten, zu schlagen vermocht. Er spürte, daß er schwerlich dasselbe Blut hatte wie diese, sondern eher in der mystischen Verwandtschaftsbeziehung der Adoptivschaft zu ihnen stand, Adoptivkind und Adoptivbruder.«
»Seines Vaters Pfiff, das Gemurr seiner Mutter, der gellende Schrei einer ungesehenen Wahnsinnigen waren für ihn jetzt wie Stimmen, die den Stolz seiner Jugend beleidigten und zu demütigen drohten …«
Dieser Stolz seiner Jugend, diese aktive und entschiedene Ablehnung seiner Adoptiveltern, wie er sie nennt; die Entfremdung von dem unerschütterlichen katholischen Glauben seiner Mutter; die Sehnsucht danach, den leeren, fruchtlosen Prahlereien seines Vaters zu entfliehen – all dies kommt gegen Ende des Buches in einem Dialog mit seinem Freund Cranly in konzentrierter, äußerst beeindruckender Form zum Ausdruck. Ich glaube, es lohnt sich, einen guten Teil davon zu zitieren:
»Cranly, ich hab heut nachmittag einen unangenehmen Krach gehabt.
– Mit deinen Leuten? fragte Cranly.
– Mit meiner Mutter.
– Über Religiöses?
– Ja, antwortete Stephen.
Nach einer Pause fragte Cranly:
– Wie alt ist deine Mutter?
– Nicht alt, sagte Stephen. Sie will, daß ich meiner österlichen Pflicht nachkomme.
– Und willst du?
– Ich will nicht, sagte Stephen.
– Warum nicht? sagte Cranly.
– Ich will nicht dienen, antwortete Stephen.
– Die Bemerkung ist schon einmal früher gemacht worden, sagte Cranly ruhig.
– Dann wird sie jetzt noch einmal hinterher gemacht, sagte Stephen hitzig.
…
– Glaubst du an die Eucharistie? fragte Cranly.
– Nein, sagte Stephen.
– Du glaubst also nicht an sie?
– Weder glaube ich an sie noch glaube ich nicht an sie, antwortete Stephen.
– Viele Menschen haben Zweifel, sogar religiöse Menschen, doch sie überwinden sie oder schieben sie beiseite, sagte Cranly. Sind deine Zweifel in diesem Punkt zu stark?
– Ich will sie gar nicht überwinden, antwortete Stephen.
…
– Laß mich etwas fragen, sagte Cranly. Liebst du deine Mutter?
Stephen schüttelte langsam den Kopf.
– Ich weiß nicht was deine Worte bedeuten, sagte er einfach.
– Hast du nie jemand geliebt? fragte Cranly.
– Meinst du Frauen?
– Davon spreche ich nicht, sagte Cranly in kühlerem Ton. Ich frage dich, ob du je für jemand oder etwas Liebe empfunden hast.
Stephen lief neben seinem Freund daher und starrte düster auf das Trottoir.