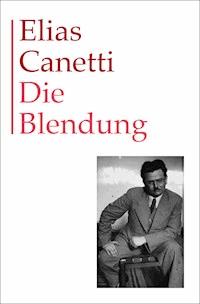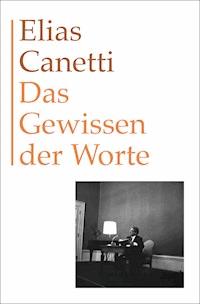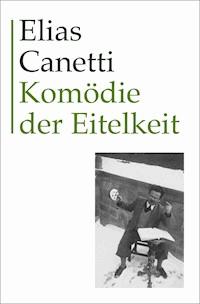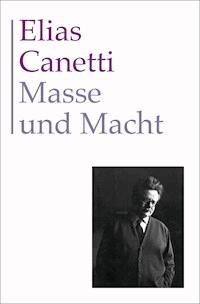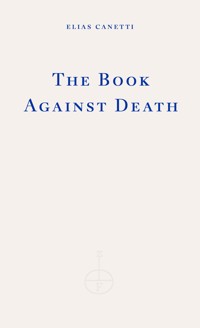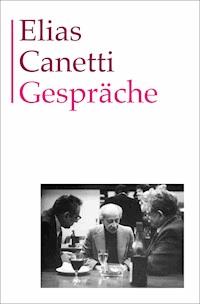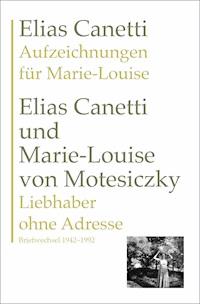Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Entwicklungsroman aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts: Der junge Canetti hat das Paradies seiner Kindheit verlassen und begibt sich nun auf einen vielfältig verschlungenen Lebensweg. Er schildert seine Frankfurter Schulzeit, die Jahre an der Universität in Wien und das kurze Intermezzo in Berlin. Er begegnet seiner späteren Frau Veza, Karl Kraus, George Grosz, Bertolt Brecht sowie Isaak Babel und vollzieht seine innere Entwicklung zum Schriftsteller.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 631
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Elias Canetti
Die Fackel im Ohr
Lebensgeschichte
1921–1931
Impressum
ISBN 978–3–446–25335–3
Zuerst erschienen 1980
Text nach Band VIII der Canetti-Werkausgabe
© 2015, 2016 Elias Canetti Erben Zürich, Carl Hanser Verlag München
Umschlaggestaltung: S. Fischer Verlag / www.buerosued.de
Cover: Karl Kraus, sein letztes Bild, 1933
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de. Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Inhaltsverzeichnis
Teil 1Inflation und OhnmachtFrankfurt 1921–1924
Pension Charlotte
Hoher Besuch
Die Herausforderung
Das Porträt
Die Beichte eines Toren
Die Ohnmacht
Gilgamesch und Aristophanes
Teil 2Sturm und ZwangWien 1924–1925
Leben mit dem Bruder
Karl Kraus und Veza
Der Buddhist
Letzte Donaufahrt. Die Botschaft
Redner
Enge
Das Geschenk
Simsons Blendung
Frühe Ehre des Intellekts
Patriarchen
Der Ausbruch
Die Rechtfertigung
Teil 3Die Schule des HörensWien 1926–1928
Das Asyl
Die Friedenstaube
Frau Weinreb und der Henker
Backenroth
Die Rivalen
Ein roter Mormone
Die Schule des Hörens
Die Erfindung von Frauen
Der Blick auf Steinhof
Unter Totenmasken
Der 15. Juli
Die Briefe im Baum
Teil 4Das Gedränge der NamenBerlin 1928
Die Brüder
Brecht
Ecce Homo
Isaak Babel
Die Verwandlungen des Ludwig Hardt
Einladung ins Leere
Flucht
Teil 5Die Frucht des FeuersWien 1929–1931
Der Pavillon der Irren
Die Zähmung
Der Ernährer
Fehltritte
Kant fängt Feuer
Teil 1
Inflation und Ohnmacht
Frankfurt 1921–1924
Pension Charlotte
Hoher Besuch
Die Herausforderung
Das Porträt
Die Beichte eines Toren
Die Ohnmacht
Gilgamesch und Aristophanes
Pension Charlotte
Die wechselnden Schauplätze meines frühen Lebens nahm ich ohne Widerstand auf. Ich habe es nie bedauert, daß ich als Kind so kräftigen und kontrastreichen Eindrücken ausgesetzt war. Jeder neue Ort, fremdartig wie er anfangs erschien, gewann mich durch das Besondere, das er hinterließ, und durch seine unabsehbaren Verzweigungen.
Einen einzigen Schritt habe ich mit Bitterkeit empfunden, ich habe es nie verwunden, daß ich Zürich verließ. Ich war 16 und fühlte mich an Menschen und Lokalitäten, Schule, Land, Dichtung, ja sogar an die Sprache, die ich mir gegen den zähen Widerstand der Mutter erworben hatte, so stark gebunden, daß ich es nie mehr verlassen mochte. Nach bloß fünf Jahren in Zürich und in diesem frühen Alter war mir zumute, als sollte ich nun nirgends anders mehr hin und ein ganzes Leben, in zunehmendem geistigen Wohlergehen, hier verbringen.
Der Riß war gewaltsam, und alles, was ich an Gründen für mein erwünschtes Bleiben ins Treffen führte, war verhöhnt worden. Nach dem vernichtenden Gespräch, in dem über mein Schicksal entschieden wurde, stand ich lächerlich und kleinmütig da, als Feigling, der um bloßer Bücher willen dem Leben nicht ins Gesicht sah, als anmaßend, mit falschem Wissen vollgepfropft, das zu nichts nütze war, als eng und selbstzufrieden, als Parasit, als Pensionist, als Greis, bevor ich mich in irgend etwas bewährt hatte.
In der neuen Umgebung, deren Wahl unter Umständen erfolgt war, die für mich im Dunkel lagen, reagierte ich auf zweierlei Weise gegen die Brutalität des Wechsels: einmal durch Heimweh, es galt als eine natürliche Krankheit der Menschen, in deren Land ich gelebt hatte, und indem ich es auf das heftigste empfand, fühlte ich mich ihnen zugehörig. Das zweite war eine kritische Einstellung zu meiner neuen Umgebung. Vorbei war die Zeit des unbehinderten Einströmens alles Unbekannten. Ich suchte mich dagegen zu verschließen, denn es war mir aufgedrängt worden. Zu einer kompletten wahllosen Abwehr war ich aber nicht imstande, dazu war ich von Hause aus zu empfänglich geraten, so begann eine Periode der Prüfung und satirischen Zuspitzung. Was anders war, als ich es kannte, übertrieb sich mir und erschien mir komisch. Es kam dazu, daß vieles sich gleich auf einmal präsentierte.
Wir waren nach Frankfurt gezogen, und da die Umstände ungewiß waren und wir noch nicht wußten, wie lange wir bleiben würden, zogen wir in eine Pension. Da lebten wir in zwei Zimmern, ziemlich gedrängt, viel näher mit anderen Menschen als je zuvor, wir fühlten uns zwar als Familie, aber wir aßen unten mit anderen zusammen an einem langen Pensionstisch. In der Pension Charlotte lernten wir alle möglichen Menschen kennen, die ich täglich während der Hauptmahlzeit wiedersah und die nur allmählich wechselten. Einige waren während der ganzen zwei Jahre da, die ich schließlich in der Pension verbrachte, andere bloß ein oder auch nur ein halbes Jahr; sie waren sehr unterschiedlich, alle haben sich mir eingeprägt, doch mußte ich gut aufpassen, um zu verstehen, wovon die Rede war. Meine Brüder, damals 11 und 13 Jahre alt, waren die Jüngsten, und dann kam gleich ich in meinem 17. Jahr.
Die Gäste fanden sich nicht immer unten ein. Fräulein Rahm, ein schlankes, junges Mannequin, sehr blond, die modische Schönheit der Pension, kam nur manchmal zum Essen. Sie nahm wegen ihrer Figur nur wenig zu sich, um so mehr war von ihr die Rede. Kein Mann, der ihr nicht nachsah, kein Mann, den es nicht nach ihr gelüstete, und da man wußte, daß es neben ihrem festen Freund, dem Inhaber eines Herrenmodegeschäfts, der nicht in der Pension wohnte, auch andere Männer gab, die sie besuchten, dachten viele an sie und betrachteten sie mit dem Wohlgefallen für etwas, das einem zusteht und einem eines Tages auch zufallen könnte. Die Frauen lästerten über sie. Die Männer, wenn sie es vor ihren Frauen riskierten oder wenn sie allein waren, legten ein gutes Wort für sie ein, besonders für ihre elegante Figur, sie war so hoch und schlank, daß man mit den Augen an ihr auf und ab klettern konnte, ohne irgendwo Halt zu finden.
Am Kopf des Pensionstisches saß Frau Kupfer, braun und von Sorge ausgemergelt, eine Kriegswitwe, die die Pension betrieb, um sich und ihren Sohn durchzubringen, sehr ordentlich, genau, der Schwierigkeiten dieser Zeit, die sich in Zahlen ausdrücken ließen, immer bewußt, ihr häufigster Satz war »Das kann ich mir nicht leisten«. Ihr Sohn Oskar, ein untersetzter Junge mit buschigen Augenbrauen und niederer Stirn, saß zu ihrer Rechten. Herr Rebhuhn saß zur Linken von Frau Kupfer, ein asthmatischer älterer Herr, Bankprokurist, überaus freundlich, nur wenn die Rede auf den Ausgang des Krieges kam, wurde er finster und böse. Er war zwar Jude, aber höchst deutschnational gesinnt, und wenn jemand ihm dann widersprach, fuhr blitzrasch, ganz gegen seine gemächliche Art, der ›Dolchstoß‹ heraus. Er regte sich bis zu einem Asthmaanfall auf und mußte dann von seiner Schwester, Fräulein Rebhuhn, die mit ihm in der Pension wohnte, hinausgeführt werden. Da man diese Eigenheit von ihm kannte und auch wußte, wie sehr er unter seinem Asthma litt, vermied man es im allgemeinen, das Gespräch auf diesen wunden Punkt zu bringen, so daß es ganz selten zum Ausbruch kam.
Nur Herr Schutt, dessen Kriegsverletzung dem Asthma Herrn Rebhuhns an Schwere in nichts nachstand, der nur an Krücken gehen konnte, an argen Schmerzen litt, sehr bleich aussah – er mußte Morphium gegen seine Schmerzen nehmen –, nahm sich kein Blatt vor den Mund. Er haßte den Krieg, bedauerte, daß er nicht vor seiner schweren Verletzung zu Ende gegangen war, betonte, daß er ihn vorausgesehen und den Kaiser immer schon für gemeingefährlich gehalten habe, bekannte sich als Unabhängiger und hätte im Reichstag ohne zu zögern gegen die Kriegskredite gestimmt. Es war wirklich sehr ungeschickt, daß die beiden, Herr Rebhuhn und Herr Schutt, so nah voneinander saßen, nur durch das ältliche Fräulein Rebhuhn getrennt. Wenn Gefahr drohte, wandte sie sich nach links ihrem Nachbarn zu, spitzte ihren süßlich-altjüngferlichen Mund, legte den Zeigefinger davor und gab Herrn Schutt einen flehentlichen langen Blick, wobei sie mit dem Zeigefinger der rechten Hand vorsichtig schief nach unten auf ihren Bruder wies. Herr Schutt, der sonst so bitter war, verstand und hielt fast immer inne, meist unterbrach er sich noch im Satz, ohnehin sprach er so leise, daß man genau zuhören mußte, bevor man etwas verstand. So war die Situation dank Fräulein Rebhuhn, die immer wachsam auf seine Sätze achtete, gerettet. Herr Rebhuhn hatte noch nichts gemerkt, er selber fing nie an, er war der friedlichste und sanfteste aller Menschen. Nur wenn jemand auf das Kriegsende kam und seinen aufrührerischen Charakter guthieß, kam blitzartig eben der Dolchstoß über ihn, und er warf sich blind in den Kampf.
Es wäre aber völlig verfehlt zu glauben, daß es sonst an diesem Tische ähnlich zuging. Dieser kriegerische Konflikt war der einzige, dessen ich mich entsinne, und vielleicht hätte ich ihn vergessen, wenn er sich nach einem Jahr nicht so zugespitzt hätte, daß man die Gegner beide vom Pensionstisch wegführen mußte, Herrn Rebhuhn wie immer am Arm seiner Schwester, Herrn Schutt viel mühseliger auf seinen Krücken und mit Hilfe von Fräulein Kündig, einer Lehrerin, die schon lange in der Pension wohnte, seine Freundin geworden war und ihn später auch heiratete, um ihm einen eigenen Haushalt einzurichten und ihn besser zu versorgen.
Fräulein Kündig war eine von zwei Lehrerinnen in der Pension. Die andere, Fräulein Bunzel, hatte ein pockennarbiges Gesicht und eine etwas weinerliche Stimme, so als beklage sie mit jedem Satz ihre Häßlichkeit. Jung waren sie beide nicht, vielleicht vierzigjährig, beide vertraten die Bildung in der Pension. Als beflissene Leser der ›Frankfurter Zeitung‹ wußten sie, worauf es ankam und worüber man sprach, und man spürte, daß sie auf der Lauer nach Gesprächspartnern waren, die sich nicht zu unwürdig anließen. Doch waren sie keineswegs taktlos, wenn kein Herr sich fand, der sich zu Unruh, zu Binding, zu Spengler oder zu Meier-Graefes ›Vincent‹ äußern mochte. Sie wußten, was sie der Pensionsinhaberin schuldig waren, und verhielten sich dann still. Fräulein Bunzels weinerlicher Stimme war Spott ohnehin nie anzumerken, und Fräulein Kündig, die viel frischer wirkte und Männer wie Bildungsthemen mit Lebhaftigkeit anging, pflegte immer darauf zu warten, daß beides sich beisammenfand, denn ein Mann, zu dem sie nicht sprechen konnte, hätte sich ohnehin nur für Fräulein Rahm, das Mannequin, interessiert. Ein Wesen, das sie nicht über dies oder jenes aufklären konnte, kam für sie nicht in Betracht, und das war auch, wie sie der Mutter unter vier Augen gestand, der Grund, warum sie, im Gegensatz zu ihrer Kollegin eine anziehende Person, noch nicht geheiratet hatte. Ein Mann, der nie ein Buch las, war für sie kein Mann, da sei es schon besser, man sei frei und habe für keinen Haushalt zu sorgen. Auch nach Kindern gelüstete es sie nicht, von diesen sehe sie sowieso schon zu viele. Sie ging in Theater und Konzerte und sprach davon, wobei sie sich aber gern an die Auffassung der ›Frankfurter‹ hielt. Es sei schon merkwürdig, sagte sie, wie die Kritiker immer ihrer Meinung seien.
Die Mutter, seit Arosa mit dem deutschen Bildungston vertraut, für den sie, im Gegensatz zur Wiener ästhetischen Décadence, etwas übrig hatte, mochte Fräulein Kündig und glaubte ihr und hielt sich auch nicht darüber auf, als sie ihr Interesse für Herrn Schutt bemerkte. Zwar war der viel zu bitter, um sich auf Gespräche über Kunst oder Literatur einzulassen, für Binding, den Fräulein Kündig nicht weniger als Unruh schätzte – beide kamen viel in der ›Frankfurter‹ vor –, hatte er nichts als ein halbunterdrücktes Grunzen übrig, und wenn der Name Spengler fiel, was damals unvermeidlich war, erklärte er: »An der Front war der nicht. Darüber ist nichts bekannt«, worauf Herr Rebhuhn milde einwarf: »Ich würde meinen, daß es bei einem Philosophen nicht darauf ankommt.«
»Bei einem Geschichtsphilosophen vielleicht doch«, wandte Fräulein Kündig ein, und es war daraus zu entnehmen, daß sie bei allem schuldigen Respekt für Spengler Herrn Schutt die Stange hielt. Es kam aber darüber zu keinem Konflikt zwischen den beiden Herren, schon daß Herr Schutt von jemand einen Frontdienst erwartete, während Herr Rebhuhn darauf zu verzichten bereit war, hatte etwas Versöhnliches, es war, als hätten sie ihre Meinungen ausgetauscht. Über die eigentliche Frage, ob Spengler an der Front gewesen sei, wurde aber auf diese Weise nicht entschieden, ich weiß es bis heute nicht. Fräulein Kündig hatte, das war offensichtlich, Mitleid mit Herrn Schutt. Ziemlich lange verstand sie es, ihr Mitleid hinter burschikosen Bemerkungen wie »unser Kriegsknabe« und »ist auch damit fertig geworden« zu verbergen. Ihm war nicht anzumerken, ob er darauf ansprach oder nicht, er verhielt sich so neutral zu ihr, als hätte sie nie ein Wort an ihn gerichtet; immerhin grüßte er sie durch ein Nicken des Kopfes, wenn er das Speisezimmer betrat, während er Fräulein Rebhuhn an seiner Rechten keines Blickes würdigte. Die Mutter fragte er einmal, als wir drei uns in der Schule verspätet hatten und beim Essen noch fehlten: »Wo ist Ihr Kanonenfutter?«, was sie nicht ohne Empörung später berichtete. Sie habe darauf entrüstet erwidert: »Niemals! Niemals!«, und er habe gehöhnt: »Nie wieder Krieg!«
Doch erkannte Herr Schutt an, daß die Mutter beharrlich gegen den Krieg Stellung bezog, obwohl sie ihn nie aus der Nähe erlebt hatte, und seine herausfordernden Bemerkungen galten eher einer Bestätigung ihrer Gesinnung. Es gab unter den Pensionsgästen eine ganz andere Sorte, von der er auf keine Weise Notiz nahm. Da war das junge Ehepaar Bemberg, das zu seiner Linken saß, er Börsenmakler mit laufendem Verständnis für materielle Vorteile, er lobte sogar Fräulein Rahm für ihre ›Tüchtigkeit‹, womit er ihre Manövrierfähigkeit unter zahlreichen Verehrern meinte. »Die schickste junge Dame in Frankfurt«, sagte er und war dabei einer der ganz wenigen, die es gar nicht auf sie abgesehen hatten, es war mehr »ihre Nase für Geld«, die ihm imponierte und ihre skeptische Reaktion auf Komplimente. »Die läßt sich den Kopf nicht verdrehen. Die will erst wissen, was dahintersteckt.«
Seine Frau, aus modischen Attributen zusammengesetzt, wovon ihr der Bubikopf noch am natürlichsten stand, auf eine andere Art leicht als Fräulein Rahm, war gutbürgerlicher Herkunft, aber ohne Penetranz. Wohl merkte man, daß sie sich alles kaufte, wonach es sie gelüstete, aber nur wenig hing an ihr, sie ging in Kunstausstellungen, interessierte sich für die Kleider von Frauen auf Bildern, bekannte ein Faible für Lucas Cranach und erklärte es mit seiner »tollen« Modernität, wobei ›erklären‹ für ihre mageren Interjektionen gewiß zu ausführlich klingt. Bei einem Shimmy hatten sich Herr und Frau Bemberg kennengelernt. Eine Stunde zuvor waren sie sich noch ganz fremd gewesen, wußten aber beide, wie er nicht ohne Stolz gestand, daß einiges dahintersteckte, mehr sogar bei ihr als bei ihm, aber er galt schon als vielversprechender junger Börsianer. Er fand sie ›schick‹, forderte sie zum Tanz auf und nannte sie gleich »Pattie«. »Sie erinnern mich an Pattie«, sagte er, »eine Amerikanerin.« Sie wollte wissen, ob das seine erste Liebe war. »Wie man's nimmt«, meinte er. Sie verstand und fand es toll, daß seine erste Frau eine Amerikanerin war, und behielt den Namen Pattie. Er nannte sie vor allen Pensionsgästen so, und wenn sie nicht zum Essen herunterkam, sagte er: »Pattie hat keinen Hunger heute. Sie denkt an ihre Linie.«
Auch dieses inoffensive Paar hätte ich vergessen, wenn es Herr Schutt nicht fertiggebracht hätte, sie so zu behandeln, als ob sie nicht auf der Welt wären. Wenn er auf seinen Krücken daherkam, waren sie wie verschwunden. Ihren Gruß überhörte er, ihre Visagen übersah er, und Frau Kupfer, die sein Vorhandensein in der Pension nur in Erinnerung an ihren kriegsgefallenen Mann hinnahm, wagte es kein einziges Mal, in seiner Gegenwart »Herr« oder »Frau Bemberg« zu sagen. Die beiden nahmen diesen Boykott, der von Herrn Schutt ausging, sich aber nicht weiter ausbreitete, ohne Murren hin. Sie hatten für den Behinderten, der in jeder Hinsicht arm erschien, etwas wie Mitleid übrig, und wenn es auch nicht viel war, so war es doch ein Gefühl, das sich seiner Verachtung gut entgegensetzen ließ.
Am entferntesten Ende des Tisches waren die Kontraste weniger scharf. Da war Herr Schimmel, ein Rayon-Chef, strotzend von Gesundheit, mit gespreiztem Schnurrbart und roten Wangen, ein Ex-Offizier, weder verbittert noch unzufrieden. Sein Lächeln, das nie von seinem Gesicht schwand, war eine Art von Seelenzustand, es war beruhigend zu sehen, daß es Seelen gibt, die sich immer genau gleich bleiben. Auch beim schlimmsten Wetter änderte es sich nie, und was einen ein wenig wunderte, war nur, daß so viel Zufriedenheit allein blieb und zu ihrer Bewahrung keiner Ergänzung bedurfte. Sie hätte sich leicht gefunden, denn gar nicht weit von Herrn Schimmel saß Fräulein Parandowski, Verkäuferin, eine schöne, stolze Person mit dem Kopf einer griechischen Statue, die sich durch keine Berufung Fräulein Kündigs auf die ›Frankfurter‹ verwirren und Herrn Bembergs Lob des Fräulein Rahm wie Regen an sich abtropfen ließ. »Das könnte ich nicht«, sagte sie und schüttelte den Kopf. Mehr sagte sie nicht, aber es war klar, was sie nicht konnte. Fräulein Parandowski hörte zu, obwohl sie kaum etwas sagte, das Unerschütterliche stand ihr gut. Herrn Schimmels Schnurrbart – er saß schräg gegenüber von ihr – sah aus, als wäre er eigens für sie zurechtgebürstet worden, die beiden waren wie geschaffen füreinander. Doch er richtete nie das Wort an sie, sie kamen oder gingen nie zusammen, es war, als sei ihre Nicht-Zusammengehörigkeit immer genau besprochen. Weder wartete Fräulein Parandowski darauf, daß er sich vom Tisch erhob, noch scheute sie sich davor, ziemlich lange vor ihm beim Essen zu erscheinen. Zwar hatten sie eines gemeinsam, ihr Schweigen, aber er lächelte immer, ohne sich etwas dabei zu denken, während sie, den Kopf hoch erhoben, so ernst blieb, als ob sie sich unaufhörlich etwas dächte.
Für alle war es klar, daß etwas dahintersteckte, aber sämtliche Versuche Fräulein Kündigs, die in dieser Gegend saß, in Erfahrung zu bringen, was es eigentlich sei, scheiterten am monumentalen Widerstand der beiden. Fräulein Bunzel vergaß sich einmal so weit, »Karyatide« hinter Fräulein Parandowski her zu sagen, während Fräulein Kündig Herrn Schimmel fröhlich mit: »Da kommt die Reiterei« begrüßte. Frau Kupfer verwies es ihr aber gleich, persönliche Bemerkungen an ihrem Pensionstisch konnte sie sich nicht leisten, und Fräulein Kündig benützte die Rüge, um Herrn Schimmel ins Gesicht zu fragen, ob er etwas dagegen habe, als »Reiterei« bezeichnet zu werden. »Es ist mir eine Ehre«, lächelte er, »ich war Kavallerist.« »Und wird bis an sein Lebensende einer bleiben.« So höhnisch reagierte Herr Schutt auf jeden Seitensprung Fräulein Kündigs, noch bevor es ausgemacht war, daß sie einander mochten.
Erst nach einem halben Jahr etwa erschien ein überlegener Geist in der Pension: Herr Caroli. Er wußte sich alle vom Leib zu halten, er hatte viel gelesen. Seine ironischen Bemerkungen, die sich als sorgsam kandierte Lesefrüchte entpuppten, erregten das Entzücken Fräulein Kündigs. Nicht immer kam sie drauf, woher ein Satz von ihm stammte, und sie demütigte sich so weit, um Aufklärung zu betteln. »Bitte, bitte, wo ist das jetzt wieder her. Bitte sagen, sonst kann ich heute wieder nicht schlafen.« »Wo wird es schon her sein«, antwortete dann Herr Schutt an Stelle von Herrn Caroli, »aus dem Büchmann, wie alle seine Reden.« Das war aber weit gefehlt und eine Blamage für Herrn Schutt, denn nichts, was Herr Caroli von sich gab, entstammte dem Büchmann. »Da nähme ich lieber Gift als den Büchmann«, sagte Herr Caroli, »ich zitiere nie, was ich nicht wirklich lese.« Es ging die Meinung in der Pension, daß das wahr sei. Ich war der einzige, der daran zweifelte, weil Herr Caroli von uns keine Notiz nahm, selbst die Mutter, die es an Bildung wahrhaftig mit ihm aufnehmen konnte, mißfiel ihm, weil ihre drei Buben am Pensionstisch Erwachsenen den Platz wegnahmen und man ihretwegen die geistreichsten Bemerkungen unterdrücken mußte. Ich las zu der Zeit die griechischen Tragiker, er zitierte aus dem ›Ödipus‹, von dem er eine Aufführung in Darmstadt gesehen hatte. Ich setzte sein Zitat fort, er tat, als hätte er nicht gehört, und als ich es hartnäckig wiederholte, wandte er sich blitzrasch mir zu und fragte scharf: »Habt ihr das heute in der Schule gehabt?« Nun kam es höchst selten vor, daß ich überhaupt etwas sagte, sein Verweis, mit dem er mir ein für allemal den Mund stopfen wollte, war ungerecht und wurde auch von den Tischgenossen so empfunden. Aber da er für seine Ironie gefürchtet war, murrte niemand, und ich verstummte beschämt.
Herr Caroli hatte nicht nur vieles auswendig im Kopf, er wandelte ganze Sätze auf geistreiche Weise ab und wartete dann, ob jemand auch verstehe, was er sich da geleistet habe. Am ehesten blieb ihm Fräulein Kündig als eifrige Theaterbesucherin auf der Spur. Er hatte Witz, und besonders im Entstellen triefendernster Dinge bewies er viel Geschick. Doch mußte er sich von Fräulein Rebhuhn, der Empfindlichsten von allen, sagen lassen, daß ihm nichts heilig sei, und hatte die Frechheit, darauf zu erwidern: »Feuerbach bestimmt nicht.« Alle wußten, daß Fräulein Rebhuhn – außer für ihren asthmatischen Bruder – für Feuerbach lebte und von Iphigenie, der Feuerbachschen natürlich, sagte: »Sie wäre ich gern gewesen.« Herr Caroli, ein südländisch wirkender Mensch von etwa 35 Jahren, der von den Damen hören mußte, daß er eine Stirn wie Trotzki habe, verschonte niemand, nicht einmal sich selbst. Lieber wäre er Rathenau, sagte er, drei Tage bevor Rathenau ermordet wurde, und das war dann das einzige Mal, daß ich ihn fassungslos erlebte, denn er sah mich, einen Schuljungen, mit Tränen in den Augen an und sagte: »Es geht zu Ende!«
Herr Rebhuhn, dieser warmherzige und kaiserkranke Mann, war der einzige, den dieser Mord nicht durcheinanderbrachte. Er schätzte den alten Rathenau viel höher ein als den jungen und verzieh es diesem nicht, daß er sich in den Dienst der Republik gestellt hatte. Doch räumte er ein, daß Walther sich früher, im Krieg, einige Verdienste um Deutschland erworben hätte, als es noch seinen Stolz hatte, als es noch ein Kaiserreich war. Herr Schutt sagte grimmig: »Alle werden die umbringen, alle!« Herr Bemberg erwähnte zum erstenmal in seinem Leben die Arbeiterschaft: »Das läßt sich die Arbeiterschaft nicht bieten!« Herr Caroli sagte: »Man sollte auswandern!« Fräulein Rahm, die Ermordungen nicht leiden konnte, weil dabei oft etwas daneben ging, sagte: »Nehmen Sie mich mit?«, und das vergaß ihr Herr Caroli nicht, denn von diesem Tag an verließ ihn sein Anspruch auf Geist, er machte ihr ganz öffentlich den Hof und wurde, zum Ärger der Frauen, gesehen, wie er ihr Zimmer betrat und es erst um zehn Uhr wieder verließ.
Hoher Besuch
Am Mittagstisch der Pension Charlotte spielte die Mutter eine geachtete, aber nicht eine dominierende Rolle. Sie war durch Wien geprägt, auch wo sie Wien widerstand. Von Spengler wußte sie nicht mehr, als der Titel seines Werkes besagte. Malerei hatte ihr nie viel bedeutet, als nach dem Erscheinen des ›Vincent‹ von Meier-Graefe van Gogh zum vornehmsten Gesprächsstoff der Pensionstafel wurde, konnte sie nicht mitreden, und wenn sie sich doch einmal hinreißen ließ, etwas zu sagen, machte sie keine sehr gute Figur. An Sonnenblumen, sagte sie, die keinen Duft verbreiteten, seien die Kerne ja doch das Beste, die könne man wenigstens knabbern. Darauf herrschte betretenes Schweigen, von Fräulein Kündig angeführt, Oberste in aktueller Bildung an diesem Tisch und wirklich von vielen der Dinge angerührt, die in der ›Frankfurter‹ zur Sprache kamen. Damals war es, daß die Religion um van Gogh begann, und Fräulein Kündig sagte einmal, jetzt erst, seit sie sein Leben kenne, sei ihr aufgegangen, was es mit Christus auf sich habe; eine Äußerung, gegen die Herr Bemberg ganz energisch protestierte. Herr Schutt fand das überspannt, Herr Schimmel lächelte. Fräulein Rebhuhn flehte: »Aber er ist doch so unmusikalisch«, womit sie van Gogh meinte, und als sie spürte, daß sie allgemeiner Verständnislosigkeit begegnete, setzte sie unbeirrt hinzu: »Können Sie sich vorstellen, daß er das ›Konzert‹ gemalt hätte?«
Ich wußte damals nichts von van Gogh und fragte oben in unseren Zimmern die Mutter nach ihm aus. Sie hatte so wenig zu sagen, daß ich mich für sie schämte. Sie sagte sogar, was sie früher nie getan hätte: »Ein Verrückter, der Strohsessel und Sonnenblumen gemalt hat, immer alles gelb, der mochte keine anderen Farben, bis er einen Sonnenstich bekam und sich eine Kugel in den Kopf schoß.« Ich war über diese Auskunft sehr unzufrieden, ich spürte, daß die Verrücktheit, die sie ihm zuschrieb, mir galt. Seit einiger Zeit nahm sie gegen jede Exaltiertheit Stellung, jeder zweite Künstler war für sie ein ›Verrückter‹, aber das galt nur für moderne (besonders solche, die noch lebten), die früheren, mit denen sie groß geworden war, ließ sie ungeschoren. Niemandem erlaubte sie, ihren Shakespeare anzutasten, und große Augenblicke am Pensionstisch hatte sie nur, wenn Herr Bemberg oder sonst ein Unvorsichtiger sich darüber beklagte, wie sehr er sich bei irgendeiner Shakespeare-Aufführung gelangweilt habe, es sei doch wirklich Zeit, damit Schluß zu machen und etwas Moderneres an seine Stelle zu setzen.
Da wurde dann die Mutter endlich wieder zu ihrem alten bewunderten Selbst. In wenigen funkelnden Sätzen vernichtete sie den armseligen Herrn Bemberg, der sich jämmerlich nach Hilfe umsah, aber niemand kam ihm zu Hilfe. Wenn es um Shakespeare ging, da scherte sich die Mutter um nichts, da kannte sie keine Rücksicht, da war es ihr auch gleichgültig, was die anderen von ihr dachten, und wenn sie gar damit endete, daß für die seichten Menschen dieser Inflationszeit, die nur Geld im Kopfe hätten, Shakespeare gewiß nicht das Richtige sei, flogen ihr die unterschiedlichsten Herzen zu: von Fräulein Kündig, die ihren Elan und ihr Temperament bewunderte, über Herrn Schutt, der das Tragische verkörperte, wenn er es auch nie beim Namen genannt hätte, bis zu Fräulein Parandowski, die für alles Stolze war und sich unter Shakespeare etwas Stolzes vorstellte. Ja sogar Herrn Schimmels Lächeln bekam etwas Geheimnisvolles, als er zum Staunen des ganzen Tisches »Ophelia« sagte und den Namen, aus Angst, daß er sich versprochen haben könnte, noch einmal etwas langsamer wiederholte. »Unser Reitersmann bei ›Hamlet‹«, sagte Fräulein Kündig, »wer hätte das gedacht«, worauf sie Herr Schutt sofort unterbrach: »Weil einer Ophelia sagt, muß er noch lange nicht ›Hamlet‹ gesehen haben.« Es stellte sich heraus, daß Herr Schimmel nicht wußte, wer Hamlet war, was großes Gelächter erregte. Nie wieder wagte er sich so weit vor. Herrn Bembergs Angriff auf Shakespeare war trotzdem abgeschlagen, seine eigene Frau beteuerte, sie habe die Hosenrollen bei ihm gern, die so schick seien.
Man las damals oft den Namen Stinnes in der Zeitung, es war die Zeit der Inflation, ich weigerte mich, von wirtschaftlichen Dingen etwas zu verstehen; hinter allem, was danach klang, witterte ich eine Falle des Onkels in Manchester, der mich in seine Geschäfte ziehen wollte. Sein Großangriff bei Sprüngli in Zürich, erst zwei Jahre her, lag mir immer noch in den Knochen. Seine Wirkung war verstärkt durch den schlimmen Disput mit der Mutter. Alles, was ich als Bedrohung empfand, führte ich auf seinen Einfluß zurück. Es war natürlich, daß er für mich mit Stinnes zusammenfloß. Die Art, wie man von Stinnes sprach, der Neid, den ich in Herrn Bembergs Stimme spürte, wenn er seinen Namen nannte, die schneidende Verachtung, mit der Herr Schutt ihn verdammte: »Alle werden ärmer, er wird immer reicher«, die einhellige Sympathie aller Frauen in der Pension (Frau Kupfer: »Der kann sich noch was leisten«; Fräulein Rahm, die ihren längsten Satz für ihn fand: »Was weiß man von so einem Mann«; Fräulein Rebhuhn: »Für Musik hat er eben nie Zeit«; Fräulein Bunzel: »Mir tut er leid. Niemand versteht ihn«; Fräulein Kündig: »Die Bettelbriefe möchte ich lesen, die er bekommt«; Fräulein Parandowski hätte gern für ihn gearbeitet, »da weiß man, woran man ist«; Frau Bemberg dachte gern an seine Frau: »Für so einen Mann muß man sich schick anziehen.«) – immer war lang von ihm die Rede, die Mutter als einzige schwieg. Herr Rebhuhn traf sich dieses einzige Mal mit Herrn Schutt und gebrauchte sogar das harte Wort ›Parasit‹, genauer: »Ein Parasit an der Nation«, und Herr Schimmel, mildester aller Lächler, gab Fräulein Parandowskis Bemerkung eine unerwartete Wendung: »Da hat man uns vielleicht schon aufgekauft. Kann man nicht wissen.« Wenn ich die Mutter fragte, warum sie schwieg, sagte sie, es käme ihr als Ausländerin nicht zu, sich in innerdeutsche Dinge zu mischen. Aber es war offensichtlich, daß sie dabei an etwas anderes dachte, etwas, womit sie nicht herausrücken wollte.
Dann, eines Tages, hielt sie einen Brief in der Hand und sagte: »Kinder, übermorgen bekommen wir Besuch. Herr Hungerbach kommt zum Tee.« Es stellte sich heraus, daß sie Herrn Hungerbach vom Waldsanatorium in Arosa her kannte. Es sei ihr ein bißchen peinlich, daß er uns in der Pension besuche, er sei ein ganz anderes Leben gewöhnt, aber sie könne ihm nicht gut absagen, dazu sei es auch zu spät, er sei auf Reisen und sie wisse gar nicht, wo sie ihn erreichen könne. Ich stellte mir, wie immer, wenn ich das Wort ›Reisen‹ hörte, einen Forschungsreisenden vor und wollte wissen, in welchem Erdteil er reise. »Er ist auf Geschäftsreisen natürlich«, sagte sie, »er ist Industrieller.« Nun wußte ich, warum sie bei Tisch geschwiegen hatte. »Es ist besser, wir sprechen nicht darüber in der Pension. Es wird ihn schon niemand erkennen, wenn er kommt.«
Ich war natürlich gegen ihn voreingenommen, ich hätte nicht die Reden unten am Tisch dazu gebraucht, es war ein Mann, der in die Sphäre des Oger-Onkels gehörte, was wollte er bei uns? Ich spürte eine Unsicherheit bei der Mutter und dachte, daß ich sie vor ihm schützen müsse. Wie ernst es war, wußte ich aber erst, als sie sagte: »Du gehst nicht aus dem Zimmer, wenn er da ist, mein Sohn, ich möchte, daß du ihn von Anfang bis zu Ende anhörst. Das ist ein Mann, der mitten im Leben steht. Er hat mir schon in Arosa versprochen, euch ein wenig in die Hand zu nehmen, wenn wir nach Deutschland kommen. Er hat unendlich viel zu tun. Aber ich sehe jetzt, daß er Wort hält.«
Ich war neugierig auf Herrn Hungerbach, und da ich einen ernsten Zusammenstoß mit ihm erwartete, lag mir daran, einen Gegner in ihm zu finden, der es mir schwermachte. Ich wollte von ihm beeindruckt werden, um mich um so besser gegen ihn zu behaupten. Die Mutter, die eine gute Witterung für meine »jugendlichen Vorurteile« (so nannte sie es) hatte, sagte, ich solle ja nicht glauben, Herr Hungerbach sei als verwöhntes Bürschchen aus einem reichen Hause groß geworden. Er habe es im Gegenteil als Sohn eines Bergarbeiters sehr schwer gehabt und sich Schritt für Schritt in die Höhe gearbeitet. Er habe ihr einmal in Arosa seine ganze Geschichte erzählt, da habe sie endlich erfahren, was es bedeute, wenn man ganz klein anfängt. Sie habe zum Schluß Herrn Hungerbach gesagt: »Ich fürchte, meinem Jungen ist es immer zu gut gegangen.« Er habe sich dann nach mir erkundigt und schließlich erklärt, es sei nie zu spät. Er wisse sehr wohl, was man in einem solchen Fall zu tun hätte: »Ins Wasser werfen und strampeln lassen. Plötzlich kann er schwimmen.«
Herr Hungerbach hatte eine plötzliche Art. Er klopfte an und war schon im Zimmer. Er schüttelte der Mutter die Hand, doch statt sie dabei anzusehen, faßte er mich ins Auge und bellte. Seine Sätze waren sehr kurz und abrupt, es war unmöglich, sie mißzuverstehen, doch er sprach nicht, er bellte. Vom Augenblick seines Eintritts bis zu seinem Abschied – er blieb eine volle Stunde – bellte er unaufhörlich. Er stellte keine Fragen und erwartete keine Antworten. Er fragte die Mutter, die immerhin in Arosa eine Mitpatientin von ihm gewesen war, kein einziges Mal danach, wie es ihr ginge. Er fragte mich nicht nach meinem Namen. Dafür bekam ich alles wieder zu hören, was mich vor einem Jahr in jenem Streitgespräch mit der Mutter so entsetzt hatte. Eine harte Lehre möglichst früh sei das Beste. Nur nicht studieren. Die Bücher wegwerfen, das ganze Zeug vergessen. Alles, was in Büchern stünde, sei falsch, nur das Leben selber zähle, Erfahrung und harte Arbeit. Arbeit, bis einem die Knochen schmerzten. Etwas anderes könne man gar nicht Arbeit nennen. Wer das nicht aushalte, wer zu schwach sei, der solle zugrunde gehen. Um den sei es nicht schade. Es gebe ohnehin zu viele Menschen auf der Welt. Die Unbrauchbaren sollten verschwinden. Im übrigen sei es nicht einmal ausgeschlossen, daß man sich trotzdem als brauchbar erweise. Trotz der grundfalschen Anfänge. Aber vor allem heiße es, alle diese Dummheiten vergessen, die mit dem Leben, wie es wirklich sei, nichts zu tun hätten. Leben sei Kampf, erbarmungsloser Kampf, und das sei gut so. Anders komme die Menschheit nicht voran. Eine Rasse von Schwächlingen wäre längst ausgestorben, ohne Spuren zu hinterlassen. Für nichts gebe es nichts. Männer müßten von Männern erzogen werden, Frauen seien zu sentimental, die wollten nur immer ihre Prinzensöhnchen herausputzen und von jedem Schmutz fernhalten. Arbeit sei aber vor allem schmutzig. Die Definition von Arbeit: etwas, was einen müd und schmutzig mache, und trotzdem gebe man nicht auf. – Es scheint mir eine arge Verfälschung, das Gebell des Herrn Hungerbach in verständliche Äußerung umzusetzen, aber wenn ich auch manche besonderen Sätze und Worte nicht verstand, der Sinn jeder einzelnen Direktive war überdeutlich, er schien geradezu zu erwarten, daß man auf der Stelle aufspringe und sich an die harte Arbeit mache, eine andere zählte ja nicht.
Immerhin wurde Tee eingeschenkt, man saß um einen niederen, runden Tisch, der Gast führte die Teeschale an den Mund, aber bevor es soweit war, daß er einen Schluck davon nahm, fiel ihm eine neue Direktive ein, die zu dringlich war, um einen ganzen Schluck lang zu warten. Die Schale wurde brüsk abgestellt, der Mund öffnete sich zu neuen Kurzsätzen, denen eines jedenfalls zu entnehmen war: ihre Zweifellosigkeit. Da hätten auch Ältere schwerlich widersprochen, geschweige denn Frauen oder Kinder. Herr Hungerbach genoß seine Wirkung. Er war ganz blau, in der Farbe seiner Augen gekleidet, er war makellos, kein Fleckchen war an ihm, kein Stäubchen. Ich dachte an sehr vieles, das ich gern gesagt hätte, aber am häufigsten, immer wieder, kam mir das Wort ›Bergarbeiter‹ in den Kopf, und ich fragte mich, ob dieser sauberste, sicherste, härteste aller Menschen in seiner Jugend je wirklich in einem Bergwerk gearbeitet habe, wie die Mutter behauptete.
Da ich den Mund nicht einmal auftat – wann hätte er mir einen Sekundenspalt dazu gegönnt –, da er alles losgelassen hatte, fügte er – und diesmal klang es wie eine Direktive an sich selbst – als letztes hinzu, daß er keine Zeit zu verlieren habe, und ging. Wohl gab er der Mutter noch die Hand, aber mich beachtete er nicht mehr, er hatte mich, wie er glaubte, viel zu sehr zerschmettert, um mich noch eines Abschiedsgrußes für wert zu halten. Er verbot der Mutter noch, ihn hinunterzubegleiten, er kenne den Weg, und verbat sich als allerletztes jeden Dank. Sie solle erst einmal die Wirkung seines Eingriffs abwarten, bevor sie sich bedanke. »Operation gelungen, Patient tot«, hieß es noch. Das war ein Witz, der den Ernst des Vorherigen mildern sollte. Dann war es vorbei.
»Er hat sich sehr verändert, in Arosa war er anders«, sagte die Mutter. Sie war verlegen und schämte sich. Es war ihr klar, daß sie sich schwerlich einen schlechteren Bundesgenossen für ihre neuen Erziehungspläne hätte aussuchen können. Ich aber hatte, noch während Herr Hungerbach sprach, einen furchtbaren Verdacht geschöpft, der mich peinigte und mit Stummheit schlug. Es dauerte lange, bis ich imstande war, damit herauszurücken. Indessen berichtete die Mutter allerhand über Herrn Hungerbach, wie er früher war, noch vor einem Jahr. Zu meinem Staunen betonte sie – zum erstenmal – seine Gläubigkeit. Einige Male habe er ihr damals davon gesprochen, wieviel ihm sein Glaube bedeute. Er habe gesagt, daß er diesen Glauben seiner Mutter verdanke, nie habe er später darin gewankt, auch in den schwersten Zeiten nicht. Er habe immer gewußt, daß es gut ausgehen werde, und so sei es denn auch gekommen: Da er nie gewankt habe, habe er es so weit gebracht.
Was denn das mit seinem Glauben zu tun habe? fragte ich. »Er hat mir erzählt, wie schlecht es in Deutschland aussieht«, sagte sie, »und daß es immer schlechter werden müsse, bevor es wieder besser werde. Man müsse sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen, anders gehe es eben nicht, für Schwächlinge und Muttersöhnchen sei in einem solchen Notzustand kein Platz.«
»Hat er damals auch schon so geredet?« fragte ich.
»Was meinst du damit?«
»Ich meine, so als ob er immer bellen würde, und ohne dir ins Gesicht zu sehen?«
»Nein, das hat mich jetzt selbst verwundert. Er war damals wirklich anders. Er hat sich nach meinem Befinden erkundigt und gefragt, ob ich Nachricht von dir hätte. Es hat ihm Eindruck gemacht, daß ich oft von dir sprach. Er hat dann sogar zugehört. Einmal, ich erinnere mich genau, hat er geseufzt – stell dir vor, dieser Mensch und seufzen – und gesagt: das sei in seiner Jugend anders gewesen, für solche Feinheiten hätte seine Mutter keine Zeit gehabt, mit 15 oder 16 Kindern, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Ich wollte ihm dein Drama zu lesen geben, er hat es in die Hand genommen, den Titel gelesen und gesagt: ›Junius Brutus – kein schlechter Titel, von den Römern kann man was lernen.‹ « »Wußte er überhaupt, wer das war?« »Ja, stell dir vor, er sagte: ›Das war doch der, der seine Söhne zum Tod verurteilt hat.‹ « »Das war das einzige, was er von der Geschichte gewußt hat. Das hat ihm gefallen, das paßt zu ihm. Aber hat er's gelesen?« »Nein, natürlich nicht, für Literatur hatte er keine Zeit. Er hat immer den Wirtschaftsteil der Zeitung studiert und hat mir zugeredet, nach Deutschland zu übersiedeln: ›Da werden Sie jetzt sehr billig leben können, gnädige Frau, immer billiger!‹ «
»Und deswegen sind wir von Zürich fort und nach Deutschland gezogen?« Ich sagte es mit solcher Erbitterung, daß ich selber erschrak. Es war schlimmer als mein Verdacht. Die Vorstellung, daß sie den Ort, den ich über alles in der Welt liebte, verlassen haben könnte, um anderswo billiger zu leben, empfand ich als tiefste Demütigung. Sie merkte sofort, daß sie zu weit gegangen war, und lenkte ein: »Nein, das nicht. Bestimmt nicht. Der Gedanke mag bei meinen Überlegungen manchmal mitgespielt haben, aber entscheidend war das nicht.« »Und was war entscheidend?« Sie fühlte sich in die Verteidigung gedrängt, und da wir noch unter dem Eindruck des abscheulichen Besuchs standen, tat es ihr gut, mir Rede und Antwort zu stehen, und sich dabei selbst über einiges klarer zu werden.
Sie schien mir unsicher, es war, als ob sie sich abtaste, nach Antworten, die standhielten und nicht auf der Stelle zerflossen. »Er wollte immer mit mir sprechen«, sagte sie, »ich glaube, er mochte mich. Dabei war er respektvoll, und statt Scherze zu machen wie andere Patienten dort, blieb er immer ernst und sprach von seiner Mutter. Das hat wieder mir gefallen. Frauen haben das sonst nicht so gern, weißt du, wenn man sie mit seiner Mutter vergleicht, weil sie das älter macht. Mir gefiel das, weil ich spürte, daß er mich ernst nahm.« »Aber du machst doch jedem Eindruck, weil du schön und gescheit bist.« Das dachte ich wirklich, sonst hätte ich's in diesem Augenblick nicht gesagt, nach Freundlichkeiten war mir nicht zumute, im Gegenteil, ich spürte einen schrecklichen Haß, ich war endlich dem auf der Spur, was ich seit dem Tod des Vaters als den schwersten Verlust empfand: dem Fortgang von Zürich.
»Er hat mir immer wieder gesagt, daß ich unverantwortlich bin, weil ich dich als Frau allein erzogen habe. Du müßtest die starke Hand eines Mannes fühlen. Aber jetzt ist es schon so, pflegte ich zu antworten, woher einen Vater nehmen und nicht stehlen? Eben um mich ganz euch zu widmen, habe ich nicht wieder geheiratet, und jetzt bekam ich zu hören, daß das schlecht für euch gewesen sei: das Opfer, das ich euch gebracht hatte, müsse zu eurem Unglück ausschlagen. Ich bin darüber sehr erschrocken. Jetzt glaube ich, er wollte mich erschrecken, um mir Eindruck zu machen, geistig war er nicht sehr interessant, weißt du, er hat immer dieselben Sachen gesagt, aber mit dir hat er mich erschreckt und dann auch gleich seine Hilfe angeboten. ›Kommen Sie nach Deutschland, gnädige Frau‹, hat er gesagt, ›ich bin ein vielbeschäftigter Mann, ich habe überhaupt keine Zeit, nicht eine Minute, aber ich werde mich Ihres Sohnes annehmen, kommen Sie zum Beispiel nach Frankfurt, ich werde Sie besuchen und ein ernstes Wort mit ihm reden. Der weiß noch nicht, wie es in der Welt zugeht. Bei uns werden ihm die Augen aufgehen. Ich nehm ihn mir einmal vor, aber gründlich, und dann werden Sie ihn ins Leben werfen! Der hat genug studiert, Schluß mit den Büchern! Der wird nie ein Mann! Wollen Sie ein Weib zum Sohn haben?‹«
Die Herausforderung
Rainer Friedrich war ein großer, verträumter Junge, der beim Gehen kaum daran dachte, wie und wohin er ging, es hätte einen nicht verwundert, wenn er mit dem rechten Bein in die eine und mit dem linken in eine andere Richtung ausgeschritten wäre. Er war nicht etwa schwach, aber an körperlichen Dingen ganz uninteressiert und darum auch der schlechteste Turner in der Klasse. Er war immer in Gedanken, und zwar waren es Gedanken von zweierlei Art. Seine eigentliche Begabung war die Mathematik, er hatte darin eine Leichtigkeit, wie ich sie noch nie erlebt hatte. Ein Problem schien noch kaum gestellt, da hatte er es schon gelöst; man hatte noch nicht vollkommen begriffen, worum es ging, da kam schon seine Antwort. Aber er trumpfte damit nicht auf, es kam leise und natürlich, es war, als übersetze er fließend von einer Sprache in die andere. Es kostete ihn keine Anstrengung, die Mathematik erschien wie seine Muttersprache. Mich überraschte beides: die Leichtigkeit und daß er sich nichts darauf zugute hielt. Es war nicht nur ein Wissen, es war ein Können, das er immer, in jeder Verfassung vorzuführen bereit war. Ich fragte ihn, ob er auch im Schlaf Formeln lösen könne, und er überlegte ernsthaft und sagte dann schlicht: »Ich glaube schon.« Ich war von größtem Respekt für sein Können erfüllt, beneidete ihn aber nicht. Es war unmöglich, über etwas so Einzigartiges Neid zu empfinden, schon daß es so staunenswert war, daß es einem Wunder glich, hob es weit über die Region jedes niederen Neides empor. Wohl aber beneidete ich ihn um seine Bescheidenheit. »Das ist doch ganz leicht«, pflegte er zu sagen, wenn man der Bewunderung über eine traumwandlerische Lösung Ausdruck gab, »das kannst du auch.« Er benahm sich so, als glaube er wirklich daran, daß man alles wie er könne, als wolle man nur nicht recht, eine Art schlechter Wille, den er aber nie zu erklären versuchte, es sei denn aus religiösen Gründen.
Denn das zweite, womit seine Gedanken beschäftigt waren, war von der Mathematik himmelweit entfernt, es war sein Glaube. Er ging in den Bibelkreis, er war gläubiger Christ. Er wohnte in meiner Nähe, wir gingen zusammen von der Schule nach Haus, und er gab sich Mühe, mich zu seinem Glauben zu bekehren. Das war mir in der Schule noch nie passiert. Er versuchte es nicht mit Argumenten, es war nie eine Diskussion, von der strengen Schlüssigkeit seines mathematischen Denkens war darin keine Spur. Es war eine freundliche Aufforderung, der immer mein Name voranging, wobei er einen fast beschwörenden Ton auf das »E« der Anfangssilbe legte. »Élias«, so pflegte er etwas gedehnt zu beginnen, »versuch es, auch du kannst glauben. Du mußt es nur wollen. Es ist ganz einfach. Christus ist auch für dich gestorben.« Er hielt mich für verstockt, denn ich antwortete nicht. Er nahm an, daß es das Wort ›Christus‹ sei, das mir widerstrebe. Wie hätte er wissen können, daß ›Jesus Christ‹ mir in früher Kindheit sehr nah gekommen war, in jenen wunderbaren englischen Hymnen, die wir mit unserer Gouvernante zusammen sangen. Was mich abstieß, was mich mit Stummheit schlug, was mich entsetzte, war nicht der Name, den ich, vielleicht ohne es zu wissen, immer noch in mir trug, sondern daß er auch für mich gestorben sei. Mit dem Wort ›sterben‹ hatte ich mich nie ausgesöhnt. Daß jemand für mich gestorben sein sollte, hätte mich mit den furchtbarsten Schuldgefühlen beschwert, so als sei ich der Nutznießer eines Mordes. Wenn es etwas gab, das mich von Christus ferngehalten hatte, so war es diese Vorstellung eines Opfers, ein Lebensopfer, das zwar für alle, aber auch für mich dargebracht worden sei.
Einige Monate bevor das geheime Hymnensingen in Manchester begann, hatte ich in den Religionsstunden mit Mr. Duke von Abrahams Opfer seines Sohnes Isaak erfahren. Ich bin nie darüber hinweggekommen, und wenn es nicht so lächerlich klingen würde, möchte ich sagen: bis zum heutigen Tage nicht. Es hat den Zweifel am Befehl in mir geweckt, der nie wieder eingeschlafen ist. Es allein hat genügt, mich davon abzuhalten, zum gläubigen Juden zu werden. Der Kreuzestod Christi, obwohl selbstgewollt, hatte eine nicht weniger verstörende Wirkung auf mich, denn es bedeutet, daß der Tod, zu welchem Zwecke immer, eingesetzt wird. Friedrich, der das Beste für seine Sache zu sagen glaubte und jedesmal mit Wärme in seiner Stimme aussprach, daß Christus anch für mich gestorben sei, ahnte nicht, wie vollkommen er seine Sache bei mir mit diesem Satz zerstörte. Vielleicht deutete er mein Schweigen falsch und nahm es für Unschlüssigkeit. Denn es wäre sonst schwer zu fassen gewesen, daß er jeden Tag auf dem Heimweg von der Schule denselben Satz wiederholte. Seine Hartnäckigkeit war erstaunlich, aber ärgerlich war sie nie, denn immer spürte ich, daß sie einer guten Gesinnung entsprang: Er wollte mir das Gefühl geben, daß ich von dieser besten Sache, die er hatte, nicht ausgeschlossen sei, daß ich ebensogut wie er dazugehören könne. Auch war seine Sanftmut entwaffnend: Er schien sich über mein Schweigen in diesem Punkte nie zu ärgern, wir redeten ja über vieles, und es ging zwischen uns keineswegs schweigsam zu; er runzelte nur die Stirn, so als wundere er sich darüber, daß dieses einzige Problem so schwer zu lösen sei, sagte mir noch beim Abschied, wenn er mir, vor seinem Hause angelangt, die Hand gab: »Überleg's dir, Elias« – auch das mehr bittend als nachdrücklich –, und stolperte ins Haus hinein.
Ich wußte, daß unser Heimweg jedesmal mit seinem Bekehrungsversuch enden würde, und gewöhnte mich daran. Aber erst allmählich erfuhr ich von einer ganz anderen Stimmung, die neben der christlichen und ihr ganz entgegengesetzt, bei ihm zu Hause herrschte. Er hatte einen jüngeren Bruder, der auch in der Wöhlerschule war, zwei Klassen unter uns. Sein Name ist mir entfallen, vielleicht weil er mir so scharf entgegentrat und mich mit unverhohlener Feindseligkeit behandelte. Der war nicht ganz so groß, aber ein guter Turner, der sehr wohl wußte, was er mit seinen Beinen tat. Er war so sicher und entschlossen wie Rainer unbestimmt und verträumt. Sie hatten dieselben Augen, aber während der Ältere einen immer fragend, abwartend und menschenfreundlich ansah, war im Blick des jüngeren Bruders etwas Kühnes, Streitlustiges und Herausforderndes. Ich kannte ihn nur vom Sehen, nie hatte ich ein Gespräch mit ihm gehabt, aber von Rainer erfuhr ich brühwarm, was er über mich gesagt hatte.
Es war immer etwas Unangenehmes oder Beleidigendes. »Mein Bruder sagt, daß du Kahn heißt und nicht Canetti. Er will wissen, warum ihr euren Namen geändert habt.« Diese Zweifel kamen immer vom Bruder, in seinem Namen wurden sie ausgesprochen. Rainer wollte meine Antworten darauf, um den Bruder zu widerlegen. Er hing sehr an ihm, ich glaube, er mochte auch mich, und so mag er es als einen Vermittlungs- und Friedensversuch betrachtet haben, daß er mir jede gehässige Äußerung hinterbrachte. Ich sollte sie widerlegen, meine Antworten hinterbrachte er alle dem Bruder, aber er irrte sich sehr, wenn er an eine Versöhnungsmöglichkeit glaubte. Auf unserem Heimweg war das erste, was ich von Rainer zu hören bekam, eine neue Verdächtigung und Beschuldigung seines Bruders. Sie waren alle so unsinnig, daß ich sie nicht ernst nahm, obwohl ich sie gewissenhaft beantwortete. Ihr Hauptinhalt ging immer in dieselbe Richtung, daß auch ich, wie alle Juden, zu verbergen suche, daß ich einer sei. Es war offenkundig, daß das nicht der Fall war, und wurde noch offenkundiger, wenn ich wenige Minuten später den obligaten Bekehrungsversuch Rainers mit Schweigen beantwortete.
Vielleicht war es die Unbelehrbarkeit des Bruders, was mich zu geduldigen und ausführlichen Antworten zwang. Rainer teilte mir alles, was von seinem Bruder kam, sozusagen in Klammern mit. Er gab es tonlos weiter, ohne Stellung dazu zu nehmen. Er sagte nicht: »Ich glaube das auch« oder: »Ich glaube das nicht«, er gab seinen Auftrag weiter, als ginge er durch ihn durch. Hätte ich diese Verdächtigungen, die unerschöpflich waren, im aggressiven Ton des Bruders gehört, ich wäre zornig gewesen und hätte sie nie beantwortet. So aber kamen sie in vollkommener Ruhe, voran ging immer: »mein Bruder sagt« oder: »mein Bruder fragt«, und dann kam etwas so Ungeheuerliches, daß es mich zum Reden zwang, ohne daß es mich eigentlich wirklich aufgeregt hätte, denn es war so unsinnig, daß einem der Fragesteller leid tat. »Elias, mein Bruder fragt: Warum habt ihr Christenblut für das Pessach-Fest gebraucht?«, und wenn ich die Antwort gab: »Nie. Nie. Ich habe doch Pessach als Kind erlebt. Ich hätte doch etwas gemerkt. Wir hatten viele christliche Mädchen im Haus, das waren meine Spielgefährten« – so kam am nächsten Tag als nächste Botschaft des Bruders: »Jetzt vielleicht nicht. Jetzt ist es zu gut bekannt. Aber früher, warum haben die Juden früher Christenkinder für ihr Pessach-Fest geschlachtet?« Jede der alten Beschuldigungen wurde ausgekramt: »Warum haben die Juden die Brunnen vergiftet?« Wenn ich zur Antwort gab: »Das haben sie nie getan«, so hieß es: »Doch, zur Pestzeit.« »Aber sie starben doch genauso wie die anderen an der Pest.« »Weil sie die Brunnen vergiftet haben. Ihr Haß gegen die Christen war so groß, daß sie an ihrem Haß selber mit zugrunde gingen.« »Warum verfluchen die Juden alle anderen Menschen?« »Warum sind die Juden feig?« »Warum waren keine Juden im Krieg an der Front?«
So ging es weiter, meine Geduld war unerschöpflich, ich antwortete, so gut ich konnte, immer ernsthaft, nie beleidigt, als hätte ich in meinem Lexikon nachgeschlagen, um die wissenschaftliche Wahrheit zu erfahren. Ich nahm mir vor, solche Beschuldigungen, die völlig absurd erschienen, durch meine Antworten aus der Welt zu schaffen, und um es Rainer an Gemütsruhe gleichzutun, sagte ich einmal zu ihm: »Sag deinem Bruder, daß ich ihm für seine Fragen dankbar bin. So kann ich diese Dummheiten ein für allemal aus der Welt schaffen.« Da wunderte sich sogar der gutgläubige, unschuldige und redliche Rainer. »Das wird schwer sein«, sagte er, »er kommt immer mit neuen Fragen.« Der Unschuldige aber war in Wirklichkeit ich, denn ich merkte während mehrerer Monate nicht, worauf es der Bruder abgesehen hatte. Eines Tages sagte Rainer: »Mein Bruder fragt dich, warum du seine Fragen immer beantwortest. Du kannst ihn doch auf dem Schulhof in der Pause stellen und zum Kampf herausfordern. Du kannst dich doch mit ihm schlagen, wenn du keine Angst vor ihm hast!«
Es wäre mir nie eingefallen, Angst vor ihm zu haben. Ich empfand nur Mitleid für ihn, wegen seiner unsäglich dummen Fragen. Er aber hatte mich herausfordern wollen und wählte den sonderbaren Weg über seinen Bruder, der in dieser ganzen Zeit an keinem einzigen Tage von seinen Bekehrungsversuchen abließ. Das Mitleid schlug nun in Verachtung um, die Ehre einer Herausforderung tat ich ihm nicht an, er war zwei Jahre jünger als ich, es hätte mir schlecht angestanden, mich mit einem Jungen herumzuschlagen, der in eine tiefere Klasse ging. So schnitt ich diesen ganzen ›Verkehr‹ mit ihm ab. Als Rainer das nächste Mal anfing: »Mein Bruder läßt sagen?…«, unterbrach ich ihn mitten im Satz und sagte: »Dein Bruder soll sich zum Teufel scheren. Mit kleinen Buben schlage ich mich nicht.« Es blieb aber bei unserer Freundschaft, auch an den Bekehrungsversuchen änderte sich nichts.
Das Porträt
Hans Baum, mit dem ich mich zuerst befreundete, war der Sohn eines Ingenieurs von den Siemens-Schuckert-Werken. Er war ein sehr förmlicher Mensch, von seinem Vater zu Disziplin erzogen, darauf bedacht, sich nie etwas zu vergeben, immer ernst und gewissenhaft, ein guter Arbeiter, nicht sehr beschwingt, aber dafür bemüht. Er las gute Bücher und ging in die Saalbaukonzerte, es gab immer etwas, worüber wir sprechen konnten. Ein unerschöpfliches Thema war Romain Rolland, besonders sein ›Beethoven‹ und der ›Jean Christophe‹. Baum wollte aus einer Art von Verantwortungsgefühl für die Menschheit Arzt werden, was mir sehr an ihm gefiel. Über Politik machte er sich wohl Gedanken, sie waren gemäßigter Art, alles Extreme lehnte er instinktiv ab, er war so beherrscht, daß er wirkte, als ob er immer in einer Uniform stecke. In seinen jungen Jahren schon bedachte er jede Sache von allen Seiten, »aus Gerechtigkeit«, wie er sagte, vielleicht aber noch mehr, weil ihm Unbedachtheit zuwider war.
Als ich ihn zu Hause besuchte, staunte ich darüber, wie temperamentvoll der Vater war, ein heftiger Spießer mit tausend Vorurteilen, die er unaufhörlich äußerte, gutmütig, unbedacht, zu Späßen aufgelegt, seine tiefste Zuneigung galt Frankfurt. Ich kam noch manchmal zu Besuch, jedesmal las er aus seinem Lieblingsdichter, Friedrich Stoltze, vor. »Das ist der größte Dichter«, sagte er, »wer den nicht leide mag, gehört erschosse.« Die Mutter von Hans Baum war schon vor Jahren gestorben, der Haushalt wurde von seiner Schwester geführt, einer heiteren, trotz ihrer Jugend schon etwas behäbigen Person.
Die Korrektheit des jungen Baum war etwas, das mich beschäftigte. Er hätte sich eher die Zunge abgebissen als eine Lüge gesagt. Feigheit war in seiner Welt eine Sünde, vielleicht sogar die größte. Wenn ein Lehrer ihn zur Rede stellte – was nicht häufig geschah, er war einer der besten Schüler –, so gab er, unbekümmert um die Folgen für sich, eine vollkommen offene Antwort. Wenn es nicht um ihn selber ging, war er ritterlich und deckte Kameraden, aber ohne zu lügen. Wurde er aufgerufen, so stand er kerzengrad auf, er hatte von allen in der Klasse die steifste Haltung, und knöpfte sich entschlossen, aber gemessen, den Rock zu. Es wäre ihm unmöglich gewesen, in einer öffentlichen Situation mit nicht zugeknöpftem Rock zu erscheinen, vielleicht war das der Grund, warum man bei ihm häufig an eine Uniform dachte. Es war gegen Baum wirklich nichts einzuwenden, er war schon früh ein integrer Charakter und keineswegs dumm, aber er blieb sich immer gleich, jede seiner Reaktionen war vorauszusehen, man wunderte sich nie über ihn, höchstens darüber, daß es bei ihm nie etwas zu verwundern gab. In Ehrendingen war er mehr als empfindlich. Als ich ihm, ziemlich viel später, von dem Spiel erzählte, das Friedrichs Bruder sich mit mir erlaubt hatte, verlor er die Fassung – er war Jude – und fragte mich allen Ernstes, ob er ihn jetzt noch stellen solle. Er begriff weder die lange, geduldige Periode meiner Antworten noch die spätere komplette Verachtung, die ich ihm bewies. Die Sache beunruhigte ihn, er hatte das Gefühl, daß bei mir etwas nicht ganz in Ordnung sein könne, weil ich so lange darauf eingegangen war. Da ich ihm nicht erlaubte, irgend etwas Direktes in meinem Namen zu unternehmen, ging er der Sache nach und fand heraus, daß Friedrichs verstorbener Vater geschäftlich in Schwierigkeiten geraten war, wobei Konkurrenten von ihm, Juden, ihre Hand mit im Spiel gehabt hätten. Die Einzelheiten verstand ich nicht, wir erfuhren sie auch nicht genau genug, um sie zu verstehen. Aber er war bald darauf gestorben, und nun begann ich zu begreifen, wie es in der Familie zu diesem blinden Haß gekommen war.
Felix Wertheim war ein temperamentvoller, lustiger Junge, dem es ziemlich gleichgültig war, ob und wieviel er lernte, denn während der Unterrichtsstunden war er damit beschäftigt, die Lehrer zu studieren. Keine Eigentümlichkeit eines Lehrers entging ihm, er erlernte sie alle wie Rollen, wobei er besonders ergiebige Lieblinge hatte. Sein eigentliches Opfer war Krämer, der cholerische Lateinlehrer, den er so perfekt spielte, daß man ihn vor sich zu haben meinte. Einmal während einer solchen Vorführung betrat Krämer unerwartet früh die Klasse und fand sich plötzlich mit sich selbst konfrontiert. Wertheim war so sehr in Rage geraten, daß er nicht mehr aufhören konnte, und so beschimpfte er Krämer, als wäre er der Falsche und maße sich unverschämterweise seine Rolle an. Ein oder zwei Minuten setzte sich die Szene fort, die zwei standen sich gegenüber, starrten einander ungläubig an und schimpften, wie es Krämers Art war, auf die unflätigste Weise weiter. Die Klasse erwartete das Schlimmste, aber nichts geschah – Krämer, den cholerischen Krämer, kam das Lachen an, er hatte Mühe, es zu unterdrücken. Wertheim sank auf seine Bank zurück, er saß in der ersten Reihe, über Krämers unverkennbarer Lust zum Lachen war ihm sein eigenes vergangen. Die Sache wurde nie erwähnt, es kam zu keiner Strafe, Krämer fühlte sich durch die vollkommene Treue des Porträts geschmeichelt und war unfähig, etwas gegen sein Abbild zu unternehmen.
Wertheims Vater war Inhaber eines großen Konfektionsgeschäfts, er war reich und nicht daran interessiert, seinen Reichtum zu verbergen. Zu Silvester waren wir bei ihm eingeladen, und da fanden wir uns in einer großen Wohnung voller Liebermanns. In jedem Zimmer hingen gleich fünf oder sechs Liebermanns, ich glaube nicht, daß es andere Bilder gab. Der Clou der Sammlung war ein Porträt des Hausherrn. Man wurde gut bewirtet, es ging protzig zu, der Hausherr zeigte ohne Scheu auf sein Porträt und sprach, für alle vernehmlich, von seiner Freundschaft mit Liebermann. Ich sagte, nicht weniger laut, zu Baum: »Er ist ihm zu seinem Porträt gesessen, drum ist er noch lange nicht sein Freund.«
Der Anspruch dieses Mannes auf die Freundschaft mit Liebermann irritierte mich, schon die Vorstellung, daß ein großer Maler sich mit diesem gewöhnlichen Gesicht befaßt hatte. Das Vorhandensein des Porträts störte mich mehr als das Vorhandensein des Porträtierten. Ich sagte mir, wieviel schöner die Sammlung wäre, wenn es dieses Bild darin nicht gäbe. Es war nicht möglich, darum herumzukommen, alles war darauf angelegt, daß man's sah. Auch mit meiner unhöflichen Äußerung war es nicht aus der Welt geschafft, außer Baum hatte niemand sie beachtet.
In den Wochen danach kam es darüber zu einer hitzigen Diskussion zwischen uns. Ich stellte Baum die Frage: Mußte ein Maler jeden malen, der mit einem Porträt-Auftrag zu ihm kam? Durfte der Maler nein sagen, wenn ihm der zu Porträtierende als Gegenstand seiner Kunst nicht lag? Baum meinte, der Maler müsse annehmen, es bleibe ihm die Möglichkeit, seine Meinung über den Porträtierten durch die Art des Bildes zu bekunden. Zu einem häßlichen oder abstoßenden Porträt habe er jedes Recht, das liege im Bereiche seiner Kunst, ein Nein im vorhinein wäre aber ein Zeichen der Schwäche, es würde bedeuten, daß er seiner Fähigkeiten nicht sicher sei. Das klang gemessen und gerecht, meine Maßlosigkeit, das fühlte ich, stach unangenehm dagegen ab.
»Wie kann er malen«, sagte ich, »wenn ihn der Ekel über eine Visage schüttelt? Wenn er sich rächt und das Gesicht des Sitzers entstellt, so ist es nicht mehr ein Porträt. Dazu hätte ihm der nicht sitzen brauchen, das hätte er auch ohne ihn gekonnt. Nimmt er aber Bezahlung für diese Verhöhnung des Opfers an, so hat er sich für Geld zu etwas Niedrigem hergegeben. Das könnte man einem armen Teufel nachsehen, der hungert, weil ihn noch niemand kennt. Aber bei einem berühmten und gesuchten Maler ist es unverzeihlich.«
Baum waren rigorose Maßstäbe nicht unsympathisch, aber er war an der Moral der anderen weniger interessiert als an der eigenen. Man könne nicht von jedem erwarten, daß er wie Michelangelo sei, es gebe auch abhängige und weniger stolze Naturen. Ich fand, es sollte nur stolze Maler geben, wer das Zeug dazu nicht in sich habe, der könne ja einem gewöhnlichen Gewerbe nachgehen. Aber Baum gab mir noch etwas Wichtiges zu bedenken.
Was ich mir denn eigentlich unter einem Porträtisten vorstelle? Solle er Menschen darstellen, wie sie sind, oder solle er Idealbilder von ihnen malen? Für Idealbilder brauche man doch keine Porträtisten! Jeder Mensch sei, wie er sei, und eben das habe der Maler, dem er sitze, festzuhalten. So wisse man dann später auch, was es alles für Menschen gegeben habe.
Das leuchtete mir ein, und ich gab mich geschlagen. Aber es blieb mir ein Unbehagen über die Beziehung von Malern zu ihren Mäzenen. Ich wurde den Verdacht nicht los, daß die Mehrzahl aller Porträts als Schmeicheleien zu gelten hätten und darum nicht ernst zu nehmen seien. Vielleicht war das auch einer der Gründe, warum ich mich um diese Zeit mit solcher Entschiedenheit auf die Seite der Satiriker schlug. George Grosz wurde mir so wichtig wie Daumier, die Verzerrung, die satirischen Absichten diente, gewann mich vollkommen, ich verfiel ihr widerstandslos, als wäre sie die Wahrheit.