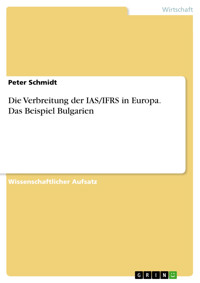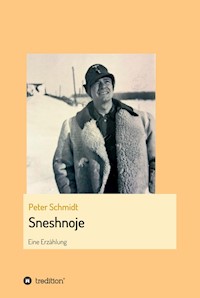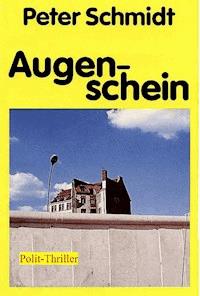
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nahe der Mauer mit Blick auf den Todesstreifen existiert eine geheime Dienststelle, die sich mit Überläufern aus dem Osten befasst. Dissidenten, die nicht unbedingt das sein müssen, was sie vorgeben zu sein … Todesurteil? –– "Sie wissen ja: Es sind einnehmende Burschen, die man uns herüberschickt. Keiner darunter, dem man seine dunklen Absichten ansieht, und je mehr wir von ihnen abfangen, desto gerissener werden sie." PRESSESTIMMEN: "Ein wirklich hübsches Stück Agentengeschichte." (zitty-Magazin) –– "Der einzige deutsche Autor von Polit-Thrillern, den man ernst nehmen muss." (Krimikritiker Rudi Kost) –– "Die Spannung ist ganz nach innen verlegt: ein leises, böses Buch von hoher Sprengkraft." (Jochen Schmidt, FAZ)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Schmidt
Augenschein
Agententhriller
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
ZUM BUCH
PRESSESTIMMEN
ÜBER DEN AUTOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
WEITERE TITEL
Impressum neobooks
ZUM BUCH
West-Berlin in der „heißesten“ Phase des Kalten Krieges: der zwielichtigen Existenzen, falschen Freunde, getürkten Überläufer und trojanischen Pferde … Wem kann man noch trauen, wem nicht? Nahe der Mauer mit Blick auf den Todesstreifen existiert eine geheime Dienststelle, die sich mit Überläufern aus dem Osten befasst. Dissidenten, die nicht unbedingt das sein müssen, was sie vorgeben zu sein … Todesurteil?
„Sie wissen ja: Es sind einnehmende Burschen, die man uns herüberschickt. Keiner darunter, dem man seine dunklen Absichten ansieht, und je mehr wir von ihnen abfangen, desto gerissener werden sie.“
Überarbeitete, erweiterte Neuausgabe der gedruckten Fassung im Ullstein Verlag, Berlin
PRESSESTIMMEN
„Der einzige deutsche Autor von Polit-Thrillern, den man ernst nehmen muss.“
(Krimikritiker Rudi Kost)
„Die Spannung ist ganz nach innen verlegt: ein leises, böses Buch von hoher Sprengkraft.“ (Jochen Schmidt, FAZ)
„Ein wirklich hübsches Stück Agentengeschichte.“
(zitty-Magazin)
„Seine Geschichten aus der Welt der Geheimdienste sollte man sich heute, mit dem NSU-Desaster der Sicherheitsbehörden im Hinterkopf, noch einmal durchlesen!“
(„Kriminalakte“, Axel Bussmer)
„Gleich mit dem ersten Satz wird der Leser eingestimmt: ‚Ich nahm an, dass man Kofler auf die übliche – unauffällige – Weise beseitigen würde, beginnt ein skrupelbehafteter Ich-Erzähler’ (...) den Bericht über seine Tätigkeit für einen deutschen Geheimdienst. Der ehemalige, verkrachte Staatsanwalt Cordes prüft bei Überläufern aus dem Ostblock, ob sie eingeschleuste Agenten sein könnten.“
(Jochen Schmidt, „Gangster, Opfer, Detektive“, Ullstein Verlag)
„Damit tritt – ungewöhnlich für den Thriller – die Rätselspannung in den Vordergrund. Wie der Titel „Augenschein“ bereits suggeriert, verfolgt der Protagonist das Ziel „einer nie erreichbaren Gewissheit nachzujagen, das war schon meine Profession als Staatsanwalt gewesen, um hinter dem „Augenschein“lichen das zu sehen, was wirklich war“.
(Christina Rühl, „Jenseits von Schuld und Sühne“)
ÜBER DEN AUTOR
Peter Schmidt, geboren im westfälischen Gescher, Schriftsteller und Philosoph, gilt selbst dem Altmeister des Spionagethrillers, John le Carré, als einer der führenden deutschen Autoren des Spionageromans und Politthrillers. Darüber hinaus veröffentlichte er Kriminalkomödien, aber auch Medizinthriller (zuletzt „Endorphase-X“), Wissenschaftsthriller, Psychothriller und Detektivromane.
Bereits dreimal erhielt er den DEUTSCHEN KRIMIPREIS („Erfindergeist“, „Die Stunde des Geschichtenerzählers“ und „Das Veteranentreffen“). Für sein bisheriges Gesamtwerk wurde er mit dem Literaturpreis Ruhr ausgezeichnet.
Schmidt studierte Literaturwissenschaft und sprachanalytische und phänomenologische Philosophie mit Schwerpunkt psychologische Grundlagentheorie an der Ruhr-Universität Bochum und veröffentlichte rund 40 Bücher, darunter auch mehrere Sachbücher.
1
Gott scheint durch dich ein paar
negative Dinge auszuprobieren.
Dich hat er dazu ausersehen.
Was kannst du schon dagegen tun?
B.S.R.
Ich nahm an, dass man Kofler auf die übliche unauffällige Weise beseitigen würde. Er war schuldig wie all die anderen vor ihm. Aber ich wusste nicht, wie es geschehen sollte. Und ich war auch nicht sonderlich interessiert daran, es zu erfahren.
»Es belastet Sie nur«, meinte F., meine Kontaktperson und der einzige Vorgesetzte, von dem ich Weisungen entgegennahm. »So was ist nichts für Ihre schwachen Nerven …«
Er hielt es für zweckmäßiger, mich über Einzelheiten der Hinrichtungen – er sagte Hinrichtung, nicht Mord – als handele es sich um die Vollstreckung eines rechtskräftigen Urteils – im Unklaren zu lassen.
Ich erfuhr nicht mal, ob die Schuldsprüche, die auf der Grundlage meiner Ermittlungsarbeit gefällt wurden, tatsächlich immer die »äußerste Konsequenz« (wie F. es gelegentlich abschwächend nannte) nach sich zogen.
»Das alles verursacht nur böse Träume«, lachte er. »Die Tatsache dass und das Wissen wie sie umkommen, könnte Sie entscheidende Fakten in anderem Licht sehen lassen, weniger eindeutig, weniger gewiss. Gefühle, der menschliche Faktor – verstehen Sie?
Schreiben Sie nur weiter Ihre Berichte. Durchforsten Sie ihre Lebensgeschichte.
Kommen Sie ihnen auf die Schliche, entlarven Sie ihre Tricks und Täuschungsmanöver, durchschauen Sie ihre geheimen Absichten, die Pläne, die man drüben für sie ausgearbeitet hat. Sie sind ja Spezialist darin. Finden Sie heraus, auf welche Weise sie unserem Staat schaden wollen. Das ist alles. Den Rest erledigen wir.«
In den vergangenen Jahren hatte ich dreizehn Fälle für F. bearbeitet – alle zu seiner Zufriedenheit, wie er mir immer wieder versicherte …
Aber nur ein einziges Mal hatte ich miterlebt, wie jemand dabei ums Leben gekommen war. Ein magerer weißhaariger Kerl, der versuchte, über die Mauer an der Bellevuestraße in den Ostsektor zurückzuklettern.
Er trug einen blau-weiß gestreiften Krankenhausanzug der billigsten Sorte, wie er Patienten gestellt wird, wenn man gerade von drüben gekommen und auf alles andere gefasst ist als auf einen Krankenhausaufenthalt. Also eher auf die Ausstellung eines Reisepasses und der Papiere, die man im Westen benötigt, oder die Prozedur der Flüchtlingsaufnahme, die üblichen bürokratischen Hürden und Befragungen.
Ich bog gerade vom Kemperplatz ein, wo ein Kiosk war, an dem ich Zigaretten und Tageszeitungen kaufte – einer meiner wenigen Kontakte zur »Außenwelt« –, wenn ich aus der Privatwohnung kam.
Er saß rittlings auf dem Rohrkranz der Betonmauer, etwa fünfzig Schritte entfernt und sah ziemlich verwirrt aus! Sein weißes Haar war strähnig und ungekämmt und seine Gestalt wirkte irgendwie kränklich, leidend, während er – geblendet vom plötzlichen Scheinwerferkegel des Wachturms im Ostsektor – abwehrend seine Arme hochriss …
… und dabei schwankte, als würde er jeden Moment das Gleichgewicht verlieren …
Ich sah, dass er beim Hinaufklettern einen seiner beiden Pantoffel verloren hatte. Dicht an der Mauer unter ihm parkte ein offener VW-Transporter mit Farbeimern und einer Anstreicherleiter, die von der Ladefläche aus gegen den Mauerkranz lehnte. Die Mauer war hier an der schräg abfallenden Straße höher als weiter hinten, aber die Leiter hatte es ihm trotzdem ermöglich, ohne Probleme auf den Mauerkranz zu steigen.
Passanten, Frauen mit Einkaufstaschen und ein bärtiger junger Mann, der einen Kinderwagen voller leerer Bierkästen schob, ermunterten ihn von der gegenüberliegenden Straßenseite mit Winken und Zurufen. Aus einem Wohnungsfenster über mir rief jemand:
»Spring endlich, alter Narr …«
– und eine Frauenstimme antwortete aus der Tiefe des Zimmers mit heiserem Lachen …
Es war Herbst. Die Blätter waren gelb und fielen von den Bäumen. Passend dazu las ich gerade Willliam Smith‘s Oden an den Herbst (ein fast vergessener irischer Dichter des 17. Jahrhunderts). Aber solche Texte machten mich immer ein wenig depressiv. Trotzdem konnte ich‘s nicht lassen!
Auf den Mann auf der Mauer war ich jedenfalls nicht gut vorbereitet. Offenbar glaubten sie im Wachturm, er käme von drüben. Es war nur natürlich, das anzunehmen. Wer überklettert schon die Mauer von West nach Ost?
Doch das kalte grelle Scheinwerferlicht schloss jeden Zweifel für mich aus – derselbe Mann hatte mir dreißig Tage und Nächte in einer eigens für Verhöre hergerichteten Wohnung an der Luckauer Straße gegenübergesessen. Dreißig Tage und Nächte, die über sein Leben entschieden. Stunden, in denen sich ein Indiz, ein Fehler, ein Hinweis, ein Verdachtsmoment an das andere reihten.
Ich schrieb meinen Bericht, und sein Schicksal war besiegelt.
Ad multos annos …
Auf welche Weise, das erfuhr ich nicht. Angeblich war er ein bulgarischer Dissident – ein Funktionär –‚ den Zweifel an der Realisierbarkeit des sozialistischen Traums befallen hatten und der im Alter von achtundsechzig Jahren (er sah älter aus) zum Kapitalismus konvertiert war.
Eine freche Täuschung, nichts weiter. Er war ein erbärmlicher Schauspieler.
Es verwirrte ihn schon, dass ich ihn fragte, ob ihn der Materialismus des Westens nicht anwidere.
Nach den herübergefunkten Unterlagen bestanden Verdachtsmomente, ihn in jene Kategorie von Überläufern einzustufen, die ein Rechtsstaat zwar akzeptieren sollte, das übergeordnete Interesse der Allgemeinheit jedoch nicht akzeptieren kann (»dem Ideal nach vielleicht, aber nicht in der Wirklichkeit«),wie F. zu beteuern pflegte: jene (durchaus seltenen) Fälle, in denen ein Individuum dem Land voraussichtlich mehr schaden wird, als die moralischen Bedenken gegen seinen Tod wiegen könnten.
Ich hatte das Problem mit F. in den vergangenen Jahren wieder und wieder diskutiert. Er war so etwas wie moralische Aufrüstung, Beichtvater und Psychotherapeut für mich.
Doch nie hat er mich wirklich davon überzeugen können, dass dieses Verfahren durch politische oder weltanschauliche Erwägungen zu rechtfertigen ist.
Ich halte seine Äußerungen, obwohl sie sehr überzeugend vorgetragen werden, für die obskuren Entlastungsversuche eines Schreibtischtäters, dem von höchster Stelle – die immer ungenannt bleibt – angeblich keine Wahl gelassen wird. Die Betonung liegt auf »angeblich«.
Er versucht für mich und den Verein, den er leitet, ein guter Medizinmann zu sein, aber ich habe den Glauben an die wohlmeinenden Götter und Dämonen hinter seinem Pulverdampf und seinen Beschwörungsriten längst verloren.
Trotzdem ist und bleibt er eine beeindruckende Erscheinung, eine mächtige, knapp zwei Meter hohe Gestalt mit kreisrunder, randloser starker Brille und völlig kahlem Kopf, an dem selbst die Spur eines Härchens oder Flaumes fehlt – nicht einmal Augenbrauen besitzt er, und seine Augenlider sind wimpernlos.
Sein Gesicht ist auf eine ungewöhnliche Weise leer, unbestimmt, als gehe die teigige Haut der Wangen konturlos in das Kinn über. Und doch vergisst man es nicht, wenn man es einmal gesehen hat. Er spricht bedächtig, beinahe gesetzt:
»In allen Staaten – vor und hinter dem Eisernen Vorhang – gibt es Institutionen wie die unsrige, die ein Schattendasein führen, von deren Existenz niemand auch nur ahnen darf. Nicht einmal dem Geheimdienst ist die wirkliche Rolle seines Ablegers bekannt.
Ihre Aufgabe ist es, Aufträge von höchstem Staatsinteresse in einer Weise zu lösen, die sich mit rechtsstaatlichen Mitteln nicht erreichen ließen. Glauben Sie denn, Bolijar wäre durch ein ordentliches Gericht verurteilt worden?«
Er erwähnte Bolijar, einen meiner Fälle aus dem ersten Jahr, als ein besonders krasses Beispiel!
»Nein, mit Sicherheit nicht! Und ich schwöre Ihnen in die Hand«, sagte er und legte seine große weiche, ebenso gestaltlose Hand auf die meine, »der Schaden durch ihn wäre so immens gewesen, dass jene Richter, die ihn freisprechen mussten, bei genauerer Kenntnis der Lage die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hätten.«
»Schieben Sie ihn ab«, sagte ich, » – zurück über die Grenze.«
Aber er schüttelte nur unwillig seinen glänzenden Schädel. »Sie wissen so gut wie ich, dass es nur ein Hinauszögern wäre. Wenig später kommen sie mit neuen Leuten und ausgeklügelteren Tricks zurück – nur ihre Ziele bleiben die alten. Herrgott noch mal, Sie waren doch selbst Staatsanwalt und wissen, wie wenig Handhabe wir gegen diese Burschen hätten – in der gewöhnlichen Rechtsfindung zählen Gefühle und Intuitionen nicht.«
Ein Warnschuss knallte herüber … und ich schreckte aus meinen Gedanken auf.
Ich sah das Mündungsfeuer in der Schwärze unter dem Scheinwerfer des Wachturms.
Es war ein trockener, kaum nachhallender Knall, wie von einem frisch geölten Karabiner mit gerade gereinigtem Lauf.
Der Alte auf der Mauer kümmerte sich nicht darum. Nur einmal blickte er – argwöhnisch – in den Westsektor zurück, als ein schweres Motorrad hinter uns durch die Parallelstraße fuhr.
Ich musterte die graue Straße mit ihren hohen alten Häusern – in einigen Fenstern war Licht, und Leute lehnten heraus und sahen zu uns hinunter –, dann überquerte ich mit schnellen Schritten die Fahrbahn, zog mich ein Stück an der Ladefläche des Transporters hoch und versuchte einen Zipfel seines Hosenbeins zu fassen. Ich musste mich recken, um von der Stoßstange aus den Mauerkranz zu erreichen. Er entzog mir sein Bein.
»Um Gottes willen, lassen Sie doch den Unsinn … erkennen Sie mich denn nicht mehr?«
Er warf mir einen unsagbar traurigen Blick zu … melancholischer als Smith‘s Herbst-Oden …
Noch vor wenigen Tagen hatten wir zahllose Gespräche miteinander geführt. An seiner Schuld gab es keinen Zweifel, und er wusste es.
Als habe er meine Gedanken gelesen, hob er nun auch das andere Bein auf die östliche Seite der Mauer. Dann sah er zögernd an der hohen Wand hinunter.
Aus der Richtung des Fahrwegs jenseits des Todesstreifens war das Aufheulen schwerer Motoren zu hören – von Militärfahrzeugen, die dort Stellung bezogen.
Eine Stimme brüllte etwas über Megaphon herüber, das im Lärm unterging.
Ich war nicht einmal sicher, ob sie sich völlig klar darüber waren, in welche Richtung er klettern wollte – in den Osten oder Westen? – und ob er das eine Bein vielleicht nur wieder herübergenommen hatte, weil er zögerte …
Noch mehr Bogenlampen flammten auf und erleuchteten taghell den Himmel über uns. Von fern heulte eine Sirene auf und verstummte wieder.
Der Bulgare wandte langsam den Kopf nach mir … an seinem Blick erkannte ich, dass er zum Sprung entschlossen war. Es bedeutete nichts Geringeres als die »Heimkehr« für ihn …
Und während er über die Mauerkrone rutschte, sich mit beiden Händen in leicht verdrehter Haltung abstieß, um beim Absprung nicht mit Kopf oder Rücken an der Betonmauer anzuschlagen, fiel er – den Bruchteil einer Sekunde lang war es deutlich zu erkennen – in die Kugeln der Salve, die vom Wachturm drüben aus abgegeben wurde …
Ich hörte den Aufprall seines Körpers auf dem Sandboden jenseits der Mauer …
Einen Augenblick lang stand ich wie erstarrt da. Er gab keinen Laut mehr von sich. Verhaltene Stimmen und die Schritte schwerer Stiefel waren vom asphaltierten Fahrweg hinter dem Todesstreifen zu hören. Ich überquerte eilig die Straße, um nicht in ein Verhör mit der Westberliner Polizei verwickelt zu werden, die jetzt bald auftauchen würde.
Als ich in die Potsdamer Straße einbog, entdeckte ich den schwarzen Mercedes …
Er parkte einsam im Schatten des Eckhauses unter einer ausgeschalteten Straßenlaterne.
Während ich auf ihn zuging, rollte er langsam vor, und als er wendete, erkannte ich F.s kahlen bebrillten Schädel durch die Windschutzscheibe. Er saß auf dem Beifahrersitz und wandte den Kopf ab, als er mich sah. Dann fuhr der Wagen in Richtung Moabit davon.
Am nächsten Morgen entdeckte ich in der Zeitung eine Notiz über den Zwischenfall. Einen mageren Sechszeiler, in dem es hieß, der Bulgare habe abends »gegen 22 Uhr aus bisher ungeklärten Gründen« die psychiatrische Abteilung des Wilmersdorfer Krankenhauses verlassen.
Ein ärgerlicher Lapsus für F., dachte ich, denn auf Publicity konnte er nicht versessen sein.
Aber als ich ihn am Nachmittag traf, zeigte er sich erstaunlich gelassen. Er saß mir an seinem großen, unaufgeräumten Schreibtisch in der Zentrale gegenüber, die, seit ich ihn kannte, immer im Begriff war, wegen der angeblichen Gefahr der Enttarnung verlegt zu werden, kaute wie gewöhnlich Weingummibärchen und zeigte nicht die Spur einer Verunsicherung. Angeblich hatte man ihn gerade erst telefonisch über den Vorfall unterrichtet. Zum Glück gab es keine Fotos von dem Mann auf der Mauer. Die Zeitungsnotiz stützte sich auf Zeugenaussagen.
An jenem Nachmittag kam mir der Verdacht, sie hätten ihn auf irgendeine Weise dazu gebracht, in den Osten zu klettern – ich weiß nicht, mit welch dreckigem Trick und was sie ihm dazu eingeredet hatten …
Jedenfalls war es ein sauberer Tod für F’s Leute, an dem sich niemand die Hände schmutzig zu machen brauchte …
Der Grund für seine Einlieferung in die psychiatrische Abteilung blieb allerdings mysteriös. Während der Verhöre hatte er keine Anzeichen einer psychischen Krankheit erkennen lassen (durch meine frühere Tätigkeit als Staatsanwalt glaubte ich davon genug zu verstehen). Aber ich versuchte nicht einmal, darauf anzuspielen.
Ich fragte F. nicht nach dem Mercedes an der Straßenecke – er hätte es ohnehin geleugnet.
Ich fragte ihn auch nicht, wer dem Bulgaren die Stelle genannt und wer den VW-Transporter mit der Holzleiter so dicht an der Mauer geparkt hatte.
Am späten Abend kehrte ich noch einmal an die Stelle in der Bellevuestraße zurück und vergewisserte mich, dass man die Kletterpartie des Alten vom Parkplatz des Mercedes hatte beobachten können. Es war der Punkt, von dem aus man eben noch an der Hausecke vorbeisah.
Die Stelle, wo der Transporter gestanden hatte, war leer. Ich nahm an, dass es F. keine Schwierigkeiten bereitet hatte, sich den Wagen für einige Stunden zu besorgen; und ebenso sicher erschien es mir, dass sein Fahrer – den unwahrscheinlichen Fall vorausgesetzt, dass sich jemand die Fahrzeugnummer des Transporters notiert hatte – beweisen können würde, in einem der Häuser gegenüber einen »dringenden Auftrag« erledigt zu haben.
2
Kofler schien ernsthaft zu glauben, er beziehe sein Ein-Zimmer-Apartment nur, um eine Weile vor der Neugier westlicher Journalisten geschützt zu werden. Jedenfalls gab er vor, das zu glauben – und er spielte seine Rolle gut …
Mir fiel auf, mit welcher Unbefangenheit er auch auf heiklere Fragen einging. Ein Marxist ohne eine Spur bürokratischer Kleinkariertheit oder jenem Hang zu weltanschaulicher Eiferei, die ich so oft an seinen Genossen beobachtet hatte.
Aus Gründen, die ich noch nicht durchschaute, hielt ich ihn sogar für einen ausgemachten Epikureer. Ein Zug, der mir imponierte, weil ich selbst eher dem anderen Lager angehöre, »der melancholischen Fraktion«, wenn man so will (glücklicherweise verschaffte mir F. ein ausgezeichnetes Medikament dagegen).
Bei alledem wirkte er zurückhaltend und schien ungern über seine Ansichten zu reden. Ein großer, braungebrannter Mann in den Sechzigern mit schütterem, zurückgekämmtem Haar, blassen Sommersprossen, die überall auf seiner runzligen, an einigen Stellen rötlich durchscheinenden Haut zu sehen waren, und einem kaum merklichen nervösen Tick, den Kopf ruckartig nach links zu werfen, als versuche er auf diese Weise seinen Geist von der materiellen Gebundenheit des Rumpfes zu befreien – eine Bewegung, die derart suggestiv auf mich wirkte, dass ich mich schon am zweiten Tag dabei ertappte, ihn nachzuahmen.
In der Tat – es klappte!
Aus irgendeinem Grund, vielleicht durch eine Manipulation der Nervenbahnen im Nacken, ließ sich auf diese Weise die Konzentration verbessern.
Ich musste lachen, wenn ich mir vorstellte, wie wir beide in den nächsten Wochen – er nach links und ich nach rechts – mit dem gleichen Kopftick Fragen und Antworten austauschen würden.
Ich verstand, dass man im Westen seinen Einfluss auf die Jugend fürchtete.
Etwas lag in seiner Haltung, seiner Art zu reden und zu gestikulieren, das auch Jüngere akzeptieren konnten. Er war Pole, aber gebürtiger Deutscher.
Seine Eltern hatten bis vierunddreißig in Leipzig gelebt und waren dann zu Verwandten in der Nähe von Warschau gezogen. Er sprach so gut Polnisch wie Deutsch. Und als sein Einfluss in der polnischen Gewerkschaftsbewegung zunahm, enthob man ihn seines Postens an der Universität.
Dabei war er erst sehr spät zur Soziologie und Sozialpsychologie übergewechselt und damit in jenen theoretischen und gesellschaftlich relevanten Bereich, der ihn angeblich für die östliche Führung gefährlich werden ließ.
Seine ursprüngliche Laufbahn war die eines Kriminologen an der Krakauer Universität gewesen, und er hatte es dort bis zu einem Lehrstuhl gebracht (es war die Nahtstelle, an der F. seine Verbindung zum KGB vermutete). Aber eines Tages musste er sein Interesse für die soziologischen und sozialphilosophischen Aspekte des Marxismus entdeckt haben, die Analyse von Fingerabdrücken, Blut und Sekreten befriedigte ihn nicht mehr.
Denn, ein halbes Jahr später, als sich eine radikale Jugendbewegung um ihn bildete, eine Entwicklung, die er nicht gewollt hatte und zutiefst bedauerte, und nachdem ohne Wissen der Partei in Großbritannien ein Buch mit dem Titel »What is to be done?« erschienen war, dessen Übersetzung er als eine grobe Verfälschung seiner Ideen ansah, hatte man ihn zunächst in die DDR ausgewiesen.
Nach einer Art Schamfrist war er dann gestern Morgen am Übergang Friedrichstraße von F.s Leuten in Empfang genommen worden.
Das Buch war auf Polnisch geschrieben und von einem nach London emigrierten Weißrussen namens Kremiew unautorisiert übersetzt worden – einer etwas obskuren Gestalt, weshalb der Verdacht nahelag, es handele sich um eine fingierte Falsch-Übersetzung, also ein von der Partei forciertes Machwerk, um Kofler abschieben zu können.
So jedenfalls lautete die östliche Version, die man uns glauben machen wollte.
F. hielt es für ein großangelegtes, von langer Hand vorbereitetes Komplott. Man baute eine Führerpersönlichkeit auf, die für den Osten zu rechts, für den Westen aber zu links war, ihre Aufgabe: das ideologische Vakuum im Westen auszufüllen, kleine Zellen des Widerstandes zu bilden und schließlich eine breite Massenbewegung.
Schon seit längerem konnte man beobachten, dass man im Osten nicht mehr auf die Überzeugungskraft der kommunistischen Ideologie setzte, sondern auf Persönlichkeiten. »Cheguevarismus« war das neudeutsche Wort, das F. dafür geprägt hatte. Andere nannten sie »Messiasse«.
In der Kode-Sprache hießen sie: »Rote Kakadus«. Persönlichkeiten, nicht Ideologien, hatten die Weltgeschichte verändert: Gestalten wie Buddha, Alexander der Große, Jesus von Nazareth, Napoleon, Marx, Hitler, Stalin.
Leo Kofler, Sohn eines böhmischen Schusters und einer polnischen Magd, würde ein kleineres Licht unter ihnen sein – doch immer noch hell genug, um in einigen Wirrköpfen die Idee jenes langersehnten Umsturzes Wirklichkeit werden zu lassen, der aus der Sicht der dialektisch-materialistischen Geschichtsschreibung ohnehin unvermeidlich war.
»Feiner Plan, aber leicht zu durchschauen«, lachte F., als er mir im Gang der Westberliner Zentrale entgegenkam; sie lag in der Franz-Künstler-Straße, beinahe um die Ecke. Mein ganzes Leben spielte sich in dem Dreieck von kaum einem Quadratkilometer Größe zwischen meiner Privatwohnung in der Hitzigallee, der Zentrale und der Wohnung an der Mauer ab ….
Er schüttelte unwillig eine grüne Kunststoffmappe. »Haben Sie den Bericht gelesen?«
Ich nickte.
»Und?« Seine hochgezogenen kahlen Bögen über den Augen, bei gewöhnlichen Menschen die Augenbrauen, signalisierten, dass er ungeduldig war. Er musterte mich, als wolle er sagen: Bestätigen Sie einfach, was wir ohnehin schon wissen – schuldig! Todesurteil! Legitimieren Sie es mit Ihrem Fachwissen und Ihrer Quasi-Funktion als Staatsanwalt.
»Ich werd‘s mir noch genauer ansehen müssen.«
»Dazu ist keine Zeit. Wir sind etwas in Zugzwang diesen Monat«, erklärte er unbeherrscht. »Die Senegalesen, das Kubakomplott …«
Er schwieg und warf mir einen mürrischen Blick zu.
»Großer Gott«, sagte ich – ich sagte es aus dem Stand, aber mit so viel Nachdruck, wie ich konnte: »Wenn ich für Sie arbeite, um die Wahrheit herauszufinden – und ich hoffe, das ist noch immer der Zweck des Unternehmens –‚ dann müssen Sie mir Zeit lassen, genügend Zeit. Ihre Methoden werden immer perfekter. Sie schenken jetzt auch den unwesentlichsten Kleinigkeiten so viel Aufmerksamkeit, dass es schwer wird, ihre Leute zu überführen. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist einiges geschehen auf dem Gebiet der Agenteneinschleusung.«
»Richtig«, bestätigte er, »richtig. Nur ihre hinterhältigen Absichten sind dieselben geblieben.«
Er drückte mich so weit gegen die Wand, dass ich den Verputz im Rücken spürte – es war ein schmaler Gang, künstlich eingezogen zwischen die Räume einer gut florierenden Scheinfirma für Zucker- und Mehlprodukte –, als er sich an mir vorbeidrängte. Er hasste Diskussionen.
»Und vermeiden Sie Besuche hier im Haus. Ich sagte es schon einmal, es schadet Ihnen mehr als uns, wenn die drüben Ihnen auf die Schliche kommen. Auch gute Leute sind zu ersetzen.«
Dann war er auch schon hinter der schwachbeleuchteten Eisentür des Fahrstuhls verschwunden. Ich stand im Gang und blickte ihm nach. Ein schmales, schwarzes Heftchen war aus seiner Mappe gefallen. Ich hob es auf und sah hinein: Es enthielt Zahlen und Buchstaben, mit denen ich nichts anfangen konnte. Ich steckte es in die Manteltasche.
Eigentlich hatte ich ihm mitteilen wollen, dass ich diese Art von Isolationshaltung – anders konnte man es nicht bezeichnen, in dem Einquadratkilometerdreieck –, die er mir seit knapp zweieinhalb Jahren zumutete, nicht länger akzeptieren und mich nach einem hübschen und braven (lieber Himmel, wenn es denn sein sollte, auch »biederen und verschwiegenen«) Mädchen umsehen würde – etwas, das es nach F.s Ansicht nicht gab, da alle Frauen entweder Huren oder karrieresüchtige Politteufel waren (oder Ambitionen auf einen Managerposten oder Professorentitel hatten).
Vermutlich war es gutgemeint, wenn er mich wie einen Patienten mit ansteckender Krankheit isolierte.
Er wollte vermeiden, dass man drüben auf meine Tätigkeit aufmerksam wurde. Im Grunde missbilligte er auch meine kleine Privatwohnung in der Hitzigallee (»zu hohe Mieten so nahe am Tiergarten« war sein Standardargument), doch da ich während der Verhöre fast ausnahmslos in der Wohnung an der Luckauer Straße blieb, beließ er es dabei, sich gelegentlich über meine »überflüssigen Fußmärsche« zu mokieren.
Offenbar glaubte er, meine sämtlichen Bedürfnisse seien mit den Mädchen aus der Organisation befriedigt, die er mir gelegentlich zuschanzte (etwa alle drei Monate – ich weiß nicht, wie er auf diese hirnverbrannte Zeitspanne gekommen war), und für einen Kerl in Staatsdiensten gebe es ohnehin nur die Arbeit. Es waren in der Regel nette und verständige Mädchen, und sie hatten überhaupt keine Ahnung, auf welche Weise sie missbraucht wurden. Es waren auch weder Huren noch karrieresüchtige Politteufel, aber das schien F. entgangen zu sein.
Die Wohnung in der Luckauer Straße bestand aus drei nebeneinanderliegenden Räumen im dritten Stock eines grauen Mietshauses aus der wilhelminischen Zeit, das direkt an der Zonengrenze lag. F.s Spezialisten hatten diese Lage mit Absicht gewählt. Man sah auf die Mauer, den Todesstreifen, einen Teil des Übergangs Heinrich-Heine-Straße – vor allen Dingen aber erlaubte sie den Sichtkontakt mit einem Haus im Ostsektor an der Roßstraße.
Beide Etagen unter uns wurden von ruhigen, älteren Mietern bewohnt, Leuten, die entweder schwerhörig, halb blind oder so senil waren, dass sie das Haus selten verließen. Neben der Toreinfahrt im Parterre, die zu einem grasüberwachsenen Trümmergrundstück im Hinterhof führte, befand sich eine seit den sechziger Jahren geschlossene Fahrradhandlung, ihre schmutzigen Scheiben waren mit braunem Packpapier verhängt.
Die verblichene Reklame aus der Zeit um die Jahrhundertwende gab offenbar für Mauertouristen und Fotografen ein reizvolles Motiv ab. Zu Anfang waren wir überrascht und misstrauisch gewesen, wenn man unsere Hausfassade fotografierte, später hatten wir uns daran gewöhnt. Es gab nur eine Familie mit Kindern.
Ihr fünfjähriger Knirps spielte manchmal unten an der Mauer. Obwohl er sehr aufgeweckt war, hatte er uns kaum Scherereien gemacht. Nur einmal war es ihm gelungen, die Wohnungstür vom Treppenhaus aus mit einem verbogenen Nagel zu öffnen. Es waren uralte Schlösser, für die praktisch jeder Schlüssel annähernd gleicher Größe oder ein krummer Draht ausreichte. F.s Spezialisten mussten das beim Einzug übersehen haben.
Möglicherweise hatten sie es auch als unwichtig angesehen, da für den Fall der unbefugten Türöffnung – dieser Eingang wurde von uns nicht benutzt, wir gelangten durch das Nachbarhaus in die Wohnung – eine Sicherung eingebaut war.
Seine Überraschung musste so groß gewesen sein wie die unsrige, denn durch einen Spezialkontakt im Türscharnier fiel im ganzen Haus der Strom aus. Es wurde stockfinster.
Er hatte keine Gelegenheit mehr gehabt, zu sehen, was sich hinter der Tür befand: Es wäre eine weitere Überraschung wert gewesen. Damals ließ F. ein einbruchsicheres Schloss einbauen.
Für den Kontakt mit der Roßstraße hatten wir eine neuartige Laser-Signalanlage installiert. Mit ihr kabelten wir Fragen und Antworten über unseren jeweiligen Klienten heraus und herein, soweit sie im Zentralcomputer nicht greifbar waren. Auf diese Weise war es möglich, Antworten zu überprüfen und Zusammenhängen, die sich meist im Verlauf der Verhöre ergaben, sofort nachzugehen.
Die Maschine sah aus wie ein überdimensionaler Diaprojektor. Ihr Objektiv zeigte nach Nordwesten, auf das Dachfenster Ecke Roß- und Neue Jakobstraße. Ihre Signale waren mit bloßen Augen völlig unsichtbar und nach dem gegenwärtigen Stand der Technik drüben auch weder zu orten noch zu entschlüsseln. In der Hinsicht konnten wir unbesorgt sein. Sorgen machte uns lediglich der Mann, der den Datenaustauscher auf der Gegenseite bediente.
Da der Apparat seine Nachrichten automatisch auswarf, genügte ein Spezialist für die Wartung und Bedienung. Auf unserer Seite hieß er Kruschinsky – ein magerer, etwas unscheinbarer Junge, der zunächst in einem Fernmeldebataillon der Bundeswehr gearbeitet hatte und dort durch seine Begabung aufgefallen war.
Um die Geheimhaltung zu gewährleisten, wechselte F. den Techniker nach jedem Klienten aus. So wurde vermieden, dass für ihn zwischen unseren Verhören und den Todesfällen, die wie Unglücksfälle aussahen, eine Verbindung herstellbar war. F. hatte mir oft versichert, es gebe niemanden außer uns beiden, der Einblick in das Verfahren habe.
Ich hielt das für eine Lüge, denn es musste von höchster Regierungsstelle abgesegnet sein. Auch die Leute, die das Ende arrangierten, wurden ständig ausgetauscht. In dieser Beziehung glaubte ich ihm. An übergeordneter Stelle wolle man angeblich nichts mit alledem zu tun haben. Es gebe keine direkte Order, sondern nur eine Art »Pauschalarrangement« für eine nicht näher festgelegte Anzahl von Personen, eine stillschweigende Übereinkunft, Im Ernstfall würde niemand zu solch einem Befehl stehen wollen. Meine Berichte seien die einzigen Unterlagen, und niemand außer ihm, F., wisse, wer sie verfasse. Sie seien weder mit vollem Namen gezeichnet noch dritten Personen überhaupt zugänglich.
Im Grunde besäßen sie nur dokumentarischen Wert und würden in einem sicheren Tresor verwahrt, um bei einem fiktiven Fall (der natürlich nie eintreten werde), nachweisen zu können, warum man die betreffende Person habe eliminieren müssen.
Das Ganze hatte offenbar eine ausgemachte Alibifunktion. Es lag irgendwie zwischen Rechtsstaatlichkeit, Notwendigkeit und Verbrechen: ein Kompromiss, der sich aus der Praxis ergab.
Der Laser stand rechts im mittleren der drei durchgehenden Zimmer auf einem stabilen Holztisch vor einem Spezialfenster mit Doppelscheiben, in das durch Spiegelschlitze das Bild einer durchsichtigen Gardine projiziert wurde, hinter der auch mit stärksten Teleskopen aus dem Ostsektor nie etwas anderes wahrnehmbar sein würde als eine verstaubte Wohnungseinrichtung, deren Besitzer seit Jahren im Ausland lebte.
Von innen her war das Glas vollkommen durchsichtig, allerdings ließ es kein Tageslicht herein, so dass wir ständig Lampen brennen mussten.
Links von diesem Raum befand sich Koflers Zimmer, ein durchaus luxuriös eingerichtetes Einzimmerapartment mit breitem Bett, Einbauschränken, einem Farbfernseher schräg in der Ecke, Videogerät, Schreibtisch, rundem Rauchtischchen mit Sesseln und einem in das Zimmer ragenden, gekachelten Badezimmer. Lediglich das Fenster fehlte.
Mein eigenes Zimmer auf der gegenüberliegenden Seite war weniger komfortabel: Bett, Tisch, Kleiderschrank. Tapeten in fadem Beige, hochglanzlackiert. Aber ich hatte nie viel Wert auf Luxus gelegt.
Während der Gespräche saßen wir in Koflers Zimmer, wegen der vertrauten Atmosphäre. Klienten, die zwischen ihren eigenen vier Wänden lebten, waren gesprächiger und verrieten sich schneller. Eine ungewohnte Umgebung dagegen signalisierte Zurückhaltung und Vorsicht. Kofler hatte, um die Zeit bis zu seiner Abreise zu nutzen, mit einem neuen Buch begonnen – er ahnte wohl kaum, dass er es nicht zu Ende bringen würde –, und wir ließen ihn gewähren.
Um in der Bundesrepublik rasch Fuß fassen zu können, benötigte er größere Summen, doch auf dem Konto einer Kölner Bank, auf die man sein restliches Vermögen überwiesen hatte und dessen Nummer er uns bereitwillig mitteilte, war kaum Geld.
Wir nahmen an, dass ein Geheimkonto existierte. Ihm dieses Geheimnis irgendwann zu entreißen, würde uns einen zwingenden Beweis für seine Schuld liefern …
Die drei Räume waren untereinander verbunden. Es gab keinen Korridor – auch keinen Zugang zum Treppenhaus mehr. Sicherheitsvorkehrung. Der alleinige Ein- und Ausgang war die Fahrstuhltür im mittleren Zimmer, dem Arbeitszimmer Kruschinskys. Sie konnte nur durch ein in einer Wandnische versenktes Tipptastenfeld geöffnet werden, für dessen Bedienung man durch einen Sehschlitz blicken musste. So ließ sich vermeiden, dass Unbefugte den Zahlenkode erfuhren.
Der Fahrstuhlschacht endete ohne Zwischenstation in einer Tiefgarage, deren Ausfahrt im Nachbarhaus lag, einem Neubau, in dem Geschäfte, Büros und Arztpraxen untergebracht waren. Ein fast perfektes Gefängnis und eine Tarnung, die so wirksam war, dass noch keiner der übrigen Mieter bisher von uns Notiz genommen zu haben schien.
Irgendwo im Treppenhaus des dritten Stockwerks gab es eine blinde, immer verschlossene Wohnungstür, hinter der sich Mauerwerk befand. Ihr von Werbesendungen überquellender Briefkasten wurde gelegentlich von einem wohlmeinenden Hausmeister geleert. Das Gegenstück des Tipptastenfeldes in der Tiefgarage war hinter einem verschlossenen Eisentürchen verborgen.
Sie hatten Kofler am frühen Morgen in einem fensterlosen Lieferwagen herübergefahren. Vom Übergang Friedrichstraße zur Wohnung waren es nur wenige hundert Meter. Allerdings brachte man ihn zunächst nach Lichterfelde – ein Umweg von einigen Kilometern durch den Süden des Westsektors –‚ wo man ihn sicherheitshalber in einer Garage umsteigen ließ.
Als er mir in der Wohnung zum ersten Mal entgegentrat, wirkte er unausgeschlafen, übermüdet und sah gar nicht wie ein »Messias« aus.
Angeblich hatte ihn die Nachricht von seiner endgültigen Abschiebung in den Westen überrascht. Es mochte auch Nervosität sein oder Angst. Leider lassen die sichtbaren Gemütsbewegungen eines Menschen nicht unbedingt Rückschlüsse auf seine wahren Gedanken zu, wie jeder gute Pokerspieler bestätigen kann. Deshalb misstraute ich auch allen Arten von Apparaten, die neuerdings im Einsatz waren – vom alten Lügendetektor ganz abgesehen, denn Hautwiderstand ist mental beeinflussbar – also: Stimmenstressanalysator, Gesichtswärmemesser und ähnlichem Zeug.