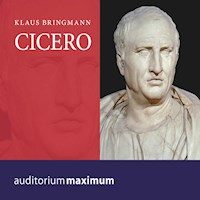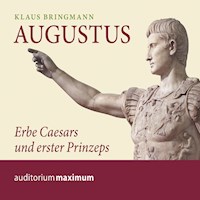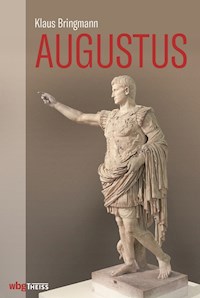
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Konrad Theiss Verlag GmbH
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Sonderausgabe der Augustus-Biographie des renommierten Althistorikers Klaus Bringmann: Spannend und hintergründig schildert er die widersprüchlichste Gestalt der römischen Geschichte. Augustus stieß das Tor auf zu der letzten, der verheerendsten Phase des Bürgerkriegszeitalters und wurde doch zum Begründer eines Weltfriedens, der zu seinen Ehren den Namen »Pax Augusta« trägt. Er begann als Hochverräter und war am Ende der »Vater des Vaterlandes«. In seinen Anfängen trat er Recht und Gesetz mit Füßen, aber er ging als Wiederhersteller von Recht und Gesetz und als Schöpfer einer Ordnung, die er selbst und wahrscheinlich die Mehrheit seiner Zeitgenossen als den besten und glücklichsten Zustand des römischen Staates bezeichneten, in die Geschichte ein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 586
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Klaus Bringmann
Augustus
Impressum
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttp://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig.Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung inund Verarbeitung durch elektronische Systeme.
wbg THEISS ist ein Imprint der wbg.
© 2018 by wbg (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), DarmstadtSonderausgabe 2018, auf Grundlage der 2., durchgesehenen undbibliographisch aktualisierten Ausgabe 2012Die Herausgabe des Werkes wurde durch die Vereinsmitglieder der wbg ermöglicht.Satz: SatzWeise, FöhrenUmschlagabbildung: Augustus-Statue von Prima Porta. Rom, Vatikanische Museen.Foto: © akg-imagesUmschlaggestaltung: Harald Braun, Helmstedt
Besuchen Sie uns im Internet: www.wbg-wissenverbindet.de
ISBN 978-3-8062-3823-5
Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlich:eBook (PDF): 978-3-8062-3835-8eBook (epub): 978-3-8062-3836-5
Menü
Innentitel
Inhaltsverzeichnis
Buch lesen
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur Reihe
Vorwort des Autors
Vorwort zur zweiten Auflage
Einführung
I. Kindheit und Jugend
1. Der familiäre und zeitgeschichtliche Hintergrund
2. Jugendjahre. Die Vorbereitung auf ein Leben für die Politik
II. Der Erbe Caesars
1. Der Hochverräter
2. Der Verbündete Ciceros
3. Der Rächer Caesars
4. Der Kampf um die Beherrschung des Westens
5. Der Weg zur Alleinherrschaft
III. Die Errichtung der Monarchie in der wiederhergestellten Republik
1. Die Neuordnung des Ostens
2. Die Begründung des Prinzipats
3. Krisen und Krisenbewältigung
4. Reformen und symbolische Politik
IV. Augustus und das Reich
1. Die Expansion im Westen
2. Augustus und die Provinzen
V. Res publica und dynastische Nachfolge
VI. Dreierlei Bilanz
Anhang
1. Zeittafel
2. Karten
3. Stammbaum
Anmerkungen
Hinweise zu Quellen und wissenschaftlicher Literatur
Abkürzungsverzeichnis
Personen- und Ortsverzeichnis
Personen
Orte
Abbildungsnachweis
Vorwort zur Reihe
„Gestalten der Antike“ – die Biographien dieser Reihe stellen herausragende Frauen und Männer des politischen und kulturellen Lebens jener Epoche vor. Ausschlaggebend für die Auswahl war, dass die Quellenlage es erlaubt, ein individuelles Porträt der jeweiligen Personen zu entwerfen, und sie konzentriert sich daher stärker auf politische Persönlichkeiten. Sie ist gewiss auch subjektiv, und neben den berühmten „großen Gestalten“ stehen interessante Personen der Geschichte, deren Namen uns heute vielleicht weniger vertraut sind, deren Biographien aber alle ihren je spezifischen Reiz haben.
Die Biographien zeichnen spannend, klar und informativ ein allgemein verständliches Bild der jeweiligen „Titelfigur“. Kontroversen der Forschung werden dem Leser nicht vorenthalten. So geben auch Quellenzitate – Gesetzestexte, Inschriften, Äußerungen antiker Geschichtsschreiber, Briefe – dem Leser Einblick in die „Werkstatt“ des Historikers; sie vermitteln zugleich ein facettenreiches Bild der Epoche. Die Darstellungen der Autorinnen und Autoren zeigen die Persönlichkeiten in der Gesellschaft und Kultur ihrer Zeit, die das Leben, die Absichten und Taten der Protagonisten ebenso prägt wie diese selbst die Entwicklungen beeinflussen. Die Lebensbeschreibungen dieser „Gestalten der Antike“ machen Geschichte greifbar.
In chronologischer Reihenfolge werden dies sein:
Hatschepsut (1479–1457), von den vielen bedeutenden Königinnen Ägyptens nicht nur die bekannteste, sondern auch die wichtigste, da sie über zwei Jahrzehnte die Politik Ägyptens bestimmt hat;
Ramses II. (1279–1213), der Pharao der Rekorde, was seine lange Lebenszeit wie die nahezu unzähligen Bauvorhaben betrifft;
Alexander (356–323), der große Makedonenkönig, dessen Rolle in der Geschichte bis heute eine ungebrochene Faszination ausübt;
Hannibal (247–183), einer der begabtesten Militärs der Antike und Angstgegner der Römer; seine Kriege gegen Rom haben Italien mehr geprägt als manch andere Entwicklung der römischen Republik;
Sulla (138–78), von Caesar als politischer Analphabet beschimpft, weil er die Diktatur freiwillig niederlegte, versuchte in einem eigenständigen Konzept, den römischen Staat zu stabilisieren;
Cicero (106–43), Philosoph, Redner und Politiker, von dem wir durch die große Zahl der überlieferten Schriften und Briefe mehr wissen als von jeder anderen antiken Persönlichkeit; sein Gegenpart,
Caesar (100–44), ein Machtmensch mit politischem Gespür und einer ungeheuren Energie;
Kleopatra (69–30), Geliebte Caesars und Lebensgefährtin Marc Antons, die bekannteste Frauengestalt der Antike, die vor allem in den Darstellungen ihrer Gegner unsterblich wurde;
Herodes (73 v.–4 v. Chr.), der durch rigorose Anpassung an die hellenistische Umwelt die jüdische Monarchie beinahe in den Dimensionen der Davidszeit wiederherstellte, dem seine Härte jedoch letzten Endes den Ruf des „Kindesmörders“ eintrug;
Augustus (43 v.–14 n.Chr.), der mit unbeugsamer Härte, aber auch großem Geschick vollendete, was Caesar angestrebt hatte; da er die Bürgerkriege beendete, wurde er für die Zeitgenossen zum Friedenskaiser;
Nero (54–68), der in der Erinnerung der Nachwelt als Brandstifter und Muttermörder disqualifiziert war, auch wenn ihn die zeitgenössischen Dichter als Gott auf Erden feierten;
Marc Aurel (161–180), der so gerne als Philosoph auf dem Thron bezeichnet wird und doch immer wieder ins Feld ziehen musste, als die ersten Wellen der Völkerwanderung das Römische Reich bedrohten;
Septimius Severus (193–211), der erste „Nordafrikaner“ auf dem Thron, aufgeschlossen für orientalische Kulte; er förderte die donauländischen Truppen und unterwarf das Reich zahlreichen Veränderungen; mit
Diocletian (284–305)beginnt die Spätantike, die sich vor allem durch konsequente Ausübung der absoluten Monarchie auszeichnet;
Konstantin der Große (306–337), der im Zeichen des Christengottes in die Schlacht zog und siegte, hat den Lauf der Geschichte nachhaltig verändert; dem Christentum war nun der Weg zur Staatsreligion vorgezeichnet;
Athanasius (295–373), unter den großen politischen Bischöfen der Spätantike einer der radikalsten und erfolgreichsten in dem Bemühen, den neuen Glauben im und gegen den Staat durchzusetzen;
Julian (361–363), dessen kurze Regierungszeit vieles von seinen Plänen unvollendet ließ und deshalb die Phantasie der Nachwelt anregte;
Theodosius der Große (379–395), von dem man sagt, er habe mit einer rigorosen Gesetzgebung das Christentum zur Staatsreligion erhoben; er bewegte sich mit Geschick durch eine Welt religiöser Streitigkeiten;
Theoderich der Große (474–526), der bedeutendste jener „barbarischen“ Heerführer, die das Weströmische Reich beendeten, und schließlich Kaiser
Justinian (527–565), der die Größe des alten Imperium Romanum wiederherstellen wollte; seine Herrschaft kann insofern einen guten (chronologischen) Abschluss bilden.
Manfred Clauss
Vorwort
Ermutigt von meinem Frankfurter Kollegen Prof. Dr. Dr. Manfred Clauss verfasste ich für die von ihm herausgegebene Reihe „Gestalten der Antike“ die hiermit der Öffentlichkeit vorgelegte Biographie des Augustus. Ich war mir der Schwierigkeit der Aufgabe wohlbewusst, und ich hätte mich nicht an sie gewagt, wenn ich nicht in dem im Akademieverlag erschienenen Studienbuch Augustus und die Begründung des römischen Kaisertums sowie auch sonst mehrfach auf Augustus und seine Zeit zu sprechen gekommen wäre. Es gehört zu den signifikanten Kennzeichen der augusteischen Epoche, dass Augustus und sein öffentliches Wirken in allen damals zur Verfügung stehenden Medien des Wortes und des Bildes eine Publizität erfuhr, die ihresgleichen in der Antike nicht hatte. Um von dem Gebrauch, den Augustus von der „Macht der Bilder“ machte, wenigstens einen Eindruck zu geben, habe ich dieser Biographie eine verhältnismäßig große Zahl von Bildern mit ausführlichen Erläuterungen beigegeben. Dabei habe ich wertvolle Hilfe von archäologischer und numismatischer Seite erhalten: von meinen beiden Frankfurter Kollegen Prof. Dr. Götz Lahusen und Dr. Helmut Schubert, der wie schon für das oben genannte Studienbuch so auch jetzt die Münzabbildungen beisteuerte. Bei der Abfassung der Biographie unterstützte mich in der gewohnt bewährten Weise Dirk Wiegandt M.A. Die Karten zeichnete PD Dr. Peter Scholz. Für die Fahnenkorrekturen und die Anfertigung des Index bin ich den Herren Tilman Moritz und Dawid Wierzejski, studentischen Hilfskräften am Historischen Seminar, Abteilung Alte Geschichte, von neuem verpflichtet. Allen Genannten gilt mein aufrichtiger Dank. Zu danken habe ich, last but not least, auch dem Lektorat der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, insbesondere Herrn Dr. Harald Baulig, für die vorbildliche Betreuung des Bandes und für das freundliche Entgegenkommen bei der Aufnahme der Abbildungen.
Dieses Buch, das vielleicht mein letztes sein wird, widme ich meinen Söhnen Jan, Martin und Felix, für die ich, als sie Heranwachsende waren, berufsbedingt oft wenig Zeit hatte.
Frankfurt im September 2006
Klaus Bringmann
Vorwort zur zweiten Auflage
Der Text der ersten Auflage wurde neu durchgesehen. Druckfehler und Versehen bei der Nennung von Eigennamen sind beseitigt worden. Kritische Einwände, die in den größtenteils auf einen positiven Tenor gestimmten Rezensionen geäußert wurden, habe ich ernsthaft in Erwägung gezogen, doch bestand nach meiner Überzeugung kein Grund zu sachlichen Korrekturen oder Änderungen. Bereits kurz nach Erscheinen der ersten Auflage habe ich in einem Vortrag an der Universität Bielefeld, der die Funktion einer Metakritik hatte, das Konzept meiner Biographie des Augustus erläutert und verteidigt. Dieser Vortrag liegt inzwischen in erweiterter Form unter dem Titel „Kaiser Augustus. Grenzen und Möglichkeiten einer Biographie“ in der Zeitschrift Gymnasium gedruckt vor.
Im Folgenden nehme ich zu einigen Einwänden und kritischen Anmerkungen zu meiner Biographie des Augustus Stellung. Dabei beziehe ich mich sowohl auf private Mitteilungen als auch auf gedruckte und im Internet veröffentlichte Rezensionen. Es sind dies
– A. Klingenberg: Rezension zu: Bringmann, Klaus. – Augustus. Darmstadt 2007, in: H-Soz-u-Kult, 16.04.2007, <http://hsozkult.geschichte.huberlin.de/rezensionen/2007-2-032>
– H. Schlange-Schöningen, in: Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 12, 2009, 1105–1109
– E. Stein-Hölkeskamp, in: Süddeutsche Zeitung vom 3.7.2007, 16
– N. Wiater, in: Frankfurter elektronische Rundschau zur Altertumskunde 5, 2007, 13–15
– U. Walter, in: Historische Zeitschrift 285, 2007, 695–698.
In der Süddeutschen Zeitung wird unter der Zwischenüberschrift „Große Männer im leeren Raum?“ suggeriert, dass ich in meiner Biographie einen „Großen Mann“ im leeren Raum hätte agieren lassen. Das schlichte Gegenteil ist richtig. Es ist darauf geachtet worden, die allgemeinen und speziellen Voraussetzungen, die von Augustus gar nicht geschaffen werden konnten, sowie die Zeitverhältnisse zu berücksichtigen, auf die er gestaltend einwirkte. Allenfalls ist zuzugeben, dass die Gruppierung des historischen Umfelds um die Persönlichkeit, die im Mittelpunkt einer Biographie steht, zu einer gewissen perspektivischen Verkürzung führen kann, ja, führen muss. Ein volles Zeitpanorama der augusteischen Epoche in der vorgegebenen Gattung Biographie und in der vorgegebenen Umfangbegrenzung zu malen, wäre nicht nur unmöglich, sondern geradezu sinnwidrig gewesen. Wer von den Kritikern auch sonst dieses und jenes vermisst, neben der Berücksichtigung von Politikfeldern und Kulturgeschichtlichem auch ausführliche Problemerörterungen, sei darauf hingewiesen, dass eine erzählende Biographie weder Gesamtdarstellung einer Epoche noch ein Forschungsbericht sein kann und auch nicht sein darf. Für das legitime Bedürfnis nach entsprechender Orientierung sind andere von mir genannte Werke zuständig, nicht zuletzt das monumentale Werk von Dietmar Kienast, das jetzt in einer Sonderausgabe der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft neu aufgelegt ist.
Irritationen scheint auch mein im Ganzen positives Urteil über die politische Leistung des Augustus nach 27 v. Chr. ausgelöst zu haben. In der Süddeutschen Zeitung wird dieser Kritikpunkt schon im Untertitel der Rezension formuliert: „Seinem [d.h. Augustus’] kalten Blut zum Trotz: Klaus Bringmann lobt Augustus als Friedenskaiser“. Die positive Würdigung gilt weniger dem Friedenskaiser als der tragfähigen Gestaltung der politischen Problemfelder, auf denen die Republik versagt hatte, ja infolge der Regierungsunfähigkeit ihrer kollektiven Regierung versagen musste. Dass nach der siegreichen Beendigung des Krieges gegen den Rivalen Antonius Frieden im Inneren herrschte, machte zwar auf die Mitlebenden großen Eindruck, ergab sich jedoch schlicht und einfach aus dem definitiven Sieg in einem verheerenden Krieg um die Macht. Anders steht es mit dem, was danach kam: Hier wurde um die Lösung der Probleme gerungen, mit denen die Republik nicht fertiggeworden war. Damals wurden die Grundlagen für die lange Dauer des Römischen Reiches gelegt.
Der Unterschied zwischen Jochen Bleicken und mir in der Beurteilung des Augustus ist mehrfach hervorgehoben worden. Was den Menschen Augustus anbelangt, fällt mein Urteil in der Sache nicht viel anders als das Bleickens aus. Augustus war alles andere als sympathisch. Ein „netter Mensch“ war er schon gar nicht, seine Rivalen freilich auch nicht. Er war in seinen Anfängen ein skrupelloser Terrorist, aber er ist dies in der sogenannten Prinzipatszeit nicht gewesen. Ein Unterschied zwischen Bleicken und mir besteht nur darin, dass ich die negativen Charakterzüge, ohne sie im Geringsten zu leugnen, gegenüber der im Ganzen positiven politischen Schlussbilanz nicht so stark in den Vordergrund der Urteilsbildung schiebe. Möglicherweise beruht die Differenz zwischen Bleicken und mir auch darauf, dass mein Bild der späten Republik, der Folie, vor der Augustus’ Prinzipat gesehen werden muss, düsterer ausfällt, als Bleicken voraussetzt. Dass ich mich für den Gesichtspunkt der historischen „Leistung“ auf ein Zitat des protestantischen Kirchenhistorikers Adolf von Harnack berufen habe, hat mit konfessioneller Prägung, wie Uwe Walter anzudeuten scheint, nichts zu tun. Schließlich beruft sich auch Augustus in seinem Tatenbericht, dem Wertekodex der römischen Aristokratie entsprechend, auf seine Leistungen, und einem späteren Historiker ist es nun einmal aufgegeben, die Leistungsbilanz eines wirkungsmächtigen Politikers aus der Perspektive des zeitlichen Abstands neu aufzumachen. Am Schluss seiner lebendig geschriebenen Augustusbiographie, der gegenwärtig jüngsten, hat Werner Dahlheim das Unsympathische der Persönlichkeit scharf akzentuiert und dagegen die bleibende Leistung des Prinzeps Augustus herausgestellt. In der Sache habe ich gegen dieses Bild nichts einzuwenden.
Im übrigen verweise ich auf meinen oben genannten Aufsatz, in dem ich über „meinen“ Augustus und die Grenzen und Möglichkeiten der ihm gewidmeten Biographie Rechenschaft ablege.
Frankfurt am Main, im Oktober 2011
Klaus Bringmann
Einführung
Augustus ist die wirkungsmächtigste und widersprüchlichste Gestalt der römischen Geschichte. Er stieß das Tor auf zu der letzten, der verheerendsten Phase des Bürgerkriegszeitalters und wurde doch zum Begründer eines Weltfriedens, der zu seinen Ehren den Namen „Pax Augusta“ trägt. Der Friedensbringer war zugleich ein Eroberer, der im Laufe von 40 Jahren viele Kriege führte und die Grenzen des Römischen Reiches erweiterte wie kein Römer vor ihm oder nach ihm. Er war der Totengräber der auf den Tod daniederliegenden Republik, und doch zog er die größte Genugtuung aus den Ehrungen, die er erhielt, weil er die res publica, den römischen Staat, aus seiner Verfügungsgewalt in das freie Ermessen von Senat und Volk, den Institutionen also, die für die Republik standen, zurückgegeben hatte. Er begann als Hochverräter und war am Ende der „Vater des Vaterlandes“. In seinen Anfängen trat er Recht und Gesetz mit Füßen, aber er ging als Wiederhersteller von Recht und Gesetz und als Schöpfer einer Ordnung, die er selbst und wahrscheinlich die Mehrheit seiner Zeitgenossen als den besten und glücklichsten Zustand des römischen Staates bezeichneten, in die Geschichte ein.
Um seine Stellung in dieser Ordnung zu charakterisieren, nannte er sich „Prinzeps“, das heißt den ersten und führenden Mann des Staates. Damit knüpfte er an den Sprachgebrauch der Republik an, dem zufolge die Gruppe der einflussreichsten Senatoren principes civitatis, die führenden Männer der Bürgerschaft, genannt wurden. Indem er diesen Begriff für seine Person monopolisierte, brachte er das Neue, das in dem Alten steckte, wohl unabsichtlich zum Ausdruck: Der überragende Einfluss war von einem Kollektiv auf den Einen übergegangen. Im Anschluss an diese Selbstbezeichnung haben wir uns nach dem Vorgang Theodor Mommsens daran gewöhnt, die von Augustus begründete Ordnung des römischen Staates als Prinzipat zu bezeichnen, und verstehen darunter die in das Gefüge der republikanischen Verfassung eingelassene Führerstellung des Augustus und der ihm nachfolgenden römischen Kaiser. Einen unverhüllteren Blick auf die realen Machtgrundlagen seines Prinzipats gibt der Name Imperator, das heißt Feldherr, den er seit dem Jahre 40 v. Chr. anstelle eines Vornamens offiziell verwendete. Das Wort verweist auf den alten Brauch, nach dem ein siegreiches Heer seinen Oberkommandierenden zum Imperator ausrief und ihn so zum Empfang der höchsten Ehrung, eines in Rom gefeierten Triumphes, qualifizierte. Obwohl Augustus alles andere als ein großer Feldherr war, ist er in seinem Leben insgesamt 21-mal zum Imperator ausgerufen worden – öfter als jeder der großen Feldherren der Republik. Indem er also in den Anfängen seiner Laufbahn den Titel als Namensbestandteil annahm, verwies er auf die besondere Beziehung, die ihn mit den Soldaten und der Armee verband. Dieser Beziehung, dem so genannten Heerespatronat, verdankte er die Alleinherrschaft. Er hatte dieses Patronat von seinem Adoptivvater, dem Diktator Caesar, geerbt, und er hat dieses Erbe als Instrument des Machterwerbs und des Machterhalts zu nutzen verstanden. In den modernen europäischen Sprachen sind der Titel Imperator und der Familienname Caesar zu Bezeichnungen der Monarchie geworden, die im Kreis der europäischen Monarchien den höchsten Rang beanspruchte: Kaiser und Zar – emperor und empereur. Aber obwohl der Eigenname und der Titel somit die Konnotation einer Militärmonarchie hatten und Augustus’ Anfänge die eines Militärdespoten waren: Er wurde die Geister, die er rief, wieder los und verstand es, die Gefahren zu bannen, die seit der späten Republik die Militarisierung der inneren Konflikte heraufbeschworen hatte.
Wie dies alles zusammenhängt und das eine aus dem anderen folgte, ist Gegenstand dieser Biographie, der aufgegeben ist, Augustus’ Persönlichkeit und sein öffentliches Wirken mit den Zeitverhältnissen in Beziehung zu setzen. Der Weg, den er von seinen hochverräterischen Anfängen bis zum gefeierten „Vater des Vaterlandes“ zurücklegte, war nicht die Umsetzung eines ihm von Anfang an vorschwebenden Meisterplans. Er wusste im Jahre 44 v. Chr. nicht, wohin ihn der Entschluss führen würde, das nicht ungefährliche Erbe des Diktators Caesar für den eigenen Aufstieg zu nutzen. Wenn irgend jemand für die Richtigkeit des Satzes einstehen kann, dass derjenige am weitesten kommt, der das Ziel des Weges nicht kennt, dann ist es Augustus. Die Biographie folgt dem weiten Weg, den er zurücklegte, und versucht, der Person und ihrem Wirken, den problematischen Zügen ebenso wie der positiven Leistung, gerecht zu werden.
Jede Biographie ist auf die Gunst der Quellenlage angewiesen. Diese ist für Augustus, gemessen an dem, was für die antike Geschichte üblich und erwartbar ist, nicht schlecht, stellt freilich – verglichen mit dem Reichtum des ursprünglich Vorhandenen – ein Trümmerfeld dar. Davon vermittelt die Augustusbiographie des Sueton aus hadrianischer Zeit mit ihren Zitatennestern aus verlorenen Quellen einen anschaulichen Eindruck. Was Augustus’ eigenes Oeuvre anbelangt, so besitzen wir mit Ausnahme seines für die Nachwelt bestimmten Tatenberichts nur Fragmente. Sie entstammen seinen literarischen Versuchen, seiner Autobiographie, der umfangreichen privaten und amtlichen Korrespondenz und den Reden. Hinzu kommen, meist durch glückliche Inschriftenfunde erhalten, Edikte und jurisdiktionelle Entscheidungen sowie aus literarischer Überlieferung Anekdoten und Äußerungen, echte beziehungsweise gut erfundene, für die es in der Antike spezielle Sammlungen gab. Dieses primäre Quellenmaterial wird ergänzt durch die biographische und historiographische Überlieferung. Die erste wird durch die bereits genannte, vollständig erhaltene Augustusbiographie des Sueton sowie durch das Fragment einer zweiten, von dem griechischen Diplomaten und Gelehrten Nikolaos von Damaskus verfassten repräsentiert. Dieses Fragment reicht von der Geburt bis zum Jahre 44 v. Chr. und stellt eine wichtige Quelle für die Jugendgeschichte des Augustus dar. Die historiographische Überlieferung ist vornehmlich drei Autoren zu verdanken, Velleius Paterculus, Appian von Alexandria und Cassius Dio. Der erstgenannte, ein Zeitzeuge der Feldzüge in Germanien und Dalmatien, verfasste seine „Römische Geschichte“ in tiberischer Zeit, die beiden griechischen Historiker im zweiten beziehungsweise frühen dritten Jahrhundert. Im Unterschied zu Velleius Paterculus haben sie für die Geschichte des Augustus ältere, für uns verlorene Werke benutzt. Bedauerlicherweise endet die „Römische Geschichte“ des Appian jedoch schon mit dem Jahr 36/35 v. Chr. und stellt somit nur für Augustus’ Anfänge und die so genannte Triumviratszeit eine ausführliche und wertvolle Quelle dar. Alle diese Werke bilden zusammen mit der übrigen schriftlichen Überlieferung, zu der Inschriften und Papyri in gleicher Weise wie die augusteische Dichtung und Literatur gehören, den Grundstock unserer Kenntnis vom Leben des Augustus und der Geschichte seiner Zeit. Aus dem Widerspruch zwischen faktischer Alleinherrschaft und dem Anspruch, die Tradition der Republik zur Vollendung geführt zu haben, entstand ein Legitimationsbedarf, der seinen Niederschlag nicht nur im Medium des Wortes, sondern auch in Monumenten und Bildern, nicht zuletzt auch in den Bildmotiven der Münzprägung, fand. Für dieses Phänomen hat Paul Zanker vor Jahren eine suggestive Formulierung in Gestalt des Buchtitels „Augustus und die Macht der Bilder“ geprägt.
Die gesamte, vielschichtige und höchst heterogene Überlieferungsmasse enthält Elemente, die den Zugriff auf ein breites Panorama der augusteischen Zeit erlauben. Um den Entwurf eines solchen Panoramas kann es in diesem Buch nicht gehen. Das ist nicht nur wegen der vorgegebenen Beschränkung des Umfangs, sondern vor allem auch wegen der ebenfalls vorgegebenen biographischen Ausrichtung der Reihe, in der es erscheint, schlechterdings unmöglich. Aber der Verfasser darf versichern, dass das von ihm entworfene Lebensbild des Augustus auf ein breites Spektrum der vorhandenen Quellen fundiert ist. Für Einzelnachweise verweise ich auf den Abschnitt „Hinweise zu Quellen und wissenschaftlicher Literatur“ im Anhang.
I. Kindheit und Jugend
1. Der familiäre und zeitgeschichtliche Hintergrund
Der Mann, der unter dem Ehrennamen Augustus (der Verehrungswürdige) in die Geschichte einging, wurde am 23. September 63 v. Chr. als Gaius Octavius in Rom geboren. Die Familie des Vaters1 stammte aus Velitrae, einer am Südhang der Albanerberge gelegenen Landstadt.2 Die ursprünglich volskische Gemeinde, deren Sprache nicht das Lateinische war, wurde am Ende des Latinerkrieges (340–338 v. Chr.) von den Römern erobert. Die führenden Familien der Stadt wurden deportiert, und auf ihren Ländereien wurden römische Kolonisten angesiedelt, die dem im Jahre 332 v. Chr. gegründeten Stimmbezirk der tribus Scaptia angehörten. Velitrae wurde eine sich selbst verwaltende Gemeinde im römischen Bürgerverband, ein municipium civium Romanorum, dessen politisch führende Klasse, ganz so wie der Senatorenstand in Rom, eine landbesitzende Aristokratie war. Zu ihr gehörten von Alters her die Octavier. Im Zweiten Punischen Krieg brachte es ein Mitglied der Familie bis zum Praetor, dem zweithöchsten Amt des römischen Staates.3 Der gleichnamige Sohn dieses Gnaeus Octavius wurde, nachdem er als Flottenbefehlshaber im Dritten Makedonischen Krieg nach der Schlacht bei Pydna (168 v. Chr.) König Perseus auf Samothrake gefangengenommen hatte, im Jahre 165 v. Chr. sogar Konsul.4 Damit war dieser Zweig der Octavier in den inneren Machtzirkel der Senatsaristokratie, die so genannte Nobilität, die aus den Familien ehemaliger Konsuln bestand, aufgestiegen, und seine Nachkommen hatten so gute Chancen, dass sie, immer vorausgesetzt, dass sie willens und in der Lage waren, sich den harten Anforderungen der Ämterlaufbahn zu stellen, ebenfalls den Konsulat erreichten. Tatsächlich gelang dies insgesamt viermal, nämlich in den Jahren 128, 87, 76 und 75 v. Chr.5 Der letzte Octavier aus diesem Zweig der Familie kämpfte auf Seiten der Republikaner gegen Caesar und fand in Nordafrika den Tod, ohne die höchsten Ämter, Praetur und Konsulat, erreicht zu haben.6
Die jüngere Linie, aus der Augustus stammte, blieb in Velitrae. Dort gehörte sie zu den führenden Familien, begnügte sich mit den lokalen Ehren und mehrte ihren Reichtum. Von Augustus’ Großvater ist überliefert, dass er in Velitrae die Munizipalämter bekleidete und bei großem Reichtum in zurückgezogener Behaglichkeit ein hohes Alter erreichte.7 Der Vater war der erste, der den Sprung auf die Bühne der stadtrömischen Politik wagte. Wie üblich erleichterten Geld, lokaler Einfluss, Beziehungen zur stadtrömischen Aristokratie und die Ehe mit der Tochter eines Senators den Aufstieg des Neulings in die regierende Klasse. Gaius Octavius heiratete in zweiter Ehe Atia, die Tochter des aus dem benachbarten Aricia stammenden Marcus Atius Balbus und der Iulia, einer Schwester Caesars.8 Aus dieser Ehe gingen zwei Kinder hervor: Gaius Octavius, der spätere Augustus, und als Erstgeborene die jüngere Octavia. Aus einer ersten Ehe des Vaters stammte noch eine weitere Tochter, die ältere Octavia. Um das Jahr 70 v. Chr. wurde Augustus’ Vater zum Quaestor gewählt, und mit dem Erreichen dieser ersten Stufe der Ämterlaufbahn wurde er lebenslanges Mitglied des Senats. Spätestens im Jahre 64 v. Chr. bekleidete er das Amt eines Aedilen und im Jahre 61 v. Chr. die Praetur, das Amt der obersten Gerichtsherren Roms. Dann folgte die Statthalterschaft der Provinz Macedonia, wo er nach einem Sieg über den thrakischen Stamm der Bessi von seinen Soldaten zum Imperator ausgerufen wurde.9 Damit erfüllte er die Voraussetzung für die Zuerkennung eines Triumphs, der höchsten Ehre, die der Senat für seine siegreichen Feldherren zu vergeben hatte, und auch bei der Erfüllung seiner zivilen Aufgaben in Rechtsprechung und Verwaltung hat er sich offenbar bewährt. Als Cicero an seinen Bruder Quintus, der als Propraetor die Provinz Asia verwaltete, eine lange Denkschrift richtete, wies er ihn auf das Vorbild hin, das Gaius Octavius als Praetor und Statthalter gegeben hatte.10 Der Lohn für die Bewährung, Triumph und Konsulat, blieb ihm freilich vorenthalten. Bei der Rückkehr aus seiner Provinz starb er plötzlich und unerwartet im kampanischen Nola (Sommer 59 v. Chr.).
Die Mutter heiratete ein Jahr später einen Angehörigen der Nobilität, Lucius Marcius Philippus, der im Jahre 56 v. Chr. den Konsulat bekleidete.11 In dessen Haus wuchs der junge Octavius zusammen mit Mutter und Schwester, vielleicht auch mit einem seiner beiden Stiefbrüder, dem jüngeren Sohn seines Stiefvaters aus erster Ehe,12 auf. Seinen leiblichen Vater kann er kaum gekannt haben. Dieser hinterließ dem Sohn ein stattliches Vermögen – und über die Großeltern mütterlicherseits verwandtschaftliche Beziehungen zu den beiden Politikern und Feldherren, die zu Totengräbern der römischen Republik werden sollten, zu Pompeius und Caesar. Der junge Octavius war Caesars Großneffe, seine Großmutter Iulia, Caesars Schwester, hatte in die Familie der Atii Balbi eingeheiratet, und ihr Schwiegervater, der ältere Atius Balbus, war über seine Frau Lucilia, eine Nichte des berühmten Dichters Lucilius, mit Pompeius’ Vater verschwägert. Sie alle gehörten der Klasse reicher Grundbesitzer an, die mit Ausnahme der Familie Caesars erst im zweiten beziehungsweise in der ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts v. Chr. in die römische Senatsaristokratie aufgestiegen waren. Was Caesars Familie anbelangt, gehörte sie zwar einem Geschlecht des uralten Geburtsadels der Patrizier an, hatte aber, nach langer Bedeutungslosigkeit, erst wieder in der Generation seines Vaters damit begonnen, einen Platz in dem engeren Machtzirkel der Nobilität zurückzugewinnen. Caesars Onkel Sextus war im Jahre 91 Konsul, ein anderer Verwandter, Lucius Caesar, spielte ein Jahr später, ebenfalls als Konsul, eine bedeutende Rolle bei der Beendigung des Bundesgenossenkriegs, indem er das Gesetz einbrachte, das den Bundesgenossen den Zugang zum römischen Bürgerrecht öffnete.13 Drei Jahre später krönte er seine Karriere mit der Zensur. Caesars Vater hatte es allerdings nur bis zum Praetor gebracht. Durch die Verheiratung seiner Schwester, der Tante Caesars, hatte er ein Familienbündnis mit Gaius Marius geschlossen, der als Sieger über den numidischen König Jugurtha und den germanischen Wanderverband der Kimbern und Teutonen einen kometenhaften Aufstieg nahm. Aber dem Aufstieg folgte im Jahre 100, Caesars Geburtsjahr, Marius’ tiefer Absturz. Als er sich dann im Jahre 87 im Bündnis mit Lucius Cornelius Cinna gewaltsam die Rückkehr zur Macht bahnte, gehörten Lucius Caesar, der es bis zum Konsul und Zensor gebracht hatte, und sein Bruder Gaius Caesar mit dem Beinamen Strabo zu den ersten blutigen Opfern des Umsturzes. Gleichwohl wurde der junge Caesar, der spätere Diktator, mit Cornelia, der Tochter des Lucius Cornelius Cinna, verheiratet. Aber dieser starb bereits im Jahre 84, und seine Partei unterlag dem mit seinem Heer aus dem Osten zurückkehrenden Lucius Cornelius Sulla, der seine Gegner ächtete und ein Blutbad unter ihnen anrichtete. Caesar kam mit dem Leben davon, obwohl er sich weigerte, die Tochter Cinnas zu verstoßen. Wie andere Angehörige der Aristokratie auch wurde er durch familiäre Fürsprache gerettet, und obwohl er im Kreis der von Sulla an die Macht gebrachten Bürgerkriegspartei mit Misstrauen betrachtet wurde, so verstand er es doch mit bemerkenswertem Geschick, nach Sullas Tod Vorteile aus der Auflösung der sullanischen Ordnung zu ziehen und seine Karriere zu befördern. Im Jahre 63 v. Chr., dem Geburtsjahr seines Großneffen Gaius Octavius, wurde er zum obersten Repräsentanten der römischen Staatsreligion, zum Pontifex maximus, und zum Praetor für das kommende Jahr gewählt.
Das Jahr 63 war überhaupt ein denkwürdiges Jahr.14 Pompeius organisierte damals nach seinem Sieg über die Könige Mithradates von Pontos und Tigranes von Armenien die römische Herrschaft vom Schwarzen Meer bis zu den Grenzen Ägyptens neu und verschaffte dem römischen Staat, abgesehen von der unermesslichen Beute, regelmäßige Einnahmen, deren Höhe die aus den älteren Provinzen überstiegen. Während Pompeius im Osten wie ein König schaltete und waltete, war der Konsul Marcus Tullius Cicero in Rom und Italien mit einem bewaffneten Putschversuch konfrontiert. Er ging aus von Lucius Sergius Catilina, der im Sommer zum zweiten Mal bei den Konsulwahlen durchgefallen war. Er fand Anhänger in der Aristokratie ebenso wie in den städtischen und ländlichen Unterschichten, nicht zuletzt auch unter den Veteranen, die Sulla in den Städten Italiens angesiedelt hatte. Die Bereitschaft zum Putsch, die erfolglose Amtsbewerber, Nutznießer und Opfer der sullanischen Proskriptionen, Tagelöhner auf dem Land und Gelegenheitsarbeiter in Rom miteinander verband, wurde von der weitverbreiteten Verschuldung gefördert, mochte diese aus dem Aufwand für Ämterbewerbung und luxuriöse Lebensführung oder aus der schlichten Unmöglichkeit resultieren, aus Besitz oder Arbeit ein hinreichendes Einkommen zu erzielen. Dies war die Kehrseite des aus den Ressourcen eines Weltreichs in den Händen einer kleinen Minderheit akkumulierten Reichtums. Als Sallust seine zweite Karriere, die des Geschichtsschreibers, nach der Ermordung des Diktators Caesar mit seiner Darstellung der Catilinarischen Verschwörung eröffnete, knüpfte er seinen Exkurs über den Parteienkampf in Rom an eine Betrachtung über den Kontrast zwischen der imponierenden äußeren Expansion und der inneren Krise Roms an, wie er in seiner, der Sicht eines Zeitgenossen, im Jahre 63 exemplarisch zutage getreten war:
„Zu dieser Zeit erschien mir das Imperium des römischen Volkes bei weitem am beklagenswertesten. Obwohl ihm vom Aufgang bis zum Untergang der Sonne alles, mit Waffen bezwungen, gehorchte, im Inneren Ruhe und Reichtümer, was Sterbliche für die höchsten Güter halten, im Überfluss vorhanden waren, gab es dennoch Bürger, die mit verhärtetem Sinn darangingen, sich und den Staat zugrunde zu richten. Denn trotz der beiden Senatsbeschlüsse hatte aus der Masse (der an dem Umsturzversuch Catilinas Beteiligten) kein einziger, durch die (ausgesetzte) Belohnung veranlasst, die Verschwörung enthüllt, noch hatte irgendeiner von ihnen das Lager Catilinas verlassen: So groß war die Stärke der Krankheit, die wie eine Seuche die Gemüter vieler Bürger befallen hatte.“15
Caesar hatte in der entscheidenden Senatssitzung vom 5. Dezember davor gewarnt, die gefangenen und der Verschwörung überführten Catilinarier ohne Gerichtsurteil hinrichten zu lassen, und statt dessen vorgeschlagen, sie bis auf weiteres in Sicherheitsverwahrung zu nehmen, bis ihnen nach Beruhigung der Lage der Prozess gemacht werden könne. Doch drang er mit seinem sachlich wohlbegründeten Votum nicht durch, und beim Verlassen der Kurie wurde er von der aus jungen Angehörigen des Ritterstandes gebildeten Leibgarde des Konsuls Marcus Cicero mit dem Tode bedroht:16 Die Stimme der Vernunft hatte keinen Platz in der angsterfüllten Atmosphäre des Tages. Die Catilinarische Verschwörung wurde niedergeschlagen, aber ihre Nachwirkungen machten das ländliche Italien, insbesondere den Süden, noch unsicherer, als er durch die aus Sklaven, Enteigneten und Verschuldeten rekrutierten Banden ohnehin schon war. So wurde Octavius’ Vater vom Senat damit beauftragt, auf dem Weg in seine Provinz Macedonia im Gebiet von Thurii (im heutigen Kalabrien am Golf von Tarent gelegen) die Reste der Gefolgschaft des Spartacus, der den Sklavenaufstand der Jahre 73 – 71 angeführt hatte, und des Catilina zu vernichten.17 Von dieser erfolgreichen Polizeiaktion seines Vaters erhielt das Kind den scherzhaften Beinamen „Thurinus“, der soviel bedeutet wie „Sieger von Thurii“ – nach Analogie der berühmten Siegerbeinamen wie beispielsweise Africanus, Macedonicus, Numidicus. Der „Sieg“ des Vaters über Banden, die das Land terrorisierten, reichte freilich nur zu einem Scherz. Ideelles Kapital war daraus nicht zu gewinnen – im Gegenteil: Als Gaius Octavius später einen anderen Namen, den Caesars, trug und mit Marcus Antonius um die Macht rivalisierte, verspottete dieser den wenig eindrucksvollen Heerführer als „Sieger von Thurii“, und schließlich wurde aus dem Beinamen die Mär von einer obskuren Herkunft der Familie aus Thurii gesponnen.18
Für den zeitgeschichtlichen Hintergrund und für den Lebensweg des jungen Gaius Octavius sollten freilich nicht die Catilinarische Verschwörung und ihre Nachwirkungen, sondern das fatale Bündnis bedeutsam werden, das im Jahre 60 v. Chr. seine beiden Verwandten, sein Großonkel Gaius Iulius Caesar und der mit seinem Großvater mütterlicherseits verschwägerte Gnaeus Pompeius Magnus, unter Einbeziehung des reichen, an unbefriedigtem Ehrgeiz leidenden Marcus Licinius Crassus schlossen. Der Grund des Bündnisses, des sogenannten Ersten Triumvirats, war, dass sowohl der aus dem Osten siegreich zurückgekehrte Feldherr Pompeius als auch der für das Jahr 59 zum Konsul gewählte Iulius Caesar nur in einem gemeinsamen Vorgehen eine Chance sahen, ihre politischen Ziele durchzusetzen und so das drohende Ende ihrer politischen Laufbahn zu verhindern. Was Crassus anbelangt, so witterte er für seine Ambitionen Morgenluft und ließ sich trotz seiner Eifersucht auf Pompeius von Caesar für das Bündnis gewinnen, das auf der Generalklausel beruhte, dass keiner der Drei etwas gegen das Interesse seiner Verbündeten unternehmen dürfe.19 Die vitalen Interessen, um die es ging, waren folgende: Pompeius konnte gegen die Mehrheit des Senats weder die Versorgung seiner demobilisierten Soldaten mit Bauernstellen noch die Ratifikation der Verfügungen durchsetzen, die er im Osten getroffen hatte. Der Feldherr, der auf den Spuren Alexanders des Großen gewandelt war, zeigte sich dem politischen Kleinkrieg in Rom nicht gewachsen und drohte gegenüber seiner Klientel das Gesicht zu verlieren. Das hätte sein politisches Ende bedeutet, und eben deswegen wurden alle seine ungeschickten Bemühungen, seine Ziele durchzusetzen, von den Gegnern blockiert, denen seine die Grenzen des Amtsrechts sprengende Karriere und die Akkumulierung von Macht und Einfluss längst ein Dorn im Auge waren. Auch Caesar war in einer Zwangslage. Zwar war es ihm gelungen, zum Konsul gewählt zu werden, aber seine Gegner im Senat hatten ihm einen Amtsbereich zugewiesen, der weder Ruhm noch finanziellen Gewinn versprach – er sollte eine Revision der in Italien gelegenen staatlichen Viehtriften und Weidewege vornehmen. Auf finanziellen Gewinn aber war er schon deshalb angewiesen, weil er die zur Bestechung der Wähler aufgenommenen Schulden zurückzahlen musste. Was Caesar darüber hinaus anstrebte, waren die Mittel, die Pompeius groß gemacht hatten: einen umfangreichen militärischen Aufgabenbereich, einen Krieg, der ihm eine ergebene Armee, Beute, Macht und Einfluss einbrachte. Er war gewillt, die Versorgung der Veteranen des Pompeius und die Ratifikation der Anordnungen, die dieser im Osten getroffen hatte, auf Biegen und Brechen durchzusetzen, wenn als Gegenleistung ein außerordentliches Kommando für ihn selbst dabei heraussprang. Der Dritte im Bunde, Crassus, der über großen Reichtum und entsprechenden Einfluss verfügte, hatte sich dem Bündnis mit der Aussicht angeschlossen, später zum Zuge zu kommen. Als es soweit war, im Jahre 55 v. Chr., und er seinerseits mit der Provinz Syrien eine Option auf einen großen Krieg gegen die Parther im Zweistromland erhielt, bezahlte er den vom Zaun gebrochenen Krieg mit seiner Niederlage in der Schlacht bei Carrhae und seinem Tod (53 v. Chr.).
Caesar setzte in seinem Konsulatsjahr unter Gewaltanwendung und Rechtsbrüchen das Gesetzgebungsprogramm durch, auf das sich die Verbündeten geeinigt hatten, und ihm wurden das in der Poebene gelegene Diesseitige Gallien mit dem Illyricum an der Ostküste der Adria und das Jenseitige Gallien als Provinz zugewiesen. Das Machtkartell der drei Verbündeten hatte Stellen, Geld und Karrierechancen zu vergeben, und es gab genug Angehörige der beiden Stände, aus denen sich die römische Oberschicht zusammensetzte, des Senatoren- und des Ritterstandes, die sich zur Unterstützung des Dreibundes gewinnen ließen. Zu ihnen gehörte Octavius’ Großvater mütterlicherseits, Caesars Schwager Marcus Atius Balbus. Er trat in die aus 20 Mitgliedern bestehende Kommission ein, deren Aufgabe die Landverteilung gemäß den umstrittenen beiden Agrargesetzen Caesars war, und beteiligte sich, so erfahren wir, an der Landverteilung in Kampanien.20 Ob Octavius’ Vater sich ebenfalls dem Machtkartell angeschlossen hätte, wenn er am Leben geblieben wäre, können wir nicht wissen. Für eine solche Annahme spräche die ihm zugeschriebene Absicht, sich nach seiner Rückkehr aus seiner Provinz um den Konsulat zu bewerben.21 Zu Recht ist gesagt worden, dass in Rom das Kernstück einer Partei die Familie und ihre verwandtschaftlichen Beziehungen waren,22 und so liegt die Annahme immerhin nahe, dass Gaius Octavius seine Kandidatur im engen Anschluss an das Machtkartell des Dreibundes betrieben hätte. Aber andererseits wirkten die brutalen Methoden, mit denen Caesar den Widerstand der Optimaten gebrochen hatte, polarisierend bis in die Familien der Aristokratie hinein. Gegen die Anhänger der Triumvirn, die sich ihnen um der eigenen Sicherheit oder des eigenen Vorteils willen angeschlossen hatten, stand der harte Kern der Senatsaristokratie, der für die kollektive Herrschaft des Senats unter Führung der alten Familien der Nobilität einstand. Gaius Octavius war, wie die Bemerkungen Ciceros zeigen, auch bei denen, die sich vom Machtkartell des Dreibundes fernhielten, ein hochangesehener Mann, und so ist zumindest nicht auszuschließen, dass er sich von dem anrüchigen Bündnis ferngehalten hätte.
Aber wie dem auch sei: Der Gegensatz zwischen dem Dreibund und den Optimaten war nicht die einzige Konstante, die die stadtrömische Politik in den fünfziger Jahren bestimmte. Rom wurde in Atem gehalten von den Umtrieben des Publius Clodius, der im Jahre 58 v. Chr. mit Hilfe der Triumvirn Volkstribun geworden war, sich jedoch von seinen Ziehvätern emanzipierte und es verstand, das Stadtvolk gegen Pompeius zu mobilisieren. Gewalt und Gegengewalt beherrschten die Szene, und mehr als einmal erwies es sich als unmöglich, die Wahlen der städtischen Magistrate ordnungsgemäß durchzuführen. Wer dem Chaos der Tagespolitik anhand der Briefe Ciceros folgt, mag geneigt sein, sich dem unübertrefflich formulierten Urteil Theodor Mommsens anzuschließen: „Man könnte ebenso gut ein Charivari auf Noten setzen als die Geschichte dieses politischen Hexensabbats schreiben wollen; es liegt auch nichts daran, all die Mordtaten, Häuserbelagerungen, Brandstiftungen und sonstigen Räuberszenen inmitten einer Weltstadt aufzuzählen und nachzurechnen, wie oft die Skala vom Zischen und Schreien zum Anspeien und Niedertreten und von da zum Steinewerfen und Schwerterzücken durchgemacht ward.“23
In diese unruhige Zeit zwischen dem Tod des Vaters und dem Ausbruch des Bürgerkriegs zwischen Caesar und Pompeius im Jahre 49 v. Chr. fiel die Kindheit des jungen Gaius Octavius. Er verbrachte sie im Haus seines Stiefvaters Lucius Marcius Philippus. Dieser gehörte wie schon sein Vater zu den nicht wenigen Angehörigen der regierenden Klasse, die sich im Streit der Parteien vorsichtig zurückhielten und es nach Möglichkeit vermieden, bei irgendeiner Seite Anstoß zu erregen. Auf diese Weise hatte er sein Konsulatsjahr (56 v. Chr.), in dem Caesar den gefährlichen Versuch seiner Gegner, den Dreibund zu sprengen, in letzter Minute vereitelt hatte, unbeschädigt überstanden. Als im Januar 49 der Bürgerkrieg ausbrach, blieb er, zumindest nach außen hin, neutral. Doch im Geheimen stand er wohl im Einverständnis mit Caesar, dem sehr daran gelegen war, dass möglichst viele Angehörige der Senatsaristokratie sich nicht mit der Regierung und Pompeius gegen ihn solidarisierten. Sein Sohn war bei Ausbruch des Bürgerkrieges Volkstribun und konnte es nicht ganz vermeiden, Flagge zu zeigen, als im Januar 49 die Beschlüsse zur Abberufung Caesars gefasst wurden. Er interzedierte in einer untergeordneten Angelegenheit gegen einen dieser Beschlüsse,24 hielt sich aber in allen entscheidenden Punkten zurück. Die durchtriebene Vorsicht war der Familie, in der Gaius Octavius aufwuchs, zur zweiten Natur geworden. Marcius Philippus hatte durch die Heirat mit Atia eine Familienverbindung mit Caesar geknüpft, aber er hatte seine Tochter aus erster Ehe dem schärfsten Gegner Caesars, dem jüngeren Cato, zur Frau gegeben. Wie immer der Streit der Parteien ausgehen mochte, worauf es ankam, war, dass der Rang der Familie unbeschädigt blieb und sie letzten Endes auf Seiten der stärkeren Bataillone stand. In diesem Milieu verbrachte der junge Gaius Octavius seine Kindheit und frühe Jugend, und es lässt sich mit gutem Grund vermuten, dass sich im Haus seines Stiefvaters gewisse Grundzüge seines Wesens ausbildeten, die eine Voraussetzung seines späteren politischen Aufstiegs waren: die mit einem ausgeprägten Machtinstinkt verbundene durchtriebene Vorsicht.
2. Jugendjahre. Die Vorbereitung auf ein Leben für die Politik
Die Kinder der großen Familien Roms waren für die Politik bestimmt. Die Töchter wurden verheiratet nach den Bedürfnissen aristokratischer Familienbündnisse, und von den Söhnen wurde erwartet, dass sie sich in Krieg und Frieden durch die Tat bewährten, die Ämterlaufbahn bis zum Führungsamt des Konsulats durchmaßen und den ererbten Familienschatz an Macht und Einfluss mehrten. Um der öffentlichen Stellung willen, die ihnen vorherbestimmt war, bedurften sie gewisser physischer und psychischer Voraussetzungen und einer Erziehung, die ihnen den Habitus der regierenden Klasse vermittelte und sie auf die Aufgabengebiete vorbereitete, in denen sie sich zu bewähren hatten.25 Als Erwachsene mussten sie ihren Mann stehen als Soldaten und Feldherren, als Ankläger und Verteidiger vor Gericht, als Berater ihrer Klienten und als Gutachter in Rechtsfragen, in der Administration von Staat und Reich, bei den Verhandlungen mit fremden Gesandten und in der Gewinnung einer Meinungsführerschaft in den politischen Gremien von Senat und Volksversammlung. Es liegt auf der Hand, dass ein solches Leben für die Politik nicht nur Ehrgeiz, Machtwille und Sachkompetenz voraussetzte, sondern auch auf gewisse natürliche Voraussetzungen angewiesen war: auf eine gute Gesundheit sowie auf körperliche und seelische Belastbarkeit.
Damit stand es von Haus aus mit dem jungen Gaius Octavius nicht zum Besten. Er war von Jugend auf kränklich.26 Er litt an häufig wiederkehrenden Erkältungen, er hatte erhebliche Hautprobleme, Blasensteine und Schwächezustände setzten ihm zu; im Laufe seines Lebens musste er mehrere schwere Krankheiten durchstehen, die ihn an den Rand des Todes brachten. Hitze und Kälte konnte er nicht ertragen. Sein linkes Bein war vom Hüftgelenk bis zum Unterschenkel schwächer als das rechte, so dass er oft hinkte, und seine Zähne waren schon in der Jugend schlecht. Auch seine psychische Belastbarkeit hatte ihre Grenzen. Der Ausnahmesituation einer offenen Feldschlacht war er nicht gewachsen, und seine ohnehin labile Gesundheit konnte in kritischen Momenten des Krieges und der Politik zusammenbrechen. Erziehung und Lebensführung mussten ausgleichen, was ihm die Natur versagt hatte. Er war von Jugend auf zur Selbstdisziplin genötigt. Ein Leben aus der Fülle jugendlicher Kraft zu führen war ihm versagt. Das hieß auf der anderen Seite, dass er den Versuchungen des süßen Lebens, der sich die jeunesse dorée in Rom hinzugeben pflegte, der Verschwendung von Zeit, Kraft und Vermögen, nicht ausgesetzt war. Unterstützt und geleitet von der an altrömischer Sittenstrenge festhaltenden Mutter führte er von Jugend auf ein Leben der Askese, das ganz seiner Ausbildung und der Vorbereitung einer politischen Karriere gewidmet war.27 Zeitlebens hielt er sich von dem unter seinen Standesgenossen verbreiteten Tafel-, Kleidungs- und Ausstattungsluxus fern. Er pflegte wenig zu essen und zu trinken, und mit Rücksicht auf seinen schwachen Magen nahm er mehrmals am Tage nur kleine, frugale Mahlzeiten zu sich. Wein trank er tagsüber nur ganz selten: „Anstatt zu trinken“, schreibt sein Biograph Sueton, „pflegte er ein in kaltes Wasser getauchtes Stück Brot oder ein Stück Gurke, einen Lattichstengel oder auch frisches oder getrocknetes Obst mit leichtem Weingeschmack zu sich zu nehmen.“28
Die ersten vier Lebensjahre verbrachte das Kind auf einem Landgut des Großvaters bei Velitrae. Das Kinderzimmer, das noch in der Zeit Kaiser Hadrians als heiliger Ort verehrt wurde, war klein und bescheiden, nicht größer, wie unser Gewährsmann überliefert, als eine Vorratskammer.29 Der Vater, der in Rom seine politische Karriere beförderte und nach seiner Praetur die Provinz Macedonia verwaltete, kann sich nur wenig um den Sohn gekümmert haben. Als er im Jahre 59 plötzlich starb, war Octavius gerade vier Jahre alt, zu jung also, als dass seine Erziehung bereits einem Hauslehrer hätte anvertraut werden können. Dies geschah dann im Haus seines Stiefvaters Marcius Philippus. Dort kümmerten sich die Eltern, die Mutter und der Stiefvater gemeinsam, so wird berichtet, um seine Ausbildung und vertrauten ihn einem gebildeten Sklaven namens Sphaerus an.30 Wie der Name anzeigt, stammte er wohl aus dem griechischsprachigen Osten. Zu seinen Aufgaben gehörte neben der Beaufsichtigung und Unterrichtung des Knaben in den elementaren Kulturtechniken des Lesens, Schreibens und Rechnens die Einführung ins Griechische, dessen Kenntnis für alle Angehörigen der römischen Aristokratie seit der Mitte des zweiten Jahrhunderts v. Chr. obligatorisch war. Der junge Octavius lernte die Sprache, schätzte auch die klassische Literatur der Griechen, wurde aber nie im Griechischen so heimisch, dass er es fließend sprach oder sich getraut hätte, ohne die Hilfe von Übersetzern einen griechischen Brief aufzusetzen.31 Gaius Octavius erwies seinem ersten Lehrer eine Anhänglichkeit, wie sie sonst vor allem für das Verhältnis von Amme und Zögling vielfach bezeugt ist. Als Erwachsener ließ er den ehemaligen Lehrer frei, und als Sphaerus im Jahr 40 v. Chr. starb, richtete er, obwohl er damals in einen Bürgerkrieg auf Leben und Tod verstrickt war, dem Verstorbenen ein öffentliches Begräbnis aus.32 Er würdigte ihn damit der gleichen Ehre wie seine eigene Mutter, die zwei Jahre vorher verstorben war.33 Eltern und Hauslehrer pflegten bei der Erziehung der Kinder eng zusammenzuarbeiten, und es war nicht unüblich, dass ein Vater beziehungsweise die Mutter dabei mitwirkten, ihren Kindern elementare Fähigkeiten und Kenntnisse beizubringen. Von Augustus ist überliefert, dass er später es sich nicht nehmen ließ, seine Enkel, die er adoptiert hatte, im Lesen, Schreiben und Rechnen sowie in anderen Disziplinen zu unterrichten.34 Ob Marcius Philippus sich mit seinem Stiefsohn die gleiche Mühe machte, steht dahin. Aber soviel ist überliefert, dass beide Elternteile der Erziehung des Sohnes große Aufmerksamkeit schenkten. In seiner Lebensbeschreibung des Augustus notiert Nikolaos von Damaskus: „Seine Mutter und ihr Mann Philippus kümmerten sich um ihn. Jeden Tag fragten sie die Lehrer und Beschützer, die sie dem Jungen gegeben hatten, was er getan habe, wohin er gegangen sei und wie und mit wem er den Tag verbracht habe.“35
Die Erziehung eines Heranwachsenden, der dazu bestimmt war, in die regierende Klasse Roms einzutreten, war an dem Ziel ausgerichtet, ihm die Fähigkeiten zu übermitteln, die er brauchte, sich in Krieg und Frieden zu bewähren und im Konkurrenzkampf mit seinen Standesgenossen zu bestehen. Er musste auf die Rolle des Feldherrn und auf den Kampf mit der Waffe des Wortes vorbereitet werden. Er musste Schwimmen und Reiten lernen, und er hatte sich so früh wie möglich im Gebrauch von Waffen zu üben. Auch dem jungen Octavius blieb das nicht erspart,36 aber er machte, kein Wunder bei seiner Konstitution, keine gute Figur in den Künsten des Reitens, Fechtens und Speerwerfens. Dennoch hielt er aus und setzte seine Waffenübungen über die Zeit seiner Ausbildung hinaus bis zum Ende der Bürgerkriege, also bis zum Jahr 30 v. Chr., fort. Dann gab er diese Pflichtübungen erleichtert auf und beschränkte seine körperliche Betätigung auf das Ballspiel und verschaffte sich daneben Bewegung durch Spazierengehen.37
Dafür war Octavius ein brillanter Schüler in den Disziplinen, die der intellektuellen Schulung des künftigen Redners und Politikers dienten.38 Auf diesem Feld zeigte er sich, wie wenigstens Nikolaos von Damaskus behauptet, sogar seinen Lehrern überlegen. Gelesen und interpretiert wurden Werke der griechischen und lateinischen Literatur, sowohl Dichtung als auch Prosa, dann folgte die theoretische und praktische Unterrichtung in der Kunst der Rede sowie ein ergänzendes Studium der Philosophie.39 Rhetorik und Philosophie waren von Haus aus Gewächse der griechischen Geisteskultur, und dies erklärt neben der Notwendigkeit zum Erlernen der griechischen Sprache als der lingua franca der damaligen Welt die starke Stellung griechischer Lehrer und griechischer Werke in der römischen Jugendbildung. Dem griechischen Bildungsgang war im ersten Jahrhundert v. Chr. freilich ein analoger in lateinischer Sprache an die Seite getreten. Es gab inzwischen eine lateinische Literatur, römische Grammatiker, das heißt Literaturlehrer, und Rhetoren. Nur auf dem Feld der Philosophie war Rom, wie Cicero wiederholt betonte, noch im Rückstand. Cicero selbst machte sich in der Zeit der Alleinherrschaft Caesars, also noch in Octavius’ Jugendzeit, an eine umfassende Darstellung der hellenistischen Philosophie in lateinischer Sprache, und er hatte dabei nicht zuletzt das Ziel ins Auge gefasst, einen Beitrag zur politisch-moralischen Erziehung der zur politischen Führung bestimmten Jugend zu leisten. Dieser gesellschaftlichen Rolle hatten sich seit dem zweiten Jahrhundert v. Chr. insbesondere die Stoiker angepasst, und es ist sicher kein Zufall, dass die beiden Philosophen, die als Lehrer des jungen Gaius Octavius genannt werden, Vertreter dieser Schule waren: der aus Alexandria stammende Areios, bei dem er zusammen mit dessen Söhnen Dionysios und Nikanor Unterricht erhielt,40 und Athenodoros, der Sohn des Sandon aus dem kilikischen Tarsos.41 Zu beiden Philosophen unterhielt er über seine Studienzeit hinaus gute Beziehungen und verwendete sie als seine Vertrauten in verschiedenen Funktionen. Areios fungierte als sein Prokurator in Sizilien, und als er seinen Rivalen Marcus Antonius beseitigt und sich in den Besitz Ägyptens gesetzt hatte, zeichnete er Areios besonders aus, indem er in Alexandria öffentlich erklärte, sein alter Lehrer sei einer der drei Gründe, warum er die Stadt verschone. Doch wusste der Philosoph seine Unabhängigkeit zu wahren. Das Angebot, die Leitung der Finanzverwaltung Ägyptens zu übernehmen, lehnte er ab. Athenodoros gelangte etwa zur selben Zeit an die Spitze seiner Heimatstadt Tarsos, wo er die Herrschaft des Boethos, eines Vertrauensmannes des Antonius, beendete und Tarsos eine neue Verfassung gab. Was die Rhetorik anbelangt, die Schlüsseldisziplin für die Ausbildung künftiger Politiker, hatte Octavius einen lateinischen und einen griechischen Lehrer: Marcus Epidius, der in Rom eine renommierte lateinische Rhetorenschule betrieb – als prominente Schüler werden neben Augustus der Triumvir Antonius und der Dichter Vergil genannt – und Apollodoros von Pergamon, einer der gefeiertsten Redelehrer der griechischen Welt, der ihn in Rom unterrichtete und gegen Ende des Jahres 45 über die Adria nach Apollonia folgte, um ihm dort in der griechischen Stadt weiter Unterricht zu geben.42
Wie es üblich war, setzte Gaius Octavius seine Studien fort, nachdem er in feierlicher Form durch Anlegung der Bürgertoga auf dem Forum für volljährig erklärt worden war. Dieses Ereignis fand am 18. Oktober 48 statt, also kurz nach seinem 15. Geburtstag.43 In seiner mit Unterbrechungen bis in die ersten Monate des Jahres 44 dauernden Studienzeit legte er die Fundamente seiner ausgezeichneten Kenntnis der griechischen und lateinischen Literatur, und er besaß zeitlebens ein sicheres ästhetisches Urteil über literarische Qualität. Als er später auf dem Gipfel der Macht stand, legte er den größten Wert darauf, dass nur die besten Autoren ihn und sein Werk sich zum Thema wählten: Er dachte dabei vorzugsweise an Vergil und Horaz.44 Die Beschäftigung mit Dichtung und Prosa führte wie bei anderen auch zu frühen Versuchen eigener Produktion.45 Er schrieb Epigramme und verstand es, Pasquille in der Art Catulls zu verfassen, eines gegen seinen Rivalen Antonius aus späterer Zeit ist erhalten.46 Aus dem Aias-Mythos nahm er den Stoff für eine Tragödie, aber als er merkte, dass seine Gestaltungskraft nicht ausreichte, tilgte er, was er geschrieben hatte. Als er von einem Freund nach den Fortschritten seines „Aiax“ gefragt wurde, antwortete er mit ironischer Anspielung auf den Selbstmord des Helden: „Er hat sich in den Schwamm gestürzt.“47 Ebenfalls in die Jugendzeit dürften die „Ermahnungen zur Philosophie“, eine Frucht des philosophischen Unterrichts, gehören.48 Ob das Gedicht über Sizilien, von dem nur der Titel erhalten ist, ein Lehrgedicht geographischen Inhalts war, wissen wir ebenso wenig wie die Abfassungszeit.49 Obwohl Augustus zeitlebens eine Sensibilität für die ästhetische Qualität von Dichtung besaß, war sein Verhältnis zur Literatur doch weitaus stärker von einer moralischen und zweckrationalen Einstellung bestimmt. Ein so eleganter und geistvoller Dichter lasziver Liebesverhältnisse wie Ovid fand später keine Gnade vor den Augen des Reformers, der sich die Wiederherstellung altrömischer Sittenstrenge zum Ziel setzte. Er war gewohnt, sich aus beiden Literaturen, der griechischen wie der römischen, Auszüge mit Vorschriften und Beispielen anzufertigen, die ihm nützlich zum Gebrauch im privaten wie im öffentlichen Leben zu sein schienen.50
Was das Reden anbelangt, so hatte Gaius Octavius von Jugend auf mit Stimmproblemen zu kämpfen.51 Wenn Erkältungen und Heiserkeit hinzukamen, war er unfähig, vor einem größeren Publikum zu sprechen. Dann musste er vorlesen lassen, was er schriftlich ausgearbeitet hatte. Bei zunehmender Schwäche im hohen Alter war er ganz auf schriftliche Kommunikation angewiesen. Aber in der Jugend kämpfte er mit aller Macht gegen die Benachteiligung mangelnder Stimmkraft an. Bei der Redeübung des Deklamierens bediente er sich eines Stimmbildners, und er lebte, wie Nikolaos von Damaskus zu berichten weiß, nach der Pubertät im Interesse einer Kräftigung seiner Konstitution und seiner Stimme ein ganzes Jahr sexuell enthaltsam52, was ihm bei seiner bleibenden Vorliebe für junge Schönheiten gewiss nicht leicht gefallen sein wird. Seine Redeübungen setzte er auch nach Beendigung seiner Ausbildung fort, selbst in den Bedrängnissen des Mutinensischen Krieges (43 v. Chr.), so erfahren wir, ließ er nicht davon ab.53 Octavius besaß die Fähigkeit der freien, flüssigen Rede, er war schlagfertig und verstand es, die scharfen Waffen der Ironie und des Sarkasmus glänzend zu handhaben.54 Doch vermied er, wenn es um wichtige Dinge ging, die Stegreifrede. Seine öffentlichen Reden arbeitete er sorgfältig bis in den Wortlaut hinein schriftlich aus und las den Text vom Blatt ab. Das entsprach nicht antiken Gepflogenheiten und wurde entsprechend vermerkt.55 Auch in wichtige Unterredungen ging er mit schriftlicher Vorbereitung, selbst bei seiner klugen dritten Ehefrau Livia, deren Rat er oft suchte, machte er keine Ausnahme.56 Offenbar hatte er sich schon in der Jugend angewöhnt, nichts dem Zufall zu überlassen und sich mit äußerster Konzentration auf jede Situation vorzubereiten.
Zweckrationalität war dem jungen Octavius schon früh zur zweiten Natur geworden, und dem entsprach sein Redestil. Ausgestattet mit überragender Intelligenz erfasste er leicht und schnell den springenden Punkt dessen, was gesagt werden musste oder sollte, und er richtete sein ganzes Augenmerk darauf, dies klar und schnörkellos zum Ausdruck zu bringen. Die Erregung von Affekten, die als höchste Leistung der Redekunst galt, war seine Sache nicht, und in Apollodoros von Pergamon hatte er einen Lehrer, der ihn in seiner Neigung zu rationalem Argumentieren und klarer Komposition bestärkt zu haben scheint.57 Wie Caesar mied er alle ungewöhnlichen Worte, und die Liebhaber eines altertümelnden Stils verlachte er ebenso wie alle diejenigen, die sich einer gesuchten oder schwülstigen Ausdrucksweise bedienten.58 Von der Höhe geistiger und sprachlicher Überlegenheit herab kanzelte er später Antonius wegen seiner Unfähigkeit, sich klar auszudrücken, und wegen seines schlechten, zwischen Extremen schwankenden Stils ab: „Und du hast noch Zweifel, ob du Cimber Annius oder Veranius Flaccus nachahmen sollst, in der Weise, dass du die Wörter verwendest, die Crispus Sallustius aus den ‚Ursprüngen‘ des Cato exzerpiert hat, oder ob du die gedankenleere Wortfülle der asianischen Redner in unsere Sprache übernehmen sollst?“59 Auch von der gezierten und verschnörkelten Redeweise seines Freundes Maecenas hielt er nichts. Aber während er den politischen Gegner im Krieg der Worte erbarmungslos bloßstellte, wurde der Freund nur mit gutmütigem Spott bedacht.60
Während seiner Ausbildungszeit geriet Octavius zunächst unmerklich, dann immer stärker in das Gravitationsfeld seines Großonkels Gaius Iulius Caesar. Im Jahre 51 v. Chr., als Caesar dabei war, die Unterwerfung Galliens zu vollenden, starb seine Schwester, Octavius’ Großmutter. Der noch nicht Zwölfjährige war nach Caesar der nächste männliche Verwandte der Verstorbenen, und so fiel ihm die Aufgabe zu, der Großmutter die Grabrede zu halten und dabei der Öffentlichkeit das Alter und den Ruhm des Iulischen Geschlechts in Erinnerung zu rufen.61 Dann brach zum Jahreswechsel 50/49 der Bürgerkrieg aus.62 Caesars Gegnern aus dem optimatischen Lager war es gelungen, Pompeius von seinem politischen Bündnispartner zu trennen und auf ihre Seite zu ziehen. Ihr Plan war, Caesar zum frühestmöglichen Zeitpunkt aus Gallien abzuberufen, damit er als amtloser Bewerber um den Konsulat für das Jahr 48 wegen der vielen Rechtsbrüche, die er in seinem ersten Konsulat begangen hatte, in Rom vor Gericht gezogen und verurteilt würde. Das hätte nach menschlichem Ermessen das Ende seiner politischen Karriere bedeutet. Dahin ließ es Caesar freilich nicht kommen. Er beantwortete den Abberufungsbeschluss vom 7. Januar 49 umgehend mit der Eröffnung des Bürgerkrieges. Er wollte seinen Feinden keine Zeit lassen, die Ressourcen Italiens und des Römischen Reiches gegen ihn zu mobilisieren. In zwei Monaten bemächtigte er sich der gesamten italischen Halbinsel und zwang Pompeius und die Regierung zur Flucht über die Adria, dann manövrierte er in einem brillanten Feldzug die Generäle des Pompeius in Spanien aus, so dass sie Anfang August 48 kapitulieren mussten, und im folgenden Jahr trug er den Krieg über das Adriatische Meer nach Griechenland, wo Pompeius eine gewaltige Streitmacht zusammengezogen hatte. Caesar gelang es, sich aus der prekären Lage zu befreien, in die er bei Dyrrhachium geraten war, und am 9. August 48 gewann er in Thessalien die Entscheidungsschlacht bei Pharsalos. Er folgte dem flüchtenden Pompeius nach Ägypten, traf ihn aber nicht mehr lebend an. Die vormundschaftliche Regierung, die in Alexandria die Geschäfte führte, hatte ihn am 28. September bei der Landung im Hafen umbringen lassen. Caesar wurde in die Thronstreitigkeiten der Ptolemäer verwickelt, blieb mehrere Monate in Alexandria und im Osten des Reiches und kehrte erst Anfang Oktober 47 nach Rom zurück. Was Gaius Octavius anbelangt, so ließen ihn die Eltern bei Ausbruch des Bürgerkrieges aus Rom in die Sicherheit eines der väterlichen Landgüter bringen.63 Als der Feldzug in Italien beendet und Pompeius mitsamt der Regierung geflohen war, kehrte er nach Rom zurück. Im Oktober 48 wurde er mit der feierlichen Anlegung der Bürgertoga für volljährig erklärt und erhielt als Fünfzehnjähriger die Priesterstelle im Leitungsgremium der römischen Staatsreligion, die durch den Tod des in der Schlacht bei Pharsalos gefallenen Caesargegners Lucius Domitius Ahenobarbus frei geworden war.64 Es bedarf keines Beweises, dass dies mit Rücksicht auf Octavius’ Verwandtschaft mit dem Sieger von Pharsalos geschah. Ungefähr ein halbes Jahr später, im Frühjahr 47, durfte der noch nicht Sechzehnjährige mit dem Titel eines Stadtpraefekten für einen Tag als Ersatzkonsul in Rom fungieren, als die ordentlichen Magistrate am Latinerfest in feierlicher Prozession zum Heiligtum des Iuppiter Latiaris in den Albanerbergen zogen, um dem Gott von Staats wegen ein Opfer darzubringen.65 Das war eine Ehre, die jungen Männern aus den großen alten Familien Roms in Vorwegnahme ihrer künftigen Stellung erwiesen wurde. Der junge Gaius Octavius, der von Haus aus nicht zu dieser Nobilität gehörte, hatte auch diese Ehre wiederum seinem Großonkel zu verdanken. Offenbar hatte er sich auf seinen öffentlichen Auftritt gut vorbereitet. Nikolaos von Damaskus weiß zu berichten, dass der junge Stadtpraefekt mit den Rechtsauskünften, die er anstelle der Konsuln und Praetoren gab, großes Aufsehen erregte. Die Übermittlung von Elementarkenntnissen im römischen Recht gehörte zum Ausbildungsprogramm künftiger Senatoren, und durch die Prägung im Elternhaus, in das ratsuchende Klienten ein- und auszugehen pflegten, mag ein junger Mann die Sachkenntnis und die Selbstsicherheit gewonnnen haben, die ihn die Probe des ersten Auftritts in amtlicher Funktion bestehen ließen. Überhaupt rückte Octavius immer stärker in den Mittelpunkt öffentlicher Aufmerksamkeit. Als nächster männlicher Verwandter Caesars drängten sich Altersgenossen und Mitschüler an ihn heran, die sich von ihm eine Förderung ihrer Karriere oder sonstige Vorteile versprachen. Wenn er die Stadt verließ, um sich im Reiten zu üben oder um Besuche zu machen, gaben sie ihm in großer Zahl das Geleit.66 Damals schloss er mit Marcus Vipsanius Agrippa, der später sein wichtigster Helfer und sein Schwiegersohn werden sollte, Freundschaft fürs Leben.
Caesar kehrte im Oktober 47 nach Rom zurück, doch schon im Dezember brach er nach Nordafrika auf, um das neue republikanische Widerstandszentrum, das sich dort gebildet hatte, zu zerschlagen. Octavius wollte seinen Großonkel begleiten, um unter dessen Aufsicht erste praktische Erfahrungen im Kriegswesen zu sammeln. Ein derartiges Praktikum gehörte ebenso zur Vorbereitung auf die Ämterlaufbahn, den so genannten cursus honorum, wie das intensive Studium der Rhetorik und der enge Anschluss an einen der als Sachwalter und Politiker auf dem Forum tätigen erfolgreichen Senatoren. Freilich war im Lärm des Bürgerkriegs die Redekunst verstummt. Auf dem Feld der Auseinandersetzungen vor Gericht und Volksversammlung gab es ähnlich wie zur Jugendzeit Ciceros nichts zu lernen. Anders stand es mit der Kunst des Krieges. Hier hätte Octavius bei dem größten Feldherrn der Zeit in die Lehre gehen können. Doch Atia, die Mutter, erhob Einspruch, und der Sohn gehorchte.67 Seine Gesundheit war viel zu ungefestigt, und man hielt es in der Familie für besser, wenn er zu Hause bliebe und seine gewohnte Lebensweise beibehalte.
Octavius’ Fernbleiben vom afrikanischen Kriegsschauplatz hinderte Caesar nicht daran, seinen Großneffen anlässlich seines mit großem Aufwand gefeierten Triumphes (20.–30. September 46, das entspricht der Zeit vom 20. bis 30. Juli nach dem reformierten Julianischen Kalender) mit militärischen Auszeichnungen zu ehren. Im Schmuck dieser Auszeichnungen durfte er dem Triumphwagen folgen, „als ob er Caesars Zeltgenosse in diesem Feldzug gewesen wäre“.68 Vor allem aber: Caesar ließ ihn als Mittelsmann gewähren, der die Anliegen von Bittstellern vor dem Diktator vertrat. Der Bruder seines Freundes Agrippa hatte auf Seiten der Republikaner gekämpft und war in Gefangenschaft geraten. Agrippa bat den Freund, sich für den Gefangenen zu verwenden, und Octavius erwirkte die Begnadigung durch Caesar.69 Überhaupt hatte seine Vermittlungstätigkeit meist Erfolg,70 und es darf wohl mit gutem Grund vermutet werden, dass die Rolle, die er spielte, mit seinem Großonkel abgesprochen und Teil des von Caesar verfolgten Planes war, seinem Großneffen den Weg zu Einfluss und Macht zu ebnen. Ihn einer größeren Öffentlichkeit bekannt machen sollte die ihm von Caesar übertragene Ausrichtung der Aufführungen im griechischen Theater. Octavius ging mit vollem Einsatz seiner Kräfte zu Werke, aber seine schwache Konstitution war überfordert. Er brach zusammen. An den heißesten Tagen des Jahres setzte er sich im Theater der Sonne aus und erlitt einen Hitzschlag.71
Als Caesar im November 46 nach Spanien in den Krieg gegen die Söhne des Pompeius zog, war Octavius noch immer nicht von dem Zusammenbruch, den er im Sommer erlitten hatte, wiederhergestellt. Er musste wieder zu Hause bleiben. Erst zu Beginn des folgenden Jahres reiste er Caesar mit kleinem Gefolge nach – die Begleitung der Mutter lehnte er ab. Die Reise war nicht ohne Gefahren. Er erlitt Schiffbruch und musste zu Lande seinen Weg auf Straßen nehmen, die vom Feind bedroht waren. Als er Caesar schließlich in der Nähe von Carteia erreichte, hatte dieser schon die Entscheidungsschlacht bei Munda (17. März 45 v. Chr.) gewonnen.72 Nun fand er Aufnahme in den Stab seines Großonkels, der ihn genau beobachtete und häufig ins Gespräch zog. Folgt man der Darstellung des Nikolaos von Damaskus, dann bestand er die Probe auf das glänzendste: „Als Caesar erkannte, dass Octavius treffsicher, verständig und prägnant im Ausdruck war und immer die passenden Antworten gab, schloss er ihn in sein Herz und mochte ihn sehr.“73