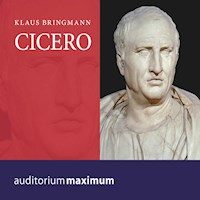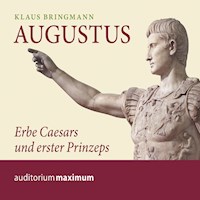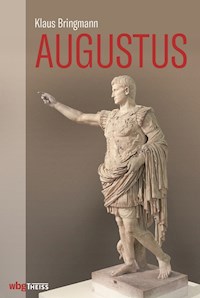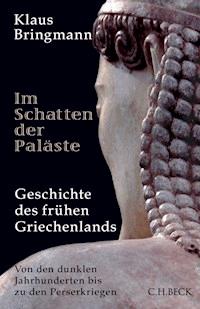
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wann beginnt die griechische Geschichte? Mit den mykenischen Palästen? Mit Homer? Oder gar erst mit der Zeit Herodots, des Vaters der Geschichtsschreibung? Klaus Bringmann rückt jede Phase der griechischen Frühgeschichte ins rechte Licht und entwirft ein eindrucksvolles Epochenportrait, das die Zeit vom 12. bis zum 5. Jahrhundert v. Chr. umfasst. Spannend und anschaulich beschreibt Klaus Bringmann die Welt der griechischen Frühzeit mit ihren Hunderten von Stammesgemeinden und Stadtstaaten. Er erläutert ihre verbindenden Elemente – Sprache, Wanderungs-und Kolonisationsbewegungen, Kunst, Kultur und Religion -, betont die Bedeutung des Meeres für die Griechen, die prägende Rolle des Adels in Politik und Kultur, zeigt aber auch die Notwendigkeit auf, Machtgier und Skrupellosigkeit der Führungsschicht durch die Ausbildung von Rechtsordnungen und staatlichen Strukturen einzuhegen. Schließlich erhellt er die Entstehung der bipolaren griechischen Welt mit den Machtzentren Athen und Sparta und richtet zuletzt den Blick auf die erste große äußere Bedrohung des griechischen Kosmos durch die Perser, die das griechische Gemeinschaftsbewusstsein politisierte und die griechische Geschichte in neue Bahnen lenkte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Klaus Bringmann
IM SCHATTEN DER PALÄSTE
GESCHICHTE DES FRÜHEN GRIECHENLANDS
Von den Dunklen Jahrhunderten bis zu den Perserkriegen
VERLAG C.H.BECK
ZUM BUCH
Wann beginnt die griechische Geschichte? Mit den mykenischen Palästen? Mit Homer? Oder gar erst mit der Zeit Herodots, des Vaters der Geschichtsschreibung? In diesem Werk wird jede Phase der griechischen Frühgeschichte ins rechte Licht gerückt; es bietet ein eindrucksvolles Epochenportrait, das die Zeit vom 12. bis zum 5. Jahrhundert v. Chr. umfasst.
Gestützt auf die Erkenntnisse der Archäologie und die gründliche Erforschung der Schriftquellen beschreibt Klaus Bringmann spannend und anschaulich die Welt der griechischen Frühzeit mit ihren Hunderten von Stammesgemeinden und Stadtstaaten. Er erläutert ihre verbindenden Elemente – Sprache, Wanderungs- und Kolonisationsbewegungen, Kunst, Kultur und Religion –, betont die Bedeutung des Meeres für die Griechen und ihren Weg durch die Geschichte, erklärt die prägende Rolle des Adels in Politik und Kultur, zeigt aber auch die Notwendigkeit auf, Machtgier und Skrupellosigkeit der Führungsschicht durch die Ausbildung von Rechtsordnungen und staatlichen Strukturen einzuhegen. Sodann erhellt er die Entstehung der bipolaren griechischen Welt mit den Machtzentren Athen und Sparta und richtet schließlich den Blick auf die erste große äußere Bedrohung des griechischen Kosmos durch die Perser, die das griechische Gemeinschaftsbewusstsein politisierte und die griechische Geschichte in neue Bahnen lenkte.
ÜBER DEN AUTOR
Klaus Bringmann lehrte bis zu seiner Emeritierung an der Goethe-Universität Frankfurt/Main. Von demselben Autor liegen im Verlag C.H.Beck vor: Kleine Kulturgeschichte der Antike (2011); Geschichte der römischen Republik. Von den Anfängen bis Augustus (22010); Römische Geschichte. Von den Anfängen bis zur Spätantike (102010).
INHALT
VORWORT
ZUR EINFÜHRUNG
I. VORAUSSETZUNGEN
1. Der Schauplatz: Land und Meer
2. Die Vorgeschichte
3. Die Dunklen Jahrhunderte
II. DIE WELT HOMERS UND HESIODS
III. MIGRATION
1. Der Aufbruch zu neuen Ufern
2. Die griechische Kolonisation
IV. STAATENBILDUNG
1. Sparta: Die Entstehung einer Führungsmacht
2. Adelsherrschaft und Tyrannis
3. Athen: Der Kampf gegen die Gefahr einer Tyrannis.Die Gesetzeskodifikationen Drakons und Solons
4. Die Peisistratiden und Kleisthenes:Tyrannis und Gemeinschaft der Bürger im Widerstreit
V. DER KAMPF UM DIE FREIHEIT
1. Die Griechen Kleinasiens unter persischer Herrschaft
2. Die Abwehr der persischen Invasion und die Entstehung der Demokratie in Athen
VI. DIE WISSENSKULTUR DER SPÄTARCHAISCHEN ZEIT
RÜCKBLICK UND AUSBLICK
ANHANG
Hinweise zu Quellen und weiterführender Literatur
VERZEICHNIS DER QUELLENZITATE
REGISTER
Griechen aus der Antike
Nichtgriechen aus der Antike
Nicht aufgenommen sind die Namen der Usurpatoren und Länder, die in der Behistun-Inschrift (S. 270 f.) aufgelistet sind
Personen aus Mittelalter und Neuzeit
Götter und Göttinnen
Heroen und Personen der homerischen Epen
Geographische Begriffe
Athen und Sparta (Lakedaimon/Lakonien) stehen passim und sind deshalb nicht in das Ortsregister aufgenommen
ABBILDUNGSNACHWEIS
IN MEMORIAM EBERHARD RUSCHENBUSCH 1924–2007
VORWORT
Eine griechische Geschichte der archaischen Zeit von den Anfängen bis zu den Perserkriegen in Form einer fortlaufenden Ereignisgeschichte zu schreiben ist unmöglich. Dies liegt nicht nur an dem Mangel an authentischen Zeugnissen, ohne die das Dunkel der Vergangenheit nicht erhellt werden kann. Für die Frühgeschichte Roms ist die Quellenlage auch nicht besser, eher noch schlechter. Aber Rom war ein Stadtstaat, der als kollektives Subjekt in Erscheinung trat und eine letztlich gradlinige Entwicklung von kleinen Anfängen zur Herrin Italiens und zum Mittelpunkt eines Weltreiches nahm. Nichts von alledem gilt für Griechenland mit seinen Hunderten von Stadtstaaten und Stammesgemeinden. Und was die Anfänge ihrer Geschichte anbelangt, glaubten die Römer zu wissen, dass ihre Stadt am 21. April des Jahres 753 v. Chr. gegründet worden sei. Auch wenn die moderne Geschichtswissenschaft dieses Datum in Frage stellt, so ist doch unstrittig, dass die Geschichte Roms ihren Anfang mit einer Stadtgründung nahm. Für die Bestimmung der Anfänge der griechischen Geschichte sind einzelne Daten von Stadtgründungen bedeutungslos. Die Frage ist also: Ab wann können wir von griechischer Geschichte sprechen? Beginnt sie mit der mykenischen Palastkultur des zweiten Jahrtausends, deren schriftliche Zeugnisse, wie man seit der Entzifferung des Schriftsystems Linear B weiß, in griechischer Sprache abgefasst sind, oder mit der Zerstörung dieser Palastkultur um 1200 v. Chr.? Oder sollte man griechische Geschichte mit dem achten Jahrhundert beginnen lassen, als die Griechen wie aus dem Nichts zu neuen Ufern, im wortwörtlichen und im übertragenen Sinn, aufbrachen, und eine Schriftkultur neu entstand, die unseren Einblick in die Lebensverhältnisse der Zeit wesentlich erweitert? Zumindest ist die Zeit vom achten Jahrhundert bis zu den Perserkriegen die Epoche, in der die Bildung der spezifisch griechischen Lebensform in der Antike stattfand und die vorhandenen Quellen, die schriftliche Überlieferung und die Überreste der materiellen Kultur, die Darstellung dieses Prozesses in großen Zügen erlauben.
Wie dem auch sei: Die griechische Geschichte seit dem achten Jahrhundert beruht ebenso wie die Epoche der mykenischen Palastkultur im zweiten Jahrtausend auf älteren Voraussetzungen, auf der Entwicklung der materiellen Kultur seit der Jungsteinzeit, auf der Differenzierung der indogermanischen Sprachfamilie und auf Wanderbewegungen, die Griechisch sprechende Stämme in die südlichen Ausläufer der Balkanhalbinsel brachten. Dies alles gehört ebenso wie die von einer vorgriechischen Bevölkerung getragene minoische Palastkultur auf Kreta, die der mykenischen vorausging, zur Vorgeschichte der mit dem achten Jahrhundert beginnenden Zeit der Geschichte Griechenlands, die seit Alfred Heuß als die archaische bezeichnet zu werden pflegt. Entsprechend dieser Einschätzung bin ich in der Darstellung verfahren und habe die Voraussetzungen und Anfänge der Geschichte der archaischen Zeit, soweit dies möglich ist, in einem gesonderten Kapitel erläutert.
Wie bereits oben angedeutet worden ist, verfügen wir zur Geschichte der archaischen Zeit Griechenlands, anders als für die vorhergehenden Epochen, über einen Fundus an Schriftquellen. Gewiss bleiben Bodenfunde auch für die Zeit, in der Schriftzeugnisse existieren, eine wichtige, zur Kenntnis bestimmter Teilaspekte Grundlegendes beitragende Quellengattung. Doch mit den Schriftzeugnissen erweitert sich für den Historiker die Möglichkeit, vergangene Lebenswirklichkeit in ihrer Komplexität zu erkennen und darzustellen. Dies gilt freilich nicht für die Ereignisgeschichte. Historische Überlieferung entstand erst im fünften Jahrhundert mit Herodot, dem ersten Historiker im Kosmos der griechischen Literatur. Was an Dichtung der verschiedenen Gattungen, an Inschriften und Gesetzesfragmenten vorhanden ist, beleuchtet Lebensverhältnisse, erlaubt aber keine an der Ereignisgeschichte orientierte fortlaufende Erzählung. So habe ich es für sinnvoll gehalten, traditionelle Erzählungen nicht variierend nachzuerzählen, sondern mich anhand der Quellen der Epoche auf die Darstellung der Zeitverhältnisse und ihres Wandels zu konzentrieren. Um dabei größtmögliche Anschaulichkeit zu erreichen, habe ich eine große Zahl von Übersetzungen aus Schriftquellen und Abbildungen von Werken der bildenden Kunst in dieses Buch aufgenommen. Die Namen der Übersetzer sind jeweils hinzugefügt, ohne Namensnennung bleiben eigene Übertragungen bzw. solche, deren Urheber nicht festgestellt werden konnten. An einigen wenigen Stellen habe ich mich nicht gescheut, den Abdruck eines Zitats zu wiederholen, wenn es unter einem anderen Gesichtspunkt als beim ersten Mal betrachtet wird.
Der Leser dieses Buches möge entscheiden, ob es mit dieser Methode gelungen ist, ein anschauliches Bild der Verhältnisse zu schildern, unter denen die spezifisch griechische Lebensweise entstanden ist.
Zum Schluss sage ich denen herzlichen Dank, ohne deren Hilfe ich dieses Buch nicht hätte vollenden können. Frau Janine Aures hat mich bei der Erstellung der Endfassung unterstützt, mein Freund Prof. Dr. Dieter Flach hat das Manuskript kritisch durchgesehen und manche Verbesserung beigesteuert. Frau Dr. Ursula Mandel, Universität Frankfurt, hat mich bei der Auswahl, Beschaffung und Präsentation der Abbildungen beraten und unterstützt. Besonderen Dank schulde ich dem Lektorat des Verlags. Frau Andrea Morgan hat sich um die Drucklegung des Bands verdient gemacht, und ohne die Ermutigung und Unterstützung von Herrn Dr. Stefan von der Lahr wäre das Buch, das nach menschlichem Ermessen mein letztes sein wird, nicht entstanden.
Bad Homburg, im März 2016
Klaus Bringmann
ZUR EINFÜHRUNG
Eine Geschichte der Griechen in der Antike zu schreiben ist mindestens ebenso schwierig, vielleicht noch schwieriger als eine Geschichte der Deutschen. Das vor einigen Jahren von Morgens Herman Hansen und Thomas Heine Nielsen herausgegebene Handbuch der griechischen Staatenwelt, An Inventory of Archaic and Classical Poleis, führt insgesamt, wenn ich richtig gezählt habe, 1035 politische Einheiten auf. Vergleichbar war die territoriale Zersplitterung des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation in der frühen Neuzeit, als unter Einschluss der Reichs- und Freien Städte sowie der Reichsritterschaft knapp zweitausend Landesherrschaften existierten. Aber diese waren eingebunden in eine übergreifende, durch den Dualismus von Kaiser und Reich geprägte Organisation zur Verteidigung nach außen und zur Friedenswahrung im Inneren. Eine politische Geschichte Deutschlands vor der Reichsgründung des Jahres 1871 zu schreiben, ist unter diesen Umständen ein schwieriges Problem, das weder von den schwach ausgebildeten übergreifenden Institutionen noch von den einzelnen, halbsouveränen Territorien oder, seit dem Ende des Heiligen Römischen Reiches, völlig souveränen Staaten her zu lösen möglich erscheint. Nicht ohne Grund hat deshalb der Neuzeithistoriker Hagen Schulze seine Erörterung des Problems unter die provokative Frage gestellt: «Gibt es überhaupt eine deutsche Geschichte?»
Mit noch größerem Recht könnte man die Frage in Hinblick auf die Geschichte der Griechen in der Antike stellen. Die rund tausend griechischen Gemeinden besaßen keine übergreifenden politischen Institutionen, die für zwischenstaatlichen Frieden oder für Verteidigung gegen Angriffe von außen sorgen konnten. Krieg und Gewaltanwendung zwischen Nachbarn waren je nach Umständen jederzeit ebenso möglich wie die strikte Beschränkung auf die eigenen Angelegenheiten. Die rund tausend Geschichten der einzelnen Gemeinden würden, wenn sie denn, von Ausnahmen wie Athen abgesehen, überhaupt geschrieben werden könnten, noch keinen geschichtlichen Zusammenhang konstituieren, der es erlaubte, von einer griechischen Geschichte zu sprechen. Wegen des Mangels an Quellen ist es jedoch schier unmöglich, die Geschichte jeder einzelnen Gemeinde zu schreiben. Was möglich wäre, sind günstigenfalls einzelne Fallstudien, wie sie unter anderem jüngst Elke Stein-Hölkeskamp vorgelegt hat, das meiste ginge jedoch nicht über eine lexikonartige Zusammenstellung von Artikeln hinaus, wie sie das oben genannte, von Hansen und Nielsen herausgegebene Handbuch enthält.
Einen Ausweg aus dem beschriebenen Dilemma bietet die Konzentration auf die gemeinsamen Züge griechischer Geschichte. Dies sind die Entstehung einer in Dialekte gegliederten sprachlichen Einheit aus dem Differenzierungsprozess des Indogermanischen, die Voraussetzungen und der Vollzug der Landnahme auf den südlichen Ausläufern der Balkanhalbinsel einschließlich der Inseln der Ägäis und der Westküste Kleinasiens sowie die Kolonisation an den Küsten des Mittelmeeres und des Schwarzen Meeres vom achten bis sechsten Jahrhundert als Teil der Migrationsgeschichte der Menschheit, die Entfaltung der griechischen Kultur, die prägende Rolle, die der gesamtgriechische Adel in Politik und Kultur der archaischen Zeit gespielt hat, die Überwindung von Eigengewalt und Adelswillkür durch Ausbildung von Rechtsordnungen und staatlichen Strukturen zur Durchsetzung des Willens der Bürgergemeinde sowie die Stellung des Griechentums im Umfeld von fremden Kulturen und Großreichen. Am Ende der hier vorgelegten Geschichte des frühen Griechenlands wird die Darstellung der erfolgreichen Abwehr der Perser stehen, die das griechische Gemeinschaftsbewusstsein politisierte und die griechische Geschichte in neue Bahnen lenkte. Damit bin ich der inhaltlichen Bestimmung und der zeitlichen Begrenzung der archaischen Epoche verpflichtet, die Alfred Heuß in einem richtungsweisenden Artikel unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs begründet hat (die bibliographischen Angaben sind in den Hinweisen zu Quellen und weiterführender Literatur zu finden), gehe jedoch insofern über ihn hinaus, als ich die Abwehr der Perser als Abschluss und Übergang zu einer neuen Epoche, der klassischen, in meine Darstellung mit einbeziehe.
Einen besonderen Hinweis verdient die Quellenlage, die die Grundlage und die Grenzen jedes Versuchs historischer Darstellung bildet. Für die sogenannten Dunklen Jahrhunderte der griechischen Geschichte, das heißt die Epoche vom zwölften bis neunten Jahrhundert, gibt es keine schriftlichen Zeugnisse. Für diese Zeit sind die einzige Quellengattung, über die wir verfügen, die sogenannten Überreste, wie sie in der Terminologie des Historikers Johann Gustav Droysen (1808–1884) heißen, das heißt in diesem Falle Bodenfunde, die Zeugnis von der materiellen Kultur, von untergegangenen Siedlungen und Gräberfeldern vergangener Epochen ablegen. Die Bergung dieser Funde und ihre Auswertung sind einer der archäologischen Wissenschaften aufgegeben, die im akademischen Fächerkanon traditionellerweise die Bezeichnung Vor- und Frühgeschichte trägt. Dies ist durch die alte, um nicht zu sagen: veraltete Vorstellung bedingt, dass erst schriftliche Quellen das Fach Geschichte im vollen Wortsinn konstituieren. Die mit den Methoden der Archäologie arbeitende sogenannte Vor- und Frühgeschichte hat zwar in erster Linie die Geschichte schriftloser Zeiten zum Gegenstand, doch sind es große Themen der Menschheitsgeschichte, in die sie Licht gebracht hat. Dazu gehört nicht zuletzt der Übergang von der Nahrungsaneignung durch Jagen und Sammeln zur Nahrungsproduktion durch Ackerbau und Viehzucht im sogenannten Neolithikum. Dabei handelte es sich um einen Prozess, der – von mehreren Zentren ausgehend – nach und nach die ganze Welt erfasste. Von ihm kann mit gutem Recht gesagt werden, dass er die Geschichte der Menschheit wohl noch grundlegender revolutionierte als Industrialisierung und Digitalisierung in neuerer Geschichte und Gegenwart. Aber auch für die Epochen nach Erfindung der Schrift und der Entstehung schriftlicher Überlieferung bleibt die auf die Untersuchung materieller Überreste bezogene archäologische Forschung eine grundlegende historische Disziplin. Die Geschichte des archaischen Griechenland, die Gegenstand dieses Buches ist, ist dafür eines der besten Beispiele. Denn ohne Berücksichtigung der Ergebnisse der mit archäologischen Methoden arbeitenden Wissenschaften wäre eine griechische Geschichte der archaischen Zeit noch lückenhafter, als sie ohnehin schon ist.
Doch seit dem achten Jahrhundert v. Chr. erweitern schriftliche Zeugnisse das Spektrum historischer Erkenntnismöglichkeiten, ob es sich bei diesen Zeugnissen um die homerischen Gedichte oder andere Werke der Sängerzunft, um lyrische Dichtung oder Dokumente des privaten oder öffentlichen Lebens handelt. Deren Zahl erhöht sich kontinuierlich nach dem siebten Jahrhundert v. Chr. Auch diese schriftlichen Zeugnisse sind wie die materiellen Überreste lückenhaft, aber sie beleuchten vielfach Aspekte und Zusammenhänge, die die archäologischen Zeugnisse im Dunkeln lassen. Bei der Benutzung von Schriftzeugnissen ist freilich zu beachten, dass primär solche als Quellen herangezogen werden dürfen, die der jeweils betreffenden Periode angehören, spätere nur dann, wenn sie die Kontinuität eines älteren Zustandes bezeugen.
Was jedoch in der gesamten archaischen Epoche fehlt, ist Historiographie, diejenige literarische Gattung also, die der historischen Überlieferung dient. Ihre Entstehung ist geknüpft an zwei Ereigniszusammenhänge, die die Geschichte der Griechen in neue Bahnen lenkten: die Abwehr der Perser und den folgenden athenisch-spartanischen Dualismus des fünften Jahrhunderts, der für Athen mit einer totalen Niederlage endete. Der erste Historiker, der aus dem kleinasiatischen Halikarnassos stammende Herodot (ca. 485–425 v. Chr.), der seine Historien, das heißt Erkundungen, im dritten Viertel des fünften Jahrhunderts schrieb, galt der Antike zu Recht als der Erfinder der neuen Gattung. Cicero (106–43 v. Chr.) nennt ihn in einem um das Jahr 50 v. Chr. geschriebenen Rückblick auf die griechisch-römische Historiographie den «Vater der Geschichtsschreibung», aber er verschweigt nicht, dass Herodot auch als Erfinder «zahlloser Fabeln» galt.
Herodot ist ein hinreißender Erzähler, aber sein Werk ist zustande gekommen durch Befragung von Leuten, die ihm vortrugen, was sie aus mündlicher Überlieferung in Erinnerung behalten hatten. Mündliche Überlieferung verfährt höchst selektiv, und ihre Bruchstücke reichen im besten Fall etwa hundert Jahre zurück. Einem späteren griechischen Historiker, Polybios von Megalopolis (ca. 200–120 v. Chr.), war sie so fragwürdig, dass er als belastbare Information nur gelten lassen wollte, was Gewährsleute seiner Generation oder die der Väter gesehen oder erlebt hatten, alles Frühere und anders zustande Gekommene erklärte er zu bloßem Hörensagen und damit für unzuverlässig. Herodots Geschichtswerk reicht bis in die Mitte des sechsten Jahrhunderts zurück. Es ist orientiert am Wachstum des persischen Großreiches und ordnet in diesen Rahmen alles ein, was er an mündlicher Überlieferung zur griechischen Geschichte zusammentragen konnte. Aber er besaß – was in den Anfängen historischer Erkundungen nicht anders sein konnte – noch keinen rechten Maßstab historischer Kritik. Mit dieser Herausforderung ist der moderne Historiker konfrontiert. Dennoch ist es Herodots Werk zu verdanken, dass zumindest für die Epoche der Perserkriege mit Abstrichen eine zusammenhängende Ereignisgeschichte erzählt werden kann.
I. VORAUSSETZUNGEN
1. Der Schauplatz: Land und Meer
Das Kernland des griechischen Siedlungsgebiets umfasste die Südspitze der Balkanhalbinsel. Im Norden war es durch eine Linie begrenzt, die ungefähr von der Südgrenze des heutigen Albanien im Westen bis an den Olympos, den höchsten Berg Griechenlands (2918 Meter), im Osten reicht. Die Oberfläche dieses Landes ist durch Ketten von Kalksteingebirgen geprägt, die von Nordwesten nach Südosten verlaufen und deren Höhe allmählich abnimmt, bis die Gipfel nur noch als Inseln aus dem ägäischen Meer herausragen. Die antike und heutige Verteilung von Festland, Meer und Inseln ist erst nach dem Ende der letzten Eiszeit entstanden. Vor ungefähr dreißigtausend Jahren lag der Meeresspiegel 120 Meter tiefer als heute, das Klima war kälter und trockener, die großen Küstenebenen waren Grasland, und es gab nur einen geringen Baumbestand. Dann folgten bis etwa 6000 v. Chr. eine langsame Erwärmung des Klimas und als Folge ein Anstieg des Meeresspiegels, der die Küstenebenen unter Wasser setzte und in der Ägäis die zahlreichen Inseln entstehen ließ. Auf dem verbleibenden Festland entstanden ausgedehnte Wälder aus Laub- und Nadelbäumen. In neolithischer Zeit kam es durch Menschenhand zu einer erheblichen Lichtung des Waldbestandes. In den letzten dreitausend Jahren hat sich im Großen und Ganzen wenig an der Verteilung von Land und Meer, am Klima und an der natürlichen Vegetation geändert. Durch den Anstieg des Meeresspiegels ist eine vielgestaltige Küstenlinie entstanden mit der Folge, dass das Festland und das Meer mit seinen zahlreichen Inseln eng miteinander verzahnt sind. Das Relief des Landes ist durch schroffe Gebirgszüge mit Hochtälern bestimmt, die nur an Küsten und in Flusstälern Raum für Ebenen lassen.
Griechenland als Ganzes liegt in der mediterranen Klimazone, aber das differenzierte Bodenrelief bedingt erhebliche lokale Unterschiede des Klimas, die von der subtropischen über die gemäßigte bis zur nordisch-alpinen Klimazone reichen. Der Wechsel von heißen, trockenen Sommern und feuchten Winterhalbjahren (Oktober bis März), der für das mediterrane Klima typisch ist, fällt in Griechenland je nach Bodenrelief und Himmelsrichtung unterschiedlich aus: Generell ist der Westen feuchter, der Süden und Osten heißer und trockener. Die Küsten südlich von Thessalien waren (und sind) baumlos. Das übrige Land war im Unterschied zu heute im Altertum dichter mit Nadelbaumwäldern bewachsen, in tieferen Lagen mit der Aleppo-Kiefer, die Harz und Brennholz lieferte, aber nicht zu Bauholz taugte. Besser geeignet für diesen Zweck war die in Griechenland in höheren Lagen vorkommende Schwarzkiefer (pinus nigra). Die griechische Tanne (abies cephalonica), die in Attika, Boiotien und im nördlichen Griechenland in Höhen zwischen 600 und 2000 Meter wächst, wurde wegen ihres leichteren Gewichts und ihrer Stärke für den Bau von Schiffen sowie für die Anfertigung von Rudern genutzt. Aber als Schiffsbauholz bevorzugt wurde die in Makedonien vorkommende Silbertanne (abies alba).
Das Bodenrelief und die Verschränkung von Festland, Meer und Inseln hatten erhebliche Auswirkungen auf menschliche Besiedlung und Verkehr. Mehr oder weniger hohe Gebirge umschlossen zahlreiche Siedlungskammern und trennten sie voneinander, so dass der menschlichen Kommunikation große, unter Umständen unüberwindliche Hindernisse in den Weg gelegt waren. Unter diesen Voraussetzungen machten die Nähe vieler Siedlungskammern zum Meer und die zahlreichen Inseln das Schiff und die Seefahrt zum bevorzugten Mittel des Transports und der Kommunikation. Die Folgen liegen auf der Hand: Die Natur des Landes begünstigte die Entstehung zahlreicher politischer Einheiten, von Stammesorganisationen und Stadtstaaten, sogenannter Poleis – das griechische Wort polis bedeutet Burg, Stadt, Bürgerschaft beziehungsweise Stadtstaat. Die Landesnatur verwies die Bewohner auf das Meer, um miteinander zu verkehren und angesichts der begrenzten Ressourcen des gebirgigen Landes ihren Unterhalt durch Handel und Piraterie zu sichern – oder neues Land in Übersee zur Ansiedlung zu gewinnen. Die Griechen sind zu allen Zeiten ein Volk von Bauern und Seefahrern gewesen. Das Meer war ein notwendiges Lebenselement, aber es zu befahren war gefährlich, und angesichts dieser Gefährlichkeit war es meist der materiellen Not beziehungsweise der Notwendigkeit geschuldet, dass man sich dem unsicheren Element des Meeres um des Zweckes willen anvertraute, mit Gewinn wieder in den sicheren Hafen der Heimat einzulaufen. Niemand hat dies um 700 v. Chr. klarer und prägnanter zum Ausdruck gebracht als der Dichter und Sänger Hesiod in dem Gedicht Werke und Tage, mit dem er seinem Bruder, der ihn um einen Teil seines Erbes gebracht hatte, den Weg zu gerechtem Erwerb durch Arbeit weisen wollte:
«Hast du dem Handel jedoch die törichte Seele verschrieben,
Dass du Mangel vermeidest und unerfreulichen Hunger,
Will ich dir weisen die Bahnen des lautaufrauschenden Meeres,
Hab ich auch wenig Erfahrung in Seefahrt oder mit Schiffen,
Denn noch niemals befuhr ich im Seeschiff die Weiten des Meeres.»
(Hes. erg. 646–650. Übersetzung nach Th. von Scheffer)
Hesiods eigene Erfahrung beschränkte sich auf die Überquerung des schmalen Sundes zwischen dem boiotischen Aulis und der Stadt Chalkis auf Euboia, wo er erfolgreich an einem Sängerwettbewerb teilgenommen und einen Preis gewonnen hatte. Der Hauptteil des Mahngedichtes an den Bruder ist der bäuerlichen Arbeit gewidmet, doch für den Fall, dass dieser es vorziehen würde, sein Glück auf dem Meer zu suchen, gab er ihm den Rat, den Gewinn möglichst schnell in die Sicherheit eines bäuerlichen Hofes zu investieren. Dies hatte der Vater getan, der von Kyme an der kleinasiatischen Küste aus «segelte in dem Schiff, nach edlen Gütern zu spähen» (Hes. erg. 634), je nach Gelegenheit als Händler oder Seeräuber, bis er sich im boiotischen Askra als Bauer niederließ:
«Einstmals kam er hierher auf weit sich dehnender Meerfahrt;
Das aiolische Kyme verließ er im schwärzlichen Seeschiff,
Nicht aus reicher Habe noch Wohlstand und Segen entwich er,
Nein, aus bitterer Armut, wie Zeus sie den Menschen gegeben,
Nahe dem Helikon ließ er sich nieder im ärmlichen Askra,
Übel im Winter, beschwerlich im Sommer und niemals erfreulich.»
(Hes. erg. 635–640. Übersetzung nach Th. von Scheffer)
Aber die Verlockungen des Meeres brachten auch den Typus des Abenteurers hervor, wie ihn Homer in der Odyssee geschildert hat. Als Odysseus nach langer, gefährlicher Irrfahrt auf Ithaka, seiner Heimat, landete und verbergen wollte, wer er war, erzählte er Eumaios, dem alten Schweinehirten des väterlichen Gutes, der ihn nicht wiedererkannt hatte, auf die Frage nach seiner Herkunft eine Seemannsgeschichte, die, obwohl erfunden, für den Zuhörer den Stempel der Glaubwürdigkeit trug. Es handelt sich um die Erlebnisse eines den Kampf liebenden, auf Krieg und Seeraub ausgehenden Abenteurers:
«Also war ich im Kampf und liebte weder den Feldbau
Noch das Leben im Haus, das treffliche Kinder heranzieht;
Sondern das Ruderschiff war meine Freude beständig,
Und der Kampf, und die Speere mit blinkendem Schaft und die Pfeile
…
Eh’ der Achaier Söhne hinauf nach Troia gesegelt,
Führt’ ich neunmal Männer in schnell geruderten Schiffen
Gegen entlegenes Volk und gewann gar reichliche Beute.»
(Hom. Od. XIV, 222–225 und 228–231. Übersetzung nach J. H. Voß)
Nach der Teilnahme am Troianischen Krieg wurde, so seine Geschichte, das unstete Leben wieder aufgenommen. Ziel des Plünderungszugs war diesmal Ägypten. Aber im Nildelta trafen die Abenteurer auf organisierten Widerstand, und nach eigenem Bericht konnte sich der Erzähler nur retten, indem er schutzflehend dem siegreichen Pharao zu Füßen fiel. Dann lebte er sieben Jahre in Ägypten, bis das Erscheinen eines phoinikischen Seefahrers seinem Leben eine neue Wendung gab:
«Doch wie das achte Jahr im Laufe der Zeiten herankam,
Kam ein phoinikischer Mann daher, im Betrügen erfahren,
Ein Erzgauner, der anderen schon viel Schlimmes erwiesen,
Der beredete mich, mit ihm nach Phoinike zu fahren …»
(Hom. Od. XIV,287–290. Übersetzung nach J. H. Voß)
Nach einem dort verbrachten Jahr begleitete er den phoinikischen Schiffsherrn auf neuer Fahrt nach Afrika, doch dieser plante, ihn als Sklaven zu verkaufen:
«Führt’ er gen Libyen mich auf dem meerdurchfahrenden Schiffe,
Da er log, ich sollte mit ihm die Ladung geleiten:
Aber er dachte, mich dort mit hohem Gewinn zu verkaufen.»
(Hom. Od. XIV,295–297. Übersetzung nach J. H. Voß)
Doch der Plan scheiterte. Als das Schiff die Südküste Kretas passiert hatte, kam heftiger Sturm auf, das Schiff wurde nach Norden abgetrieben und sank. Nur der Erzähler konnte sich als Schiffbrüchiger an die Küste im Land der Thesproten gegenüber der Insel Ithaka, seiner Heimat, retten.
Das Meer zu befahren war lohnend und gefährlich zugleich. Gewiss fuhren Schiffe nach Möglichkeit in Sichtweite der Küsten des Festlandes oder von Insel zu Insel. Doch gab es bereits befahrene Hochseerouten. Sie führten von Griechenland zum Nildelta sowie von Phoinikien, dem heutigen Libanon, südlich an Kreta vorbei über die gefürchtete «Wüste des Meeres» nach dem heutigen Tunesien und weiter zu den «Säulen des Herakles», der Straße von Gibraltar. In Fernand Braudels schönem Buch Das Mittelmeer und die mediterrane Welt in der Epoche Philipps II. ist nachzulesen, dass noch im 16. Jahrhundert die Mittelmeerfahrer sich dieser Seewege bedienten, wenn sie sich denn auf die hohe See hinauswagten – denn ein Wagnis war es immer. Stürme und Klippen konnten Seefahrern zum Verhängnis werden, und zur Winterszeit war es geradezu Selbstmord, in See zu stechen, so dass im Winter von November bis März die Seefahrt ruhte. Aber im Sommerhalbjahr wurde das Risiko um der Gewinne willen, die Handel und Piraterie einbrachten, in Kauf genommen. Piraterie und Handel waren miteinander verschwistert, denn zu einem nicht unerheblichen Teil nährte der Seeraub den Handel. Seeraub ist indes ein zumindest missverständlicher Begriff, denn Beute wurde durch Plünderung des küstennahen Landes gemacht, nicht oder nur selten, indem Schiffe auf hoher See aufgebracht wurden. Die Beute bestand neben Gegenständen und Tieren vor allem aus geraubten Menschen, die Lösegeld einbrachten oder als Sklaven verkauft werden konnten. Handel und Seeraub aber haben vielfach zu fester Ansiedlung geführt, nicht nur in der angestammten Heimat, sondern auch in Übersee, wo immer die Verhältnisse es zuließen. Dass Griechen und Phoiniker Träger dieser überseeischen Auswandererbewegung in der Zeit vom achten bis zum sechsten Jahrhundert wurden, erklärt sich in erster Linie aus den geringen Ressourcen, die die jeweilige Heimat in Griechenland und an den Küsten der Levante bot. Armut und die aus Not und Konkurrenz geborenen Streitigkeiten mit den Nachbarn im Inneren und im Umland waren die Ursachen. In der Odyssee ist die Gemeinde der Phaiaken auf der Insel Scheria der Prototyp einer auf diese Weise entstandenen Auswandererstadt:
«… Aber Athene
Ging hinein in das Land zur Stadt der phaiakischen Männer.
Diese bewohnten zuvor das weite Gefild’ Hyperaia,
Nahe bei den Kyklopen, den übermütigen Männern,
Welche sie immer beraubten und mächtiger waren und stärker.
Aber sie führte von dannen Nausithoos, ähnlich den Göttern,
Brachte gen Scheria, fern von den erfindsamen Menschen,
Und umringte mit Mauern die Stadt und richtete Häuser,
Baute Tempel der Götter und teilte dem Volke die Äcker.»
(Hom. Od. VI,2–10. Übersetzung nach J. H.Voß)
Der letzte Halbvers «und teilte dem Volke die Äcker» zeigt an, dass die Landwirtschaft die Hauptlebensgrundlage des – im vorliegenden Fall fiktiven – neuen Gemeinwesens bildete. Das war seit der Neolithischen Revolution, die vor etwa zwölftausend Jahren begann, überall der Fall. Landwirtschaft aber bedeutete Rodung von Wäldern, Anbau von Pflanzen und Haltung von Tieren. Wie und in welchem Umfang dies alles möglich war, hing von natürlichen Gegebenheiten ab, von der Beschaffenheit von Boden und Klima. Was Griechenland anbelangt, so beschränkte der gebirgige Charakter des Landes Anbaufläche und Nutzungsmöglichkeiten. An Hanglagen musste dem Verlust von Mutterboden durch Terrassierung gewehrt werden. In vielen Gegenden waren nicht Weizenarten, sondern Gerste und Hülsenfrüchte die wichtigsten Nutzpflanzen. Auf den nicht zum Ackerbau geeigneten Böden wurden je nach Lage entweder Ölbäume und Weinstöcke kultiviert oder Vieh gehalten, vor allem Schafe und Ziegen, die genügsam sind und alles fressen, auch Gebüsch, Blätter und Äste von Bäumen. So sorgten sie für einen besonderen Bewuchs des beweideten Landes mit aromatischen Pflanzen wie Salbei und Thymian. In welchem Maße menschliche Aktivitäten in den letzten drei Jahrtausenden die Erosion gefördert haben, ist umstritten und muss hier außer Betracht bleiben.
Was die agrarische Produktivität in vormoderner Zeit anbelangt, haben uns Untersuchungen über die traditionelle Landwirtschaft, wie sie auf den Inseln Amorgos und Karpathos noch bis vor kurzem betrieben wurde, Einblick verschafft. Allein für die Getreideernte eines Hektars einschließlich Dreschen und Worfeln benötigt eine Arbeitskraft dreißig Tage. Dieser Ertrag reicht nur für den jährlichen Nahrungsmittelbedarf eines Erwachsenen. Umgekehrt kann die Arbeitskraft eines erwachsenen Mannes auf zwei Hektar so viel erzeugen, wie für die Ernährung von zwei, allenfalls drei Erwachsenen im Jahr ausreicht. Setzt man die drei Faktoren Land, Arbeitskraft und Ertrag zueinander in Beziehung, so bedeutet das: Eine Familie mit mehreren Kleinkindern und alten hinfälligen Eltern geriet, eine hinreichend große Bodenfläche vorausgesetzt, unweigerlich unter den Druck mangelnder Arbeitskraft. Umgekehrt konnte eine Familie mit erwachsenen, noch unverheirateten Kindern und alten arbeitsfähigen Eltern einen erheblichen Überschuss erwirtschaften – vorausgesetzt genügend Bodenfläche war vorhanden –, das Doppelte von dem, was die Arbeitsfähigen verbrauchten, oder noch mehr. Zusätzliche Arbeitskraft konnte für die Zeit erhöhten Arbeitsanfalls, Ernte und Bodenbestellung, durch Anwerbung von Saisonarbeitern oder auf dem Weg der Nachbarschaftshilfe mobilisiert werden. Sklaven zu halten lohnte sich in einer kleinteiligen Landwirtschaft nur bei Viehhaltung. Der oben erwähnte Schweinehirt Eumaios war als Kind von Seeräubern entführt und als Sklave an den König von Ithaka verkauft worden. Landbesitz war freilich in der Regel nicht nur nicht vermehrbar, sondern sein Umfang konnte sich in der Generationenfolge durch die übliche Erbteilung verkleinern, sofern zwei oder mehr Söhne vorhanden waren. Die Fortsetzung einer Familie stellte unter den Bedingungen der vormodernen Subsistenzwirtschaft und des herrschenden Prinzips der Erbteilung ein schwieriges, ja, im Grunde unlösbares Problem dar. Missernten, Verschuldung und der Ausfall der Hauptarbeitskraft durch Krankheit oder frühen Tod konnten die Existenzgrundlage ganzer Familien auslöschen. Diese Beschränkung der Möglichkeit, von den Ressourcen des Landes zu leben, konnte bis zu einem gewissen Grad durch die Nutzung des Meeres in Gestalt von Fischfang, Piraterie, Handel und Auswanderung kompensiert werden. Ohne Berücksichtigung der einander ergänzenden Faktoren – Familiengröße, Bodenfläche und Arbeitsproduktivität, Seefahrt, Handel und Piraterie – bliebe, wie im Folgenden gezeigt werden soll, die Geschichte der Griechen in archaischer Zeit und darüber hinaus unerklärlich.
2. Die Vorgeschichte
Die Griechen waren in der Antike niemals in einem Staat geeint. Sie bildeten zu keinem Zeitpunkt das, was man ein Staatsvolk nennt. Wenn gegenwärtig häufig zu hören oder zu lesen ist, dass die Griechen die Erfinder der Demokratie und damit die Väter der Staatsform waren, die heutzutage als die einzig legitime gilt, so ist dies eine ungenaue Redeweise. Nicht die Griechen, sondern die Athener, eines der vielen ‹Staatsvölker› des griechischen Siedlungsraumes, waren die Erfinder der Demokratie. Begriff und Sache gehören der athenischen Geschichte vom ausgehenden sechsten bis zum fünften Jahrhundert v. Chr. an. Die Zersplitterung der politischen Landkarte des griechischen Siedlungsraumes erfuhr ihre letzte Steigerung durch die Kolonisationsbewegung in der Zeit vom achten bis zum sechsten Jahrhundert v. Chr. Von den rund 1000 selbständigen Gemeinden waren mehr als 350 an den Küsten des Schwarzen und des Mittelmeeres kolonialen Ursprungs. Mit gutem Recht sprach also Platon im vierten Jahrhundert davon, dass die Griechen um das Meer säßen wie Frösche um einen großen Teich.
Auch wenn die Griechen in der Antike nie in einer gemeinsamen politischen Ordnung geeint waren, bildete sich doch eine griechische Kulturnation avant la lettre. Als dieser Prozess bereits weit fortgeschritten war, prägte der berühmte athenische Redner und Publizist Isokrates (436–338 v. Chr.) im vierten Jahrhundert das vielzitierte Wort, dass Zugehörigkeit zum Griechentum weniger eine Frage der Abstammung als einer Teilhabe an attischer Bildung sei. Aber diese spezifisch attische Bildung der klassischen Zeit im fünften und vierten Jahrhundert setzt eine gemeingriechische Kulturentwicklung voraus, deren Grundlagen in archaischer Zeit gelegt worden waren. Die allgemeinste dieser Grundlagen lag freilich aller bewussten Kulturgestaltung, derjenigen der archaischen Zeit ebenso wie der attischen des fünften und vierten Jahrhunderts, voraus. Gemeint ist die Existenz einer gemeinsamen, freilich in verschiedene Dialekte gegliederten griechischen Sprache. Dem Einfluss attischer Bildung in klassischer Zeit war es dann geschuldet, dass schließlich die attische Variante des Griechischen in hellenistischer Zeit seit dem Ende des vierten Jahrhunderts v. Chr. zur Sprache der Literatur und zur Umgangssprache aller Gebildeten wurde.
Sprachen sind dem geschichtlichen Wandel unterworfen und sie sind in vielem ein Spiegel der allgemeinen Geschichte. Griechisch gilt als die älteste der indogermanischen Sprachen Europas. Seine Geschichte kann dank der Schrifttäfelchen des sogenannten Linear-B-Typs aus der Mitte des zweiten Jahrtausends v. Chr. und aus der seit dem achten Jahrhundert allmählich ansteigenden Flut von privaten und öffentlichen Inschriften und Papyri sowie von literarischen Texten über viertausend Jahre bis auf den heutigen Tag verfolgt werden. Alle indogermanischen Sprachen gehen auf eine rekonstruierbare Ursprache zurück. Deren Verbreitungsgebiet ist aller Wahrscheinlichkeit nach in der heutigen Ukraine beziehungsweise im südlichen Russland zu suchen. In dem Wortschatz der aus dieser Ursprache abgeleiteten Einzelsprachen, zu denen auch das Griechische gehört, bilden sich die Flora und Fauna des betreffenden ost- beziehungsweise nordeuropäischen Raumes ab, während diejenigen Tiere und Pflanzen, die in Nordeuropa unbekannt sind, mit Namen bezeichnet werden, die einem vorindogermanischen Sprachsubstrat angehören. Verursacht ist dieses Phänomen durch Wanderbewegungen, die Angehörige der indogermanischen Sprachfamilie in Weltgegenden mit bis dahin unbekannten und also unbenannten Tieren und Pflanzen brachten. Die Griechen übernahmen von der vorindogermanischen Bevölkerung die Namen der Tiere und Pflanzen, die sie kennenlernten, als sie am Mittelmeer heimisch wurden. Das gilt etwa für Esel, Löwe und Krokodil ebenso wie für Olive, Wein, Efeu, Feige, Minze, Narzisse und Zypresse.
Der indogermanische Wortschatz lässt erkennen, dass die von der Sprachwissenschaft rekonstruierte Ursprache bereits das Ergebnis einer Revolution aller Lebensverhältnisse abbildet, nämlich den Übergang von der Nahrungsaneignung durch Sammeln und Jagen zur Nahrungsproduktion durch Ackerbau und Nutztierhaltung. Die Bezeichnungen für Getreide und Dreschen, für Pflug, Wagen, Rad und Deichsel sowie für den Haustierbestand, Hund, Rind, Schaf, Schwein und Ziege, stammen aus dieser Ursprache. Das in den mediterranen Ländern so wichtige Last- und Transporttier, der zahme Esel, ergänzte den Haustier- und Wortbestand der Griechen erst nach ihrer Zuwanderung in die nach ihnen benannte Mittelmeerregion. Hinsichtlich der Technologie lässt der Wortschatz der indogermanischen Ursprache erkennen, dass sie der metallurgischen Revolution des zweiten Jahrtausends, der Verhüttung und Verarbeitung von Metall, vorausliegt. Zwar zeigt der Wortstamm (h)ájes, davon abgeleitet altindisch ájas, lateinisch aes, dass Kupfer bereits bekannt war, aber es fehlen gemeinsame Worte im Umfeld der Gewinnung und Verarbeitung von Metallen zu Werkzeugen und Waffen.
Der Prozess der Sprachentrennung dürfte nicht vor der Mitte des vierten Jahrtausends eingesetzt haben. Dies ist daraus zu erschließen, dass alle Folgesprachen des Urindogermanischen ein gemeinsames Wort für Rad kennen und die Archäologie die erste gesicherte Benutzung von Rädern im angenommenen Sprachgebiet in diese Zeit datiert. Der ersten Phase der Ausdifferenzierung des Indogermanischen gehört nach einer plausiblen sprachwissenschaftlichen Theorie die gemeinsame Vorstufe des Griechischen, Phrygischen und Armenischen an, die in der ersten Hälfte oder in der Mitte des dritten Jahrtausends entstand. Nach dem angenommenen Siedlungsgebiet ist für diese rekonstruierte Sprache die Bezeichnung Balkanindogermanisch gewählt worden. Auf der Suche nach neuem Siedlungsland kamen Angehörige der betreffenden Sprachgemeinschaft seit dem zweiten Jahrtausend v. Chr. in die südlichen Ausläufer der Balkanhalbinsel und nach Kleinasien und bildeten voneinander getrennt unterschiedliche neue Sprachen aus: Griechisch im Süden der Balkanhalbinsel, auf den Inseln der Ägäis und an der kleinasiatischen Ägäisküste, Phrygisch im Nordwesten und Armenisch im Osten Kleinasiens. Herodot, der erste griechische Historiker, erwähnt mit Berufung auf eine Erzählung aus Makedonien, dass die Phryger unter dem Namen Briger ursprünglich in jenem Land gewohnt und erst nach ihrer Übersiedlung nach Kleinasien den Namen gewechselt hätten, und fügt hinzu, dass die Armenier Abkömmlinge der Phryger seien (Historien VII,73). Es ist zumindest möglich, dass in dieser Erzählung eine Erinnerung an längst vergangene Zeiten steckt.
Die Ausbreitung von Ackerbau und Viehzucht vollzog sich im Neolithikum zwischen ungefähr 9000 und 4000 v. Chr. vom Vorderen Orient ausgehend bis Ost- und Nordeuropa.
Der Übergang von der Nahrung sammelnden zur Nahrung produzierenden Wirtschaftsweise vollzog sich in Vorderasien und Europa im Neolithikum, der letzten Phase der Steinzeit, ungefähr vom zehnten bis zum fünften Jahrtausend v. Chr. Trotz der langen Dauer dieses Prozesses ist der Begriff einer Neolithischen Revolution in Hinblick auf die Wirkung gerechtfertigt, weil die neue Wirtschaftsweise alle Lebensbedingungen umstürzend veränderte. Ackerbau und Viehzucht vermehrten das Nahrungsangebot und schufen die Voraussetzung für eine signifikante Vermehrung der Menschheit. Deutlich ist auch, dass die neue Wirtschaftsweise die Bildung eines vererblichen Familieneigentums an Land und Vieh sowie die Entstehung der vaterrechtlich organisierten Gesellschaft bewirkte. An der Spitze einer die Generationen übergreifenden Arbeitsorganisation stand das Familienoberhaupt, der pater familias, wie es im Lateinischen heißt, Herr des Hofes und der Familie. Das Erbe ging an die Söhne und deren Abkömmlinge, beim Fehlen direkter Nachkommen an die nächsten Verwandten in männlicher Linie. Nicht die Blutsverwandtschaft als solche, die kognatische, sondern die agnatische, das heißt die Abstammung von einem gemeinsamen Vater, bestimmte den Erbgang. Erbteilung war die Regel. Fiel das Familiengut an zwei oder mehrere Söhne, führte das oft dazu, dass die den einzelnen Erben zufallenden Teile nicht zur Ernährung der neu entstehenden Familien ausreichten. Andererseits konnte die unterschiedlich große Zahl der erbberechtigten Kinder auch die Entstehung einer schmalen Schicht von Hofbesitzern begünstigen, die mehr Grund und Boden und einen größeren Viehbestand besaßen als die Mehrheit. Beides, Erbteilung und Akkumulierung der Produktionsmittel in der Hand einer Oberschicht, erzeugte unter den Bedingungen einer reinen Agrarwirtschaft den Druck, neues Siedlungsland außerhalb der angestammten Heimat zu suchen, nach Möglichkeit in Gegenden mit besseren Umweltbedingungen, das heißt einem günstigeren Klima und gutem Siedlungsland. Dies war die Antriebskraft, die Ackerbau und Haustierhaltung über die Jahrtausende hinweg in immer neue Weltgegenden trug.
Auch nachdem dieser Prozess am Ende des Neolithikums zu einem Abschluss gekommen war, setzte sich die Suche nach neuem Siedlungsland und besseren Lebensbedingungen fort. Auf diese Weise kam es zu neuen Landnahmen einzelner Gruppen, ja, zu Völkerwanderungen, in deren Verlauf die Neuankömmlinge die Vorbevölkerung verdrängten, unterwarfen oder sich in der einen oder anderen Form mit ihr arrangierten. Zwar können wir den Prozess der Wanderungen und Landnahmen mangels aussagekräftiger Quellen nicht im Einzelnen verfolgen. Doch wenn das Griechische, das Phrygische und das Armenische aus einer gemeinsamen Wurzel entstanden sind, so liegt die Schlussfolgerung nahe, dass sich die drei Sprachgemeinschaften nach Abschluss von Wanderbewegungen in räumlicher Trennung voneinander seit dem zweiten Jahrtausend gebildet haben müssen. Zuwanderer, die Frühformen des Griechischen sprachen, sind im zweiten Jahrtausend in mehreren Wellen in die südlichen Ausläufer der Balkanhalbinsel und über die Inselbrücke der Ägäis an die West- und Südküste Kleinasiens gelangt. Ihre Landnahme begann um 2000/1900 v. Chr. und kam um 1100/1000 v. Chr. mit der sogenannten Dorischen Wanderung zum Abschluss. Anhaltspunkte für Verlauf und Datierung dieses langdauernden, sich über ein ganzes Jahrtausend erstreckenden Prozesses bietet die Dialektgeographie des Griechischen. Wie die in dem Alphabet Linear B geschriebenen Texte aus dem Bereich der mykenischen Palastkultur zeigen, wurde um die Mitte des zweiten Jahrtausends von der Peloponnes über Mittelgriechenland bis nach Thessalien das sogenannte Ostgriechisch gesprochen. Bei diesem handelt es sich um die Vorstufe der eng miteinander verwandten Dialekte des Attischen und des Ionischen, die in historischer Zeit in Attika sowie auf den Inseln der mittleren Ägäis und an der gegenüberliegenden Westküste Kleinasiens gesprochen wurden, sowie um das Arkadische im Inneren der Peloponnes und das Kyprische auf Zypern. Nördlich und westlich von diesem Sprachgebiet wurde ein davon deutlich geschiedener Dialekt gesprochen, das Nordwestgriechische. Seit etwa 1200/1100 v. Chr. verbreitete es sich auf der Peloponnes, in Mittelgriechenland und auf den südlichen Inseln der Ägäis wie Kreta und Rhodos (um nur die größten zu nennen) sowie an der Südwestküste Kleinasiens. Durch Vermischung des Ost- und Nordwestgriechischen entstand in Thessalien ein Mischdialekt, das Uraiolische, das um 1250 v. Chr. nach Boiotien sowie um 1000 v. Chr. über die Insel Lesbos an die gegenüberliegende kleinasiatische Küste, in die sogenannte Aiolis, gelangte.
Diese Schichtung der griechischen Dialekte ist das Ergebnis einer höchst komplexen Besiedlungsgeschichte. Zunächst kamen die Ostgriechisch sprechenden Einwanderer, die in der Zeit von 1450 bis 1200 v. Chr. zu Trägern der mykenischen Palastkultur wurden. In der zweiten Hälfte dieser Epoche setzten, getragen von Angehörigen Nordwestgriechisch sprechender Gruppen, neue Zuwanderungswellen ein, die nacheinander Thessalien, das mittelgriechische Boiotien und dann über die Inselbrücke von Lesbos die nördliche Zone der kleinasiatischen Küste erreichten. Das Ergebnis war ein Mischdialekt, gebildet aus ost- und nordwestgriechischen Anteilen. Dieser sprachliche Befund erlaubt die Schlussfolgerung, dass sich in diesem Dialektgebiet die Ansiedlung der Zuwanderer aus dem nordwestgriechischen Sprachraum im Wesentlichen ohne Vertreibung der eingesessenen Bevölkerung vollzog und dass aus dem Zusammenleben beider Gruppen im Ergebnis ein neuer Dialekt des Griechischen entstand, eben das Aiolische. Ganz anders verlief die Entwicklung in anderen Teilen Griechenlands in der Zeit der großen Wanderung, die um 1200 v. Chr. vom Balkan ausging und wie eine Lawine den östlichen Mittelmeerraum heimsuchte. Nordwestgriechische Stammesgruppen fielen nach Mittelgriechenland und in die Peloponnes ein und verdrängten in weitem Umfang die vorgefundene, im Kernland der mykenischen Palastkultur ansässige griechische Bevölkerung. Mittelgriechenland westlich von Boiotien, große Teile der Peloponnes sowie die Inseln in der südlichen Ägäis und die südwestliche Küste Kleinasiens wurden zur Dialektzone des Dorischen – dies ist die von der Landschaft Doris in Mittelgriechenland abgeleitete Bezeichnung für das in den eroberten Gebieten gesprochene Nordwestgriechisch. Im griechischen Mutterland hielt sich die vordorische Bevölkerung nur in wenigen Rückzugsgebieten, in Arkadien, im unfruchtbaren Inneren der Peloponnes und in Attika. Von dort aus erfolgte über die Ägäis eine Auswanderung, die zur Besiedlung zahlreicher Ägäisinseln und des mittleren Abschnitts der kleinasiatischen Westküste führte – die sogenannte Ionische Wanderung. Auf diese Weise bildete sich in den betreffenden Gebieten aus ostgriechischen Wurzeln die Dialektzone des Attisch-Ionischen. Die Fluchtbewegung der vordorischen Bevölkerung führte von Kreta und den Inseln der Südägäis aus nach Zypern. Dort entstand ein neuer Außenposten griechischer Besiedlung, in dem bis in historische Zeit wie in Arkadien ein aus dem Griechisch der mykenischen Zeit abgeleiteter altertümlicher Dialekt weiterlebte. Die in der Zeit der sogenannten Dorischen Wanderung ausgelösten gewaltsamen Veränderungen haben sich archäologisch in der Zerstörung der mykenischen Burganlagen, in einem Rückgang der Bevölkerung und in einer Verarmung der materiellen Kultur und der allgemeinen Lebensverhältnisse niedergeschlagen. Wie dies alles im Einzelnen geschah, ist unbekannt und Gegenstand unsicherer Hypothesen.
Der langdauernde Prozess griechischer Landnahme fiel in eine Zeit, in der, ausgehend von Vorderasien, in ganz Europa die Technologie der Herstellung von Bronze aus Kupfer und Zinn ihren Siegeszug antrat. Um 2200 v. Chr. erreichte ihre Kenntnis die Mitte, um 1800 v. Chr. den Norden Europas. Durch die Legierung mit Zinn im Verhältnis 10:1 erhält das weiche Kupfer jenen Härtegrad, der Metall zur Produktion von Waffen und Geräten geeignet macht. Der neue Werkstoff revolutionierte das Kriegswesen, da er die Erfindung effektiver Angriffs- und Verteidigungswaffen ermöglichte, des Schwertes, der Speerspitze aus Metall und der Rüstung zum Schutz des Körpers gegen Verwundungen. Aus der Überlegenheit der neuen Bewaffnung resultierte der Zwang, sich in den Besitz des neuen Werkstoffs zu setzen. Das war nicht möglich ohne eine Intensivierung des Fernhandels und der gesellschaftlichen Arbeitsteilung. Kupfer und Zinn mussten je nach Vorkommen getrennt voneinander abgebaut und dann über lange Transportwege zusammengebracht werden, damit Bronze hergestellt und zu Waffen und Geräten geschmiedet werden konnte. Kupfer und Zinn mussten freilich nicht nur transportiert, sondern auch bezahlt werden. So entstand ein Warenaustausch über große Entfernungen, nicht ausschließlich, aber doch vornehmlich über das Meer mit seetüchtigen Schiffen. Der glückliche Zufallsfund eines vor Kap Uluburun an der kleinasiatischen Südwestküste gesunkenen Schiffes aus der Bronzezeit hat uns einen anschaulichen Beleg für diesen Überseehandel geliefert.
Spätgeometrische Kanne, 2. Hälfte des 8. Jahrhunderts v. Chr.: Darstellung eines Schiffbruchs
München, Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek
Im Jahre 1982 entdeckte ein Schwammtaucher an der betreffenden Stelle vor der Küste unter der Meeresoberfläche schwere kupferne Gegenstände. Zwei Jahre später begann die Bergung und wissenschaftliche Auswertung des Fundmaterials. Sie erstreckte sich über insgesamt zehn Jahre. Die Artefakte, vor allem die Keramik, die von der Ladung geborgen wurden, konnten in das vierzehnte Jahrhundert v. Chr. datiert werden. Dazu stimmt auch der Fund eines Skarabäus der berühmten ägyptischen Königin Nofretete (ca. 1360–1335 v. Chr.). Der Hauptteil der Ladung bestand aus Kupfer und Zinn in dem Verhältnis 10:1, in dem es zur Herstellung von Bronze gebraucht wurde. Das Kupfer stammte, wie durch Isotopenanalyse des Bleianteils geklärt wurde, aus Zypern, das Zinn möglicherweise aus Zentralasien oder dem kleinasiatischen Taurusgebirge. Daneben fanden sich Keramik und Schmuck aus der Levante und Ägypten sowie 175 blaue und türkisgrüne Glaszylinderbarren, die vermutlich aus dem syrisch-palästinensischen Raum stammten. Dieses Material wurde, wie Funde aus Ägypten und dem mykenischen Griechenland zeigen, zur Herstellung von Edelsteinimitaten verwendet. Erwähnenswerte Einzelstücke sind Rollsiegel aus Assur, das bereits erwähnte ägyptische Siegel in Form eines Skarabäus sowie ein goldenes Pektorale, ein Brustschmuck in Gestalt eines Falken, zwei Schwerter und Keramik aus dem mykenischen Griechenland, Elfenbeinarbeiten und viele tausend Perlen aus Achat, Karneol, Bergkristall und Gold. Unikate stellen eine Bernsteinperle aus dem Ostseeraum und ein steinerner Szepterkopf dar, zu dem Vergleichsstücke an der bulgarischen Schwarzmeerküste gefunden worden sind.
Dieser Befund ist ein eindrucksvoller Beleg für den Fernhandel der Bronzezeit. Handelsgegenstände waren vor allem Metalle, daneben ein breites Spektrum von Luxuswaren. Sie stammten, mit der bemerkenswerten Ausnahme der Bernsteinperle, aus dem östlichen Mittelmeerraum, von Ägypten über den Vorderen Orient bis zum mykenischen Griechenland. Wie diese Ladung, von der sich der Schiffsherr gewiss reichen Gewinn versprochen hat, zustande gekommen ist, wissen wir ebenso wenig, wie wir den Heimathafen des Schiffes kennen. Vielleicht war es im Etappenhandel eingesetzt, wie ihn Fernand Braudel in seinem Werk über das Mittelmeer zur Zeit Philipps II. von Spanien für das sechzehnte Jahrhundert beschreibt. Die Handelsschiffe fuhren damals noch wie in der Antike an der Küste entlang, legten in den auf ihrem Kurs gelegenen Häfen an, schlugen einen Teil ihrer Waren um, nahmen neue auf und setzten ihre Reise fort, bis der erzielte Gewinn sie zur Rückfahrt bestimmte. Mit der Annahme, dass die Ladung des Schiffes von Uluburun das Ergebnis eines solchen Etappenhandels repräsentiert, lässt sich ihre Zusammensetzung am zwanglosesten erklären.
Die Zusammensetzung der Ladung ist in doppelter Hinsicht aufschlussreich – einerseits als eindrucksvoller Beleg für die Bedeutung des Metallhandels. Kupfer gab es nicht überall, und Zinn war extrem selten. Beide Metalle mussten über weite Strecken zu den Zentren der Herstellung und der Verarbeitung von Bronze transportiert werden, und da es sich bei Metall um ein schweres Massengut handelt, war das Schiff aufgrund seiner Ladekapazität und Schnelligkeit das Transportmittel der ersten Wahl. Der Bedarf an dem Werkstoff Bronze aber intensivierte – dies ist der zweite Gesichtspunkt – mit Notwendigkeit den Austausch von Rohstoffen und Fertigprodukten beziehungsweise Luxusgütern. So entstand eine globale Arbeitsteilung der drei Segmente ökonomischer Tätigkeit: Urproduktion, Verarbeitung und Güteraustausch im Handelsverkehr. Die globale Vernetzung dieser drei Segmente besorgte im Mittelmeerraum das seetüchtige Schiff mit einer Ladekapazität von 20 bis 150 Tonnen. Schon seit dem dritten Jahrtausend sind auf Abbildungen und in Funden Ruder und Segel als Antriebsmittel von Schiffen archäologisch nachweisbar. Wie erwähnt, war noch in der frühen Neuzeit im Mittelmeerraum Küstenschifffahrt von Handelsplatz zu Handelsplatz üblich, doch Ausnahmen bestätigen die Regel. Zwischen der Ägäis und Ägypten ermöglichten Wind- und Strömungsverhältnisse die Fahrt über das offene Meer. Die Verbindung von Osten nach Westen führte von der Levante entlang der Küsten von Kreta und Nordafrika zur Straße von Gibraltar beziehungsweise durch die Straße von Messina über Sardinien und die Balearen nach Spanien.
Ackerbau, Metallurgie und Handel waren die Antriebskräfte nicht nur einer gesellschaftlichen Arbeitsteilung, sondern – dank ungleicher Güterverteilung – auch zur Bildung von Oberschichten, die an Reichtum und Macht über die Masse der Bevölkerung herausragten. Dies war die Entstehungsbedingung von Hochkulturen und von Formen politischer Herrschaft. Ihre Bildung geschah zeitlich und räumlich in Relation zur Ausbreitung von Ackerbau und Viehzucht sowie zum Siegeszug der Metallurgie. Während im dritten Jahrtausend im Zweistromland und im Niltal bereits Hochkulturen mit monarchischer Herrschaft und zentraler Arbeitsorganisation existierten, verharrten der Westen und Norden Europas noch auf einer primitiveren Entwicklungsstufe. Hier gab es im Unterschied zu Ägypten, Mesopotamien und zum Vorderen Orient weder steinerne Tempel noch Paläste, weder ein vergleichbar hochdifferenziertes Handwerk noch Formen der Schriftlichkeit, weder Städte noch großräumige Herrschaftsbildung. Monumente des Totenkultes in einer Größenordnung, die Formen koordinierter Arbeitsorganisation voraussetzen, gab es auch im Norden Europas, aber nirgends erreichten sie die gewaltigen Dimensionen der im dritten Jahrtausend in Ägypten errichteten Pyramiden. Für die Errichtung der 140 Meter hohen Cheopspyramide waren nach moderner Berechnung rund 13 Millionen Arbeitstage nötig. Ohne die Herrschaft des göttergleichen Pharaos, der mit Hilfe eines Stabes von Schreibern und Priestern über die Ressourcen Ägyptens einschließlich des dort vorhandenen Potentials an Arbeitskräften herrschte, wäre ein solcher Riesenbau nicht zustande gekommen.
Die Kenntnis der Hochkulturen des Nahen Ostens verbreitete sich durch Handel und Seefahrt in den Randzonen, und so kam es, dass um 2000 v. Chr. als erste Hochkultur auf europäischem Boden die sogenannte minoische auf Kreta entstand, die ihrerseits auf die Inseln der Ägäis und auf die gegenüberliegenden Küsten des Festlandes ausstrahlte. Geschaffen wurde diese Hochkultur von einem Volk vorindogermanischer Herkunft, dessen in der Linear-A-Schrift verfasste Schriftzeugnisse wir lesen, aber nicht verstehen können. Hervorstechendstes Kennzeichen dieser Kulturepoche sind die Überreste großartiger, unbefestigter Palastanlagen inmitten städtischer Siedlungen. Der bedeutendste dieser Paläste ist der von Knossos auf Kreta, den zum Beginn des vorigen Jahrhunderts der englische Archäologe Sir Arthur Evans ausgegraben hat. Er war es, der die gesamte durch diesen Palast repräsentierte Kulturepoche nach Minos, dem mythischen Herrscher von Knossos, als die minoische bezeichnete. Dies tat er in Anknüpfung an den griechischen Historiker Thukydides, der fast ein Jahrtausend nach dem Untergang der minoischen Palastkultur der Sage von Minos mit der Zuschreibung einer ausgebreiteten Seeherrschaft einen realistischen Hintergrund zu geben bemüht war. Diese Deutung ist das Produkt einer konstruktiven Phantasie, die vom Interesse an einer Geschichte der Akkumulierung von Macht geleitet war. Aber sie trifft insofern etwas Richtiges, als die Palastherrschaft auf Kreta in weitgespannte Handelswege über das Meer eingebunden war. Was den Palast von Knossos anbelangt, so waren die zum Wohnen und Repräsentieren bestimmten Raumfolgen von zahlreichen Lagerräumen und Werkstätten umgeben. Der Palast war Zentrum einer Wirtschaftsorganisation, die von der landwirtschaftlichen Produktion des Umlandes über die Herstellung von Waffen, Gerätschaften und Luxusgütern wie Schmuck, bemalter Keramik und purpurgefärbter Stoffe bis zum Austausch der produzierten Güter alle drei Sektoren der Ökonomie umfasste. Begünstigt waren Knossos und die übrigen Plätze mit zentral organisierter Wirtschaft durch ihre Lage an den Seewegen zu den Metalllagerstätten im Osten und Westen. Der Zwischenhandel mit den Metallen, auf denen die bronzezeitliche Metallurgie beruhte, Kupfer und Zinn, bildete nicht nur die Voraussetzung für die Herstellung von Waffen und Geräten aus Bronze, sondern bewirkte auch die Entstehung einer handwerklichen Kunst, mit deren Produkten die begehrten Metalle eingekauft werden konnten. Wie im Vorderen Orient wurde eine Schrift als Hilfsmittel der Wirtschaftsverwaltung, das sogenannte Linear A, entwickelt. Somit kommen alle Elemente zusammen, die es rechtfertigen, in dem Verbreitungsgebiet der minoischen Palastkultur den Randsaum der fortgeschrittenen bronzezeitlichen Hochkulturen Ägyptens und Vorderasiens auf europäischem Boden zu sehen.
Tontafel mit Linear-B-Inschrift aus Knossos, um 1400 v. Chr.
Linear B war das Alphabet, mit dem in mykenischer Zeit griechische Texte geschrieben wurden.
Heraklion, Archäologisches Museum
Dieses Verbreitungsgebiet blieb nicht auf Kreta beschränkt. Die archäologischen Befunde lassen die Schlussfolgerung zu, dass dem Handel mit den Ägäisinseln und dem gegenüberliegenden Festland eine kulturelle Expansion nach Norden folgte, zuerst nach Kythera an der Südspitze der Peloponnes und zu den Kykladen wie Melos und Thera, dann, in der sogenannten Neupalastzeit (ca. 1700–1400 v. Chr.), auch nach dem Festland, vor allem in die Küstenregionen der Argolis und Messeniens auf der Peloponnes. Um die Mitte des zweiten Jahrtausends gerieten dann einwandernde Griechen in den Einflussbereich der minoischen Kultur, überzogen den Süden Griechenlands mit befestigten Herrensitzen und wurden auf Kreta die Erben der vorindogermanischen Begründer der minoischen Palastherrschaft. Nach der in der Argolis gelegenen Burg von Mykene wird diese von Griechen getragene Fortsetzung der minoischen Kultur als die mykenische bezeichnet. Wie sich das im Einzelnen abgespielt hat, wissen wir nicht. Aber wir besitzen für die Ablösung der vorindogermanischen Träger dieser Palastkultur ein gesichertes sprachliches Zeugnis in Gestalt der Ersetzung der für uns unverständlichen Silbenschrift von Linear A durch Linear B, das zur Wiedergabe von Worten eines frühen Griechisch entwickelt wurde. Wie aus allerneuesten Funden hervorgeht, wurde Linear B bereits um 1650 v. Chr. auf dem griechischen Festland verwendet – kurz bevor das der griechischen Sprache angepasste Schriftsystem auch auf Kreta das ältere Linear A der minoischen Palastverwaltung ablöste. Die zahlreich erhaltenen in Linear B geschriebenen Texttafeln enthalten, von einigen Weihinschriften abgesehen, Inventare, Abrechnungen und Bestätigungen. Es handelt sich also um Zeugnisse einer zentralen Wirtschaftsverwaltung nicht nur der auf Kreta, sondern auch der auf dem griechischen Festland gelegenen Paläste. Dank der Entzifferung von Linear B ist es möglich geworden, ein genaueres Bild von der gesellschaftlich-politischen Struktur dieser mykenischen Welt zu gewinnen. Paläste wie die von Mykene und Tiryns in der Argolis oder Pylos an der Westküste der Peloponnes waren die Residenzen von lokalen Herrschern, die mit Hilfe einer adligen Gefolgschaft das in Bezirke mit eigenen Vorstehern gegliederte Umland kontrollierten und über dessen Ressourcen verfügten. Die herrschaftlich organisierte Gesellschaft war in der Lage, zahlreiche Arbeitskräfte für große Bauvorhaben zu mobilisieren, für die Errichtung von Palästen, Burgen und pompösen Grabbauten wie den sogenannten Tholosgräbern, runden Grabdenkmälern, sowie für aufwendige Maßnahmen der Landmeliorisierung. Zu letzteren zählen die Errichtung einer Talsperre und die Umleitung eines die Siedlung von Tiryns mit Überschwemmungen bedrohenden kleinen Flusses oder die der Gewinnung von Ackerland dienende Trockenlegung des Kopaisbeckens im mittelgriechischen Boiotien.
Die Palastkultur erwies sich als regenerationsfähig bei Naturkatastrophen wie Erdbeben oder dem verheerenden Vulkanausbruch um 1628 v. Chr. (?), dem die Insel Thera (heutiger Name Santorin) ihre Entstehung verdankt. Sie war auch fähig, Zuwanderer wie die frühen Griechen zu integrieren und sie in die Lage zu versetzen, die vorgefundene Hochkultur fortzusetzen. Aber in dem Völkersturm, der um 1200 v. Chr. die östliche Mittelmeerwelt erschütterte, ist sie untergegangen. Von der kriegerischen Völkerwanderung, die vom Balkan ihren Ausgang nahm, wurden selbst die Großreiche des Vorderen Orients betroffen. Das Hethiterreich in Anatolien erlag dem Ansturm der Phryger und Palaister. Ägypten geriet beim Ansturm der sogenannten Seevölker, zu denen unter anderem auch Palaister gehörten, in große Bedrängnis, konnte sich ihrer aber letztlich erwehren. Von den Ägyptern zurückgeschlagen, bemächtigten sich die Palaister, im Alten Testament Philister genannt, der Ägypten benachbarten palästinensischen Küstenebene – das Land heißt bis heute nach den Eroberern Palästina. In diesem Zusammenhang ist der Palastkultur samt der sie tragenden Wirtschafts- und Herrschaftsstruktur ein Ende gesetzt worden. Ein Indiz für den Seevölkersturm dürfte die archäologisch gesicherte Metallarmut der betreffenden Zeit sein. Der Metallhandel und die Herstellung des Werkstoffs scheinen unterbrochen gewesen zu sein. Wir wissen nicht, was im Einzelnen alles geschah. Was wir mit Sicherheit fassen können, ist der Niederschlag einer grundstürzenden Katastrophe: einen Zerstörungshorizont, der alle mykenischen Paläste betroffen hat. Auf ihren Trümmern entstanden nur noch kleine ein- bis zweistöckige Häuser. Es gab zwar eine Siedlungskontinuität, aber mit deutlich geringerer Bevölkerung. Eine zentral organisierte Ökonomie existierte nicht mehr. Mit ihr kam auch die Kenntnis der Schrift, die ihren Zweck mit dem Ende der Palastwirtschaft verloren hatte, abhanden. Was folgte, waren die sogenannten Dunklen Jahrhunderte.
3. Die Dunklen Jahrhunderte
Für die sogenannten Dunklen Jahrhunderte gibt es keinerlei zeitgenössische Schriftquellen. Nicht einmal eine Schreibschrift war nach dem Untergang von Linear B vorhanden. Wir sind für unsere Kenntnis der Geschichte jener Epoche in erster Linie auf ihre materiellen Überreste angewiesen, auf Gräber und Siedlungsspuren sowie auf Gebrauchsgegenstände wie Gefäße aus Ton und Metall, Geräte und Waffen sowie Schmuck aus Grabbeigaben. Die Sicherung und Deutung dieses Materials ist den mit den Methoden der Archäologie arbeitenden Disziplinen, der Vor- und Frühgeschichte und speziell der Klassischen Archäologie, aufgegeben. Sie ermitteln durch Ausgrabungen und Surveys, das heißt Untersuchungen der Bodenoberfläche einzelner Landschaften, den Befund, datieren ihn, vornehmlich mit Hilfe der gefundenen Tonkeramik, deren relative Chronologie anhand der sich wandelnden Formen und Dekorationen erforscht werden kann, und deuten ihn im Licht historischer beziehungsweise kunsthistorischer Fragestellungen. Althistoriker sind, was die Geschichte der Dunklen Jahrhunderte anbelangt, Kostgänger dieser beiden archäologischen Nachbardisziplinen, doch sie sind, wie es sich für jede Wissenschaft von selbst versteht, nicht von einer kritischen Prüfung der von diesen ermittelten Befunde und ihrer Deutung dispensiert.
Oben ist bereits darauf hingewiesen worden, dass am Anfang der Epoche ein gewaltiger Zerstörungshorizont zu beobachten ist. Diesem folgte ein Neubeginn auf einem erheblich geringeren kulturellen und ökonomischen Niveau. Gewiss wirkten die Formen und Verzierungen mykenischer Keramik noch nach, und ebenso gab es, in der Regel in reduziertem Umfang, Siedlungskontinuität. Aber die mykenischen Burgen auf der Peloponnes und auf Kreta wurden nicht wiederaufgebaut. Nicht einmal die Kenntnis der mykenischen Mauerbautechnik überlebte, und mit den Palästen gingen die hochentwickelte Palastwirtschaft und die sie tragende politische Herrschaftsstruktur zugrunde. Die Schreibschrift Linear B, die ihre Funktion als Hilfsmittel einer komplexen Wirtschaft verloren hatte, geriet in Vergessenheit. Wie aus den Siedlungsüberresten hervorgeht, war die Bevölkerung geschrumpft und siedelte in einfachen Bauernhäusern. Die prachtvollen Tholosgräber der mykenischen Epoche wurden von Einzelgräbern mit ärmlichen Beigaben abgelöst, ein sprechender Beweis für das Fehlen einer reichen Herrenschicht. Der Befund ist insoweit eindeutig. Doch welches die Ursachen jener Katastrophe waren, die einen so deutlichen Niederschlag in den archäologischen Befunden hinterlassen hat, ist eine Frage, deren Beantwortung durch die Wissenschaft alles andere als eindeutig ausfällt.