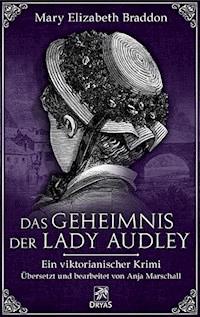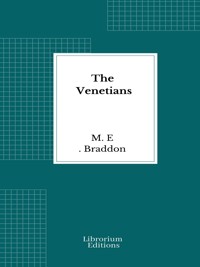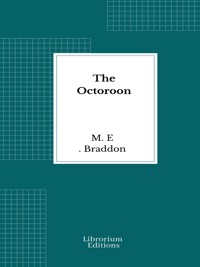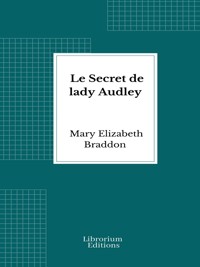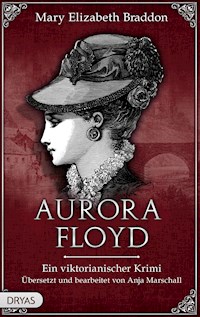
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dryas Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Baker Street Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Aurora Floyd, Tochter aus bestem Haus, kehrt von einer Pariser Privatschule zurück nach Felden Woods, dem Landsitz ihres Vaters. Ihr Start ins gesellschaftliche Leben scheint perfekt, doch etwas muss in Paris geschehen sein, über das Aurora nicht reden will. Auch ihrem Verlobten gegenüber verweigert sie die Wahrheit, und so kommt es zum Bruch. Da wird die Leiche eines Mannes nahe Felden Woods entdeckt und Aurora des Mordes beschuldigt. Ihr Schweigen droht Aurora und der gesamten Familie zum Verhängnis zu werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mary Elizabeth Braddon
AURORA FLOYD
Der Roman wurde erstmals im Jahr 1863 veröffentlicht.
2., überarbeitete Auflage 2019
© Dryas Verlag
Herausgeber: Dryas Verlag, Imprint der Bedey Media GmbH, Hamburg,
gegr. in Mannheim.
Alle Rechte vorbehalten.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form
ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert
oder unter Verwendung elektronischer Systeme vervielfältigt
oder verbreitet werden.
Herstellung: Dryas Verlag, Hamburg
Korrektorat: Birgit Rentz, Itzehoe
Umschlaggestaltung: © Guter Punkt, München (www.guter-punkt.de), unter Verwendung von Motiven von iStock und Thinkstock
Graphik „Black silhouette of lily flower“: © naddya - Fotolia.com
Satz: Dryas Verlag, Hamburg
Gesetzt aus der Palatino von Linotype
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie, detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar
ISBN: 978-3-940855-82-4
eISBN: 978-3-940855-83-1
www.dryas.de
Mary Elizabeth Braddon
AURORA
FLOYD
Ein viktorianischer Krimi
Übersetzt und bearbeitet
von
Anja Marschall
KAPITEL 1
Ein reicher Bankier heiratet eine Schauspielerin
Blassrote Streifen schimmerten hier und da über den dunklen Wäldern von Kent. Des Herbstes Hand legte sich sacht auf das Laub, sparsam wie ein Künstler, der die hellen Farbtöne mit Bedacht in sein Bild einfügte. Die Pracht des Sonnenuntergangs überflutete an diesem Abend im August die friedvolle Landschaft und ließ sie erstrahlen. Die umliegenden Wälder und weiten Wiesen … die klaren Teiche … die dichten Hecken und sanften, kurvenreichen Wege … die Hügelkuppen, die sich in die violette Ferne hineinschmolzen … die Hütten der Tagelöhner, wie sie sich strahlend weiß vom herbstlichen Laub abhoben … die einsamen Gasthöfe am Straßenrand mit ihren braunen Strohdächern und den von Moos bewachsenen Kaminen … das vornehme Herrenhaus, versteckt hinter uralten Eichen mit seinem Säulentor, gekrönt von in Stein gehauenen Wappenschildern, geschmückt mit grünen Kränzen aus Efeublättern.
Auf der breiten Fassade des mächtigen Herrenhauses aus rotem Ziegelstein, das im Stil der frühen georgischen Epoche erbaut worden war, verweilte die sinkende Sonne lange genug, um für einen herrlichen Schimmer in den langen Reihen der schmalen Fenster zu sorgen, die allesamt vom Abendlicht entzündet schienen.
Ein braver Wanderer, der von der nahen Landstraße kam, um über die Weite des taufrischen Rasens und des ruhigen Sees zum Herrenhaus zu blicken, mochte anderes als das Zwielicht der Sonne darin erblicken. Vielleicht wären seine Gedanken voll Angst, könnte er doch fürchten, das brennende Haus von Master Floyd entdeckt zu haben!
Ja, das herrschaftliche Haus dort hinten gehörte Master Archibald Floyd, wie er vom braven Volk der Gegend genannt wurde. Er war einer der Floyds vom großen Bankhaus Floyd, Floyd & Floyd aus der Lombard Street in der Londoner City.
Die Leute in Kent wussten nicht viel von dem bekannten Bankhaus in der Stadt, denn Archibald, der Seniorpartner, hatte sich seit einiger Zeit aus dem aktiven Geschäft zurückgezogen, das nun vollständig von seinen beiden Neffen Andrew und Alexander Floyd betrieben wurde. Beide waren ruhige Männer mittleren Alters mit Familien und Landhäusern. Und beide verdankten ihr Vermögen dem reichen Onkel, der für sie vor dreißig Jahren, als sie selbst noch ungestüm und rothaarig gewesen waren, einen Platz in seinem Unternehmen gefunden hatte.
Seit der Gründung entwickelte sich das Bankhaus wunderbar. Erfolg über Erfolg wartete auf jede Unternehmung, die die angesehene Firma Floyd, Floyd & Floyd jemals in Angriff genommen hatte. Es ging seit einem Jahrhundert stetig aufwärts, denn immer, wenn ein Mitglied des Hauses aus dem alten Stammbaum herausfiel, trieb ein junger grüner Zweig aus, sodass es bisher nie nötig gewesen war, die dreifache Wiederholung des bekannten Namens auf den Messingschildern über den hohen Mahagonitüren zu ändern.
Auf dieses Messingschild wies Archibald Floyd hin, als er etwa dreißig Jahre vor besagtem Augustabend seine beiden Neffen zum ersten Mal über die Schwelle des ehrwürdigen Geschäftshauses treten ließ.
»Seht her, Jungs«, sprach er. »Schaut euch die drei Namen dort oben an. Euer Onkel George ist über fünfzig und Junggeselle – das ist der erste Name. Unser Cousin ersten Grades, Steven Floyd aus Kalkutta, wird seine Geschäftsanteile früher oder später verkaufen – das ist der zweite Name. Der dritte Name ist meiner, und ich bin siebenunddreißig Jahre alt. Ein Mann, der nicht daran denkt, einen Narren aus sich zu machen, indem er heiratet. Kinder bleiben mir also erspart. Darum werden eure Namen früher oder später die dann entstandenen Lücken füllen. Bis dahin aber soll der Name Floyd leuchten. Wehe euch, wenn auch nur ein Fleck auf diesen Namen fällt!«
Vielleicht nahmen sich die jungen Männer diese Lektion damals zu Herzen, vielleicht war aber auch Ehrlichkeit eine natürliche und angeborene Tugend im Hause Floyd. Wie dem auch sei, weder Alexander noch Andrew entehrten jemals ihre Vorfahren. Und als sich der ostindische Kaufmann aus dem Geschäft zurückzog und auch Onkel George der Geschäfte überdrüssig wurde und den üblichen Beschäftigungen eines alleinstehenden Mannes nachzugehen trachtete, traten die beiden jungen Männer in die Schuhe ihrer Verwandten und nahmen das Geschäft auf ihre breiten Schultern.
An einem einzigen Punkt aber hatte Archibald Martin Floyd seine Neffen irregeführt, und dieser Punkt betraf ihn selbst.
Zehn Jahre nach seiner Ansprache an die jungen Männer machte sich der Bankier nicht nur durch eine Heirat lächerlich, sondern sank noch weiter hinab von den stolzen Worten, die er einst gesprochen hatte, indem er sich verzweifelt in eine schöne, jedoch mittellose Frau verliebte, die er nach einer Geschäftsreise durch die Fertigungsbezirke eines Kunden mit nach Hause brachte. Während einer unangebracht kleinen Zeremonie stellte er diese Frau seinen Verwandten und den Familien der Grafschaft vor.
Die Angelegenheit kam so plötzlich! Kaum hatten die Leute einen bestimmten Abschnitt in der linken Kolumne der Times gelesen, aus der sie von der Vermählung Archibald Floyds, Bankier in der Lombard Street, mit Eliza, der einzig überlebenden Tochter von Kapitän Prodder, erfuhren, jagte auch schon der Reisewagen des Bräutigams an den Toren des Pförtnerhauses vorbei, hinauf zum Herrenhaus.
Die frisch angetraute Gattin des Bankiers war eine kaum dreißigjährige, hochgewachsene Frau mit dunklem Teint und großen schwarzen Augen, die ihr Gesicht erstrahlen ließen.
Erinnern wir uns an eines jener Gesichter, dessen alleinige Schönheit im glanzvollen Licht eines prachtvollen Augenpaares liegt.
Erinnern wir uns daran, wie weit diese Augen in ihrer Faszination alle anderen übertreffen. Dieselbe Schönheit, die auf einer wohlgeformten Nase, rosa, schmollenden Lippen, einer symmetrischen Stirn und einem zarten Teint beruht, würde jedoch nur eine Frau von gewöhnlicher Schönheit ergeben. Erst im wunderbaren Glanz der Augen konzentriert, wird aus üblicher Schönheit Göttlichkeit, die einer Circe würdig ist! Ersterem Liebreiz kannst du an jedem Tag begegnen, zweiterem aber nur einmal im Leben!
Mister Floyd stellte seine Frau den angesehenen Familien der Gegend auf einer Dinnerparty vor, die er kurz nach der Ankunft der Dame in Felden Woods gab, wie sein Landsitz genannt wurde. In der Einladung, die sehr eilig verschickt worden war, ließ er nicht viel über seine Wahl verlauten, obwohl seine Nachbarn und Verwandten allesamt gern erfahren hätten, wie diese unvorhergesehene Ehe zustande gekommen war. Natürlich heizte gerade diese Zurückhaltung Archibald Floyds die tausend Zungen des Gerüchts an. Rund um Beckenham und West Wickham nahe Felden Woods gab es kaum eine verdorbene und niedere Station des Lebens, der Mrs Floyd nicht angeblich entsprungen sein sollte. Sie wäre ein Fabrikmädchen, und der dumme alte Bankier hätte sie in den Straßen von Manchester gesehen. Mit einem farbigen Tuch um den Kopf, einer Korallenkette um den Hals und schuh- und strumpflosen Füßen sei sie im Schlamm umhergestolpert. Er hätte sie gesehen und sich sofort in sie verliebt, ja, ihr sogar angeboten, sie auf der Stelle zu heiraten.
Sie sei eine Schauspielerin, hieß es von anderer Seite, und er habe sie auf der Bühne eines heruntergekommenen Theaters entdeckt. Nein, schlimmer noch! Sie sei eines dieser armen Geschöpfe, die, mit dreckigem weißem Musselin, rotem Baumwollsamt und Pailletten geschmückt, in einem Zelt mit jämmerlichen wandernden Vagabunden und einem gelehrigen Schwein umherzogen. Manchmal sagten die Leute, sie sei eine Reiterin und es wäre bei Astley’s und nicht in den Arbeitervierteln gewesen, wo der Bankier sie zum ersten Mal gesehen hätte. Nein, einige waren bereit zu schwören, dass sie selbst die Braut durch vergoldete Reifen hatten springen und die Cachucha auf einem Pferd hatten tanzen sehen, mitten in einer mit Sägemehl ausgestreuten Arena. Es gab flüsternde Gerüchte, die noch weiter gingen. Gerüchte, die ich hier nicht niederzuschreiben wage, denn die geschäftigen Zungen, die so unbarmherzig mit dem Namen und dem Ruhm von Eliza Floyd umgingen, wurden ihrer eigenen Bosheit nicht müde.
Es könnte sein, dass einige der Damen persönliche Gründe für ihren Widerwillen gegen die Braut hatten. All die schwindenden Schönheiten in ihren feinen Villen mochten auf das Einkommen des Bankiers und die damit verbundenen Vorteile einer Vereinigung mit dem Besitzer von Felden Woods spekuliert haben.
»Eine gewagte, verruchte Kreatur, die nicht einmal mit Schönheit zu empfehlen ist«, tuschelten die Damen der Grafschaft und ignorierten beflissentlich Elizas wunderschöne Augen. Man war sehr kritisch ob ihrer niedrigen Stirn, der angeblich zweifelhaften Nase und dem ziemlich weiten Mund. Sie sei eine raffinierte Minx, die im reifen Alter von neunundzwanzig Jahren und mit Haaren, die ihr fast bis zu den Augenbrauen herunterhingen und hinter denen sie sich versteckte, die Schwäche eines alten Mannes ausgenutzt habe.
Der weibliche Teil der Gemeinschaft wunderte sich empört über die beiden Neffen und den alten Junggesellen George Floyd. Warum hatten diese Herren nicht ein wenig Mut bewiesen und ihren verrückten Verwandten in ein Irrenhaus gesteckt? Er hätte es verdient.
Die verarmten Adelsgeschlechter der Faubourg St. Germain mit ihren verwelkten Herzoginnen und ausgemergelten Vidames hätten einem wohlhabenden Bonapartisten kaum mit stärkerem Groll begegnen können, als sie es mit ihrem unaufhörlichen Gerede über die junge Frau des Bankiers taten. Was immer Eliza sagte oder tat, es bot neuerlichen Anlass für Kritik. Nicht einmal auf ihrer ersten Dinnerparty gaben sie Ruhe, obwohl Eliza es nicht gewagt hatte, sich in die Arrangements des Küchenchefs und der Haushälterin einzumischen, fast so, als sei sie selbst eine Besucherin im Haus. Man hasste die glückliche Abenteurerin wegen ihrer schönen Augen, aber auch für ihre prächtigen Juwelen und die extravaganten Geschenke ihres liebenden Ehemannes. Sie hassten sie für ihre würdevolle Gestalt und ihre anmutigen Bewegungen, die niemals das Geheimnis ihrer Herkunft verrieten.
Hätte Eliza nur das Mahl der Demut, das die vornehme Gesellschaft Kents vor ihr auszubreiten bereit war, ohne zu zögern angenommen, ja hätte sie doch nur bereitwillig den Staub von ihren adeligen Schuhen geleckt, um Gunst gebettelt und sich von ihnen in die besseren Kreise »aufnehmen« lassen, dann hätte man ihr vielleicht mit der Zeit vergeben können. Aber Eliza tat nichts dergleichen.
Wenn man ihr unangemeldet die Aufwartung machte, war sie stets freimütig und schien erfreut, ihre Gäste zu sehen. Man traf sie vielleicht mit Gartenhandschuhen an den Händen, zerzaustem Haar und einem Gießkübel bei den Wintergärten an. Jeden empfing sie so gelassen, als wäre sie in einem Palast auf die Welt gekommen und es von Kindheit an gewohnt zu huldigen. Eliza war immer unkompliziert, offen, freundlich und gutmütig. Oft erzählte sie von ihrem »lieben alten Archy«, wie sie ihren Wohltäter und Ehemann zu nennen pflegte, oder sie zeigte ihren Gästen ein neues Bild, das er ihr gekauft hatte, und wagte es – das freche, unwissende, hochtrabende Geschöpf! –, über Kunst zu sprechen, als wäre ihr der hochtrabende Jargon, mit dem ihre Besucher sie zu zermalmen suchten, so vertraut wie einem königlichen Akademiemitglied.
Als die Etikette es verlangte, diese hochnäsigen Besuche zu erwidern, fuhr Eliza mutig in einem winzigen Korbwagen, der nur von einem groben Pony gezogen wurde, zu den Türen ihrer Nachbarn. Sie strahlte die ganze Würde ihrer Person aus, lachte und plauderte, als wäre es das Selbstverständlichste. Dies brachte ihr die Bewunderung irregeführter junger Männer ein, die kaum die großartigen Reize ihrer Feindinnen wahrnahmen, stattdessen aber nicht müde wurden, von Mrs Floyds fröhlichem Wesen und ihren strahlenden Augen zu sprechen.
Ich frage mich, ob die arme Eliza Floyd auch nur die Hälfte von dem wusste, was man Grausames über sie erzählte. Aber vielleicht genoss sie auch den Spaß, es zu wissen und die bösen Zungen darüber im Ungewissen zu lassen.
Sie war an ein aufregendes Leben gewöhnt, so viel kann ich verraten, und Felden Woods mag ihr gelegentlich langweilig erschienen sein, bis auf diese immer wieder neuen Skandale, in deren Zentrum sie stand. Ich denke, sie ergötzte sich insgeheim an der Niedertracht ihrer Feinde.
»Wie sehr müssen diese Damen dich als Ehemann begehrt haben, Archy«, sagte sie lachend, »wenn sie mich so heftig dafür hassen, dass ich deine Frau bin. Arme, unbedarfte alte Jungfern. Ich weiß, dass sie es kaum aushalten können, mich nicht aufhängen zu lassen, weil ich dich geheiratet habe.«
Der Bankier aber war schwer getroffen, als er von dem Klatsch hörte. Stolz und sensibel wie fast alle ehrlichen und gewissenhaften Männer konnte er es nicht ertragen, dass irgendein Geschöpf den Namen der Frau, die er so zärtlich liebte, zu beschmutzen wagte. Was war so verwerflich daran, dass sie bei ihm war? Ist ein Stern weniger hell, weil er auf die Gosse leuchtet? Ist eine tugendhafte und großherzige Frau weniger würdig, weil sie aus dem einzigen Gewerbe stammt, das man ihr auszuüben gestattet?
Ja, der Rufmord musste ein Ende haben, denn die Boshaften lagen mit ihren Vermutungen nicht ganz falsch. Eliza Prodder war eine Schauspielerin. Und tatsächlich hatte der reiche Bankier sie das erste Mal auf den schmutzigen Brettern eines zweitklassigen Theaters in Lancashire gesehen.
Archibald Floyd verspürte eine aufrichtige Bewunderung für das britische Drama, seit er es in jungen Jahren eines Abends erlebt hatte. Seither waren George Barnwell und Jane Shore zu den Lieblingskünstlern des Londoner Publikums geworden. Und so hatte Mr Floyd für eine Nacht in einer kleinen Stadt in Lancashire Halt gemacht und war ohne große Erwartungen in die staubigen Logen des Theaters geraten, um die Aufführung von Romeo und Julia zu sehen. Julia – eine Rolle, die von Miss Eliza Percival alias Prodder vorgetragen wurde. Sie zu erleben war ein Privileg, das die Fabrikarbeiter im Publikum jeweils drei Cents gekostet hatte.
Ich glaube nicht, dass Miss Percival eine gute Schauspielerin war oder dass sie sich in ihrem Beruf jemals einen Namen hätte machen können, aber sie hatte eine tiefe, melodische Stimme, die dem Stück die Schönheit der Worte entlockte und in ihrer Melodie angenehm zu hören war. Auf der Bühne war Miss Percival anmutig anzusehen, denn ihr Gesicht erhellte das kleine Theater mehr, als all die Gaslampen, die der Theaterdirektor seinem spärlichen Publikum gönnte, es vermochten.
Was kann ich über ihre Leistung als leidenschaftliche Italienerin an diesem Abend sagen? Sie trug weißen Satin und Pailletten, die auf den schmutzigen Saum ihres Kleides genäht waren, in dem festen Glauben, der allen provinziellen Schauspielerinnen gemein war, dass Pailletten ein Mittel gegen Schmutz seien. Kurz bevor sie auf die Bühne lief, um dort für ihren ermordeten Verwandten und um den verbannten Geliebten bitterlich zu klagen, lachte und scherzte sie noch in der weiß getünchten kleinen Garderobe. Miss Percival nahm sich ihren Berufsstand nicht sehr zu Herzen. Die Gagen der Lancashire-Truppe deckten kaum die körperlichen Strapazen früher Proben sowie langer und später Auftritte oder die geistige Erschöpfung, die der wahre Künstler erlebt, wenn er mit seinen Charakteren in leidenschaftlicher Hingabe mitfühlt.
Den unbeschwerten Komödianten in der Truppe, mit denen Eliza auftrat, war das Interesse eines gewissen Herrn im Publikum nicht entgangen. Und so spekulierten sie über Elizas private Angelegenheiten und über den Wohlstand, der auf sie warten mochte.
Es war wahrlich nicht Miss Percivals Schauspielkunst, die den Bankier faszinierte. Archibald Floyd wusste, dass sie so schlecht spielte, wie nie zuvor eine Schauspielerin die berühmtesten Tragödien und Komödien für fünfundzwanzig Schillinge pro Woche gespielt hatte. Und so bewegte es ihn zu einem mitleidigen Lächeln, als die Fabrikarbeiter der armen Eliza während der Giftszene derart ergriffen und mit Tränen in den Augen applaudierten.
Aber Archibald Floyd verliebte sich in sie. Es war eine Wiederholung der alten Geschichte. Ein nüchterner, ruhiger Geschäftsmann von siebenundvierzig Jahren, der bis zu jenem Abend noch nie Derartiges gefühlt hatte, wenn sein Blick auf das Gesicht einer schönen Frau gefallen war. Von jenem Abend an gab es für ihn nur noch ein Wesen auf der Welt.
Eliza lachte über ihre neue Eroberung. Es war nur eine von vielen, die alle gleich ausgegangen waren. Was schon oft zu nichts Besserem geführt hatte als dem Kauf einer Pralinenschachtel am Premierenabend oder eines Blumenstraußes, der später an der Bühnentür hing. Sie kannte nicht die Macht der ersten Liebe. Bevor die Woche vorüber war, hatte Archibald Floyd sie um ihre Hand gebeten und war bereit, sein Leben und sein Vermögen mit ihr zu teilen.
Von den Komödianten hatte er viel und ausschließlich Gutes über Eliza gehört. Sie habe so mancher Versuchung widerstanden, sagten sie, und Diamantarmbänder nur allzu oft empört abgelehnt. Im Geheimen zeige sie edle Gesten sanfter, weiblicher Nächstenliebe und habe bei aller Armut und Versuchung stets ihre Unschuld bewahrt. Ihm wurden hundert Geschichten über ihre Güte zugetragen, die ihm das Blut ins Gesicht trieben und in ihm stolze und großzügige Gefühle weckten.
Sie selbst aber erzählte ihm die einfache Geschichte ihres Lebens. Sie sei die Tochter eines Handelskapitäns namens Prodder und in Liverpool auf die Welt gekommen. Ihr Vater sei immer auf See gewesen, und auch an ihren drei Jahre älteren Bruder könne sich auch kaum noch erinnern. Er war nach einem Streit mit dem Vater davongelaufen, um ebenfalls zur See zu fahren. Sie hörte nie wieder etwas von ihm. Auch nicht von ihrer Mutter. Eine Tante nahm Eliza auf. Sie führte einen kleinen Laden, wo das junge Mädchen lernte, Seidenblumen herzustellen und zu kunstvollen Sträußen zu binden. Doch Eliza lag dieses Handwerk nicht. Viel lieber schlich sie sich in die Liverpooler Theater und beschloss schon bald, selber auf die Bühne zu gehen.
Als mutige und energische junge Frau verließ sie eines Tages das Haus ihrer Tante, eilte direkt zum Bühnenmeister eines der kleinen Theater in der Stadt und bat ihn, sie als Lady Macbeth auftreten zu lassen. Der Mann lachte sie aus, erzählte ihr aber, dass er ihr angesichts ihrer schönen Gestalt und ihrer schwarzen Augen fünfzehn Schillinge pro Woche geben würde, damit sie als unbedeutende Statistin auf die und von der Bühne gehen könne, mal als Dorfbewohner gekleidet, mal in der Robe eines Richters. Sie solle nur vage anstarren, was auch immer in der Szene vor sich ginge. Bald schon bekam Eliza kleine Rollen, die die anderen Schauspieler ob ihrer Bedeutungslosigkeit empört abgelehnt hatten. Von nun an stürzte sie sich ehrgeizig in tragische Rollen und folgte neun Jahre lang ihrem Traum, bis kurz vor ihrem neunundzwanzigsten Geburtstag besagter wohlhabender Bankier ihren Weg kreuzte.
In einer kleinen Pfarrkirche in den Potteries änderte die schwarzäugige Schauspielerin den Namen Prodder in jenen der Floyds. Sie hatte den reichen Mann akzeptiert, denn sie war bewegt von einem Gefühl der Dankbarkeit für die großzügige Zuneigung ihr gegenüber. Sie war willens, ihn mehr zu mögen als jeden anderen, der ihr seine Liebe geschworen hatte. Sie tat es aber auch in Übereinstimmung mit dem Rat ihrer Theaterfreunde, die ihr mit mehr Offenheit als Eleganz sagten, dass sie ein Dummkopf sei, würde sie sich eine solche Möglichkeit entgehen lassen. So gab sie also Archibald Floyd ihre Hand, ohne zu wissen, welch unvorstellbaren Reichtum er vor ihr ausbreiten würde.
Er hatte ihr erzählt, dass er Bankier sei, und ihr reger Verstand erinnerte sich sofort an das Bild der einzigen Bankiersfrau, die sie je gekannt hatte: eine füllige Dame, die Seidenkleider trug, in einem hübschen Haus mit grünen Jalousien wohnte, eine Köchin und ein Hausmädchen hielt und einmal drei Logenkarten für eine Vorstellung mit Miss Percival gekauft hatte.
Als der glückliche Ehemann seine wunderschöne Braut also mit Diamantarmbändern und Halsketten, mit Seide und Brokat beladen hatte, fuhr er sie direkt von den Arbeitervierteln zur Isle of Wight, wo er sie in geräumigen Appartements im besten Hotel übernachten ließ. Er verschleuderte sein Geld hier und da, als ob er Aladins Lampe mit sich umhertrüge, sodass Eliza befürchtete, ihr Gemahl sei durch seine Liebe zu ihr dem Wahn verfallen! Anders waren diese alarmierenden Auswüchse von Extravaganz nicht zu erklären. Als er sie dann aber durch die Türen von Felden Woods führte, konnte sie die Pracht kaum fassen. Sie fiel vor ihrem Mann auf die Knie. »Oh Archy!«, rief sie. »Es ist alles zu gut für mich. Ich fürchte, ich werde sterben oder als armes Mädchen vor all der Pracht fliehen müssen.«
Da Sie, lieber Leser, nun mit Elizas Vorgeschichte vertraut sind, verstehen Sie auch, warum Eliza so mühelos auf die Frechheit und Unverfrorenheit dieser armseligen Nachbarn reagierte, mit der man sie in Verlegenheit bringen wollte. Sie war Schauspielerin. Neun Jahre lang hatte sie in jener Welt gelebt, in der Herzöge und Marquise im Leben ebenso üblich waren wie Metzger und Bäcker. In der ein Edelmann im wahren Leben ein armer Schlucker war, der von allen Seiten nur das Schlimmste erfuhr, aber am Abend von dem Publikum bejubelt und dem gehuldigt wurde. Wie sollte Eliza sich beim Betreten der Salons schämen, war sie doch neun Jahre lang allabendlich auf eine Bühne gegangen, um unter den Augen der Leute im Mittelpunkt zu stehen, mit dem Ziel, ihre Gäste vortrefflich zu unterhalten? War es möglich, dass sie von den Lenfields eingeschüchtert wurde, die Karosseriebauer in der Park Lane waren, oder von Miss Manderly, deren Vater sein Geld durch irgendein Patent verdient hatte? Oh, nein, nicht sie, die König Duncan vor den Toren ihres Schlosses empfangen und die auf ihrem Thron gesessen hatte, um den unterwürfigen Fürsten in Dunsinane herablassende Gastfreundschaft entgegenzubringen. Die Leute im Salon in Felden Woods waren nicht imstande, Mrs Eliza Floyd zu unterwerfen.
Um der Kränkung der feinen Gesellschaft noch weitere Schmach hinzuzufügen, wurde es jeden Tag deutlicher, dass Mr und Mrs Floyd eines der glücklichsten Ehepaare waren, welches je die süßen Fesseln der Zweisamkeit getragen hatten. Eine Kette, die die beiden in Girlanden aus Rosen verwandelten. Ich bin verpflichtet, wahrheitsgetreu zu berichten, dass die Liebe, die Eliza Floyd für ihren Mann empfand, so rein und aufrichtig war, wie ein Mann es jemals von einer aufopfernden Frau erhoffen konnte. Welchen Anteil jedoch Dankbarkeit in dieser Liebe gehabt haben mag, vermag ich nicht zu sagen. Jeder ihrer Wünsche, kaum geäußert, wurde sogleich erfüllt. Auch wenn Eliza in einem stattlichen Haus wohnte und von aufmerksamem Personal bedient wurde, wenn sie von delikaten Speisen aß und kostbare Weine trank, reiche Kleider und prächtige Juwelen trug, wusste sie genau, wem sie all das verdankte: ihrem liebenden Gatten, Archibald Floyd. Und ihm galt all ihre Dankbarkeit.
Ihre Liebe mag im Vergleich zu so manch anderer erhabener Romanze zwischen zwei Buchdeckeln zutiefst verabscheuungswürdig wirken, ja, manchem als eine falsche Zuneigung erscheinen, doch Eliza liebte ihren Mann von Herzen und machte ihn vollkommen glücklich. So glücklich, dass er auf die Knie fiel und zu Gott betete, damit dieser Segen seiner liebenden Frau ihm niemals genommen werden mochte. Und sollte es dem Schicksal gefallen, ihn zu quälen, würde er jeden Schilling seines Reichtums hingeben, um mit ihr neu anzufangen. Aber ach! Es war ausgerechnet dieser Segen unermesslicher Liebe, den er verlieren sollte.
Ein Jahr lang lebten Eliza und ihr Mann ein glückliches Leben in Felden Woods. Er wollte sie mit auf den Kontinent nehmen oder für die Saison nach London, aber sie konnte es nicht ertragen, ihr schönes Heim zu verlassen. Sie war glücklich in ihren Gärten, zwischen den Kiefern und bei den Weinhängen. Und sie war glücklich mit ihren Hunden und den Pferden, aber vor allem bei den Armen. Denen schien sie ein Engel zu sein, der aus dem Himmel herabgestiegen war, um Trost zu spenden.
Eliza verfügte über eine List, sich diese Leute in den armseligen Hütten der Gegend gewogen zu machen, um sie später fast unbemerkt von ihren schlechten Gewohnheiten zu befreien. In einem frühen Stadium der Bekanntschaft schien sie blind für den Schmutz und die Unordnung in den kleinen Behausungen, wie sie es für einen schäbigen Teppich im Salon einer verarmten Herzogin gewesen wäre. Dann aber begann Eliza Stück für Stück hier und dort kunstvoll eine Andeutung fallen zu lassen, wie dies oder jenes im Haus ein wenig verbessert werden könne. In weniger als einem Monat, ohne je einen Vortrag gehalten oder Beleidigungen ausgesprochen zu haben, hatte sie eine erstaunliche Wandlung unter den Pächtern vollbracht, denn sie war äußerst geschickt im Umgang mit diesen einfachen Leuten. Anstatt ihnen auf christlich anmutende Weise zu sagen, dass sie alle schmutzig seien, nichtswürdig, undankbar und irreligiös, ging sie feinfühlig und diplomatisch vor. Sie sorgte dafür, dass die jungen Mädchen regelmäßig in die Kirche gingen, indem sie ihnen vorführte, wie vortrefflich dort ein neuer Hut darzubieten sei. Sie hielt verheiratete Männer von den öffentlichen Häusern fern, indem sie Bestechungsgelder in Form von Tabak überreichte, der zu Hause zu rauchen sei, und einmal sogar durch das Geschenk einer Flasche Gin. Sie adelte einen schmutzigen Kaminsims mit einer farbenprächtigen Porzellanvase und einen nicht minder schmutzigen Ofen mit einem neuen Kamingitter aus Messing. Sie zähmte ein bissiges Temperament mit einem Mantel und legte eine langjährige Familienfehde mit einem Kleid aus Chintz bei.
Aber ein kurzes Jahr nach ihrer Heirat, als das Vertrauen unter den dankbaren Pächtern erste Blüten zeigte und die geifernden Zungen ihrer Feinde noch immer Krieg gegen sie führten, geschah es! Ohne eine Warnung verblasste das Licht des Lebens aus ihren wundervollen Augen, um nie mehr auf dieser Seite der Ewigkeit zu strahlen.
Von diesem Tage an war Archibald Floyd Witwer.
KAPITEL 2
Aurora
Das Kind, welches Eliza Floyd zurückließ, als sie so plötzlich von allem irdischen Wohlstand und Glück entrissen worden war, taufte man auf den Namen Aurora. Archibald Floyd trauerte unermesslich um seine verstorbene Frau, und kein Geschöpf dieser Welt konnte seinen wahren Gram ermessen. Seine Neffen und ihre Frauen zollten ihm unermüdliche Kondolenzbesuche. Eine von ihnen, Mrs Alexander Floyd, eine mütterliche Person, tat sich hier besonders tröstend hervor. Der Himmel weiß, ob ihre Liebenswürdigkeit dieser verlorenen Seele auch nur ein Quäntchen Trost brachte. Vielleicht aber hatte sie den klügsten Weg eingeschlagen, der möglich war. Sie sprach wenig über Eliza, sondern saß Archibald Floyd stundenlang geduldig gegenüber und sprach über alle möglichen Dinge – den Zustand des Landes, das Wetter, eine Änderung im Ministerium und solcherlei. Themen, die von der tiefsten Trauer seines Lebens so weit entfernt waren wie nur irgend möglich.
Erst sechs Monate nach Elizas Tod wagte es Mrs Alexander Floyd zum ersten Mal, den Namen der Verstorbenen zu erwähnen. Sie sah sofort, dass sie es richtig gemacht hatte. Die Zeit war gekommen, dass der Witwer Erleichterung empfand, wenn er von seiner geliebten Frau sprach. Von da an war Mrs Alexander Floyd ein Liebling des Witwers und ein stets gern gesehener Gast in Felden Woods.
Noch am Abend von Elizas Tod hatte der Witwer mit einem Baby in den Armen im großen Saal gesessen. Das Kind war blassgesichtig und schien ihn mit großen staunenden schwarzen Augen im Halbdunkeln fragend anzusehen. Dieses Kind würde fortan das Einzige in Archibald Floyds Leben sein. Das einzige Wesen im weiten Universum, für das es sich zu leben lohnte – das Einzige, um dessentwillen es sich lohnte, das Leben zu ertragen. Und da Archibald Floyd sich mit dem Tod seiner Frau aus dem aktiven Geschäft der Bank zurückgezogen hatte, kümmerte er sich von nun an ausschließlich um die Launen seiner kleinen Tochter.
Seine Liebe zu ihr erschien so manchem als eine Schwäche, die beinahe an Wahnsinn grenzte. Er schien den vielen Kindermädchen im Haus die Zuneigung seiner Tochter zu missgönnen. Heimlich sah man ihn, wie er die Angestellten beobachtete, um zu verhindern, dass einer von ihnen zu hart mit Aurora umging. All die schweren Türen im großen Haus konnten den schwächsten Laut seiner Tochter vor seinen Ohren nicht verbergen. Er wiederholte ihre gebrochenen Babysilben, bis die Leute angesichts seines Geschwätzes ermüdeten.
Natürlich war das Ende von allem, dass Aurora verdorben wurde. Sie sagte, was ihr in den Kopf kam, tat, was ihr gefiel, und wuchs so zu einem ungestümen Wesen heran, zärtlich und großherzig wie ihre Mutter, aber mit einem Hauch Feuer in ihrer Seele. Mit siebzehn Jahren war sie doppelt so schön wie ihre Mutter und hatte Augen, die wie die Sterne des Himmels strahlten. Die angeblich zweifelhaft kleine Nase oder die Weite des lächelnden Mundes zu kritisieren, wie es die ach so feine Gesellschaft von Kent an Eliza zu bemängeln niemals müde gewesen war, fiel den bösen Zungen bei Aurora schwer.
Das Kind selbst wusste indes nur wenig über die Geschichte seiner Mutter. Im Arbeitszimmer des Bankiers hing ein Bild, das Eliza im vollen Rausch ihrer Schönheit und ihres Wohlstands zeigte. Aber das Porträt erzählte nichts von der Geschichte der früheren Eliza. Und so hatte Aurora nie etwas von dem Handelskapitän, der armen Liverpooler Unterkunft, der düsteren Tante, die einen Krämerladen führte, in dem Eliza künstliche Blumen hergestellt hatte, oder dem Provinztheater gehört. Ihr war nie gesagt worden, dass ihr Großvater mütterlicherseits Prodder hieß und dass ihre Mutter Shakespeares Julia vor einem Publikum aus Fabrikarbeitern gespielt hatte.
Die Familien der Grafschaft akzeptierten die Erbin des reichen Bankiers, aber sie waren flink zu tuscheln, dass Aurora zweifellos die Tochter ihrer Mutter sei. Hinter vorgehaltener Hand mokierten sie sich, dass wohl auch das Kind den Makel des Spielens und des Reitens, der Pailletten und des Sägemehls in seiner Natur trüge.
Um der Wahrheit Genüge zu tun, muss man allerdings sagen, dass Miss Floyd bereits mit sechs Jahren Puppen ablehnte und ein Schaukelpferd verlangte. Mit zehn Jahren konnte sie sich fließend über Jagdhunde wie Zeiger, Setter, Fuchshunde, Weihen und Beagles unterhalten. Damit trieb sie ihre Gouvernante an den Rand der Verzweiflung, denn Aurora vergaß beharrlich, unter welchem römischen Kaiser Jerusalem zerstört worden und wer zum Zeitpunkt der Scheidung Katharina von Aragons Legat des Papstes gewesen war. Mit elf Jahren sprach sie unbeschwert von den Pferderennen der Gegend, und mit zwölf brachte sie eine halbe Krone zu einem Derby, wo sie haushoch ihre Wette gewann. Mit dreizehn ritt sie mit ihrem Onkel Andrew, der Mitglied des Croydon-Jagdclubs war, quer durchs Feld, wobei der arme Mann atemlos hinterherhastete.
Nicht ohne Trauer beobachtete der Bankier die Entwicklung seiner Tochter. Und doch war sie so schön, so offen und furchtlos, so großzügig, liebevoll und wahrhaftig, dass er sich nicht dazu durchringen konnte, ihr zu sagen, dass er sie sich manchmal anders wünschte. Wenn er diese ungestüme Natur hätte regieren oder lenken können, sie wäre die Eleganteste und Vollendetste ihres Geschlechts gewesen. Aber er konnte es nicht, und dennoch dankte er dem Herrn, dass sie war, wie sie war.
Mr Alexander Floyds älteste Tochter, Lucy, war die Vertraute der jungen Aurora. Cousine Lucy kam ab und zu nach Kent, um einen Monat lang in Felden Woods zu verbringen. Anders als Aurora hatte Lucy Floyd ein halbes Dutzend Geschwister und wurde auf eine ganz andere Weise erzogen als die Erbin des Bankiers. Sie war ein Mädchen mit goldenem Haar, das Felden Woods für das Paradies auf Erden hielt. Lucy glaubte fest daran, dass Aurora mehr Glück hatte als die drei Prinzessinnen im Royal Palace. Sie selbst hatte schreckliche Angst vor den Ponys und den Hunden ihrer ungestümen Cousine. Aber sie liebte und bewunderte Aurora auf eine Art und Weise, die so manchem schwachen Wesen zu eigen ist.
Der Tag kam, an dem eine dunkle Wolke über dem Himmel von Felden Woods schwebte. Eine eigentümliche Kühle trat zwischen den Bankier und sein geliebtes Kind. Es begann damit, dass die junge Dame tagein, tagaus ausritt, begleitet von einem verwegenen jungen Stallburschen, dessen gutes Aussehen Mr Floyd nicht verborgen geblieben war. Nach diesen langen Ausritten speiste Aurora stets in ihrem eigenen Zimmer und ließ ihren Vater sein einsames Mahl im großen Speisesaal allein zu sich nehmen. Ein Raum, der dem Bankier ohne sein Kind trostlos erschien.
Der Haushalt von Felden Woods erinnerte sich noch lange an einen bestimmten Abend im Juni, an dem der Sturm zwischen Vater und Tochter losbrach. Aurora war von zwei Uhr nachmittags bis zum Sonnenuntergang fort gewesen, und Archibald Floyd ging mit seiner Uhr in der Hand auf die Terrasse hinaus. Ungeduldig wartete er darauf, dass seine Tochter nach Hause käme. Er hatte sein Abendessen unangetastet zurückgehen lassen, seine Zeitungen lagen unberührt auf dem Tisch, und die Diener erzählten sich gegenseitig, wie heftig seine Hand gezittert hatte bei dem Versuch, ein Glas Wein einzuschenken. Die Haushälterin und ihre Untergebenen schlichen sich in die Halle und schauten ängstlich zum Hausherrn hinaus. Die Männer in den Ställen sprachen von einem ungeheuren Streit zwischen Vater und Kind, der sich jeden Moment zutragen würde, sobald die Tochter zurückkäme. Und als endlich die Hufe der Pferde zu hören waren und Miss Floyd sich am Fuße der Stufen von dem verschwitzten Tier schwang, war das lauernde Publikum im Abendschatten enttäuscht, als das junge Mädchen wortlos die Stufen hinaufeilte, um sich in seine Räume zurückzuziehen. Sie alle hatten einen Streit erwartet, der den Himmel erbeben lassen würde. Ein Streit, von dem sie trefflich im Pub oder nach dem Gottesdienst berichten konnten. Doch Aurora verschwand im Haus, während der Stallbursche die bebenden und schäumenden Rösser zum Stall führte.
Mr Floyd beobachtete den Knecht mit den beiden Pferden, wie sie durch die großen Tore zum Stall verschwanden. Dann folgte er seiner Tochter in die Halle und stellte sich ihr in den Weg.
»Du bist nicht gut genug zu dem Tier, Aurora. Dein Knecht hätte es besser wissen müssen.« Er steuerte auf sein Arbeitszimmer zu und befahl ihr, ihm zu folgen.
Eine Stunde lang sah keiner im Herrenhaus auch nur einen von ihnen. Niemand vernahm ein lautes Wort hinter der verschlossenen Tür. Und dennoch wussten sie alle im Haus, dass etwas Unheilvolles geschah.
Am nächsten Morgen verließ Miss Floyds Gouvernante unerwartet Felden Woods. Zwischen dem Frühstück und dem Mittagessen trat der Bankier in den Stall und untersuchte die Lieblingsstute seiner Tochter. Es war ein wunderschönes Pferd, trainiert für Rennen. Doch das arme Tier hatte sich am Vortag zu sehr angestrengt und lahmte. Erbost ließ Mr Floyd nach dem Stallknecht seiner Tochter rufen, bezahlte und entließ ihn auf der Stelle. Der junge Mann erhob keine Widerrede, sondern ging in sein Quartier, nahm seine Livree ab, packte eine Tasche und ging fort, ohne sich zu verabschieden.
Drei Tage später, am 14. Juni, verließen Mr Floyd und seine Tochter Felden Woods, um nach Paris zu gelangen, wo Aurora in der exklusiven Mädchenschule der Demoiselles Lespard in einem stattlichen Haus in der Rue Saint Dominique untergebracht werden sollte, um ihre höchst unvollkommene Ausbildung zu korrigieren und abzuschließen.
Es war vierzehn endlose und einsame Monate später, dass der Bankier erneut auf der langen Steinterrasse vor den Fenstern seiner Villa nervös auf und ab ging. Er wartete auf die Rückkehr seiner geliebten Tochter aus Paris. Die Diener zeigten große Verwunderung darüber, dass er nicht den Ärmelkanal überquert hatte, um sie persönlich abzuholen, denn sie dachten, dass es der Würde des Hauses schade, wenn Miss Floyd unbeaufsichtigt und allein reise.
»Ein armes, liebes Ding«, sagte die Haushälterin kopfschüttelnd, »so ganz allein unter einem Rudel Franzosen mit Schnurrbart.«
Archibald Floyd schaute immer wieder auf seine Uhr und hielt inne, um die Schläge der Kirchturmuhr von Beckenham zu zählen. Er lauschte auf das Geräusch der Wagenräder, die von der Landstraße zu ihm drangen. Würde die Kutsche vorbeifahren oder an der Toreinfahrt anhalten, um den Weg zum Herrenhaus hinauf zu nehmen? Sein Herz schlug lauter denn je in väterlicher Liebe und Hoffnung.
Der Wagen stoppte. Erleichtert glaubte der Hausherr das Scharren der Torflügel über dem Kies zu hören, während die purpurfarbene Landschaft vor ihm verschwamm. Er schloss die Augen, bis endlich stürmische Arme um seinen Hals flogen und Aurora ihr Gesicht an seiner Schulter verbarg.
Es war eine armselige Mietwagenkutsche, in der Miss Floyd zurückgekehrt war. Eifrige Diener nahmen das wenige Gepäck, während der Vater sein Kind in das Arbeitszimmer führte, in dem er vierzehn Monate zuvor dieses letzte Gespräch mit ihr gehabt hatte. Eine Lampe brannte auf dem Bibliothekstisch, und zu diesem Licht führte Archibald Floyd seine Tochter.
Dieses eine Jahr hatte das Mädchen zu einer Frau werden lassen – eine Frau mit großen, hohlen, schwarzen Augen und blassen, abgemagerten Wangen. Erschreckt erkannte Mr Floyd, welchen Fehler er begangen hatte. Das Studium an der Pariser Schule war offenbar zu hart für sein Kind gewesen.
»Aurora«, klagte der alte Mann jämmerlich, »wie krank du aussiehst! Wie verändert …«
Sie legte ihre Hand auf seine Lippen. »Sprich nicht von mir«, sagte sie. »Ich werde mich erholen. Aber du, Vater, auch du hast dich verändert.« Tränen traten in ihre Augen und strömten schweigend über ihre ausgezehrten Wangen. »Mein Vater, wenn mein Herz auch aus Hartnäckigkeit gemacht ist, so bricht es, wenn ich die Veränderung in dir sehe.«
»Sage mir nur eines: Ist er tot?«
Sie nickte. »Er ist es.«
KAPITEL 3
Was aus dem Diamantarmband wurde
Ich fürchte, dass das Ansehen der Schule der Demoiselles Lespard nach der Rückkehr der jungen Erbin im Kreise vieler angesehener Leute in Kent erheblich litt, denn Miss Floyd hatte sich wahrlich nicht zu ihrem Vorteil verändert. Sie hatte keinen Appetit, schlief schlecht, war nervös und zeigte bisweilen einen Hang zum Hysterischen. Weder ihre Hunde noch ihre Pferde interessierten sie. Ja, sie hatte sich wirklich sehr verändert. Mrs Alexander Floyd erklärte, es sei völlig klar, dass diese grausamen Franzosen die arme Aurora zu einem Schatten ihrer selbst gemacht hatten. Die Zeiten im sonnenlosen Klassenzimmer schienen das freiheitsliebende Mädchen verzehrt zu haben.
Bald aber erholte sich Aurora von der deprimierenden Stimmung ihres Herzens. Als Anfang September Lucy Floyd nach Felden Woods kam, fand sie ihre hübsche Cousine fast vollständig erholt. Eigentümlicherweise aber war Aurora noch immer abgeneigt, viel von ihrer betrüblichen Zeit in Paris zu erzählen. Lucys eifrige Fragen beantwortete sie nur kurz, sagte, dass sie Demoiselles Lespard hasse und dass ihr die Erinnerung an Paris unangenehm sei.
Der fünfzehnte September war Auroras Geburtstag, und Archibald Floyd beschloss, einen Ball zu geben, um die zurückgekehrte Erbin seinen Nachbarn und Freunden aus der Stadt zu präsentieren und sie in die Gesellschaft einzuführen. Mrs Alexander kam nach Felden Woods, um die Vorbereitungen für den besonderen Ball zu treffen. Sie fuhr mit Aurora und Lucy in die Stadt, um das Abendessen und die Musiker zu bestellen sowie Kleider und Kränze für die jungen Damen auszusuchen. Aurora fühlte sich sichtlich unwohl im Ausstellungsraum eines Hutmachers, aber sie zeigte alsbald ein sicheres Urteil hinsichtlich Farbe und perfekter Form ihres Haarschmucks, fast so, als besäße sie die Seele eines Künstlers.
Lucy hingegen bereitete es endlose Schwierigkeiten, eine Entscheidung zu fällen, die ihren rosa Wangen und dem goldenen Haar schmeichelte. Aurora warf einen prüfenden Blick durch den Raum und entdeckte einen Hut aus bemaltem Batist, geschmückt mit einer kronenförmigen Girlande aus scharlachroten Beeren, umrankt von dunkelgrün glänzenden Blättern, die aussahen, als wären sie gerade aus einem strömenden Bächlein gerissen worden. Sie vernahm Lucys Verwirrung mit einem amüsierten Lächeln.
Vom Hutmacher fuhren sie zu Mr Gunter’s in Berkeley Square, dem bekannten Feinkostgeschäft. Mrs Alexander orderte Truthähne in Gelee, Schinken, raffiniert in reichhaltige Weine und Brühen eingelegt, und weitere Exemplare erhabener Confiserie. Vom Westend nahm man eine Kutsche nach Charing Cross, wo Mrs Alexander Floyd einen Auftrag für Dent’s hatte. Sie plante den Kauf einer Uhr für einen ihrer Jungen, der gerade nach Eton reiste.
Während ihre Tante und Lucy beim Uhrmacher warteten, lehnte sich Aurora müde in der Kutsche zurück. Obwohl sie viel von ihrem alten Glanz und ihrer Lebendigkeit wiedererlangt hatte, blieb dem aufmerksamen Beobachter ein gewisser düsterer Schatten in ihrem Gesicht nicht verborgen, sobald sie sich für ein paar Minuten allein zu sein wähnte. Dieser Schatten fiel nun auf ihre Schönheit, als sie aus dem offenen Fenster der Kutsche schaute.
Aurora hatte fast eine Viertelstunde lang dagesessen und mit leerem Blick auf die wandelnde Menschenmenge gestarrt, als ein Mann vorbeieilte. Überrascht warf er einen kurzen Blick auf die junge Frau in der Kutsche, ging jedoch weiter Richtung Horse Guards. Bevor er noch die Kurve erreicht hatte, blieb er abrupt stehen, kratzte sich mit seiner großen Hand am Hinterkopf und ging dann langsam wieder zurück. Er war ein breitschultriger, stierhalsiger Kerl in einem alten Mantel. Sein Halstuch war bunt, und er rauchte eine große Zigarre, deren stinkender Qualm gegen den Geruch des Rums anzukämpfen hatte. Die gesellschaftliche Stellung dieses Herrn verrieten der Kopf eines Terriers, dessen runde Augen aus der Tasche seines abgeschnittenen Mantels spähten, und ein unter dem Arm getragener Spaniel. Er war der allerletzte Mensch unter all den Seelen zwischen der Cockspur Road und der Statue König Charles’, der mit einer reichen Erbin wie Miss Floyd etwas gemein hätte haben können. Trotzdem ging er zur Kutsche zurück, legte seinen Ellenbogen auf die Tür und nickte ihr zu.
»Nun«, sagte er, ohne die Zigarre aus dem Mund zu nehmen. »Wie geht es der vornehmen Dame?« Sein abschätzender Blick glitt durch die Kutsche.
Wütend verlangte Aurora zu wissen, ob er ihr irgendetwas sagen wolle. In ihren Augen sprühte unverhohlene Empörung.
Er steckte seinen Kopf in das Kutschenfenster, und sein rumgetränktes Flüstern erreichte kein anderes Ohr außer dem von Aurora. Er zischte ihr einige Worte entgegen, die sie versteinern ließen. Als er gesagt hatte, was zu sagen war, nahm er ein fettiges, lederbezogenes Kontobuch und einen kurzen Bleistiftstummel aus seiner Westentasche und schrieb etwas auf eines der Blätter. Dann riss er es heraus und überreichte es Aurora. »Das ist die Adresse«, sagte er. »Sie werden nicht vergessen, es zu schicken!«
Sie schüttelte den Kopf, wobei sie angeekelt und voller Abscheu seinen Blick mied.
»Sie würden nicht gerne einen Terrier kaufen?«, fragte der Mann und hielt das gelockte braune Tier aus seiner Manteltasche in das Kutschenfenster. »Oder einen Spaniel, der ein Brot auf der Nase balanciert, während Sie bis zehn zählen? Wir sollten verhandeln – sagen wir fünfzehn Pfund für beide.«
»Nein!«
In diesem Moment kam Mrs Alexander auf die Straße, gerade noch rechtzeitig, um einen Blick auf die breiten Schultern des Mannes zu werfen, als dieser sich zufrieden grinsend von der Kutsche entfernte.
»Hat diese Person gebettelt, Aurora?«, wollte Mrs Alexander Floyd besorgt wissen.
»Nein. Ich habe mal einen Hund von ihm gekauft, und er hat mich wiedererkannt.«
»Und er wollte, dass du noch einen kaufst?«, fragte sie ungläubig.
»Ja.«
Während der ganzen Fahrt schaute Aurora schweigend aus dem Wagenfenster. Ihre Tante und ihre Cousine gaben bald auf, sie aufmuntern zu wollen. Mrs Alexander und ihre blondhaarige Tochter zollten der Erbin des Bankiers stets stumme Ehrfurcht und schwiegen, wenn es ihr gefiel, oder sie unterhielten sich, wenn Aurora dies wünschte.
Ich glaube allerdings, dass es nicht das Geld war, welches Aurora so unnahbar wirken ließ, sondern ihre Augen. Wäre sie eine Straßenkehrerin gewesen, in Lumpen gekleidet und um einen halben Penny bettelnd, hätten die Leute sie gefürchtet und für sie Platz gemacht. Und sie hätten ihren Atem angehalten, wenn Wut die junge Frau mit den schwarzen Augen überkommen hätte. Aurora war ein sonderbares Geschöpf, das in Menschen gleichsam Verehrung und Furcht auslösen konnte.
KAPITEL 4
Nach dem Ball
Die Bäume der langen Allee von Felden Woods waren an diesem Abend mit funkelnden Lampions in allen Farben behängt, um die Gäste zu empfangen, die zum Geburtstagsfest von Aurora Floyd erschienen. In den Fenstern im Erdgeschoss standen Kandelaber, die das Herrenhaus auf eine Wolke aus Licht hoben. Aus dem Inneren des Hauses hörte man Musik, während das unablässige Rollen von Wagenrädern und die Rufe von Besuchernamen über dem stillen Wald erklangen. Große tropische Pflanzen zierten die Empfangshalle, prächtige Blumenarrangements schwebten nahe den Türen. Glanz überall. Und inmitten aller Herrlichkeit stand die dunkle Schönheit Aurora Floyds an der Seite ihres Vaters, gekrönt mit Karmesinrot und gehüllt in Weiß.
Unter den Gästen, die als Letzte angekommen waren und nun auf den Einlass ins Herrenhaus warteten, befanden sich auch zwei Offiziere. Sie waren extra von Windsor in einem Phaeton quer durchs Land angereist. Der Ältere von beiden, zugleich der Fahrer der Kutsche, war die ganze Fahrt über mürrisch gewesen.
»Hätte ich eine leise Vorstellung von der Entfernung gehabt, mein lieber Maldon«, sagte er, »hätte ich nicht eingewilligt, mein Pferd um dieser hochnäsigen Party willen zu opfern.«
»Aber es wird keine snobistische Feier«, antwortete sein Begleiter ungestüm. »Archibald Floyd ist der beste Mann der Christenheit, und was seine Tochter angeht …«
»Oh, natürlich, eine Göttlichkeit mit einem Erbe von fünfzigtausend Pfund, die ohne Zweifel sehr genau weiß, was damit zu tun ist, wenn sie jemals einen mittellosen Taugenichts wie Francis Lewis Maldon ehelicht. Ich will dir aber nicht im Weg stehen, mein Junge. Geh hinein und gewinne sie. Ich kann mir diese junge Schottin vorstellen – feuerrote Haare, große Füße und Sommersprossen!«
»Aurora Floyd – rote Haare und Sommersprossen!« Der junge Offizier lachte laut über den Witz. »Sie sehen sie in einer Viertelstunde, Bulstrode«, sagte er.
Talbot Bulstrode, Captain der 11. Husaren Ihrer Majestät, hatte zugestimmt, seinen jungen Offizier nach Beckenham zu begleiten, damit dieser in seiner Uniform das Fest in Felden Woods schmücken konnte. Maldon war jung und noch ohne Braut. Bulstrode selbst hatte bereits das zweiunddreißigste Lebensjahr erreicht und alle notwendigen Vergnügungen des Lebens durchschritten. Er war nicht sonderlich reich, aber es genügte ihm. Zudem war er zu müde vom Leben, um sich eine Frau zu suchen. Er war der älteste Sohn eines wohlhabenden Barons aus Cornwall, dessen Vorfahren ihren Titel direkt aus den Händen des schottischen Königs James erhalten hatten. Von all dem Stolz, der jemals die Brüste der Menschheit zum Schwellen gebracht hatte, ist vielleicht der Stolz der Männer aus Cornwall der stärkste. Und die Familie Bulstrode war eine der stolzesten unter ihnen. Talbot machte hier keine Ausnahme. Dieser Stolz war die rettende Kraft gewesen, die seine erfolgreiche Karriere geleitet hatte. Andere Männer kamen von diesem Pfad, den Reichtum und Größe so außerordentlich angenehm machten, irgendwann ab, aber nicht Talbot Bulstrode. Laster oder Torheit hätten in einem Bulstrode einen Fleck auf einem bisher unbefleckten Wappenschild hinterlassen, der niemals durch Zeit oder Tränen wieder hätte ausgelöscht werden können. Dieser Stolz der Geburt hatte eine gewisse edle und ritterliche Seite. In den alltäglichen Angelegenheiten des Lebens war Talbot hingegen so bescheiden wie kein anderer. Wurde aber seine Ehre in Frage gestellt, der schlafende Drache des Stolzes, der Reinheit, Redlichkeit und Wahrheit bewachte, so erwachte er und forderte den Feind heraus.
Bulstrode war noch Junggeselle, doch nicht, weil er nie geliebt hatte, sondern weil ihm bisher keine Frau begegnet war, deren Reinheit der Seele ihn gefangen genommen hatte. Er suchte mehr als nur die gewöhnliche Tugend in der Frau seiner Wahl. Von der künftigen Lady Bulstrode forderte er jene großen und königlichen Qualitäten, die in weiblicher Art nur selten zu finden waren. Furchtlose Wahrheit, Ehrgefühl, Loyalität, Selbstlosigkeit und eine Seele, die von der kleinlichen Niederträchtigkeit des täglichen Lebens unbeeinträchtigt geblieben war. Doch beim ersten Gefühl, das ein Paar schöner Augen in ihm hervorrief, wurde er kritisch. Jedes Mal begann er, nach winzigen Flecken auf dem leuchtenden Gewand der Reinheit dieser Frau zu suchen. Er hätte die Tochter eines Bettlers geheiratet, wenn sie an sein fast unerreichbares Niveau herangekommen wäre, und er hätte die Ahnin einer Herrscherfamilie abgelehnt, wenn sie auch nur einen Millimeter von seinen Ansprüchen abgefallen wäre. Frauen wiederum fürchteten Talbot Bulstrode. Ehrgeizige Mütter schrumpften ob des kalten Lichts seiner wachsamen grauen Augen zusammen. Töchter erröteten und fühlten, wie ihre hübschen Zierden unter dem stillen Blick des prüfend dreinblickenden Offiziers von ihnen abfielen. Und so verließ Talbot Bulstrode so manchen Ball in Belgravia allein, aber mit dem sicheren Gefühl, den Fallstricken und Tücken der Bräute und ihrer ehrgeizigen Mütter ein weiteres Mal glücklich entflohen zu sein. Dieser Glaube wurde vielleicht dadurch bestärkt, dass der Mann aus Cornwall keineswegs der elegante Ignorant war, dessen einzige Errungenschaft darin bestand, sich die Haare zu schneiden, den Schnurrbart zu wachsen und eine Meerschaumpfeife zu rauchen.
Talbot Bulstrode rauchte, trank und spielte nicht, sondern liebte die wissenschaftliche Beschäftigung. Er war nur einmal in seinem Leben beim Derby gewesen, und bei dieser einen Gelegenheit hatte er sich mitten im großen Rennen von der Tribüne entfernt, während die Männer krank vor Angst und Schrecken gewesen waren, rasend vor Wahnsinn dem Lauf der Pferde folgend. Bulstrode hatte nie gejagt, wohl aber war er ein perfekter Schwertkämpfer. Weder hatte er jemals ein Billardqueue gehandhabt, noch seit seiner Kindheit eine Spielkarte berührt. Er hegte eine eigentümliche Abneigung gegen alle Glücksspiele und Geschicklichkeitsspiele und behauptete, dass es einem Gentleman nicht anstünde, diesen Utensilien des jämmerlichen Vergnügens zu frönen. Seine Zimmer waren gepflegt und geordnet, zweckmäßig eingerichtet und aufgeräumt. Statt Zigarrenkisten fand man bei ihm mathematische Instrumente, Andrucke von Raphael, welche die Wände schmückten, so-wie aquarellierte Sportskizzen. Er war mit den Ausdrucksformen der Philosophen Descartes und Condillac vertraut, aber es bereitete ihm einige Schwierigkeiten, die argotischen Lokutionen von Monsieur de Kock zu übersetzen. Diejenigen, die Bulstrode kannten, sagten, dass er nicht annähernd wie ein Offizier sei, obwohl er ein Regiment auf der Krim kommandiert hatte. Ein Abenteuer, das ihm bedauerlicherweise ein steifes Bein eingebracht hatte und ihn somit vom Tanzen ausschloss.
Aus reinem Wohlwollen oder auch aus purer Gleichgültigkeit hatte Talbot Bulstrode also auf Drängen Maldons der Einladung zum Ball in Felden Woods zugestimmt.
Nachdem er sich seinem Gastgeber vorgestellt hatte, mischte sich Bulstrode unter die Gäste. Gänzlich in der Menge zu verschwinden war ihm nicht gegeben, da er groß und breitschultrig war, mit vornehmem Gesicht, römischer Nase und kalten grauen Augen, einem dicken Schnurrbart und schwarzen Haaren, die er kurz geschoren trug. Sein Anblick bildete einen markanten Kontrast zu dem jungen Fähnrich, der ihn begleitete.
Gerade kreiste die vergnügte Gesellschaft zu einem von Charles d’Alberts Walzern. Talbot hatte diese Musik schon einmal gehört und auch all die Gesichter, obwohl ihm unbekannt, schon oft gesehen. Dunkle Schönheiten in Rosa, blasse Schönheiten in Blau, große, schneidige Schönheiten in Seide und Spitze, Juwelen und Pracht, bescheidene, niedergeschlagene Schönheiten in weißem Krepp und mit Rosenknospen am Gürtel. Er war ihnen allen entgangen. Wahrscheinlich würde der Name Bulstrode eines Tages aus der Geschichte des kornischen Adels verschwinden. Nur die Grabsteine würden dann noch von der Größe des Geschlechts der Familie zeugen.
Während er sich an die Säule einer Türschwelle lehnte, fragte er sich, ob es auf Erden irgendetwas gab, was einen Mann für die Mühen des Lebens entschädigen konnte. Da trat Fähnrich Maldon mit einer Gottheit an seiner Seite auf ihn zu.
Herrlich schön in Weiß und Scharlachrot, schmerzhaft schillernd, berauschend anzusehen. Er fand heraus, dass der Name dieses wunderbaren Geschöpfes Aurora Floyd war und dass sie jene Erbin von Felden Woods war, von der er angenommen hatte, sie sei ein schottisches Trampeltier mit Sommersprossen.
Talbot Bulstrode setzte für einen kurzen Moment der Atem aus. Diese gebieterische Kleopatra in Krinoline war sicherlich nichts anderes als eine neue Falle, die ihn mit weißem Musselin und künstlichen Blumen ködern wollte, so wie der Rest ihres Geschlechts es bisher erfolglos versucht hatte.
Ja, sie war reich, also wünschte sie keinen reichen Ehemann. Aber sie war ein Niemand, und darum wünschte sie sich sicherlich eine Position auf den vorderen Seiten von Burkes Adelsregister sowie einen Sitz im Oberhaus für ihren Erstgeborenen. Kalt verbeugte er sich, als Mrs Alexander Floyd herbeieilte und den Fähnrich zum Tanz mit der Dame an ihrer Seite verführte, die sicherlich mehr Schritte auf den Zehen ihres Partners als auf dem Boden des Ballsaals vollzog.
Aurora und Talbot blieben sich selbst überlassen. Aus den Augenwinkeln bemerkte Captain Bulstrode ihren anmutigen Kopf, der von blauschwarzem Haar umhüllt war. Er erwartete, die bescheiden herabgesenkten Augenlider einer jungen Dame mit langen Wimpern zu sehen, doch Aurora Floyd schaute weder auf ihn noch auf die Lichter noch auf die Blumen noch auf die Tänzerinnen. Ihr Blick schien in die Ferne zu schweifen, in eine unendliche Leere.
Sie war so jung und wohlhabend, bewundert und geliebt, dass es schwierig war, den Schatten der Not zu erklären, der ihre Augen trübte. Während er sich fragte, was er ihr sagen sollte, stellte sie ihm die seltsamste Frage, die er je von mädchenhaften Lippen gehört hatte.
»Wissen Sie, ob Thunderbolt oder König Cheops das Leger gewonnen hat?« Er war zu verwirrt, um zu antworten, und sie fuhr ungeduldig fort: »Das Rennen muss heute Abend um sechs Uhr in London gelaufen sein. Sie müssen davon gehört haben. Ich habe bereits ein halbes Dutzend Leute gefragt, aber niemand scheint etwas zu wissen.«
Gütiger Himmel! Was für eine schreckliche Frau! Die lebhafte Fantasie des Husaren stellte sich den künftigen Erben der Bulstrodes vor, der seine kindlichen Eindrücke von einer solchen Mutter erhielt. Sie lehrte ihn, aus dem Rennkalender zu lesen, erfand ein königliches Alphabet des Rasens und erzählte ihm, dass »D« für Derby stünde und »L« für Leger. Unterkühlt erwiderte Talbot, dass er noch nie eine Sportzeitung gelesen habe und dass er weder Thunderbolt noch König Cheops kenne.
»Cheops war bestimmt nicht gut«, murmelte sie, »auch wenn er den Liverpool Autumn Cup gewann.«
Talbot Bulstrode zitterte, doch er spürte, dass sich sein Entsetzen mit einem Gefühl des Mitleids mischte.
Aurora sagte nichts mehr, sondern fiel wieder in ihren leeren Blick zurück, der sie weit von dem Ball wegtrug. Dabei glitten ihre schlanken Finger über ein Armband an ihrem Handgelenk. Es war ein Diamantarmband. Das Geburtstagsgeschenk ihres Vaters zum heutigen Tag war ein paar Hundert Pfund wert. Miss Floyds Blick fiel auf das glitzernde Ornament. Sie betrachtete es lange, und es schien, als bewundere sie die handwerkliche Vollkommenheit des Geschmeides.
Da stürmte ein junger Mann herbei. Er erinnerte Aurora Floyd an eine Verabredung für die Quadrille, die sich soeben auf dem Parkett bildete. Sie sah auf die kleinen Tanzkarten, welche fächerartig zwischen zwei hübschen Elfenbeinplatten eingefasst waren und an einer zierlichen Kordel an ihrem Handgelenk hingen. Auf einem dieser Kärtchen stand wohl sein Name. Lustlos erhob sie sich und nahm den ihr gereichten Arm des jungen Mannes.
Eine Kleopatra mit Stupsnase, dachte Talbot. Sie sollte ein Wettbuch bei sich haben statt Tanzkarten. Wie zerstreut sie doch die ganze Zeit hier saß. Ich wage zu behaupten, dass sie berechnete, wie viel sie bei dem Rennen in London verloren hatte. – Was wird dieser arme, alte Mann mit ihr machen? Sie scheint dem Wetten verfallen zu sein. Wird er sie in eine Irrenanstalt stecken oder sie zum Jockey-Club-Mitglied wählen lassen? – Mit ihren schwarzen Augen und dem Geld des Vaters könnte sie die Welt des Sports anführen. Es gab einmal einen weiblichen Papst. Warum sollte es nicht ein weibliches Napoleon des Turfs geben?
Später, als die knisternden Blätter der Bäume im Wald von Beckenham in der grauen Stunde vor Anbruch der Morgendämmerung zitterten, bestiegen die beiden Männer ihre Kutsche und machten sich auf die Heimreise. Talbot Bulstrode sprach auf der langen Überlandfahrt von nichts anderem als von Aurora Floyd. Doch nicht voll Wohlwollen. Nein, er war gnadenlos, verspottete, belächelte und verurteilte ihren fragwürdigen Geschmack und ihre offensichtlichen Verrücktheiten. Er empfahl Maldon, vorsichtig zu sein. Und wenn er denn unbedingt wünsche, diese Person zu ehelichen, dann auf eigene Gefahr. Er wünsche ihm viel Freude mit einer solchen Frau. Er erklärte, wenn er selbst mit ihr verheiratet wäre, würde er sie erschießen, es sei denn, sie hätte sich gebessert und ihr Wettbuch verbrannt.
Ja, Talbot Bulstrode steigerte sich in einen wilden Zynismus über die möglichen Verfehlungen der jungen Dame hinein und sprach von ihr, als hätte sie ihm eine unverzeihliche Schmach zugefügt. Schließlich sah sich der junge Fähnrich gezwungen, seinen Vorgesetzten zu ermahnen. Er sprach von Aurora Floyd als einem fröhlichen und guten Mädchen, einer perfekten Dame und davon, dass es nicht an Bulstrode sei, sich darüber lustig zu machen, wenn sie wissen wolle, wer dieses Rennen gewonnen habe.
Während die beiden Männer in der Kutsche immer lauter über sie sprachen, saß Aurora in ihrem Ankleidezimmer und ließ Lucy Floyds Geplapper über den Ball über sich ergehen.
»Noch nie gab es eine so entzückende Gesellschaft«, sagte die junge Dame. Und hatte Aurora nicht einen Soundso und einen Soundso gesehen? Vor allem Captain Bulstrode hatte es Lucy angetan, der künftige Baron von Bulstrode Castle nahe Camelford. Mit einer müden Geste schüttelte Aurora den Kopf. Nein, sie hatte keinen dieser Leute bemerkt. Da hörte Lucys kindisches Gerede abrupt auf. »Verzeih mir, Aurora! Du bist erschöpft«, sagte sie. »Wie grausam ich bin, dich zu ermüden!«
»Ich bin wahrlich müde. Sehr, sehr müde.« Sie sprach mit einer so zutiefst verzweifelten Schwäche in ihrem Ton, dass ihre Cousine über ihre Worte beunruhigt war.
»