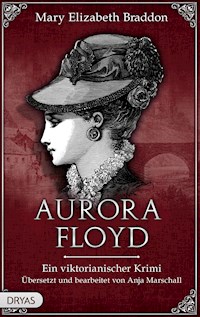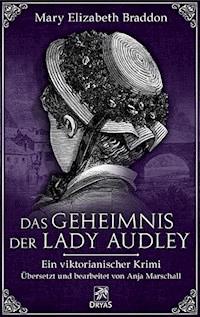
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dryas Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Baker Street Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Ein Londoner Anwalt versucht, den Mord an seinem Freund aufzuklären, doch die wunderschöne Lady Audley will dies mit allen Mitteln verhindern. Ihm wird schnell klar, dass Lady Audley ein dunkles Geheimnis hütet. Um den Mörder seines Freundes finden zu können, muss er es lüften. Ein spannendes Katz-und-Maus-Spiel beginnt zwischen dem jungen Mann und der mysteriösen Frau. Hochgelobt von den damaligen Kritikern erlebte "Lady Audley's Secret" bereits im Jahr seines Erscheinens, 1862, einen bis dahin unerreichten Erfolg. Braddons Buch wurde übersetzt, verfilmt und auf die Theaterbühnen der Welt gebracht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Das Geheimnis der Lady Audley - Ein viktorianischer Krimi
von Mary Elizabeth Braddon
übersetzt und bearbeitet von Anja Marschall
Inhaltsverzeichnis
Buch 1, Kapitel 1
Buch 1, Kapitel 2
Buch 1, Kapitel 3
Buch 1, Kapitel 4
Buch 1, Kapitel 5
Buch 1, Kapitel 6
Buch 1, Kapitel 7
Buch 1, Kapitel 8
Buch 1, Kapitel 9
Buch 1, Kapitel 10
Buch 1, Kapitel 11
Buch 1, Kapitel 12
Buch 1, Kapitel 13
Buch 1, Kapitel 14
Buch 1, Kapitel 15
Buch 1, Kapitel 16
Buch 1, Kapitel 17
Buch 1, Kapitel 18
Buch 1, Kapitel 19
Buch 2, Kapitel 1
Buch 2, Kapitel 2
Buch 2, Kapitel 3
Buch 2, Kapitel 4
Buch 2, Kapitel 5
Buch 2, Kapitel 6
Buch 2, Kapitel 7
Buch 2, Kapitel 8
Buch 2, Kapitel 9
Buch 2, Kapitel 10
Buch 2, Kapitel 11
Buch 2, Kapitel 12
Buch 2, Kapitel 13
Buch 3, Kapitel 1
Buch 3, Kapitel 2
Buch 3, Kapitel 3
Buch 3, Kapitel 4
Buch 3, Kapitel 5
Buch 3, Kapitel 6
Buch 3, Kapitel 7
Buch 3, Kapitel 8
Buch 3, Kapitel 9
Anhang
Impressum
Leseprobe
Buch eins
1. Kapitel
Da Herrenhaus von Audley Court verbarg sich in einem Tal mit prächtigen alten Bäumen und üppigen Weiden. Schritt man durch eine Allee unter Linden entlang, die auf beiden Seiten von hohen Hecken und Wiesen gesäumt war, so stieß man unweigerlich auf den Landsitz. Am Ende dieser Allee befanden sich ein alter Torbogen und ein Glockenturm mit einer dummen, verwirrenden Uhr, die nur einen Zeiger besaß. Dieser sprang von einer Stunde zur nächsten und war daher immer entweder zu früh oder zu spät. Durch den Torbogen gelangte man in den Park von Audley Court.
Ein gepflegter Rasen breitete sich vor dem Besucher aus. Hier und da lockerten Rhododendren das Bild auf, die an diesem Ort prächtiger als irgendwo sonst in der Grafschaft wuchsen. Zur Rechten lagen die Gemüsegärten, der Fischteich und ein Obstgarten. Dieser wurde von einem ausgetrockneten Graben und einer verfallenen Mauer begrenzt. Die Mauer war über und über mit rankendem Efeu, gelbem Steinkraut und dunklem Moos bewachsen. Auf der linken Seite erstreckte sich ein breiter kiesbestreuter Weg, auf dem früher, als das Anwesen noch ein Kloster gewesen war, Nonnen schweigend gewandelt sein mochten. Stattliche Eichen warfen ihre Schatten über eine nahe Mauer, die das Herrenhaus und seine Gärten wie einen Schutzwall umschloss.
Es war ein sehr altes Gebäude, uneinheitlich und verschachtelt. Die Fenster waren mal klein oder groß, manche hatten wuchtige steinerne Mittelpfosten und prächtige bunte Scheiben, andere zerbrechliche Gitter, die bei jedem Luftzug klapperten. Doch einige sahen so neu aus, als seien sie erst gestern angebracht worden.
Hinter spitzen Giebeln ragten hier und dort hohe Schornsteine auf. Sie sahen aus, als seien sie durch ihr Alter so zerfallen, dass sie zusammenbrechen müssten, würde nicht der wuchernde Efeu an ihren Wänden hinaufkriechen, sie umschließen und stützen.
Der Eingang von Audley Court lag in einem Eckturm des Gebäudes und hatte eine prachtvolle Tür. Sie bestand aus altem Eichenholz und war mit großen Eisennägeln beschlagen. Die Tür war so massiv, dass der schwere Eisenklopfer nur ein gedämpftes Geräusch hervorbringen konnte. Und so benutzten Besucher in diesen Tagen lieber eine laut klingelnde Glocke, die sich zwischen den Efeuranken neben der Tür befand. Mussten sie doch befürchten, dass der Klang des Klopfers niemals das riesige Haus durchdringen könne.
Ein herrlicher alter Landsitz. Es war ein Ort, über den Besucher in Verzückung gerieten und den sehnsüchtigen Wunsch verspürten, das unruhige Leben der Stadt hinter sich zu lassen, um für immer bleiben zu können. Es war ein Fleck Erde, an dem der Friede sich niedergelassen und seine besänftigende Hand auf jeden Baum und jede Blume gelegt zu haben schien. Er ruhte auf den Teichen und stillen Wegen, in den dämmrigen Ecken der altmodischen Räume und den tiefen Fenstersitzen hinter den bunten Glasscheiben. Ja, sogar auf dem alten, ausgedienten Brunnen, der sich, kühl und geschützt wie alles an diesem ehrwürdigen Ort, in einem Gebüsch im Hintergrund des Gartens befand.
Ein herrschaftlicher Wohnsitz, von innen wie von außen. Doch war es auch ein Haus, in dem man sich verirrte, sollte man so unbesonnen sein, sich allein auf den Weg hindurch zu machen. In diesem Haus glich nicht ein Raum dem anderen. So ging jedes Zimmer in einen weiteren Raum über, und durch diesen hindurch gelangte man über schmale Treppen hinunter zu Türen, die wieder zurückführten in gerade jenen Teil des Hauses, von dem man sich am weitesten entfernt glaubte. Ein Herrensitz, der niemals von einem gewöhnlich sterblichen Architekten in dieser Weise hätte geplant werden können. Vielmehr war es das Werk jener alten Baumeisterin, die man die Zeit nennt. In einem Jahr hatte sie einen Raum hinzugefügt und in einem anderen Jahr ein Zimmer entfernt, einmal ließ sie einen Kamin aus der Epoche der Plantagenets niederstürzen, um dann einen weiteren im Baustil der Tudors zu errichten. Hier hatte sie einen uralten Mauerrest aus der angelsächsischen Zeit umgeworfen, dort aber einen normannischen Torbogen stehen lassen. Unter der Herrschaft von Queen Anne hatte sie eine Reihe von hohen, schmalen Fenstern eingebaut und später neben einem Saal ein Esszimmer hinzugefügt, das der Mode des Hannoveraners George I entsprach. Und so hatte es die Zeit in nunmehr elf Jahrhunderten fertiggebracht, einen Wohnsitz entstehen zu lassen, wie man seinesgleichen in der gesamten Grafschaft Essex nicht finden konnte.
Sir Michael Audley, der Hausherr, war ein imposanter Mann in den besten Jahren, hochgewachsen und kräftig, mit einer tiefen, sonoren Stimme, eindrucksvollen schwarzen Augen und einem grauen Bart, der ihm – ganz gegen seinen Willen – ein höchst ehrwürdiges Aussehen verlieh. Dabei war er so aktiv wie ein junger Mann und einer der verwegensten Reiter der Grafschaft. Siebzehn Jahre lang war er Witwer gewesen. Er hatte nur ein Kind, eine Tochter, Alicia Audley, die nun achtzehn Jahre alt war. Alicia war ganz und gar nicht erfreut gewesen, als ihr Vater eines Tages eine Stiefmutter ins Haus gebracht hatte, denn sie hatte seit ihrer frühesten Kindheit die unumschränkte Herrschaft auf Audley Court gehabt. Doch nun war Miss Alicias Zeit vorüber. Wenn sie heute etwas von der Haushälterin wollte, pflegte diese ihr zu antworten, sie müsse zunächst mit Mylady sprechen. So kam es denn, dass die Tochter des Barons die meiste Zeit außer Haus verbrachte. Sie ritt im Galopp über die Weiden oder zeichnete, da sie eine talentierte Künstlerin war, was immer ihr über den Weg lief. Mit trotziger Entschlossenheit widersetzte sie sich jedem Versuch einer Annäherung durch die neue Frau des Barons, die seit Kurzem im Hause lebte und nun ihre Stiefmutter war. So sehr diese Dame sich auch bemühte, es gelang ihr nicht, die Vorurteile und Abneigung von Miss Alicia zu überwinden. Das verwöhnte Mädchen war davon überzeugt, man habe ihr grausames Unrecht angetan.
Um die Wahrheit zu sagen, hatte die neue Lady Audley durch ihre Eheschließung mit Sir Michael eine jener vorteilhaften Partien gemacht, die geeignet sind, sich den Neid und den Hass anderer Frauen zuzuziehen. Sie war zuvor in das Dorf nahe Audley Court gekommen, um als Gouvernante der Familie des hiesigen Arztes zu arbeiten. Niemand wusste Näheres über sie, außer dass sie auf eine Anzeige des Arztes, Mr Dawson, in der Times geantwortet hatte. Sie kam aus London, und die einzige Referenz, die sie vorweisen konnte, war jene von einer Schule in Brompton, an der sie einst Lehrerin gewesen war. Doch diese Empfehlung war wohl so überzeugend, dass keine weiteren Empfehlungen verlangt wurden. Und so wurde Miss Lucy Graham im Hause des Arztes als Erzieherin seiner Töchter aufgenommen. Ihre Fertigkeiten waren derart außergewöhnlich und zahlreich, dass ihre eilige Zusage Mr Dawson seltsam erschien, zumal er ihr nicht viel zahlen konnte. Miss Graham erweckte jedoch den Eindruck, als sei sie völlig zufrieden mit ihrer Stellung. Sie lehrte die Mädchen, Sonaten von Beethoven zu spielen und Zeichnungen nach der Natur im Stile Creswicks anzufertigen. Jeden Sonntag pflegte sie dreimal durch das verschlafene Dörfchen zur kleinen Kirche zu wandern. Sie schien so selbstgenügsam, als habe sie keinen größeren Wunsch auf dieser Welt, als genau auf diese Weise für den Rest ihres Daseins weiterzuleben.
Miss Lucy Graham war mit jener magischen Ausstrahlung gesegnet, mit der eine Frau ihr Gegenüber nur durch ein Wort oder ein Lächeln zu verzaubern vermag. Jedermann liebte, bewunderte und lobte sie. Ihr Dienstherr, seine Besucher, ihre Schülerinnen, die Dienstboten, sie alle, ob von hohem oder niederem Stande, waren einer Meinung: Lucy Graham war das liebenswürdigste Mädchen, das sie je gesehen hatten.
Vielleicht war es diese einhellige Meinung, die bis in die ruhigen Räume von Audley Court drang. Oder war es möglicherweise der Anblick während des sonntäglichen Gottesdienstes? Was immer es sein mochte: Sir Michael Audley verspürte plötzlich das dringende Verlangen, Mr Dawsons Gouvernante näher kennenzulernen.
Er brauchte nur eine leise Andeutung gegenüber dem ehrenwerten Doktor zu machen, und schon wurde eine kleine Gesellschaft arrangiert, zu welcher der Vikar und seine Frau sowie der Baron und seine Tochter eingeladen waren.
Dieser eine beschauliche Abend besiegelte Sir Michaels Schicksal. Er konnte sich ihm ebenso wenig widersetzen, wie er dem zarten Zauber dieser sanften Augen widerstehen konnte. Ihre anmutige Schönheit, der gesenkte Kopf mit einer wogenden Fülle flachsgoldener Locken, der melodische Klang ihrer weichen Stimme und die vollkommene Harmonie, die all diesen Liebreiz prägte, erschien ihm an dieser Frau unendlich bezaubernd. Schicksal! Wahrhaftig, sie war sein Schicksal!
Niemals zuvor hatte er wirklich geliebt. Was war dagegen seine Ehe mit Alicias Mutter gewesen? Nichts als ein langweiliger, gefühlloser Handel, der nur zustande gekommen war, um irgendwelche Ländereien in der Familie zu halten. Aber dies war Liebe! Das Fieber, das Sehnen und diese rastlose, elende Unschlüssigkeit. Hinzu kamen die grausamen Befürchtungen, dass sein Alter vielleicht ein unüberwindliches Hindernis für sein Glück sein könnte. Plötzlich hasste er seinen weißen Bart und verspürte den heftigen Wunsch, wieder jung zu sein. Schlaflose Nächte und trübsinnige Tage erhellten sich auf wundersame Weise, sobald er einen flüchtigen Blick auf ihr Gesicht werfen konnte, wenn er am Haus des Doktors vorbeiritt. All diese Anzeichen bewiesen nur zu deutlich, dass Sir Michael Audley im würdigen Alter von fünfundfünfzig Jahren an jenem schrecklichen Fieber erkrankt war, das man Liebe nennt.
Ich glaube nicht, dass der Baron während der ganzen Zeit seines Werbens auch nur einmal überlegt hatte, ob sein Reichtum und seine Stellung als Beweggründe zu seinen Gunsten ins Gewicht fallen könnten. Wenn er sich überhaupt dieser Dinge besann, dann wies er jeden Gedanken an Derartiges sogleich von sich. Es schmerzte ihn, auch nur einen Moment lang in Erwägung zu ziehen, dass jemand, der so lieblich und unschuldig war, sich als Gegenwert für ein prächtiges Haus oder einen ehrwürdigen alten Titel betrachten könnte. Nein! Seine Hoffnung beruhte vielmehr auf der Überlegung, dass ihr Leben bisher höchstwahrscheinlich ein Dasein der Mühe und Arbeit und der Abhängigkeit gewesen sein musste. Und da sie noch sehr jung zu sein schien, kaum älter als zwanzig, konnte es sein, dass sie bis zu diesem Zeitpunkt noch niemals eine tiefere Zuneigung zu jemandem gefasst haben mochte. Vielleicht gelänge es ihm, ihr junges Herz für sich zu gewinnen. Vielleicht verspräche sie ihm allein aufgrund ihrer reinen Liebe ihre Hand. Zweifellos war es eine sehr romantische Träumerei. Trotzdem schien sie Aussicht auf Verwirklichung zu haben, denn es hatte den Anschein, als missbillige Lucy Graham die Aufmerksamkeiten des Barons keineswegs. Nichts in ihrem Verhalten zeugte von jener listigen Schlauheit, die eine Frau mitunter einsetzte, um einen reichen Mann zu erobern.
Schließlich sprach Mrs Dawson die Gouvernante ihrer Töchter auf den Baron an. Die Frau des Arztes saß im Schulzimmer über ihrer Arbeit, während Lucy die Aquarellskizzen ihrer Schülerinnen mit einigen Pinselstrichen vollendete.
„Wissen Sie, meine liebe Miss Graham“, sagte Mrs Dawson, „ich denke, Sie können sich außerordentlich glücklich schätzen.“
Die Erzieherin schaute verwundert zu ihrer Dienstherrin hinüber. „Was meinen Sie damit, Mrs Dawson?“, fragte sie. Vorsichtig hielt sie einen Pinsel in ihrer Hand, um mit etwas Purpur den Horizont auf der Zeichnung ihrer Schülerin aufzuhellen.
„Nun, ich glaube, meine Liebe, dass es nur an Ihnen liegt, ob Sie Lady Audley und damit Herrin von Audley Court werden.“
Lucy Graham ließ den Pinsel auf das Bild fallen. Die Röte schoss ihr ins Gesicht. Doch dann wurde sie ganz blass – blasser, als Mrs Dawson sie jemals gesehen hatte.
„Meine Liebe, regen Sie sich nicht auf“, beschwichtigte sie die Arztfrau. „Sie wissen doch, dass niemand von Ihnen verlangt, Sir Michael gegen Ihren Willen zu heiraten. Natürlich wäre es eine glänzende Partie. Er hat ein bemerkenswertes Einkommen und ist einer der großzügigsten Männer, die ich kenne. Ihre Stellung wäre sehr bedeutend, und Sie wären in der Lage, viel Gutes zu tun. Aber wie ich schon sagte, Sie müssen sich ganz und gar von Ihren eigenen Gefühlen leiten lassen.“
„Bitte sprechen Sie nicht weiter, Mrs Dawson“, murmelte Lucy Graham verwirrt. „Ich hatte keine Ahnung. Es ist das Letzte, was mir in den Sinn gekommen wäre.“ Sie stützte ihre Ellenbogen auf das Zeichenbrett und schlug die Hände vor ihr Gesicht. Minutenlang schien sie in tiefe Gedanken versunken. Um ihren Hals trug sie ein schmales schwarzes Band, an dem sie nervös fingerte. „Ich glaube, manche Menschen sind dazu geboren, unglücklich zu sein, Mrs Dawson“, brachte sie endlich hervor. „Dennoch wäre es ein zu großer Glücksfall für mich, Lady Audley zu werden.“ Sie sagte das mit so viel Bitterkeit in der Stimme, dass die Arztfrau sie erstaunt anblickte.
„Sie! Unglücklich, meine Liebe?“, rief Mrs Dawson aus. „Ich finde, Sie sind die Letzte, die so reden sollte. Sie sind ein so heiteres, glückliches Wesen! Ich weiß wirklich nicht, was wir machen werden, wenn Sir Michael Sie uns entführt.“
Nach dieser Unterhaltung zeigte Lucy nie wieder irgendeine Gefühlsregung, wenn von der Bewunderung des Barons für sie die Rede war. In der Arztfamilie war es schließlich eine stillschweigend ausgemachte Sache, dass die Erzieherin Sir Michaels Antrag annehmen würde, wann immer er offiziell um ihre Hand anhielt. Die schlichten Dawsons hätten es für mehr als aberwitzig gehalten, würde ein mittelloses junges Mädchen ein derartiges Angebot zurückweisen.
An einem nebligen Abend im Juni, als Sir Michael Lucy Graham im kleinen Salon des Doktors gegenübersaß und die Familie nicht im Raum war, geschah es dann. Sir Michael sprach über das Anliegen, das ihm so am Herzen lag. In wenigen, aber würdevollen Worten bot er der Gouvernante seine Hand zur Ehe. Es lag etwas Rührendes in der Art und Weise, in der er sich an sie wandte. Er war sich nicht sicher, ob die Wahl eines so jungen, schönen Mädchens gerade auf ihn fallen würde. Und so bat er sie, sie möge ihn eher abweisen, selbst wenn es ihm das Herz brechen würde, als seinen Antrag anzunehmen, ohne ihn zu lieben.
„Ich denke, es gibt kaum eine größere Sünde, Lucy“, sagte er ernsthaft, „als jene, die eine Frau dann begeht, wenn sie einen Mann heiratet, den sie nicht liebt. – Sie stehen meinem Herzen so nahe, dass ich es nicht zulassen könnte, würden Sie eine solche Sünde begehen. Dennoch, der bloße Gedanke an eine Enttäuschung wäre äußerst bitter für mich. – Aber sagten Sie Ja, nur um meines Glückes willen, so würde doch nichts als Elend auf unserer Ehe liegen, die aus anderen Gründen als allein aus Aufrichtigkeit und Liebe geschlossen würde.“
Lucy Graham sah Sir Michael nicht an, sondern blickte in die neblige Dämmerung der fernen Landschaft jenseits des kleinen Gartens. Der Baron versuchte, ihr ins Gesicht zu schauen, doch sie hatte es abgewandt. Und so konnte er den Ausdruck ihrer Augen nicht deuten. Hätte er in ihre Augen sehen können, so hätte er einen Blick bemerkt, der die weite Dunkelheit zu durchbohren schien, fort, in eine andere Welt.
„Lucy, haben Sie mich gehört?“
„Ja, Sir Michael.“
„Und wie lautet Ihre Antwort?“
Sie starrte vor sich hin. Minutenlang war sie ganz still. Dann wandte sie sich plötzlich mit einer Leidenschaftlichkeit zu ihm, die ihr Antlitz in einer neuen und wundervollen Schönheit erglühen ließ. Sie fiel vor ihm auf die Knie.
„Nein, Lucy, nein!“, rief er.
„O doch!“, antwortete sie, und die seltsame Leidenschaft, die sie erschütterte, ließ ihre Stimme schrill und durchdringend klingen. „Wie gut Sie sind, wie edel und großmütig! Sie zu lieben! Wahrhaftig, es gibt Frauen, die hundertmal schöner und tugendhafter sind als ich, die Sie gewiss von ganzem Herzen lieben würden. Aber Sie verlangen zu viel von mir! – Denken Sie daran, wie mein Leben bisher verlaufen ist. Seit meiner frühesten Kindheit habe ich nichts als Armut gekannt. Mein Vater war ein kluger, gebildeter, hochherziger und stattlicher Herr, aber er war arm. Armut, Schicksalsprüfüngen, Sorgen, Erniedrigungen, Entbehrungen! Sie kennen das nicht! Sie ahnen ja nicht, was Menschen wie ich zu ertragen haben. Verlangen Sie deshalb nicht zu viel von mir. Ich kann meine Augen nicht vor den Vorteilen einer solchen Verbindung verschließen. Ich kann es nicht!“ Neben ihrer Erregung und leidenschaftlichen Heftigkeit schwang in ihrem Verhalten noch etwas Unbestimmtes mit, das den Baron mit einem Gefühl vager Unruhe erfüllte. Sie kauerte noch immer vor ihm auf dem Boden. Ihr dünnes weißes Kleid schmiegte sich eng an ihren Körper und ihr helles Haar strömte über die Schultern. Lucys Augen glühten in der Dunkelheit und ihre Hände waren in das schwarze Band an ihrem Hals verkrallt, so als ob es sie erdrosseln würde.
„Verlangen Sie nicht zu viel von mir“, wiederholte sie. „Seit meiner Kindheit bin ich auf meinen Vorteil bedacht gewesen.“
„Lucy, sagen Sie es klar und deutlich: Mögen Sie mich nicht?“
„Sie? Nicht mögen? Natürlich mag ich Sie!“
„Ist da ein anderer, den Sie lieben?“
Bei dieser Frage lachte sie laut auf. „Ich liebe niemanden auf dieser Welt“, entgegnete sie.
Ihre Erwiderung machte ihn froh, und doch ... diese Antwort und das eigenartige Lachen, beides berührte ihn seltsam. Er schwieg einen Augenblick und brachte dann mit einiger Mühe hervor: „Ich gebe zu, ich bin ein romantischer alter Narr, aber wenn Sie keine Abneigung gegen mich hegen, sehe ich keinen Grund, warum wir nicht ein sehr glückliches Paar werden könnten. Einverstanden, Lucy?“
„Ja.“
Der Baron half ihr vom Boden auf, küsste sie auf die Stirn, und nachdem er ihr eine Gute Nacht gewünscht hatte, verließ er das Haus.
Er war verwirrt, empfand weder Freude noch ein Gefühl des Triumphes, sondern spürte in sich so etwas wie eine tiefe Enttäuschung. Es war der Tod jener Hoffnung, die beim Klang von Lucys Worten gestorben war. Alle Zweifel und Befürchtungen, alle zaghaften Sehnsüchte hatten nun ihr Ende gefunden. Wie andere Männer seines Alters auch, so musste er sich damit abfinden, aufgrund seines Vermögens und seiner Stellung geheiratet zu werden.
Lucy Graham aber schritt langsam die Treppe hinauf zu ihrer Kammer unter dem Dach. Sie stellte die Kerze auf die Kommode und setzte sich auf den Rand des Bettes.
„Jede Spur meines alten Lebens verwischt und begraben“, flüsterte sie. Ihre linke Hand hatte das schwarze Band an ihrem Hals keinen Moment losgelassen. Und während sie so vor sich hin murmelte, zog sie es aus ihrem Ausschnitt und blickte auf den Ring, der daran befestigt war.
2. Kapitel
Er warf den Rest seiner Zigarre ins Wasser, stützte die Ellenbogen auf die Reling und starrte auf die Wellen. „Wie eintönig sie doch sind“, sagte er, „blau, grün und opal – opal und grün und blau. Drei Monate lang nur Wellen.“
Seine Gedanken wanderten weiter, tausend Meilen seinem Ziel entgegen. „Sie wird sich freuen“, murmelte er, während er sein Zigarrenetui öffnete. „Erstaunt wird sie sein und sehr überrascht. – Nach dreieinhalb Jahren!“ Er lächelte, als er sich ihr zartes Gesicht vorstellte, ihre Freude, wenn sie ihn wiedersah.
George Talboys war ein junger Mann von etwa fünfundzwanzig Jahren mit von der Sonne gebräuntem Gesicht. Er befand sich als Passagier an Bord der Argus, die von Sydney nach Liverpool segelte. Mit ihm reiste in der Ersten Klasse ein älterer Wollhändler, der in den Kolonien ein Vermögen gemacht hatte und nun mit Frau und Töchtern in seine Heimat zurückkehrte. Außerdem war eine Gouvernante an Bord, die nach Hause fuhr, um den Mann zu heiraten, mit dem sie bereits fünfzehn Jahre verlobt war. Die Tochter eines reichen australischen Weinhändlers, deren Erziehung in England den letzten Schliff erhalten sollte, fuhr ebenfalls mit.
Niemand wusste, wer oder was George Talboys war, doch alle mochten ihn. Beim Dinner saß er am Ende der Tafel und half dem Kapitän, die Honneurs zu machen. Er erzählte lustige Geschichten und war der Erste, der darüber mit so viel Vergnügen auflachte, dass man aus reiner Sympathie mitlachen musste. Beim Rätselraten und Kartenspiel stellte er sich ebenso geschickt an wie bei all den anderen unterhaltsamen Gesellschaftsspielen, die den kleinen Kreis unter der Kabinenlampe zusammenkommen ließen. Er rauchte seine Zigarren, unterhielt sich mit den Matrosen, lehnte an der Reling und war dabei zu jedermann auf seine Weise freundlich.
Doch als sich die Argus dem Ziel der Reise allmählich näherte und nur noch etwa zwei Wochen vor ihr lagen, bemerkten alle an Bord eine Veränderung an ihm. Er wurde unruhig und nervös. Immer öfter stand er schwermütig und nachdenklich an der Reling. Den Matrosen wurde er bald lästig mit seiner ständigen Frage nach der voraussichtlichen Ankunftszeit. Würde es noch zehn, elf, zwölf oder dreizehn Tage dauern? War der Wind auch günstig? Wie viele Knoten in der Stunde machte das Schiff? Mitunter sahen ihn seine Reisegefährten über das Deck stapfen und schimpfen. Die Argus sei ein baufälliger, alter Kahn, völlig ungeeignet für den Passagierverkehr, ja sie tauge nicht für den Transport ungeduldiger Lebewesen mit Herz und Seele.
Die Mitreisenden vom Achterdeck lachten über seine Ungeduld, nur die blasse Gouvernante nicht. Sie beobachtete den jungen Mann, wie er sich über die langsam dahinschleichenden Stunden aufregte und immer wieder auf das wogende Meer stierte.
Als der rote Rand der Sonne eines Abends gerade im Wasser versank, stieg die Gouvernante die Kabinentreppe hinauf, um einen Spaziergang zu machen, während die anderen Reisenden unter Deck bei ihrem Wein saßen. Sie gesellte sich zu George Talboys, und gemeinsam beobachteten sie die schwindende Röte am westlichen Horizont.
„Stört Sie meine Zigarre, Miss Morley?“, fragte er, während er die Zigarre aus dem Mund nahm.
„Ganz und gar nicht! Rauchen Sie ruhig weiter. Ich bin nur gekommen, um den Sonnenuntergang zu bewundern. Was für ein wundervoller Abend!“
„Ja, ja, mag sein“, antwortete er, „aber so lange noch! Noch zehn endlose Tage und zehn weitere lange Nächte, bis wir endlich Land betreten.“
Miss Morley seufzte. „Wünschen Sie sich, es dauerte nicht so lange?“
„Allerdings!“, rief George. „Das wünsche ich mir wahrhaftig! Sie nicht?“
„Eigentlich nicht.“
„Gibt es denn niemanden in England, den Sie gern haben? Wartet niemand auf Ihre Ankunft?“, wollte er wissen.
„Ich hoffe schon“, entgegnete sie leise.
Eine Zeit lang schwiegen sie. Während er voll zorniger Ungeduld seine Zigarre rauchte, so als könne er durch seine Rastlosigkeit die Fahrt des Schiffes beschleunigen, verfolgte sie das Versinken des Lichtes am Horizont.
„Sehen Sie nur“, entfuhr es George auf einmal, wobei er in eine andere Richtung deutete. „Dort! Der Mond!“
Sie blickte zu dem fahlen Mond auf, und ihr Gesicht wirkte fast ebenso fahl und bleich wie dieser.
„Es ist das erste Mal, dass wir ihn sehen. Wir müssen uns etwas wünschen“, bemerkte George. „Ich weiß, was ich mir wünsche.“
„Und was ist das?“
„Dass wir schnell zu Hause sind!“
„Und mein Wunsch ist es, dass uns keine Enttäuschung erwarten mag, wenn wir dort ankommen“, antwortete die Gouvernante voll Traurigkeit.
„Enttäuschung?“ Er fuhr zusammen, so als habe man ihn geschlagen. „Was meinen Sie damit?“
„Ich merke, dass nun, da unsere lange Reise ihrem Ende zugeht, die Hoffnung in meinem Herzen nachlässt und mich die elende Befürchtung heimsucht, es werde letztlich doch nicht alles gut enden. Der Mann, zu dem ich fahre, könnte seine Gefühle mir gegenüber geändert haben. Er könnte auch bereits tot sein. – Ich erwäge alle diese Möglichkeiten, Mr Talboys, und erlebe sie in meinem Geiste. Zwanzigmal am Tag erleide ich die Seelenqualen, die Sie begleiten, zwanzigmal am Tag.“
Mit der Zigarre in der Hand hatte George Talboys ihr regungslos zugehört. Plötzlich kam Bewegung in den jungen Mann. Voll Bestürzung wandte er sich seiner Begleiterin zu. „Was sagen Sie da?!“, rief er. „Wollen Sie mir Angst machen? Warum kommen Sie zu mir und erzählen mir diese Dinge? Ich fahre nach Hause zu der Frau, die ich liebe! Zu dem Mädchen, dessen Herz so aufrichtig ist. Und so, wie ich weiß, dass jeden Morgen die Sonne am Himmel aufgehen wird, so sicher bin ich mir, dass sie am Pier auf mich warten wird. Warum kommen Sie zu mir und versuchen, mich auf so traurige Gedanken zu bringen? – Ich kehre doch zu meiner geliebten Frau zurück.“
„Zu Ihrer Frau“, erwiderte sie. „Das ist etwas ganz anderes. Ich reise heim nach England, zu dem Mann, mit dem ich mich vor fünfzehn Jahren verlobte und den ich viele Jahre nicht mehr gesehen habe.“
„Bis zu diesem Augenblick, so versichere ich Ihnen“, entgegnete George aufgebracht, „hatte ich nie irgendwelche bösen Vorahnungen.“ Er warf die Zigarre ins Meer.
Miss Morley betrachtete ihn mit einem wehmütigen Lächeln. Sein ungestümer Eifer, die Lebhaftigkeit und Ungeduld seines Wesens erschienen ihr so seltsam und doch auch bewundernswert.
„Meine hübsche Frau! Meine sanfte Frau! Wissen Sie, Miss Morley“, fuhr er wieder ganz in seiner gewohnt hoffnungsvollen Art fort, „ich ließ sie mit dem Baby in den Armen schlafend zurück. Nur ein paar Zeilen erklärten ihr, warum ich sie verließ.“
„Sie verlassen?“, rief die Erzieherin aus.
„Ja! Ich war Kornett in einem Kavallerieregiment, als ich meinen kleinen Liebling zum ersten Mal traf. Wir waren in einer langweiligen Hafenstadt stationiert. Sie lebte dort mit ihrem alten Vater, einem heruntergekommenen Marineoffizier. Ein Schlitzohr, arm wie eine Kirchenmaus, aber stets mit einem Blick auf den eigenen Vorteil. Ein scheinheiliger alter Trunkenbold, jederzeit bereit, seine Tochter dem höchsten Bieter zu verkaufen. Zu meinem Glück galt ich zu jener Zeit als der höchste Bieter, denn mein Vater ist ein wohlhabender Mann. Und da es auf beiden Seiten Liebe auf den ersten Blick war, beschlossen wir zu heiraten. Sobald aber mein Vater hörte, dass ich ein Mädchen ohne einen Pfennig Geld zur Frau genommen hatte, schrieb er mir einen wütenden Brief und teilte mir mit, dass er nichts mehr mit mir zu tun haben wolle und dass mein jährlicher finanzieller Zuschuss gestrichen sei. – So waren meine Frau und ich mittellos, denn von meinem Sold konnte ich uns nicht ernähren. Daher verkaufte ich mein Offizierspatent. Ich war davon überzeugt, dass ich schon etwas anderes finden würde. Dem war nicht so. Als meine Barschaft bis auf ein paar Hundert Pfund dahingeschmolzen war, zogen wir in das Haus meines Schwiegervaters, der schon bald damit begann, mir das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und so gelang es dem ‚armen Papa‘, unser restliches Vermögen in kürzester Zeit durchzubringen. Ich fuhr nach London und bemühte mich um eine Stellung als Gehilfe bei einem Kaufmann, als Kontorist oder Buchhalter oder Ähnliches, doch es war erfolglos.“ Er schwieg und blickte in den Sonnenuntergang. „Sie weinte und überschüttete mich mit Vorwürfen. Mein Gott, Miss Morley! Ich war zornig auf sie, auf mich selbst, ihren Vater, die Welt und alle Menschen. Und so rannte ich aus dem Haus. Da hörte ich jemanden von der Goldgräberei in Australien schwärmen und schloss mich seiner Expedition dorthin an.“ Er blickte über das Wasser. „In jenen Tagen rechnete ich fest damit, dass mein Glück schnell eintreten würde und ich als reicher Mann bald nach Hause zurückkehren würde. So ging ich zu meiner Frau, die mit dem Baby in ihren Armen schlief. Ich schrieb ihr in ein paar kurze Zeilen, in denen ich ihr mitteilte, dass ich sie niemals mehr geliebt habe als gerade in diesem Moment, da ich sie zu verlassen schien. Ich offenbarte ihr, dass ich mein Glück in einer neuen Welt versuchen und bei Erfolg zu ihr zurückkommen wolle, um ihr Reichtum und Glück zu schenken. Dann küsste ich sie und das Kind und schlich mich leise aus dem Raum.“
„Und hatten Sie Glück?“, fragte Miss Morley.
„Nicht am Anfang. An einem trüben, nebligen Morgen vor genau drei Monaten aber geschah es: Ein riesiger Goldklumpen kam zum Vorschein. Ich war auf eine beachtliche Goldader gestoßen. Zwei Wochen danach galt ich als der reichste Mann in unserer kleinen Siedlung. Ich machte mich auf den Weg nach England. Ich schiffte mich auf der Argus ein, und in zehn Tagen werde ich meine Liebste wiedersehen.“
„Aber haben Sie Ihrer Frau in all dieser Zeit geschrieben?“
„Niemals, außer kurz bevor das Schiff Segel setzte. Ich wartete auf ein günstigeres Schicksal, und erst, als es sich endlich erfüllt hatte, schrieb ich ihr, sie solle mir ihre Adresse in ein Kaffeehaus in London senden, damit ich sie finden könne.“
Nach Ende dieses langen Berichtes versank er in tiefe Gedanken. Nachdenklich zog er an einer neuen Zigarre, die er sich angezündet hatte. „Ich schwöre Ihnen, Miss Morley“, brachte er endlich hervor, „bis zu dem Augenblick, als Sie mich ansprachen, habe ich niemals auch nur einen Funken von Furcht verspürt. Nun aber empfinde ich dieses elende, beklemmende Angstgefühl in meinem Herzen.“
Schweigend zog sie sich zurück, während er noch lange auf die Wellen starrte.
3. Kapitel
Dieselbe Augustsonne, die hinter der einsamen Weite des Meeres untergegangen war, warf einen rötlichen Schimmer auf das Zifferblatt der alten, dummen Uhr, die sich über jenem efeubedeckten Torbogen befand, der in die Gärten von Audley Court führte. Es war ein feuriger, karmesinroter Sonnenuntergang. Die Scheiben der Fenster des Herrenhauses waren vollständig in leuchtendes Rot getaucht. Das schwindende Licht flimmerte auf den Blättern der Linden in der langen Allee und verwandelte den ruhigen Fischteich in eine glatte Fläche von der Farbe polierten Kupfers. Gebrochene Strahlen des roten Scheines drangen sogar in jene dämmrigen Tiefen des Dornengebüsches und des Unterholzes, in denen sich der uralte Brunnen den Blicken entzog, so dass das feuchte Unkraut, das rostige Eisenrad und das zerbrochene Holzwerk davon wie mit Blut befleckt zu sein schienen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!