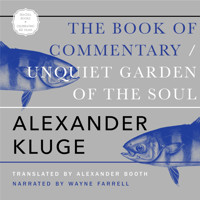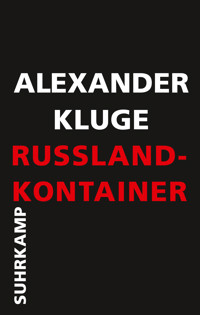Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Alexander Kluge versammelt ein reiches Material an Geschichten, Bildern und Gesprächen mit Wissenschaftlern zum Thema: »Worauf kann ich mich in meinen Gefühlen verlassen?« Seine Antwort: »Auf das, was uns mit den ältesten Zeiten und den Tieren verbindet: dass wir so alt sind wie die Evolution.« Wir bilden uns ein, als Menschen keine Maschinen und auch keine Tiere zu sein. Doch eigentlich stecken wir bis zum Hals in der Evolution, das heißt im Reich der Tiere, aus dem wir kommen. Wir ragen in die Moderne, ins Reich der Vernunft, nur mit Teilen unserer Eigenschaften hinein. Andere Teile in uns, wie die Verdauung oder die Haut, das Gleichgewicht und der Rhythmus, bleiben autonom, vom Willen nur wenig beeinflussbar. Der Atem etwa ist ein eigensinniges Tier. Er zwingt den Selbstmörder, der sich im Brunnen ertränken will, im letzten Augenblick zum Auftauchen. Die »Republik der Tiere in uns« ist eben klüger als der Kopf. Der kategorische Imperativ von Immanuel Kant fordert: Handle so, dass dein Handeln Maxime einer allgemeinen Gesetzgebung sein könnte. Theodor W. Adorno hält das für Hochstapelei und entgegnet: »Handle so, dass man von dir sagen kann, du seist ein gutes Tier gewesen.« Und Kluges These lautet: In uns steckt so manches Tierisches! Gleichzeitig reden wir Menschen sehr freimütig über Tiere – doch sollten wir uns stets fragen, was die Tiere über uns erzählen würden, wenn sie es könnten ... Es geht dem Erzähler um »Bodenhaftung für uns Menschen in zerrissener Zeit«.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexander Kluge
Aus dem Bauhaus der Natur
Die Republik der Tiere in uns
Eine Materialsammlung zu Zuständen zwischen Evolution und Moderne
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese
Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Wallstein Verlag, Göttingen 2025
Wallstein Verlag GmbH
Geiststr. 11, 37073 Göttingen
www.wallstein-verlag.de
Umschlaggestaltung: Wallstein Verlag, Göttingen
ISBN (Print) 978-3-8353-5864-5
ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-8844-4
ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-8845-1
Inhalt
Was ist »menschlich«?
Adornos Metapher vom guten Tier in uns
Wanderung des Unterkiefers einer Vorfahrin unter den Schlangen bis ins Ohr des Menschen
»Das Lebendige verbirgt sich gern«
Sechs Elemente der Vividness
Was heißt Kältegrenze des Planeten?
Übrig von Iceball Earth
Die Grönlandhaie bleiben besonders lange im Mutterleib
Longue durée Nr. 1
Bauhaus der Natur / Der Archaeopteryx & die Taube in der Stadt (Columba)
2 Die Eleganz der Tiere bei Überwinden der Schwerkraft
3 Der lange Atem der Lebendigkeiten / »Longue durée«: Zeitalter, aus denen wir Menschen kommen …
Auskünfte eines Wespenforschers
Ein Gespräch mit Dr. Gadagkar
Großer Tiefseewal, verirrt in Afrikas Bergen
VOR 40 MILLIONEN JAHREN …
»Blauwale auf Beinen« / Die Raubsaurier von Pangäa / Die Evolution bastelt
Ein Gespräch mit Oliver Rauhut
Raubwanderung
Nachricht von blinden Fischen
Der Ichtyologe Jörg Freyhof über Unbekanntes aus dem Reich der Fische
4 Unbeliebtheit mordender Tiere im Zirkus / Beliebtheit satter Tiger / Höflichkeit unter Hyänen
Unablässige Töter sind eine Rarität
Friesenhahns Nummer
Höflichkeit unter Hyänen. Der Verhaltensforscher Heribert Hofer über das interessanteste Raubtier Afrikas
5 Lebewesen an fremdem Ort und in falscher Zeit
Der Löwin blieb die Heimkehr fremd
PHÖNIX, ein Überläufer aus der Welt der Viren
Ein Philosoph aus Schwaben zeigt sich verliebt »in die Irrtümer des Meisters aus Königsberg«
Zunahme der Lebendigkeit im Abstand vom Zentrum der Materie
Das Pferd, ein Apfelschimmel, das den Leutnant Gustl aus Wien in den Grenzschlachten von 1914 in Galizien rettete, indem es seine Dressur vergaß …
Eine besonders erfolgreiche Polizeihundeerziehung
Katzen im Weltraum
6 Von der Politik eines Hundes / Experimente mit transgenen Mäusen / Kulturgeschichte der Mausefalle
Die Politik eines Hundes
Tod einer Hündin
Das Tier wollte uns nicht rammen
Der Geist des Vaters
Vergebliche Suche zweier Tauben nach einem ruhigen Moment
Tödlicher Zusammenstoß zweier Rennpferde
Der Unfall
Die Hoden der Aale
Keine Freiheit für den Hirtenhund
Geselligkeit transgener Mäuse
Kulturgeschichte der Mausefalle. Wolfhard Klein über den achttausendjährigen Krieg der Menschen gegen die Mäuse
7 Wie orientieren sich Vögel? / Fledermäuse »sehen« mit den Ohren / Algorithmen der Evolution
Ein Gespräch mit dem Zoologen und Verhaltensforscher Wolfgang Wiltschko über den einzigartigen Orientierungssinn von Vögeln
Unsere fliegenden Verwandten in der Nacht
Ein Gespräch mit dem Neurobiologen Prof. Dr. Manfred Kössl: Wie die Fledermäuse mit den Ohren »sehen«
Algorithmen der Evolution
Ein Gespräch mit dem Paläontologen Hans-Ulrich Pfretzschner
8 Der Gegenpol zu den klassischen Tierfabeln
Ein Gegenstück zu Jean de La Fontaines Tierfabeln wäre es, wenn die Tiere sich Geschichten über Menschen erzählen würden
Die Fabel von zwei Tieren in uns, die einen Massenmord verhinderten
Ein Mann, der sich »Wolf« nannte
»Ein Mensch ist des anderen Wolf«
Beißhemmung bei Wölfen
Rückkehr der Wölfe als politisches Problem im Wallis
Der spezialisierte Laufjäger
Ein Gespräch mit dem Biologen Dr. Kurt Kotrschal vom Wolf Science Center Niederösterreich über das kognitive Verhalten von Wölfen und Hunden
Das Staunen der Tiere
Poetik ist nicht harmlos
9 Intelligenz und Kooperation im BAUHAUS DER NATUR
Stichworte zu den »Nachrichten vom Bauhaus der Natur«
Kooperation im Tierreich
Reziproke Kooperation ist keine bloß individuelle Eigenschaft
Schlechtes Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen Hund und Mensch
Der Oktopus, ein Tier mit acht dezentral steuernden Gehirnen
Tiere erzählen vom Menschengeschlecht
Architektur der Wale
»Die Evolution ist ein bewundernswerter Architekt«
Die Spinne in der Taucherglocke
Gespräch mit dem Biologen Dr. Stefan K. Hetz über die einzige Spinne unter 36.000 Spinnenarten, die sich eine Taucherglocke baut
Von Sandfischen und künstlichen Libellen
Mathematik der sinnlichen Kraft
Ein Zustand der Evolution, unmittelbar vor Übergang zu den Wirbeltieren
Artwechsel durch Tunneln von Jugend zu Jugend
Flöße der Lüfte
Der Hochflieger, ein südamerikanischer fliegender Fisch
Hochflieger Napoleon / Der Kaiser und das Schicksal als Katze
Ein Fall von überraschender Kooperation / Episode aus dem Rückzug der Großen Armee von Moskau im Winter 1812
1
Abb. 1: Asiatischer Bär mit Kind auf seinem Rücken, im Hintergrund Lichter aus dem Hafen von Amsterdam
Abb. 2: Frühe Menschen auf Höhlenmalerei
Was ist »menschlich«?
Wir bilden uns ein, als Menschen keine Maschinen und auch keine Tiere zu sein. Auch keine Pilze und Bazillen. Tatsächlich, glaube ich, sind wir amphibische Lebewesen. Mehr als bis zur Brust stecken wir in der Evolution, das heißt im Reich der Tiere, aus dem wir kommen. Das bedeutet nicht, dass wir einem Wolf oder Schaf ähnlich wären. Die Wurzeln liegen tiefer und weitaus länger zurück. In uns aber verwalten wir Tiere. Der Atem ist zum Beispiel ein eigensinniges Tier. Er zwingt den Selbstmörder, der sich im Brunnen ertränken will, im letzten Augenblick zum Auftauchen. Das behaupte nicht ich, sondern die Physiologen. Der Atem ist klüger als der Kopf. Die Haut, unser flächenmäßig ausgedehntestes Organ, ist ein weiteres Tier. Sigmund Freud behauptet gegenüber Albert Einstein im Jahre 1932, meinem Geburtsjahr, in seinem Aufsatz Warum Krieg?, dass die Moralität keine Hilfe gegen den Dämon Krieg darstellt, wohl aber die Haut, die auf das Elend des Stellungskriegs im Ersten Weltkrieg mit Allergien reagiert, sodass der Soldat keine Uniform mehr auf die Haut stülpen kann.
Die Haut ist klüger als der Kopf. Ich könnte diese »Republik der Tiere in uns«, die alle gemeinsam das ausmachen, was wir Mensch nennen, um eine ganze Herde »innerer Tiere« erweitern. Mein Lieblingstier wäre das Ohr. Es ist entstanden aus dem Unterkiefer einer Wüstenschlange. Mit diesem Unterkiefer, an den Wüstenboden gelegt, hört diese Schlange, ob die Beute kommt. Dann wandert in der longue durée der Evolution dieser Knochen einige Millionen Jahre, bis er in uns Menschen, stark verkleinert, im Ohr als Mittelohrknöchelchen angekommen ist. Dort regiert dieses Genie über so Verschiedenes wie die Sprache, die Musik, das Gleichgewicht und die Zwischentöne, mit denen wir im Verhältnis zu anderen Menschen unsere emotionalen Entscheidungen treffen. Wie hochmütig ist es, wenn wir angesichts dieser Tiere sagen: Wir Menschen gehören nicht zum Tierreich.
Theodor W. Adorno wendet sich in dieser Sache gegen den kategorischen Imperativ Immanuel Kants: Jeder Mensch solle sich so verhalten, als wäre er ein allgemeiner Gesetzgeber. Dies enthalte eine Überschätzung, ja eine zivilisatorische Hochstapelei. Ich möchte ergänzen: So wie es einem nicht berechtigten Allmachtsgefühl des Menschen entspricht, wenn im Winterzirkus in Paris 1793 Artisten unter der Decke der dortigen Kuppel eines festen Gebäudes an Trapezen so tun, als könnten sie fliegen. In solchen Fällen sansculottischer Übertreibung gilt es, sich an der Bodenhaftung zu orientieren. Dort, wo die Retter, das Zirkuspersonal und die Füße gravitativ schwerer Tiere wie der Elefanten ihre Basis haben.
Adornos Metapher vom guten Tier in uns
An prominenter Stelle in seiner Negativen Dialektik schreibt Adorno:
Im Einzelnen bleibt an Moralischem nicht mehr übrig als […] so zu leben, dass man glauben darf, ein gutes Tier gewesen zu sein.
Der Satz steht am Ende des Kapitels Freiheit. Zur Metakritik der praktischen Vernunft. Er bezieht sich kritisch auf Immanuel Kants Begriffe der Freiheit, des Willens und des »intelligiblen Charakters«, einer von Kant behaupteten Struktur aller Willenskräfte, die in den Menschen die Lust an der Vernunft erzeuge. Wobei Immanuel Kant nicht von Lust oder Motiv spricht – vielmehr geht es um eine Art Grundwasser, das in den Menschen rebellisch und unaufhaltsam dem für das Gemeinwesen verträglichen, somit republikanischen und vernünftigen Zustand entgegenfließt.
Die Ableitung dieses intelligiblen Charakters ist bei Kant nicht dargelegt. Es heißt bei ihm:
Also werden wir nicht den Grund, woher das moralische Gesetz in sich eine Triebfeder abgebe, sondern was, so fern es eine solche ist, sie im Gemüthe wirkt (besser zu sagen, wirken muss), apriori anzuzeigen haben.
(Kritik der praktischen Vernunft, Seite 72)
Wir Menschen aber sind mit einem Teil unserer Körper (und vermutlich auch unseres Geistes bzw. besser unserer Geister) immer zugleich in der Evolution verwurzelt. Wir ragen in die organisierte Moderne, ins Reich der Vernunft, in eine allseitige republikanische Verfassung, nur mit Teilen unserer Eigenschaften hinein. Andere Teile in uns, wie die Verdauung, ja der Atem, die Haut oder der Herzschlag, das Gleichgewicht und der Rhythmus, bleiben autonom, vom Willen relativ unabhängig, weder ganz unbewusst noch ganz bewusst. Insofern würden wir einem Lebewesen, das zur Hälfte ein Wassertier wäre und zur anderen Hälfte ein Mensch, oder einem Lebewesen wie dem Kentauren durchaus gleichen. Zwar wäre das eine Metapher. Es wäre aber zugleich eine Realmetapher, so wie es den Tatsachen entspricht, dass wir zwei Hirnhälften besitzen, wesentliche Organe von uns paarweise existieren. Und so bestehen wir auch in den Zeiten unserer Herkunft aus lebendigen Teilen, die eher miteinander koexistieren als wirklich eine Einheit zu bilden. Es gibt in der Kritischen Theorie das Dialektische Bild und es gibt die Dialektik der Identität in uns Menschen. Wir gehören zum Tierreich und wir gehören zum Menschenreich.
Das Herz hat einen Verstand. Die menschliche Haut hat eine eigene Intelligenz, sie unterscheidet sich von der Arbeit im Kopf. Auch wenn all dies miteinander verbunden und voneinander abgeleitet ist, lässt es sich unterscheiden. Die Ohren besitzen andere Unterscheidungsvermögen als die Augen. Die Fingerspitzen sind, wenn es um den rechten Sitz einer Schraube geht, dem Denken überlegen. Wenn ich auf dem Fahrrad das Gleichgewicht halte, würde ich, falls ich jetzt die einzelnen Elemente, auf denen dieses Gleichgewicht beruht, reflektiere, stürzen. So ist die Charaktereigenschaft Intelligenz auf verschiedene Zentren in unserem Körper und Geist verteilt. Ein vielstimmiger Chor.
Der »bestirnte Himmel über mir« und das »moralische Gesetz in mir« sind, nachdem ein Krieg ausgebrochen ist, allein nicht in der Lage, Gesetzlichkeit und Vernunft wiederherzustellen. Andererseits sind viele Teile unserer Intelligenz und »Eignung zum Gesetzgeber« Derivate einer ursprünglichen Feinstruktur unserer Körper und subjektiven Geister, die aus unserer evolutionären Vorgeschichte stammt. Nach Auffassung von Münchner Astrobiologen geht diese Feinstruktur auf die Anfänge des Kosmos zurück.
Wanderung des Unterkiefers einer Vorfahrin unter den Schlangen bis ins Ohr des Menschen
Der Mathematiker und Biologe berichtet: Die Wüstenschlange braucht, um ein Jahr zu überleben, mindestens ein Beutetier. Das muss sie erjagen, auch wenn es nachts daherkommt und sie es nicht sieht. Sie muss es hören. Die Hörgenauigkeit des Unterkiefers gehört zur »Klugheit der Schlangen«. Die Schlange »hört« mit ihrem Unterkiefer. Der liegt fest auf dem Sandboden. Die Trippelschritte des Beutetiers sind nach Rhythmus und Bodenerschütterung deutlich zu verfolgen. Die Schlange lauert.
Dieser Hörkiefer unserer Vorfahrin hat sich im Laufe der Evolution enorm verkleinert und ist in das menschliche Ohr gewandert: Er ist zum Gehörknöchelchen geworden. Es befindet sich im Mittelohr und regiert dort jenes Stück der Intelligenz, das über Unterscheidungsvermögen verfügt, über so verschiedene Sensationen wie Sprache, Musik und das Gleichgewicht. Dies ist die Klugheit der Schlangen, von der die Bibel spricht.
Der Arzt Chiron, ein Kentaur, lebt mit halbem Leib (und integriert) als Tier. Er ist ein Halbbruder des Zeus, somit ein Unsterblicher. Er ist der beste Arzt der Antike. Außerdem Trainer der Intelligenz von Jason und der Mehrzahl der Helden Homers. Das ist etwas anderes, als bloß Logiker zu sein. Er ist fähig, Bildung zu transferieren und, wie gesagt, Wunden zu heilen. Das ragt aus dem Pferdeleib heraus und wurzelt doch in ihm.
Abb. 3: Der Gott Apoll übergibt seinen Sohn Aeskulap dem Kentauren Chiron zur Ausbildung in der Heilkunst.
»Das Lebendige verbirgt sich gern«
Abb. 4
Abb. 5
Sechs Elemente der Vividness
Vividness:
Lebendigkeit, Anschaulichkeit, Plastizität, Lebhaftigkeit, Bildhaftigkeit, Leuchtkraft ist eine Ressource wie Klima und Außenwelt.
1.
Vividness ist der Sitz der FREIHEIT in uns. Die Lebendigkeit gehört sich selbst und wird ihrer Natur nach regiert vom Lusthaushalt des Menschen. Nur scheinbar gehorcht das Lebendige den Zwecken oder den Direktiven. Tatsächlich ist das Lebendige eigensinnig und ungehorsam. Es ist auch unbeirrbar.
2.
Das Lebendige beruht auf VIELFALT und ALLGEGENWART. Das Lebendige in uns Menschen tut gut daran, alle Lebendigkeiten, die außerhalb von uns existieren, zu respektieren. Respektieren wir die Lebendigkeit der Dinge, werden die Dinge uns respektieren. Der französische Philosoph Michel Serres sagt: »Es gibt ein Menschenrecht der Dinge.« Das gilt vor allem, wenn die Dinge von Menschen gemacht sind, wie zum Beispiel bei der KI.
3.
Wir Menschen leben AMPHIBISCH. Zur Hälfte gehören wir in die Evolution, sind also noch Tiere, zur anderen Hälfte gehören wir in die Republiken und Zivilisationen. Manchmal übernehmen wir uns dabei. Wir verhalten uns dann als »Hochstapler der Zivilisation«. Wir müssen Vividness als MENSCHLICHE LEBENDIGKEIT teilweise erst noch herstellen.
4.
Mit jeder Geburt eines Menschen entsteht die Lebendigkeit neu. Andererseits hat das Menschlich-Lebendige ein GEWALTIGES ALTER.
5.
Die Evolution als Baumeister: der Brustkorb und das Skelett und die Lebendigkeit des Archaeopteryx und die Großstadttaube von New York. Der Archaeopteryx ist etwa rabengroß. Entworfen wurde dieses Lebewesen vor 150 Millionen Jahren. Das Skelett, Bauweise und Robustheit der Großstadttaube sind über einen so langen Zeitraum immer noch mit dem Urvogel verwandt. Die Rhizome und Wurzeln von uns Menschen sind bei einigen Organen wie Haut, Haar, Auge und Gemüt vermutlich noch älter.
Longue durée
als Trost und Hoffnung.
6.
Das Lebendige ist teilweise unsichtbar. Es ist ein POTENZIAL und eine UNBEIRRBARE KRAFT, von denen wir Teile bewusst ausüben. TRÖSTEND, DASS ALLES LEBENDIGE ENDLICH IST. Auch die wichtigste Konstante im Kosmos, die Lichtgeschwindigkeit, ist endlich. Das Licht ist unvorstellbar schnell. Aber es tröstet, dass nichts schneller sein kann als das Licht und dass Licht nicht schneller werden kann als es selbst. So gibt es auch nichts, was lebendiger ist als lebendig.
Was heißt Kältegrenze des Planeten?
Die Erde besitzt eine Grenze hin zum Weltraum, oberhalb der Ionosphäre. Zum Erdkern hin bildet für menschliche Bohrungen die Magmaschicht eine physikalische Grenze. Die Erde könnte beliebig kalt werden, sagt der Evolutionsbiologe Prof. Dr. Wilhelmsen von der Universität Rostock, aber jenseits der Kältegrenze gäbe es kein Leben. Fische überleben in Meerestiefen und in Gewässern mit einer Temperatur von minus eins bis minus acht Grad Celsius. Bei starkem Druck und heftiger Bewegung friert das Wasser, falls der Nullpunkt der Temperatur erreicht wird, nicht sofort zu Eis. Im Eis, sagt der Evolutionsbiologe, können Mikroben, Pilze und Schwämme und blutdurchströmte Lebewesen zumindest für kurze Zeit überleben. Sie können dies, wenn sie die Fähigkeit haben, ihren Kreislauf zu verlangsamen. Geschieht das über Jahrzehnte hinweg, sind ungewöhnliche Anpassungen zu beobachten. Leben »überwintert« eine gewisse Zeit im Sarg aus Eis. Als stünde die Zeit still.
Übrig von Iceball Earth
Zu einem gewissen Zeitpunkt der Erdgeschichte war, bedingt durch Konstellationen des Planetensystems, die Erde in Eis erstarrt. Unter einem Schnee- und Eispanzer, der in den Ozeanen bis in die Tiefen reichte, existierten am Grunde kleine Tümpel von eisigem Wasser, immer an der Grenze zum Gefrierpunkt.
Aus dieser vergangenen Welt stammt der Eishai, auch Grönlandhai genannt. So bestätigen es russische Forscher aus dem Wissenschaftszentrum Akademgorodok. Sie sind Überlebsel aus einer Periode vor Einbruch von Iceball Earth. Eine Wirbeltiergruppe von Fischartigen hatte sich, in äußerster Not und in ungezählten Jahren, an die kalten Tiefwasser angepasst und so aus den Vorzeiten überlebt. Die Grönlandhaie oder die Eishaie sind also nicht nur dem Lebensalter nach die ältesten Wirbeltiere, sondern auch älteste Tiere der Vorfahrenslinie nach. Sie waren – in der allmählichen Entwicklung der Erde zur Kälte hin – an der Kältegrenze des Planeten geblieben. In Kältetrance schwappten und tapsten sie wie Betrunkene im Meer. Ihr Fleisch stinkt. So sind sie vor gierigen Jägern und Harpunen einigermaßen sicher. Das Fleisch ist auch giftig für Menschen, weil es Stoffe enthält, die der Kälte entgegenwirken. Kein Schuppenpanzer schützt so wie die Ungenießbarkeit dieser Tiere.
Die Grönlandhaie bleiben besonders lange im Mutterleib
Die Jungtiere dieser Fische schlüpfen noch im Mutterleib aus den Eiern und wachsen dort, bis sie etwa einen halben Meter lang sind. Ihre Geburt braucht Zeit. Das Lebensalter dieser Tiere ist das längste unter allen Wirbeltieren. Diese Fische gehören zur Gattung der sogenannten Schlafhaie. Ihre Bewegungen sind langsam und schläfrig. Ihr Blutkreislauf ist träge. Sie leben in großer Kälte, oft in den Tiefen der nördlichen Meere. Selten tauchen sie empor. Dann kann es sein, dass sie eine Robbe im Schlaf überraschen. Für das Jagen einer wachen Robbe wären sie zu schläfrig. Sie leben wie in einem lang andauernden Winterhalbschlaf. Geschlechtsreif werden sie nach 150 Jahren. Eines dieser Tiere, das die Forscher untersuchten, war 512 Jahre alt. Oft geistert dieser Planetarier in Tiefen von 10.000 Metern unter dem Meerespiegel in Eiseskälte herum.
Longue durée Nr. 1
Abb. 6: Die Eintagsfliege hat eine der kürzesten Lebenszeiten.
Abb. 7: Grönlandhai, auch Schlafhai genannt. Höchstalter: etwa 512 Jahre
Bauhaus der Natur / Der Archaeopteryx & die Taube in der Stadt (Columba)
Abb. 8
Abb. 9
Abb. 10: New Yorker Taube
Abb. 11
Abb. 12: Gott bei der Erschaffung des gefiederten Tiers
Abb. 13
2
Die Eleganz der Tiere bei Überwinden der Schwerkraft
Abb. 14–19: »Oft halten die Tiere in Gedanken inne. Die Gedanken rasen wild umher.« (aus dem Film »Eleganz der Tiere bei Überwinden der Schwerkraft«)
Abb. 20
Abb. 21
Abb. 22
Abb. 23: Die Menschen geben dem Himmel die Namen.
Abb. 24: »Die allmähliche Verfertigung des menschlichen Gehirns durch Verlagerung des Schwergewichts in den Nacken«
Abb. 25: Im Rhythmus verbundene Beine
Die Walfischlaus / 02:52 Min.
Der Glücksfaktor / Mutter bringt Futter / 03:05 Min.
»Ein Schwarzspecht stirbt« / Lamento / 01:46 Min.
Lamento auf den Tod eines Maulwurfs / Mit Banda Franui / 02:34 Min.
3
Der lange Atem der Lebendigkeiten / »Longue durée«: Zeitalter, aus denen wir Menschen kommen …
Abb. 26
Abb. 27: »Brüder unterm Sternenzelt« (Druck auf Aluminium, 84 x 48 cm)
Abb. 28: Der Pferderücken und der Kran
Abb. 29: Die Fledermaus und ihre geometrische Orientierung im Raum
Auskünfte eines Wespenforschers
Dr. Gadagkar, Professor für biologische Ökonomie an der Universität Bangalore, ist Spezialist für die Evolution der Tierwelt in der Nachfolge von Charles Darwin. Seit 25 Jahren studiert er zwei Gruppierungen geselliger Wespen, von denen die eine Gruppe im Süden Indiens, die andere im Norden lebt. Seit etwa 90 Millionen Jahren gibt es staatenbildende Wespen. Sie haben die weltweite Katastrophe des Kometeneinschlags vor 65 Millionen Jahren, die das Saurier-Imperium beendete und die biologische Chance für Säugetiere und Menschen öffnete, als Staatswesen mühelos überbrückt. Die Wespengruppe im Süden scheint die ursprünglichere, primitivere Verfassung zu haben. Die Königinnen knuffen, beißen, drangsalieren in physischem Kontakt die Mitglieder der Gemeinschaft, wenn diese im Arbeitsprozess nachlassen, verteidigen so ihr Königtum und halten zur Arbeit an. Demgegenüber erscheint die nördliche Gruppierung »fortschrittlicher«, da die Königinnen den Stamm der Arbeiterinnen durch Gerüche, die sie absondern und die auf die Wespen wie Drogen wirken, in Disziplin halten. So können diese nördlichen Gemeinwesen umfangreicher werden, wobei wenige Moleküle der Droge ausreichen. Kleine Mengen üben nach Paracelsus in der Potenzierung große Wirkung aus.
Ein Gespräch mit Dr. Gadagkar
NZZ: Sie sprechen von Ihren Wespen, gleich ob in der Natur oder im Labor, mit großer Sympathie. Sie reden von einer matriarchalen Monarchie.
Gadagkar: Mit vollem Recht. Die Königin herrscht, die Arbeiterinnen arbeiten zu. Sobald Arbeitsteilung besteht, dass einige sich fortpflanzen, andere nicht, die Brutpflege und der Erwerb von Beute arbeitsteilig erfolgt, sprechen wir von eusozialen Insekten, d. h. von einem Zoon politikon, einem staatenbildenden Tier.
NZZ: Sind die sozialistisch?
Gadagkar: Zweifellos.
NZZ: Bedeutet das, dass Darwins Grundannahme, die Gene seien selbstsüchtig (»selfish«), es gebe keine Gutmütigkeiten im Kampf ums Dasein, widerlegt ist?
Gadagkar: Das hat Darwin so nie gesagt.
NZZ: Was hat er gesagt?
Gadagkar: Alle biologischen Umstände sind in Strukturen vorhanden. Ich habe Zellen, die bilden Organe und Kreisläufe, diese bilden eine Person oder ein Tier, diese bilden Familien oder Gesellschaften, alle gemeinsam sind die Biomasse des Planeten. Einige dieser Strukturen sind stets kooperativ, andere selfish.
NZZ: Auf den Kosmos dehnen Sie das nicht aus?
Gadagkar: Was weiß ich? Die Evolution findet auf jedem dieser Stockwerke statt. Kooperation zwischen Zellen und Organen schließt nicht aus, dass Deutsche und Franzosen sich hundert Jahre lang bekämpfen. Das kann im Planetenmaßstab wiederum Frieden bedeuten, weil sich die Ameisen oder Einzeller vermehren.
NZZ: Sie meinen, Einzeller leben von den Toten von Verdun?
Gadagkar: Oder denen des Irak. Auf der einen Ebene Kooperation ums Dasein, auf der anderen Kampf ums Dasein.
NZZ: Und einen Plan kann man nur fassen, wenn man alle Ebenen zusammenfasst?
Gadagkar: Einen Plan kann man überhaupt nicht fassen.
NZZ: Und was macht man stattdessen?
Gadagkar: Das kann ich Ihnen als Biologe nicht sagen.
NZZ: Aber Sie könnten etwas andeuten. Wir lernen aus dem Buch der Natur. Marx schrieb Widmungen und Briefe an Darwin. Gern wäre er der Ökonom der Tierwelt geworden, nicht Ökonom der Menschen.
Gadagkar: Interessant, dass Sie darauf hinweisen. In meiner Jugendzeit schrieb ich einen Essay über Marx und Darwin.
NZZ: In Indien?
Gadagkar: In Bangladesch. Die Denkweise in der Evolution geht umgekehrt. Etwas, das übrigbleibt, zeigt, dass etwas gelernt wurde.
NZZ: Man kann also nicht lernen, etwas bewirken und dann annehmen, dass es Erfolg hat?
Gadagkar: Nein. Das widerspricht dem indischen Erfahrungssatz, »etwas geschehen zu lassen«.
NZZ: An den wir Abendländer nicht glauben müssten.
Gadagkar: Zum Beispiel werden Königinnen in einem Wespenstock von den Arbeiterinnen nicht auf dieselbe Weise gewählt, wie man einen Kanzler oder einen US-Präsidenten wählt. Die Arbeiterinnen (auch bei den Bienen, den Ameisen) beobachten aber ihre Königinnen zu jedem Zeitpunkt. Wird die Königin schwach, d. h. bei den südlichen Wespen in Indien in ihren Knüffen und Bissen, bei den nördlichen in der Abströmung ihrer Drogen, wird sie draußen ausgesetzt, wo sie stirbt. Sie wählen die Königin im Fall des Versagens ab. Die Demokratie funktioniert rückwirkend.
NZZ: So wollen Sie mir die Evolution erklären?
Gadagkar: Im Gegensatz zur Revolution.
NZZ: Ein rückwirkender Lernprozess?
Gadagkar: Wie die »unsichtbare Hand« von Adam Smith.
NZZ: Könnten sich Revolutionäre darauf einstellen?
Gadagkar: Nur die bleiben übrig, die sich darauf eingestellt haben.
Großer Tiefseewal, verirrt in Afrikas Bergen
Ein Walfisch im tektonischen Bett der Menschheit
Geologen der Universität Harvard, die mit deutschen Kollegen nach Skelettfunden in Afrika forschten, entdeckten in Kenias Norden auf 620 Metern Höhe ein Walfischfossil. Der Schädelknochen war 17 Millionen Jahre alt. Es handelte sich um einen Riesenfisch, der nur in der Tiefsee lebte und dort Mollusken jagte. Er hat keine Barten, sondern Zähne. Wie gelangte ein solcher Wal vor 17 Millionen Jahren über 700 Kilometer landeinwärts auf eine Höhe von 620 Metern über dem heutigen Meeresspiegel? Als Tücke des Objekts ging das Fundstück für ein Jahrzehnt im Archiv verloren und wurde erst jetzt in Harvards gespeicherten Schätzen wiederentdeckt.
Den Schlüssel für die Erklärung lieferten Paläogeologen. Als das Tier sich vor so langer Zeit in einer Flussmündung verirrte, waren diese Küste und damit dieser Teil Afrikas flach. Erst später erhob sich, am Grund der Plume (= magmatischer Feuerkessel unter der Kontinentalplatte), Afrikas Ostseite um 600 Meter. Der mäandernde Riesenfluss (ähnlich dem Amazonas), in dem der Wal seinerzeit sacht aufwärtsschwamm, bis ihm die Nahrung ausging, bildete ein Tal, das durch Ostafrikas Vulkane später mit Lava zugedeckt wurde. So gibt das Walfischfossil (wie ein Metermaß) Auskunft über das geologische Schicksal Ostafrikas, jenes tektonischen Gebietes, in dem weitaus später die Menschheit entstand. Das waren zunächst 18.000 Unentwegte der Gattung Homo sapiens, genannt die »Verdrängungshorde«. Sie breitete sich mit ihren Nachkommen vom ostafrikanischen Graben über die ganze Welt aus.
VOR 40 MILLIONEN JAHREN …
Abb. 30
Abb. 31
»Blauwale auf Beinen« / Die Raubsaurier von Pangäa / Die Evolution bastelt
Vor 250 Millionen Jahren waren die Kontinente der Erde zu dem Riesenkontinent Pangäa zusammengeschoben. Angrenzend das Riesenmeer Panthalassa und in einer Riesenbucht der Vorläuferozean des Mittelmeers: die Tethys.
Oliver Rauhut, Kurator an der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie, ist auf solche Forschung spezialisiert. Man stellt sich dabei die Dinosaurier mit Schuppen oder mit Schlangenhaut vor. Tatsächlich haben vermutlich alle Dinosaurier (von denen nur die Vögel übriggeblieben sind) die Anlage zu einem Federkleid, gleich ob sie fliegen oder laufen.
Ein Gespräch mit Oliver Rauhut
Alexander Kluge: Sie haben einen jungen Dinosaurier entdeckt, den »Eichhörnchen-Nachahmer«.
Oliver Rauhut: Das ist ein junger Megalosaurier, der zu einer Gruppe von großen Raubsauriern gehört. Der Fund ist klein, weil es ein Jungtier ist, ungefähr 70 Zentimeter.
Kluge: Die Hirnschalenverknüpfung ist noch weich.
Rauhut: Die Verknöcherung ist noch nicht die eines ausgewachsenen Raubsauriers. Die Tiere sind relativ fertig, wenn sie aus dem Ei schlüpfen. Das waren wahrscheinlich Nestflüchter. Von daher war das Skelett gut ausgebildet. Das freut uns, weil unser Exemplar dadurch gut erhalten ist.
Kluge: Das Tier war flauschig.
Rauhut: Bei Fossilien ist es ungewöhnlich, wenn Reste von Federn erhalten sind. Das Tier hatte ein dichtes Federkleid.
Kluge: Ausgewachsen wäre er sechs Meter groß geworden.
Rauhut: Das nehmen wir an, aber nur aufgrund von Vergleichen mit Verwandten, die wir kennen. Von dem Tier haben wir leider keine ausgewachsenen Exemplare. Von daher wissen wir nicht, wie groß er geworden wäre.
Kluge: Sie deuten an, dass die Saurier generell bepelzt sind, keine glatte Schlangenhaut haben, sondern vermutlich alle Federn oder die Anlage dazu hatten.
Rauhut: Man hat die Dinosaurier bislang mit einer reptilienähnlichen Haut rekonstruiert. Aber alle Funde, zusammen mit Entdeckungen aus China, deuten an, dass Federn weitverbreitet waren bei den Dinosauriern. Eventuell bestand sogar bei allen Dinosauriern in der Anlage die Möglichkeit, ein Federkleid auszubilden. Ob das bei den großen Tieren nachher der Fall gewesen ist, ist eine andere Frage. Tiere, die in einem warmen Klima leben, wie Elefanten oder Nashörner, und groß werden, verlieren häufig die Haare wieder. Das könnte bei großen Dinosauriern ebenfalls so gewesen sein.
Kluge: Alle Vögel sind Dinosaurier.
Rauhut: Ja, aber nicht alle Dinosaurier sind Vögel. Aus Sicht der biologischen Systematik gehören unsere heutigen Vögel zu den Raubsauriern und die Raubsaurier gehören zu den Dinosauriern. Vögel sind veränderte Dinosaurier. Die größten Dinosaurier gehören zu den Sauropoden, den Langhalssauriern. Da gibt es Tiere wie den Argentinosaurus, der wahrscheinlich eine Länge von 45 bis zu 50 Metern erreicht hat und bis zu 100 Tonnen wog. Das sind Blauwale auf Beinen. Das liegt nahe an der Grenze dessen, was denkbar ist für ein Landwirbeltier. Es gibt Berechnungen, wonach für ein Landwirbeltier etwa bei 150 Tonnen die Grenze erreicht ist. Darüber hinaus wäre es nicht mehr lebensfähig.
Kluge: Die Chitinhülle kann bei den Insekten bis zu einem bestimmten Grad Eiweiß transportieren. Aber das Tier kann nicht beliebig schwer werden. Jetzt kommt die Skelettbauweise, die schon deutlich mehr kann.
Rauhut: Die Schwierigkeit liegt in einer mathematischen Funktion. Wir haben das Volumen und damit das Gewicht, das in der dritten Potenz ansteigt. Was letztlich die Festigkeit und die Möglichkeiten der Kraftaufwendung von den Knochen und den Muskeln bestimmt, sind die Durchmesser und die Flächen, die in der zweiten Potenz wachsen. Damit wächst das Gewicht überproportional gegenüber dieser Fläche, die das Gewicht tragen könnte. Bei über 150 Tonnen müsste das Tier nur noch aus Beinen bestehen. Ich interessiere mich auch für die Südhalbkugel, weil die Fauna anders ist. Wir hatten am Anfang der Dinosaurierzeit den Superkontinent Pangäa, der auseinandergebrochen ist. Dann haben sich die Dinosaurier der Südhalbkugel anders entwickelt als die der Nordhalbkugel. Argentinien gehört inzwischen zu einem der großen Schwerpunktländer der Dinosaurierpaläontologie. Dort gibt es hervorragende argentinische Kollegen, mit denen ich gern zusammenarbeite, weil die Logistik und auch die lokale Expertise vorhanden sind.
Kluge: Dort treffen Sie auf einen Hinweis von einem Hirten.
Rauhut