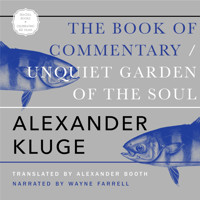Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Essays, Interviews und Kurzgeschichten über Heinrich von Kleist, die Kluges Faszination für den preußischen Gewitterkopf zum Ausdruck bringen. Alexander Kluge bezeichnet in einem Gespräch mit Jens Bisky, der eine Biographie über Heinrich von Kleist geschrieben hat, dessen Existenz als "Gewitterleben". Mit Johann Wolfgang von Goethe könnte man Kleist einen vulkanischen Charakter nennen. Gewitter und Vulkanausbruch sind bedrohliche Ereignisse. Heinrich von Kleist war der Meinung, dass gefährliche Situationen den Menschen anspornen. Kluge hat 1985 den Kleist-Preis erhalten für seinen Film und das Buch "Die Macht der Gefühle". Er hat eine Rede auf den preußischen Schriftsteller gehalten, Geschichten über ihn geschrieben, Gespräche in seinen Kulturmagazinen im Fernsehen geführt, unter anderem mit Joseph Vogl, Thomas Schmid, Jens Bisky. Kluge hat mit Ferdinand von Schirach über Kleists Geschichte "Der Findling" gesprochen und die Oper "Erdbeben. Träume" von Toshio Hosokawa gefilmt, die von Kleists "Erbeben in Chili" und Fukushima ausgeht. Für diese Oper hat Marcel Beyer das Libretto geschrieben. Mit keinem anderen Schriftsteller ist Alexander Kluge so häufig verglichen worden wie mit Heinrich von Kleist. Der Band "Heinrich von Kleist – ein Gewitterleben" zeigt Kluges Faszination für den preußischen Gewitterkopf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 157
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexander Kluge
Heinrich von Kleist –Ein Gewitterleben
Mit Beiträgen vonMarcel Beyer, Jens Bisky, Thomas Combrink, Toshio Hosokawa, Ferdinand von Schirach, Thomas Schmid und Joseph Vogl
Idee und Mitarbeit
Thomas Combrink
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese
Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Wallstein Verlag, Göttingen 2023
www.wallstein-verlag.de
Umschlaggestaltung: Wallstein Verlag, Göttingen,
unter Verwendung einer Lithografie von Heinrich von Kleist,
erschienen 1858 in Die Gartenlaube. Illustriertes Familienblatt
ISBN (Print) 978-3-8353-5398-5
ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-8418-7
ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-8419-4
Sprechen und Schweigen sind keine Alternativen. Was ist das Dritte?
Gern wäre ich ein Poet in den Jahren 1807 bis 1811 mit Sitz in Preußen. Alle Ströme und Fließwasser der Einbildungskraft und die vielen Stimmen in mir, im Schlaf, in den Augenblicken der Besinnungslosigkeit, im Unterholz der Ahnung, lasse ich dann los wie eine Meute, die einem Wildschwein nachjagt (die wildbeuterische Ausdrucksweise passt nicht in mein Jahrhundert, sie steckt in meinen Adern). Oft spreche ich im Schlaf und jemandem, der mich fragt, ein Genius oder Glücksgeist, würde mein Mund im Traume antworten. Kein Zentralverstand mit seinem hellen Licht bremst den Strom solcher Worte.
Das ist 200 + 11 Jahre nach 1811 deutlich anders. Die Sonne des Verstandes (sol) macht aus dem täglichen Himmelslicht einen Schatten. Der VERSTANDESSTRAHL ist Institution geworden, steuert von draußen, übersät mit seinem INFORMATIONSLICHT alle Dinge und Menschen, und er verbrennt meine innere Steppe. Als wäre es eine Urteilskraft, liegt diese Strahlung unsichtbar über der Konferenz, an der ich gerade teilnehme: eine Art POLIZEILICHE STRAHLWAFFE.
Ich kann ja äußern, was ich will. Ich kann stottern, toll reden, das Wort zu einem Monolog ergreifen, in Zungen sprechen, ins Flüstern verfallen, auf Zettel schreiben und diese jemandem zustecken (Kassiber), zur Zeichensprache übergehen oder in Gesang verfallen. Ja, ich bin ein freier Mensch. Und Poet noch dazu.
Poetik ist heute wie Seitenstechen. Wo Verbrechen eine Geschichtslandschaft verwüstet haben, hilft keine Kommunikation, sie zu beleben. Ich spreche von Galizien, einer Landschaft von Hunderttausenden von Seelen, die ausradiert wurden.
Alexander Kluge
1Wurzelwerk der Buche / »Dichterische Fernfühlung«
Schlafende Kraft
In Heinrich von Kleists Hermannsschlacht fällen die Römer Eichenbäume im Cheruskerwald. An den Bäumen sind Waffen und Abbilder von Götzen der Germanen aufgehängt. Die Untat wird Ursache des Aufstandes, in dessen Verlauf die römischen Legionen vernichtet werden.
Ist das historisch?
Es steht bei Tacitus.
Deshalb muss es nicht wahr sein.
Kleist aber, so der Übersetzer, der das Drama Kleists ins Französische übersetzt hatte, habe die Glaubensrichtung der Germanen bezeichnen wollen; dafür sei es unerheblich, ob eine historische Tatsache zutreffe. Nach Auffassung der Cherusker habe die Kampfkraft des Volkes in den Bäumen geschlummert. Den Römern sei das fremd gewesen. Der Glaube der Germanen aber habe nur dadurch aufgerufen werden können, dass er verletzt wurde. In diesem Moment wendete sich die SCHLAFENDE KRAFT gegen die Verletzer.
Es ging nicht um die Wurzeln der Bäume, sondern um die Wurzeln des Glaubens?
Dargestellt in den Attrappen, die im Geäst aufgehängt waren.
Nachahmungen von Gegnern? Erbeutete Waffen?
Als solche heilig geworden. »Einverleibte Feinde«.
Die Bäume wurden mit ihren Wurzeln verbrannt?
Das war aber nicht das Sakrileg, sondern die Verbrennung der heiligen Attrappen.
Besitzen Eichen mächtige Wurzeln?
Stark, aber wenig effektiv.
Die Buche im Wettbewerb mit der Eiche
Eichen müssen im Schatten von Buchen verkümmern. Die oberen, humusreichen Bodenschichten sind bei Eichen- oder Buchenwald gleichermaßen dicht durchwurzelt. Wo fast ausschließlich Eichen stehen, dominieren die Eichenwurzeln, im Buchenwald die Buchenwurzeln. Erstaunlicherweise sind aber die Buchen unterirdisch ebenso stark vertreten, wenn beide Baumarten in bunter Mischung wachsen.[1]
Der Biomasse der Feinwurzeln nach, aber auch in der Anzahl der Wurzelspitzen übertreffen die Buchen die Eichen im Mischwald um das Vier- bis Fünffache. Und ausgerechnet in unmittelbarer Nähe von Eichenstämmen sind die Buchenwurzeln besonders zahlreich. Sie, die sensiblen, machen es sich zunutze, dass im fremden Wurzelraum mehr zu holen ist als im eigenen. Denn fern der Buchenstämme, im Umkreis der gegnerischen Eichen, ist die Humusschicht dicker. Den Eichen, schreibt Reichs-Forstwart Dänicke, fehlt es gegenüber den Buchenwurzeln an Durchsetzungskraft. Sie wachsen drei- bis sechsmal langsamer als ihre Konkurrentinnen, wenn sie in deren Nähe geraten. Wenn Zuwachs und Verteilung der Feinwurzeln den Zugang zu Wasser und Nährstoffen widerspiegeln, steht die Eiche als Verliererin da.
Dies spricht, schreibt Reichs-Forstwart Dänicke an den Reichs-Jagdmeister, dafür, in den Emblemen des Großdeutschen Reiches die Eiche gegen die Buche auszutauschen. Es muss im Überlebenskampf immer um die Realitäten gehen. Deshalb darf die höchste Auszeichnung des Deutschen Reiches nicht »Ritterkreuz zum Eichenlaub mit Schwertern und Brillanten« heißen, sondern Ritterkreuz zum Buchenlaub. Rassisch wird dieser Baum, wenn auch gegen Kälte, Trockenheit und Hitze empfindlicher als die Eiche, die höhere Leistung und Verdrängungspotenz erbringen. Man müsse im Kriegsjahr 1944 äußerste Konsequenzen ziehen, gerade auch in der »Verwaltung der Symbole«.
Kleists Reise
Die Macht der Gedanken
Zu jener Zeit, als Bonaparte seine Truppen bei Boulogne zur Überfahrt nach England in einem Lager versammelte, entschloss sich der Dichter Heinrich von Kleist zu einem entschiedenen Aufbruch. Von Paris aus brach er zu Fuß mit seinem Felltornister auf. Im Gepäck hatte er die Schriften Immanuel Kants. Im Kopf und auf der Zunge die lebendigsten Ausschmückungen und Erörterungen der wichtigsten, von ihm angestrichenen Stellen. Das meiste war schon ins Französische übersetzt. Es drängte ihn mit ganzem Gemüt, in das Lager der Franzosen vorzudringen, die Korporale und Mannschaften zu unterrichten in den einzigen Gedankengängen, die in Europa die Konsistenz hatten, den neuen zivilisierten Menschen auszurüsten: ein jeglicher sein eigener Gesetzgeber. Eine Armee, die Gesetzgebung und Waffe gleichzeitig in den Händen zu halten wüsste.
Kleist gelangte in einer Dämmerstunde, es regnete über der Küste, an die Vedetten, die weiträumig das französische Lager abschirmten. Er verhandelte mit dem zuständigen Wachoffizier. Der Offizier hielt ihn für verdächtig. Handelte es sich um einen britischen Agenten, der sich als Deutscher verkleidet hatte? Die Hetzschriften, allerdings ohne Abbildungen, die der junge, deutsch und französisch sprechende Mann mit sich führte, wurden beschlagnahmt. Kleist protestierte gegen die Beschlagnahme von Kants Schriften und bestand darauf, dass der Protest in ein Protokoll aufgenommen würde. Er übernachtete in einem in der Nähe befindlichen Dorf.
Am folgenden Tag wurde er verhaftet und von einer Eskorte dem General vorgeführt, der den südlichen Teil des französischen Lagers kommandierte. Welche Art der Unterrichtung der französischen Armee hatte sich Kleist vorgestellt? Er hätte sicher einen einzelnen ihm vorgeführten Korporal überzeugen können, erstens, dass diesem in seiner intellektuellen Ausstattung etwas fehle; zweitens, dass die Gedankengänge Immanuel Kants, habe man sie nur in ihrem Zusammenhang und ihrer Vielfalt studiert, auf ein europäisches Gemeinwesen deuteten, ja, auf eine Konstitution des Erdballs, für die als erfahrener napoleonischer Fußsoldat es sich zu kämpfen lohne. Ja, die Überwindung falschen Römertums, die Formung eines prometheischen Menschen setze eine individuell, im Herzen eines jeden Einzelnen (der nicht Untertan wäre) immer erneut hergestellte Gesetzgebung voraus, sodass es lediglich erforderlich sei, die komplex und in deutscher Sprache formulierte Theorie auf einfachen Handzetteln in französische Sprache zu fassen, zu nummerieren und umzuverteilen. An diesem Vormittag traf aber Kleist auf keinen Korporal in zuhörender Position. Er hätte als Querulant gegolten, hätte er nicht dem General geantwortet, sondern sich an den nächstbesten Korporal der Bewachungseskorte gewandt. So versuchte er, dem General, in dessen Sprache, die generelle Richtung seiner Absichten zu erläutern.
Kleist entwickelte sich aus vielfältigen Gründen in späterer Zeit zum Franzosenhasser, sodass er für die Übermittlung einer weltbürgerlichen Botschaft nicht mehr in Betracht kam. Zwischen dem System der Waffen und dem System der Gedanken war keine Einheit zu stiften.
Kleist in Aspern
Unerklärliche Hassgefühle, dichterische Fernfühlung
Es trieb ihn mit Dahlmann 1809 zu den Schlachtfeldern in Österreich. Über die Landstraßen nach Aspern. Rechts und links kampierten österreichische Pelotone in weißen Uniformen. Die Freunde suchten Kontakt. Irgendeinen Offizier, der sie kannte. An diesem Tag überschritt der Tyrann die Donau.[2]
Zutrauliche Atmosphäre. Dahlmann und Kleist hätten auch Spione sein können. Waren sie Reisende? Sie boten sich an als »Kriegshelfer«. In einem Gasthaus untergebracht, nicht unbequem. Kampierende Soldaten ringsum im Gelände, von denen keiner während der Schlacht auf die Idee gekommen war, sich in einem Gasthof einzumieten.
Kleist arbeitete in den nächsten Wochen besessen an dem Konvolut, das die HERMANNSSCHLACHT enthielt. Was ist der Grund für die cheruskischen Frauen, selbst mitzukämpfen? Den totalen Krieg gegen die Usurpatoren zu entzünden? Nichts als Selbstverteidigung. Schon warten, notierte Kleist, die Frauen der Römer auf die Zähne germanischer Frauen, um sie sich einzusetzen, auf das Haar, mit Kopfhaut abgeschnitten, das sie sich als Prachttolle aufsetzen wollen. Wer das nicht erleiden will, muss sich zu wehren wissen.
Glaubte Kleist in diesen Wochen, dass die Franzosen ähnliche Attentate auf die Integrität ganzer Länder, z. B. Österreichs oder Preußens (mit dem sie zur Zeit keinen Krieg führten), planten? Wahr ist, das erfuhr Kleist, dass für ganz Hamburg Französisch als Amtssprache oktroyiert war.
Vier Wochen später überschreitet Napoleon, der seine Mannschaften in Wien ergänzt hat, die Donau erneut. Jetzt macht er keinen weiteren Fehler. Er siegt bei Wagram. Der in den Rückzug nach Brünn hineingerissene Kleist, das Konvolut des Hass-Dramas gegen die Römer auf einem Packwagen, von einer körperlichen Verzweiflung erfasst. Er fiebert. So stark die Empörung, die er in sich fühlt. Dahlmann hört den Kranken murmeln, Reden führen, kleine Schreie. Was hat das mit dem realen Napoleon zu tun, der sich wenige Meilen südlich mit administrativen Geschäften Frankreichs befasst? So rasch wie möglich will er deutschen Boden verlassen. Man müsste ihn nicht durch Schlachten vertreiben. Wäre es möglich, fragt sich Dahlmann, den Freund davon abzubringen, Hetzschriften wie die HERMANNSSCHLACHT zu verfassen? Darauf zu verzichten, sich auf den Straßen Mährens umzubringen? Was verletzt den Dichter so schwer, dass die Nieren, sonst stumm, schmerzen? Er weiß doch nichts Wirkliches, sagt Dahlmann, von irgendwelchen Schandtaten der Franzosen.
Kleist aber glaubte, in »innerer Seelenbewegung« mit dem Schlächter Armin verknüpft zu sein. So wie er einen Geisterregen von Spanien her fühlte, tausend nächtliche Augen, gierig auf Franzosenblut.
Dahlmann wollte noch bis Königgrätz gelangen, dort eine Herberge finden für den bleichen Dichter. Er wollte einen Kachelofen heizen und den Hasserfüllten unter Branntwein setzen. Als Freund gewalttätig. Angekommen in Königgrätz, riet der Stadtarzt von der Alkoholkur ab, verordnete Laudanum.
Anekdote
Einen Bauern, der auf dem Schlachtfeld Kugeln sammelte, fragte Dahlmann, zur Insel Lobau in der Flußmitte der Donau blickend, ob die Franzosen hier vor der Schlacht eine Brücke gebaut hätten oder ob man den Fluss auf einer Furt zur Insel durchwaten könne. Der Bauer zeigte die fremd redenden Fußgänger, Kleist und Dahlmann, bei dem nächst stehenden Kürassierposten an. Er hielt sie für Spione. Er meinte, die Fremden suchten einen Weg, um zu den Franzosen hinüberzugehen.
Soldaten versammelten sich um die Verhafteten. Kleist zog eines seiner patriotischen Gedichte hervor und reichte es einigen der Offiziere, gewissermaßen um sich auszuweisen. Diese hielten nichts von politischer Lyrik. Der Name Kleist erinnerte sie an einen preußischen hohen Offizier (einen Verwandten des Poeten), der im Krieg von 1806 die Festung Magdeburg ohne militärischen Grund an Napoleon übergeben hatte. Die Freunde waren in Gefahr. Zum Schlachtfeld waren sie in einem Kutschwagen mit zwei Pferden gekommen. Dort, wo die Kutsche nach Angabe der Freunde stehen sollte, war nichts zu finden. Der Kutscher war fortgefahren. In den Resten Asperns fand sich eine zerstörte Apotheke, in der das Verhör gegen Dahlmann und Kleist eröffnet wurde.
»Wir banden sie zu Kampflegionen /Alle die Schwalben«
Abb. 1: Meine Vorfahrin, Caroline Granier, Urgroßmutter meiner Großmutter väterlicherseits Hedwig Kluge.
Begegnung auf der Flucht
Auf ihrer Flucht aus Frankreich strandete in ihrem Jagdwagen meine Vorfahrin Caroline Granier, spätere Frau Glaube (Urgroßmutter meiner Großmutter väterlicherseits Hedwig Kluge), weil ihr die Pferde durchgingen. Das hat mein Cousin Burkhard Stein ermittelt, Richter in Tübingen (aus der Linie der Hermans und Glaubes im Südharz). Der Unfall ereignete sich am Eingang des Städtchens Hochspeyer. Es gelang Soldaten und Offizieren des preußischen Garderegiments Nr. 15, das Gespann aufzuhalten, die gefährdete Frau zu retten. Eine Runde bildete sich um sie in der Gastwirtschaft.
Abb. 2: Heinrich von Kleist im preußischen Garderegiment Nr. 15. Er will zu diesem Zeitpunkt »wissenschaftlicher Offizier« werden.
Einer der Offiziere schien meiner Vorfahrin aufgeregt und davon besessen, den Vorfall gründlich nachzuerzählen. Er habe ihr keine Avancen gemacht, erzählte sie, sondern bei der Lebhaftigkeit der Erörterung ihre Anwesenheit zunächst kaum bemerkt. In welcher Richtung müsse man abspringen, wenn das Gefährt außer Kontrolle gerät und die Pferde nicht zu zügeln sind? Es sei niemals leicht, sich aus einem dahinrasenden Wagen zu retten. Das sei ja soeben noch ihr unmittelbares Problem gewesen, warf meine Vorfahrin ein. Die Natur gibt uns ein, in Richtung des dahinjagenden Vorderrads zu springen, habe der Offizier weitergeredet (praktisch ein Junge). Die Kraft des Sprungs aber, die des rasenden Fahrzeugs und die irritierende Kraft der Trägheit, die gerade jetzt im Dahinflug der Katastrophe ihre Macht beweise, werde jeden Sprung aus dem Fahrzeug aus der geplanten Geraden in die Diagonale lenken, und so erfasst statt der erwünschten Rettung das Hinterrad die Springerin, wirft sie dem Vorderrad zu, von dem die Person abprallt, woraufhin sie vom Hinterrad zermalmt wird. Entgegengesetzt zur natürlichen Regung, sich nach vorn zu stürzen, sei es vielmehr richtig, das Glück in Richtung des Hinterrads zu suchen; selbst wenn man dieses streife, werde man zur Seite geworfen und lande unsanft, aber lebendig am Wegesrand. Das war ja nun nicht nötig, erwiderte Caroline Granier, weil Sie und ihre Kameraden mir so freundlich halfen. Der erzählerisch gestimmte Jungoffizier war noch nicht geneigt innezuhalten und entwickelte eine Theorie der Radnabe, die schon dem König Pelops vom Peloponnes zum Verhängnis geworden sei, weil er die Radnabe eines Rivalen mit Wachs ersetzte, diesen so tötete und damit eine Schuld auf sich lud, die auf alle Nachkommen seines Geschlechts weiterwirken musste. So sei die Radnabe des Geschicks immer parallellaufend, oft hartnäckiger als die von Handwerkern gefertigte Nabe selbst. Meine Ahnin, die noch vor Abenddämmerung Trippstadt erreichen wollte, dankte der Runde vor ihrem Abschied. Der redselige Offizier bohrte sich zu diesem Zeitpunkt in eine mathematische Frage, die immer noch die optimale Sprungrichtung betraf, dann aber auf die Rettung aus einem sinkenden Schiff überging. Das Problem sei in einem solchen Fall, dem vom Untergang des Schiffes erzeugten Sog zu entkommen. Er hatte Skizzen auf die Tischplatte eingeritzt mit der Darstellung eines Kräfteparallelogramms und mehrerer Pfeile. Das Militär verhielt sich rücksichtslos gegenüber dem einheimischen Mobiliar.
Kleist und seine Schwester
Ich bin ein Mond und reflektiere Licht. Du bist die Sonne, sagte er zu seiner Schwester. Die glaubte das nicht. Es sei nicht ihre Praxis, sich zu äußern. Auf dieser Spannung, dass ein Mensch etwas initiiert und der andere es niederschreibt, beruht Kleists Satz über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden.
Kleists Lebensplan
Während seines Studiums im Jahr 1800 in Frankfurt an der Oder, in welchem Kleist sich nicht entschließen konnte, was aus der Fülle der Wissenschaften er studieren sollte (und somit studierte er alles und jedes), und er nicht wusste, ob er besser wissenschaftlicher Offizier, Gelehrter, Dichter oder Unternehmer werden sollte, versuchte er einen VERBINDLICHEN LEBENSPLAN zu entwerfen. Den Plan wolle er dann mit irgendeiner Handlung besiegeln (ein Papier mit Blut unterzeichnen, den Plan einer geliebten Person zuschwören, ihn an geheimem Ort verwahren) und anschließend beharrlich ausführen. Wenn man nämlich immer geradeaus geht, gelangt man in eine zweite Welt, in der die engen Grenzen des hiesigen Gefängnislebens keine Gültigkeit mehr besitzen.
Tatsächlich aber liefen die Tendenzen in Kleists lebhaftem Gemüt strahlförmig auseinander. Die Anstrengung zur linearen Konzentration zerriss ihn. Dringlich verreiste er, brach das Studium ab und gelangte bis Würzburg.
Wie Goethe eine Minderjährige belauerte
Ein Vorgang, von dem Kleist erfuhr, der aber durchaus geheimgehalten werden sollte, bestand darin, dass Johann Wolfgang von Goethe eine Minderjährige umlauert hatte, zu der es ihn längere Zeit hinzog. Die junge Frau hatte den Mann, den sie für einen Nichtsnutz hielt, abblitzen lassen. Sie hatte dann einen Reiterhauptmann geheiratet. Der war von Kaiser Napoleon mit einer Schwadron von Dragonern bis nach Teheran gesandt worden, als Vortrupp seines Indienzuges. Spät, auf dem Rückzug, wurde dieser Ehemann von Freischärlern umgebracht. Die Witwe, volljährig, aber immer noch sehr jung, erschien als Freiwild. Sie besaß kein Vermögen, kaum Schutz durch Verwandte. Abenteurer traten auf, bemühten sich um ihre Hand. Zu diesem Zeitpunkt soll der Geheimrat Goethe eine erneute Annäherung an das schon immer begehrte Objekt in die Wege geleitet haben. Er trug der Witwe an, in seinen Haushalt einzutreten zwecks späterer weiterer Annäherung und eventueller Zweitehe. Dann, so Kleists Darstellung, geizte er doch mit seiner Lebenszeit, seiner verfügbaren Lebendigkeit, fürchtete um die vielen Texte, die er nicht würde schreiben können, wenn ein vitales Lebewesen sein umzirkeltes Reich bevölkerte: Das verschlug allen Ausdruck, alle Intensität des Morgens, der doch der Arbeit diente, war nach dem Kredit der Tage, die dem Tod geschuldet sind, unerschwinglich, so Kleists Worte.
Die Liaison verlief sich im Sande, weil auch nicht deutlich war, wie die junge Witwe geantwortet hätte. Vermutlich kam die Verbindung so gar nicht infrage. Kleist aber nutzte sein Wissen für die kurze, von ihm später verbrannte Novelle »Das Eigentum, das von den Sternen kam«.
Kleist wusste nichts über die Unbändigkeit von Goethes Seele, die wie in einer Parallelwelt mit dem Kokon, in dem er sich aufhielt, koexistiert. Die gewisse Zerreißung, die er spürte, als er zu keinem rechten Entschluss kam in Bezug auf die Bindung, die ihm Hirn und Nerven doch stark beschäftigten:
»Liebt ich dich als Kleine, Kleine /
Jungfrau warst du mir versagt /
Wirst doch endlich noch die Meine /
Wenn der Freund die Witwe fragt«
»Unbändig«
In dem Deutschen Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm heißt es zu dem Wort unbändig: […] mit unbändigen flammen […] wie an der nordischen Elb’ obwalt’ unbändiger winter […] dies dumpfe brausen eines unbändigen elementes […] das unbändige (zerflatternde) papier […] mit . . unbändigen Haaren […] aus dem kreise der grundvorstellung heraustretend: grosz, stark, gewaltig, nachdrücklich, ungefüge, auszerordentlich […] mehr in den mundarten als in der schriftsprache ausgebildet […] unbannig, bannig […] ein unbändig klotz und stein […] einer krankheit wegen nahm er . . eine unbändige menge opium […] der porphyr kann wegen seiner unbändigen härte nicht . . bearbeitet werden […] wie schwer zu bearbeitendes erdreich […] es wäre eine zu äuszerliche erklärung, wollte man unbändig hier nur als syn. ersatz für wild (vgl. unfreundlich für unartig im Bergbau) auffassen […] steigerungsformen: denn nichts ist unbändiger . . als der zürnende hunger (ODYSSEE) […] ein waldhorn raste in den unbändigsten falschesten tönen EICHENDORFF […] mit wildem klopfen / unbändig quoll mein herz empor […] unbändig schön CAROLINE SCHLEGEL […] unbändig guten willen […] es macht die gefühle unbändig zart.