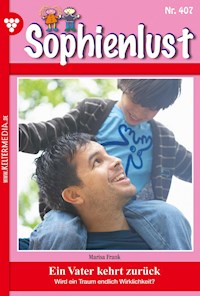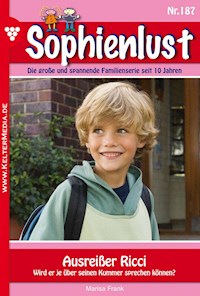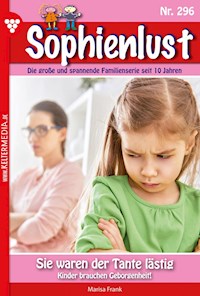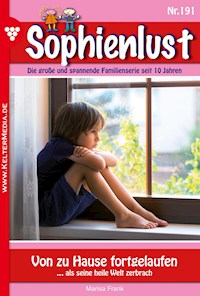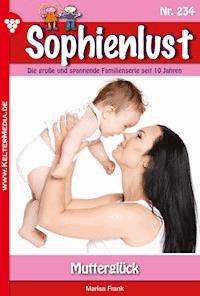Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sophienlust
- Sprache: Deutsch
Die Idee der sympathischen, lebensklugen Denise von Schoenecker sucht ihresgleichen. Sophienlust wurde gegründet, das Kinderheim der glücklichen Waisenkinder. Denise formt mit glücklicher Hand aus Sophienlust einen fast paradiesischen Ort der Idylle, aber immer wieder wird diese Heimat schenkende Einrichtung auf eine Zerreißprobe gestellt. Diese beliebte Romanserie der großartigen Schriftstellerin Patricia Vandenberg überzeugt durch ihr klares Konzept und seine beiden Identifikationsfiguren. »Vati, nimm mich bitte mit!« Atemlos kam Henrik von Schoenecker auf die Pferdekoppel gestürzt. Sein Gesicht war vom schnellen Lauf gerötet, seine grauen Augen blitzten unternehmungslustig. »Mutti hat gesagt, dass einige Pferde zum Versand kommen.« »Genau gesagt, drei Stück.« Alexander von Schoenecker stieß sich vom Zaun ab und ging seinem Sohn entgegen. Lächelnd fuhr er ihm über den wirren Haarschopf. Damit gab sich Henrik nicht zufrieden. Energisch entwand er sich der streichelnden Hand. »Lass uns an die Arbeit gehen. Ich will dir helfen.« »Hast du deine Schularbeiten schon gemacht?« Betreten senkte Henrik den Kopf. Beinahe hätte er ja gesagt und seinen Vater damit belogen. »Na dann, mein Sohn, ab nach Hause!« Henrik zog eine Schnute, aber er trollte sich. Er wusste, bei seinem Vater nützte kein Bitten und Betteln. Ein Nein blieb ein Nein. Alexander blickte seinem neunjährigen Sohn kurz nach, auf den er stolz war. Dann rief ihn wieder die Pflicht. Er musste sich beeilen, wenn er die drei Pferde in Bachenau zum Versand bringen wollte. Kurze Zeit später hatte Alexander von Schoenecker mit Hilfe des alten Janosch die Pferde in seinem Viehwagen verstaut. Mit traurigem Gesicht stand der alte Pferdepfleger neben ihm. Alexander ahnte den Grund seiner Trauer. Janosch liebte Pferde über alles. Es fiel ihm schwer, von ihnen Abschied zu nehmen. »Es sind drei Prachtstücke«, sagte Alexander. »Das habe ich deiner Pflege zu verdanken.« Bedächtig nickte Janosch, aber auch die lobenden Worte konnten ihn nicht aufmuntern. Alexander gab den Versuch, ein Gespräch zu beginnen, auf. Er wusste, wenn Janosch in einer solchen Verfassung war, machte er den Mund
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sophienlust – 174 –Aus dem Elternhaus vertrieben
Wo ist meine richtige Mutter?
Marisa Frank
»Vati, nimm mich bitte mit!« Atemlos kam Henrik von Schoenecker auf die Pferdekoppel gestürzt. Sein Gesicht war vom schnellen Lauf gerötet, seine grauen Augen blitzten unternehmungslustig. »Mutti hat gesagt, dass einige Pferde zum Versand kommen.«
»Genau gesagt, drei Stück.« Alexander von Schoenecker stieß sich vom Zaun ab und ging seinem Sohn entgegen. Lächelnd fuhr er ihm über den wirren Haarschopf.
Damit gab sich Henrik nicht zufrieden. Energisch entwand er sich der streichelnden Hand. »Lass uns an die Arbeit gehen. Ich will dir helfen.«
»Hast du deine Schularbeiten schon gemacht?«
Betreten senkte Henrik den Kopf. Beinahe hätte er ja gesagt und seinen Vater damit belogen.
»Na dann, mein Sohn, ab nach Hause!«
Henrik zog eine Schnute, aber er trollte sich. Er wusste, bei seinem Vater nützte kein Bitten und Betteln. Ein Nein blieb ein Nein.
Alexander blickte seinem neunjährigen Sohn kurz nach, auf den er stolz war. Dann rief ihn wieder die Pflicht. Er musste sich beeilen, wenn er die drei Pferde in Bachenau zum Versand bringen wollte.
Kurze Zeit später hatte Alexander von Schoenecker mit Hilfe des alten Janosch die Pferde in seinem Viehwagen verstaut. Mit traurigem Gesicht stand der alte Pferdepfleger neben ihm. Alexander ahnte den Grund seiner Trauer. Janosch liebte Pferde über alles. Es fiel ihm schwer, von ihnen Abschied zu nehmen.
»Es sind drei Prachtstücke«, sagte Alexander. »Das habe ich deiner Pflege zu verdanken.«
Bedächtig nickte Janosch, aber auch die lobenden Worte konnten ihn nicht aufmuntern.
Alexander gab den Versuch, ein Gespräch zu beginnen, auf. Er wusste, wenn Janosch in einer solchen Verfassung war, machte er den Mund nicht auf.
Mit einem raschen Seitenblick musterte Alexander das wettergegerbte Gesicht unter dem weißen Haar. Siebzig Jahre war Janosch bereits alt, aber er nahm es noch leicht mit jüngeren Arbeitern auf. Vor allem um seinen Pferdeverstand beneideten ihn alle. Selbst sein Schwiegersohn, der Tierarzt Dr. Hans-Joachim von Lehn, holte sich hin und wieder Rat bei ihm.
Der Fahrer des Viehwagens trat so plötzlich auf die Bremse, dass Alexander nicht nur aus seinen Gedanken gerissen wurde, sondern mit dem Kopf etwas unsanft an die Scheibe stieß. Der Vorwurf blieb ihm jedoch im Halse stecken, als er den Jungen bemerkte, der einfach auf die Straße gelaufen war. Jetzt stand er mit erschrocken aufgerissenen Augen einen Meter vor der Kühlerhaube.
Alexander beugte sich aus dem Fenster. »Da haben wir noch einmal Glück gehabt. Warum hast du es denn so eilig?«
Verstört blickte der Kleine zurück zum Bahnhof, wo ein Personenzug gerade die Station verließ.
»Hast du jemanden abholen wollen?« Alexander nickte dem Jungen aufmunternd zu.
Der Junge antwortete nicht. Er drehte sich um und hastete davon.
Kopfschüttelnd sah Alexander ihm nach, und Janosch meinte brummend: »Chef, Zeit wird’s.« Er deutete auf den Lastzug, der schon bereitstand.
»Du hast recht wie immer. Ihr ladet die Pferde aus, und ich kümmere mich inzwischen um die Papiere.« Alexander sprang aus dem Wagen und ging mit elastischen Schritten auf das Bahnhofsgebäude zu. Daher bemerkte er nicht, dass der Junge zurückgekommen war. Er stand am Gehweg. Als der Viehwagen sich in Bewegung setzte, lief der Junge hinterher.
Der Fahrer fuhr nun nahe an die Rampe heran. Der Marktflecken Bachenau hatte eine kleine Bahnstation, trotzdem verlud Alexander von Schoenecker seine Pferde oder andere Produkte des Gutes stets hier und nicht in der nahen Kreisstadt Maibach. Alle kannten und verehrten den großen, schlanken Mann, der für jeden ein nettes Wort fand.
Unbemerkt vom alten Janosch, der eben den Pferden gut zuredete, war der Junge wieder herangekommen. Er stand hinter einem Strauch und verschlang den ehemaligen ungarischen Pferdehirten mit seinen Blicken. So etwas hatte er noch nie gesehen.
Für einen Fremden war Janoschs Anblick auch etwas ungewohnt. Allein die Koteletten und der hängende Lippenbart waren sehenswert, aber da war noch seine Kleidung. Janosch trug eine weiße Leinenhose, ein hochgeschlossenes Leinenhemd und schwarze Schaftstiefel. Diese Tracht wurde ergänzt durch eine dunkle Weste und einen niedrigen schwarzen Filzhut.
Kein Wunder, dass der kleine Junge vor Staunen den Mund nicht mehr zubrachte. Fasziniert starrte er durch das Blätterwerk, wobei er vor Aufregung an den Fingernägeln kaute. Der Mann kommt sicher von weit her, dachte er. Nachdenklich kräuselte er die Stirn. Ob er den Alten um Rat fragen sollte? Papi hatte ihm zwar verboten, fremde Männer anzusprechen, aber irgendjemanden musste er doch um Rat fragen. Wo sollte er sonst seine Mami suchen? Bis vor Kurzem hatte er gar nicht gewusst, dass er auch so eine liebe, gute Mami hatte. Er hatte nur immer deutlicher gefühlt, dass die Mami, bei der er wohnte, ihn nicht lieb hatte.
Bei diesem Gedanken stiegen dem Jungen Tränen in die Augen. Aber auch in Janoschs dunklen Augen standen jetzt Tränen. Die Stute, die er am Halfter hielt, tänzelte unruhig. Fragend sahen ihre großen Augen ihn an. Jetzt wieherte sie. Vorwurfsvoll, wie es Janosch schien.
Traurig lehnte Janosch sein Gesicht an das Fell des Pferdes. »Ich kann nichts machen«, beteuerte er treuherzig. »Aber du wirst viele Preise gewinnen, und ich werde stolz sein.« Er holte ein blütenweißes Taschentuch hervor und schnäuzte sich heftig.
»Janosch, beeile dich! Der Waggon steht schon bereit«, rief ein Arbeiter.
»Ich komme schon«, brummte der Alte und gab der Stute einen zärtlichen Klaps. »Ich weiß, du wirst es gut machen.«
Da die Stute nicht so recht wollte, wie sie sollte, hatte Janosch nur Augen und Ohren für sie. Den Jungen, der zögernd hinter ihm stehen geblieben war, beachtete er nicht.
Der Kleine biss sich auf die Lippen, gab sich aber dann sichtlich einen Ruck. Schließlich musste er seine Mami finden. »Was machst du da?«, fragte er und zupfte den alten Janosch an seiner Weste.
»Die Pferde müssen weg. Ich mich muss beeilen.« Während Janosch die Stute mit der rechten Hand festhielt, schob er den Jungen mit der linken etwas beiseite. Er lächelte dabei aber so gutmütig, dass der Kleine sich erneut ein Herz fasste.
»Wo wohnst du? Du bist sicher sehr gescheit.« Bewundernd ließ der Junge seinen Blick über den ehemaligen Pferdehirten gleiten.
Janosch grinste. Listig zwinkerte er dem Jungen zu. »Wenn du Zeit hast, erzähle ich dir nach der Arbeit eine Geschichte. Ich erzähle den Kindern oft Geschichten vom schönen Ungarnland.«
Janosch dachte dabei natürlich an die Kinder von Sophienlust. Es war für sie ein Festtag, wenn sie mit dem alten Janosch um ein Lagerfeuer sitzen und seinen Erzählungen lauschen konnten.
»Fein, ich warte.« Begeistert sprang der fremde Junge in die Höhe. »Ich habe viel Zeit«, versicherte er dann ernst. Er hätte gern noch einiges gefragt, aber der alte Janosch hatte sich bereits wieder seinem Pferd zugewandt.
Seufzend sah der Kleine dem alten Mann nach. Er hatte ein großes Problem, das für seine sechs Jahre kaum zu bewältigen war. Konnte er diesem Mann trauen? Wenn er wirklich so viele Geschichten wusste, dann wusste er sicher auch, wo seine Mami war. Und er, Thomas Leyer, hatte beschlossen, nicht ohne sie zu seinem Papi zurückzukehren. Die andere Mama konnte man dann ja wegschicken, denn seine Mami würde Oliver sicher genauso lieb haben wie ihn.
Ja, es war ein schwieriges Problem. Thomas Leyer hatte lange darüber nachgedacht. Er hätte auch sehr gern mit seinem Papi darüber gesprochen, aber dieser war wieder einmal verreist, und keiner hatte ihm sagen können, wann er zurückkommen würde.
Ein herrlicher Geruch stieg dem Jungen in die Nase, bei dem sich sein Magen zusammenkrampfte. Er begriff, dass er Hunger hatte. Sehnsüchtig starrte er hinüber zur Würstchenbude. Er wäre bereits mit einem Brötchen zufrieden gewesen. Ob er hingehen und den Mann hinter der Theke darum bitten sollte?
Zwei Meter von der Bude entfernt blieb Thomas zögernd stehen.
»Wirst du wohl abhauen, du Mistköter«, schrie in diesem Moment der Wurstbudenbesitzer und hob drohend die Hand.
Erschrocken wich Thomas zurück. Erst dann begriff er, dass der Mann nicht ihn, sondern einen kleinen Spitz gemeint hatte. Der Hund wich winselnd zurück, und Thomas senkte beschämt den Kopf. Beide Hände auf den knurrenden Bauch gedrückt, beschloss er, lieber zu hungern, als zu betteln. Entschlossen wandte er der Würstchenbude den Rücken zu und schlenderte über den Bahnhofsplatz, auf eine Bank zu. Dabei kickte er mit der Fußspitze Steinchen vor sich her. Es war eines seiner Lieblingsspiele, vielleicht deshalb so geliebt, weil es seine Mama verboten hatte.
Ruckartig blieb Thomas stehen. Nein, sie war nicht seine Mama, und er wollte sie auch nicht mehr so nennen. Papa nannte sie Mona. Eigentlich ein schöner Name. Viel zu schön für eine Frau, die nicht seine Mama war und ihn auch nicht lieb hatte.
Tiefes Mitleid mit sich selbst überfiel Thomas. Beinahe hatte er wieder zu weinen begonnen. Er war so allein. Wahrscheinlich mochte sein Papi ihn auch nicht mehr. Wäre er sonst fortgefahren?
Zu allem Übel fiel der Blick des Jungen wieder auf die Würstchenbude. Gerade erstand ein dicker Herr eines der begehrten roten Würstchen. Thomas konnte seinen Blick nicht davon lösen. Er sah, wie der Mann hineinbiss. Das Wasser lief ihm im Mund zusammen.
Alexander von Schoenecker verließ eben das Bahnhofsgebäude. Zufrieden stellte er fest, dass zwei Pferde bereits verladen waren. Nur die Stute wollte nicht. Sie zerrte am Halfter und wieherte laut.
Erstaunt beobachtete Alexander den alten Janosch. Was war nur los? Noch nie war ein Pferd unter Janoschs Händen widerspenstig geworden. Irgendetwas schien nicht zu stimmen. Selbst von hier sah er die besorgte Miene des Alten.
Als er über den Bahnhofsplatz ging, fiel ihm der Junge wieder auf. Er sah den sehnsüchtigen Blick, der starr auf die Würstchen, die am Grill schmorten, gerichtet war. Er deutete den Blick auch richtig. Gern hätte er den Jungen noch einmal angesprochen, aber die Stute ging vor.
»Was ist los, Janosch?« Alexander beugte sich über den Huf des Pferdes, den der Ungar gerade in seinen Händen hielt.
»Sie hat Schmerzen. Armes Pferd!« Janosch fühlte mit dem Tier.
Der Gutsbesitzer sah, dass der Alte recht hatte. Der Fuß der Stute war entzündet. So konnte er sie nicht zum Versand bringen.
»Was meinst du?« Fragend sah er den alten Tierpfleger an.
»Es muss geschnitten werden. Dr. von Lehn wird es begreifen müssen.« Jetzt trat ein triumphierendes Funkeln in seine dunklen Augen. »Ich habe es gestern schon gesagt.«
Alexander musste lächeln. Sicher hatte es gestern wieder ein Streitgespräch zwischen dem alten Janosch und seinem Schwiegersohn gegeben. Na ja, man musste es dem Alten lassen. Pferdeverstand hatte er. Und außerdem besaß er viele Wundermittel.
»Gut, dann nehmen wir die Stute wieder mit«, entschied Alexander von Schoenecker.
»Da wird Nick sich freuen. Er ist trotz eigenem Pferd viel geritten auf der Stute.«
»Ich weiß.« Alexander klopfte dem Alten auf die Schulter. »Du warst gegen den Verkauf der Stute, denn du versprichst dir von dem Pferd sehr viel und meinst, Nick sollte es trainieren. Ich werde es mir überlegen. So können wir die Stute jedenfalls nicht verschicken.«
»Sie können mir glauben, es ist ein gutes Pferd«, versicherte Janosch. Dann existierte für ihn nur noch die Stute. Er redete ihr zärtlich zu und trocknete ihr die schweißnasse Stirne. Unter seinen Händen beruhigte sich das Tier bald. Es hörte auf zu zittern und folgte ihm willig zurück zum Viehtransporter.
Die Hände in den Hosentaschen ging Alexander hinterher. Da sah er den fremden Jungen wieder. Jetzt saß er mit gesenktem Kopf auf der steinernen Treppe vor dem Bahnhofsgebäude. Als er das Pferdegetrappel hörte, hob er den Kopf. Beim Anblick des alten Janosch sprang er erfreut auf, ließ aber dann enttäuscht die Schultern hängen, weil ihn der Tierpfleger gar nicht bemerkt hatte.
Kurz entschlossen ging Alexander zur Würstchenbude und erstand eine Grillwurst. »Lass sie dir schmecken!« Mit diesen Worten hielt er Thomas die Wurst hin.
Der Junge bekam ganz große Augen. »Für mich?«, stammelte er. Er streckte bereits die Hand aus, doch dann überlegte er es sich anders. »Das kann ich nicht annehmen. Mein Papi hat es mir verboten.«
Alexander unterdrückte ein Lächeln. Der Kleine gefiel ihm immer besser. »Dein Papi hat recht. Von Fremden soll man wirklich nichts annehmen.«
»Bist du denn kein Fremder?« Auf Thomas’ Stirn bildeten sich nachdenkliche Falten. Die Wurst duftete so gut. Vielleicht konnte man eine Ausnahme machen? Vorsichtig blinzelte er zu dem hochgewachsenen Mann empor.
Alexander lachte. »Du hast recht, ich bin für dich eigentlich auch ein Fremder. Aber da du mir ja beinahe ins Auto gelaufen bist, will ich dich für den Schrecken entschädigen.« Er hielt ihm wieder die Wurst hin.
Erleichtert griff Thomas zu. Heißhungrig biss er in die Wurst. »Danke«, sagte er kauend. »Sie schmeckt prima.«
Wartend blieb Alexander neben ihm stehen.
»Serviette hast du keine?«, fragte Thomas, nachdem er den letzten Bissen hinuntergeschluckt hatte.
»Die habe ich vergessen.«
»Macht nichts. Mama, ich meine, Mona kann es ja nicht sehen.« Er wischte sich die Hände an den Hosen ab.
»Wo ist deine Mama?« Alexander setzte sich einfach zu Thomas auf die Bahnhofsstufen. Um diese Tageszeit war hier nicht viel los.
»Warum willst du das wissen?« Unwillkürlich rückte der Junge etwas weg. »Mit einem Fremden darf ich nicht sprechen.«
»Gut. ich erzähle dir von mir, dann bin ich für dich kein Fremder mehr.« Alexander biss sich auf die Lippen. Wie sollte er nur beginnen? Jetzt bereute er, dass er Hernrik nicht mitgenommen hatte. Sein Sohn hätte eher Kontakt zu dem Kleinen bekommen.
»Warum überlegst du so lange?« Unsicher erhob sich Thomas. »Ich hätte die Wurst nicht annehmen dürfen, aber mein Taschengeld ist bereits alle. Viel war es auch nicht.« Ein schwerer Seufzer stahl sich über seine Lippen. Er hatte sich alles leichter vorgestellt.
»Ich heiße Alexander von Schoenecker und wohne hier in der Nähe auf einem Gut. Es ist sehr schön dort. Vielleicht hast du Lust, dir alles anzusehen? Mein Sohn ist nicht viel älter als du. Er wird dir gerne alles zeigen. Das heißt, wenn deine Mami oder dein Papi nicht auf dich warten.«
»Auf mich wartet niemand.«
»Bist du da ganz sicher?« Alexander legte dem Jungen seinen Arm um die Schultern.
»Ganz sicher.« Der Kleine nickte, aber dabei füllten sich seine Augen mit Tränen. »Meine Mama ist doch nicht meine Mami, und lieb hat mich auch niemand«, fügte er trotzig hinzu.
Also doch, überlegte Alexander. Ich habe mir doch gedacht, dass der Junge von zu Hause ausgerückt ist.
»Wie heißt du?«, fragte er.
Sofort trat Thomas einen Schritt zurück. »Warum willst du das wissen?« Seine ganze Haltung drückte Abwehr aus.
Alexander blieb ruhig. »Ich habe dir gesagt, wie ich heiße. Wenn du mit mir mitkommst, muss ich wissen, wie du heißt. Ich kann doch nicht immer Junge oder Kind zu dir sagen.«
Thomas nickte. Dann streckte er Alexander die Hand entgegen. »Ich heiße Thomas, aber Papi nennt mich Thomy. Du kannst mich auch so nennen.«
»Du hast sicher auch einen zweiten Namen«, versuchte Alexander es erneut.
Wieder nickte der Kleine. »Thomy genügt«, entschied er. »Im Übrigen weiß ich noch nicht, ob ich mit dir mitkomme.«
»Du musst dich aber bald entscheiden.« Alexander eilte zum Viehtransporter. »Meine Leute sind schon fertig. Sie warten nur noch auf uns.«
»Gehört der alte Mann mit den weißen Haaren auch zu deinen Leuten?«, erkundigte sich Thomas.
»Du meinst den alten Janosch? Er ist Tierpfleger und wohnt im Tierheim Waldi & Co.«
»Er wohnt nicht bei dir auf dem Gut?« Enttäuscht wandte Thomy sich ab. »Dann kann ich nicht mit dir mitkommen.«
»Das verstehe ich nicht. Willst du es mir nicht erklären?«
»Ganz einfach. Der alte Mann will mir Geschichten erzählen. Es ist für mich sehr wichtig, denn ich muss herausfinden, wie klug er ist.«
Alexander wusste zwar nicht, was hinter diesen Worten stand, aber er sah eine Möglichkeit, den Jungen doch noch zum Mitkommen zu bewegen. Schnell sagte er: »Janosch fährt mit uns mit, und das Tierheim ist ganz in der Nähe des Gutes. Janosch wird sicher eine Gelegenheit finden, dir Geschichten zu erzählen.«
»Gut, dann komme ich mit.« Sofort lief Thomy über den Bahnhofsplatz, direkt auf den alten Tierpfleger zu. »Du bist der Janosch. Darf ich dich auch so nennen?« Treuherzig sah er zu dem alten Mann empor.
»Alle dürfen mich so nennen. Ich bin nur Janosch, basta! Aber was willst du? Richtig, ich soll dir Geschichten erzählen.«
»Das auch, aber ich will dich etwas fragen. Zu dir habe ich Vertrauen. Zuerst muss ich aber deine Geschichten hören. Ich muss wissen, ob du gescheit genug bist.«
»Das weiß ich nicht. Aber der Chef ist gescheit.« Janosch hatte mit Alexander einen Blick getauscht. »Frage ihn. Er weiß immer eine Antwort.«
»Ich weiß nicht …« Zögernd sah Thomy auf Alexander, der inzwischen herangekommen war.
»Ich werde es mir überlegen. Weißt du, ich habe mir vorgenommen, niemandem zu vertrauen«, sagte Thomy treuherzig. »Das ist aber nicht leicht, wenn man kein Geld hat, dafür aber großen Hunger.« Ohne eine weitere Einladung abzuwarten, kletterte er ins Auto.
Alexander atmete auf und gab das Zeichen zum Aufbruch.
*
Henrik hatte seine Schulaufgaben beendet und lag nun auf der Lauer, um hervorzustürzen, sobald der Viehtransporter in Sicht kam. Dazu hatte er sich seinen Federschmuck auf das widerspenstige Haar gedrückt und sich mit Speer und Bogen bewaffnet.
Jetzt hörte Henrik Motorengeräusch. Er hob den Kopf, legte wie ein Indianer die Hand über die Augen und stieß das dazu passende Geschrei aus. Seinen Tomahawk schwingend stürzte er hinter dem geschnitzten Wegweiser hervor. »Halt! Oder es gibt Tote.«
»Wer ist das?« Aufgeregt beugte sich Thomy vor.
»Das ist mein Sohn Henrik. Du kannst ihn gleich begrüßen.« Alexander öffnete die Autotür. »Roter Bruder, ich habe dir etwas mitgebracht.« Er packte Thomy und stellte ihn auf die Straße.
Einen Moment stutzte Henrik, dann sagte er: »Ich danke dir für das Geschenk. Kannst du mir sagen, was ich damit beginnen soll?«
»Du kannst ihm alles zeigen. Er heißt Thomas. Vielleicht darfst du ihn aber Thomy nennen. Mehr weiß ich nicht von ihm. Sagen wir, in einer Stunde meldet ihr euch bei Mutti.« Ohne die fragenden Augen seines Sohnes zu beachten, ließ er den Wagen weiterfahren. Als er zurücksah, stellte er befriedigt fest, dass seine Rechnung aufging. Henrik sprach bereits in seiner lebhaften Art auf den fremden Jungen ein.
»Ich finde es toll, dass Vati dich mitgebracht hat«, erklärte Henrik eben. »Allein macht das Indianerspiel keinen Spaß.«
»Da hast du recht. Zu Hause muss ich auch immer allein spielen. Deswegen bin ich auch fortgelaufen.«