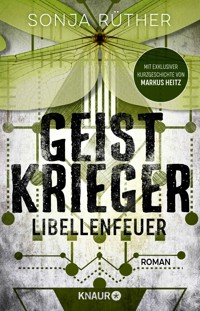4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Markus Heitz, Thomas Finn und andere Autoren lehren uns die Kunst des Schreckens in der Anthologie „Aus dunklen Federn“, jetzt als eBook bei dotbooks. Ein unheimliches Baby, die Macht lang verschwundener Götter und nächtlicher Gesang, der den Tod herbeiruft: Lesen Sie diese düsteren Geschichten auf eigene Gefahr! Aus den dunklen Federn von Thomas Finn und Markus Heitz, Boris Koch, Lena Falkenhagen, Hanka Jobke, Vincent Voss und Sonja Rüther fließt feinster Horror über Schrecken, die sich hinter der Maske des Alltäglichen verbergen. Wenn Sie keine Angst vor einem Karussell haben, das sich bis in alle Ewigkeit drehen wird, und eine Begegnung mit den Todesschläfern aus dem Bestseller „Oneiros“ von Markus Heitz nicht fürchten, heißen wir Sie herzlich Willkommen. Aber sagen Sie nicht, wir hätten Sie nicht gewarnt ... Jetzt als eBook kaufen und genießen: Die Horror-Anthologie „Aus dunklen Federn“ mit den blutigen Handschriften von Thomas Finn, Boris Koch, Markus Heitz, Sonja Rüther und vielen anderen. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag. JETZT BILLIGER KAUFEN – überall, wo es gute eBooks gibt!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 350
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein unheimliches Baby, die Macht lang verschwundener Götter und nächtlicher Gesang, der den Tod herbeiruft: Lesen Sie diese düsteren Geschichten auf eigene Gefahr! Aus den dunklen Federn von Thomas Finn und Markus Heitz, Boris Koch, Lena Falkenhagen, Hanka Jobke, Vincent Voss und Sonja Rüther fließt feinster Horror über Schrecken, die sich hinter der Maske des Alltäglichen verbergen. Wenn Sie keine Angst vor einem Karussell haben, das sich bis in alle Ewigkeit drehen wird, und eine Begegnung mit den Todesschläfern aus dem Bestseller »Oneiros« von Markus Heitz nicht fürchten, heißen wir Sie herzlich Willkommen. Aber sagen Sie nicht, wir hätten Sie nicht gewarnt …
Bei dotbooks veröffentlichte Sonja Rüther bereits die Thriller »Blinde Sekunden« und »Tödlicher Fokus«, die Horror-Story »Eine Spur aus Frost und Blut« sowie die von ihr herausgegebene Anthologie »Aus dunklen Federn 2«, in der neben ihr auch Autoren wie Markus Heitz, Kai Meyer, Boris Koch und Thomas Finn ihre schwärzesten Seiten zeigen.
***
Lizensierte eBook-Ausgabe Dezember 2014
Copyright © der Originalausgabe © 2014 Briefgestöber, Buchholz/Nordheide. Die Nutzung der einzelnen Texte erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Autoren. Das Copyright der einzelnen Texte liegt beim jeweiligen Autor.
Copyright © der eBook-Ausgabe 2014 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung eines Bildes von shutterstock/Alex Malikov
ISBN 978-3-95520-442-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Aus dunklen Federn« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Aus dunklen Federn
mit den blutigen Handschriften von Markus Heitz, Tom Finn, Boris Koch, Lena Falkenhagen, Sonja Rüther, Hanka Jobke und Vincent Voss
herausgegeben von Sonja Rüther
Inhalt
Vorwort
Hanka Jobke DER RUMMEL
Boris Koch KEINE SIEBEN TAGE
Sonja Rüther O TANNENBAUM
Markus Heitz EXEMPLUM
Lena Falkenhagen ALLES GANZ NORMAL
Thomas Finn BITTERE WAHRHEIT
Hanka Jobke MENSCHLICHES VERSAGEN
Vincent Voss FARBEN DES FRÜHLINGS
Vincent Voss DESTRUENTEN
Markus Heitz FRÄULEIN ANGSTFREI
Sonja Rüther WALPURGIA
Die Menschen hinter den Geschichten
Lesetipps
Vorwort
Warum eine Anthologie? Warum gerade Horror? Und was hat das alles mit mir zu tun? Dazu muss ich zunächst sagen, was ich an Anthologien besonders schätze: Die Vielfältigkeit des Gesamtwerks.
Was von außen gern mal wie eine zufällige Zusammenstellung unterschiedlicher Geschichten mehr oder weniger bekannter Autoren aussieht, ist die Einladung, sich kurzweilig auf unterschiedliche Ideen, Schreibstile und Stimmungen einzulassen.
Gäbe man sieben Autoren ein einziges Schlagwort als Thema für die Geschichten, bekäme man sieben vollkommen unterschiedliche Texte zurück. In diesem Fall war es kein Schlagwort, sondern die Genrevorgabe: Horror.
Wer wie ich als Kind Wundertüten liebte und auch als Erwachsener einen erhöhten Pulsschlag verzeichnet, wenn etwas geheimnisvoll und überraschend ist, versteht sicherlich meine Faszination für das Untergründige, das Mysteriöse, den Alptraum und – Anthologien.
Und genau das hat diese Anthologie auch mit mir zu tun. Als Herausgeberin, Verlegerin und Autorin genieße ich die Freiheit, ein solches Projekt auf meine eigene Weise umzusetzen. Das fing bereits bei der Auswahl der Autorinnen und Autoren an. Markus Heitz ist mein ältester Freund in dieser Runde und gern auch mein kreativer Sparringspartner, wenn neue Ideen in den Ring steigen.
Im Zuge der Workshops, die ich in meinem Kreativhof (www.ideenreich-kreativhof.de) jährlich anbiete, lernte ich durch Markus vor drei Jahren Thomas Finn kennen, der von Beginn an als Dozent dabei ist. Als Teilnehmer war damals auch Vincent Voss dabei, der inzwischen einige Veröffentlichungen vorzuweisen hat. Im letzten Jahr ergänzten Sina Beerwald und Boris Koch das Dozenten-Team, von denen ich Letzteren für die Anthologie begeistern konnte.
Lena Falkenhagen gehört zu den Personen, denen ich eine Zeitlang immer wieder zufällig begegnet bin. Ihr Roman für die Justifiers-Reihe hat mir sehr gefallen, also bekam auch sie eine Einladung. Und natürlich durfte Hanka Jobke nicht fehlen. Als Lektorin arbeitet sie generell zwar eher im Hintergrund, aber für mein Hörgeschichtenprojekt 2013 (gratis auf www.briefgestoeber.de zu finden) konnte ich sie schon einmal zum Schreiben einer Kurzgeschichte verführen. Ihr sterbender Nachbar hat mir so gut gefallen, dass ich diesmal unbedingt etwas ganz Böses von ihr haben wollte.
Die Geschichten in dieser Anthologie sind so unterschiedlich wie die Personen, die sie verfasst haben. Von ganz grauenhaft bis subtil schrecklich und unheimlich lustig ist alles dabei. Ich freue mich sehr, dass fast alle Wunschkandidaten meiner Einladung gefolgt sind und sich in diesem teils fremden Genre austobten. Mir hat es Spaß gemacht, über die Geschichten zu diskutieren, sich auf neue Ideen und Arbeitsweisen einzulassen – und natürlich auch etwas beizusteuern.
Ich freue mich, dass diese Anthologie zeitgleich als Druckausgabe bei Briefgestöber und als eBook-Ausgabe bei dotbooks erscheint – einem jungen eBook-Verlag, dessen Entwicklung ich vom ersten Moment an mit Begeisterung verfolge.
Ich bedanke mich bei allen beteiligten Autorinnen und Autoren, Timothy Sonderhüsken, Beate Kuckertz und bei Euch, lieben Leserinnen und Lesern, die Ihr ein Exemplar erworben habt.
Eure
Sonja Rüther
Hanka Jobke DER RUMMEL
Der Rummel liegt zwischen Fluss und Eisenbahnbrücke.
Grau ist das Wasser, grau sind die Schienen, und grau ist das Wetter, welches über der Festwiese liegt wie ein altes Mottentuch.
Die Lichter der Fahrgeschäfte blinken vergeblich in den Dunst, denn da ist kein Auge, sie zu spiegeln. Die animierenden Aufrufe vom Band erreichen kein Ohr. Der Geruch verbrannter Mandeln stört keine Nase, und niemand steigt über die herabgefallenen Glühweinbecher. Zwischen aufgerissenen Losen liegen leblose Enten aus Plastik. Sie schauen die Flucht zwischen den Buden hinab, zum Ende des Platzes, wo sich das Kettenkarussell noch dreht. Unablässig quietschen die Aufhängungen am Drehkranz. In verzweifelter Gleichförmigkeit werfen sich die Sitze in das umgebende Grau, in einem hängt unbemerkt ein kleiner Körper. Die dünnen Arme in den Ketten verknotet, fliegt das Kind Runde um Runde.
Boris Koch KEINE SIEBEN TAGE
Der Gesang prasselte wie Regen gegen das geschlossene Fenster.
Martin wurde aus dem Schlaf gerissen und schnappte nach Luft. Er war sicher, einen Alptraum gehabt zu haben, aber er konnte sich nicht an ihn erinnern. Er atmete schnell, als wäre er gerannt.
Da erst hörte er den Gesang. Traurig und klagend drang die Stimme ins Zimmer. Sie war voller Schmerz und fern und doch so nah, als würde Martins Mama auf der Bettkante sitzen und ihm ein Schlaflied singen. Eine Stimme, die ihm unter die Haut kroch und ihm Angst machte, obwohl sie hell und klar war wie die einer Märchenprinzessin.
Martin verstand kein Wort von dem, was sie sang, denn keines schien deutsch zu sein, nur irgendwie so ähnlich. Auch kannte er die Melodie nicht, sie klang ganz anders als alles, was im Radio lief. Dennoch hätte er beinahe mitgesummt.
»Der Himmel weint«, sagte Oma Marie immer bei Unwetter, und daran musste er plötzlich denken, obwohl es nicht regnete, schon seit Tagen nicht.
Martin wollte Licht machen, aber er wagte es nicht, die Hand auszustrecken. Sein Blick huschte durchs Zimmer. Niemand war hier, er war allein. Nur sein Stoffmeerschweinchen, das er zum Kicken im Zimmer verwendete, lag auf dem Boden. Martin hatte ihm nie einen Namen gegeben.
Die Stimme sang weiter und weiter, es gab keine Strophen, keinen Refrain und kein Ende. Martin bekam eine Gänsehaut, und sein Inneres wurde zusammengeknüllt wie altes Papier. Er biss sich auf die Lippe und ballte die Faust, aber es half nichts: Er begann zu weinen. Wütend presste er sein Gesicht ins Kissen, um das Schluchzen zu ersticken. Er wollte nicht, dass seine Eltern ihn hörten, er war fast zehn und kein Mädchen. Nach einer Weile liefen die Tränen nur noch stumm, und er drehte sich auf die Seite, die Decke bis über den Hals gezogen.
Lautlos öffnete sich die Zimmertür. Martin rührte sich nicht. Er schloss die Augen fast vollständig. Durch die Wimpern konnte er sehen, wie ein Kopf durch den Türspalt gesteckt wurde. Es war seine Mama, und sie sah lange zu ihm herüber. Er blieb stocksteif liegen.
Draußen sang die Frau noch immer. Warum brachte sie keiner zum Schweigen? Bestimmt durfte sie das nicht. Würde er nachts so einen Lärm machen, wäre sofort ein Erwachsener da und schrie: »Ruhestörung!«
»Martin?«, flüsterte seine Mama.
Er reagierte nicht.
»Martin?«, wiederholte sie noch einmal.
Er unterdrückte den Impuls, ihr zu antworten. Sein Körper kribbelte vor Anstrengung, ruhig zu liegen.
Langsam zog seine Mama den Kopf wieder zurück und schloss die Tür. Martin streckte die Beine und öffnete die Augen.
Der Gesang drängte weiter gegen das Fenster wie eine Flut. Martin hatte Angst, die Scheibe würde wie in einem Zeichentrickfilm knacken und in tausend nutzlose Splitter zerbersten, die auf ihn niederregneten und ihn aufschnitten. Er rutschte ganz an den hinteren Rand des Bettes, bis er an die Wand stieß.
Obwohl er kein Wort verstand, wusste er, dass die Stimme von schlimmen Dingen sang. Er hielt sich die Ohren zu, doch es half nichts, die Stimme fand ihren Weg in seinen Kopf und in sein Herz. Sie riss alle seine Gedanken und Gefühle an sich.
Irgendwann – viel, viel später in der Nacht – verstummte die Stimme. Draußen in der Nacht herrschte völlige Stille. Doch in Martins Kopf hielt der klagende Gesang an, ein schneidender Ohrwurm, der sich tief in sein Gehirn gebohrt und dort festgebissen hatte. Martin wollte ihn mit einem schönen Lied vertreiben, aber ihm fiel keines ein, nur sinnlose Fetzen: Zeilen ohne Reime und Bruchstücke von falschen Melodien. Er vergrub den Kopf unter dem Kissen, und es dauerte ewig, bis er wieder einschlief.
***
Als Martin erwachte, lag das Kissen auf dem Boden, und er hatte die Stimme noch immer im Kopf. Doch sie war leise, draußen sangen Vögel, und es schien die Sonne. Er erinnerte sich auch wieder an die Titelmelodie der Drei ??? und andere Lieder. Summend stand er auf, fünf Minuten bevor der Wecker läuten würde, und riss die Vorhänge zur Seite. Der Himmel war strahlend blau. Martin rannte die Treppe nach unten.
»Wie hast du geschlafen?«, fragte seine Mama und sah ihn durchdringend an.
»Gut«, antwortete er, weil man das so sagte. Fast hätte er erzählt, dass er von lautem Gesang geweckt worden war, aber dann hätte er erklären müssen, warum er sich schlafend gestellt hatte, und das wollte er nicht. Er verspürte nicht die geringste Lust, über die Stimme zu reden, deren Echo noch immer durch seinen Hinterkopf hallte.
»Schön.« Seine Mama lächelte, strich ihm über den Kopf und machte die Milch für seinen Kakao warm. Ihre schmale Hand zitterte, und sie hatte dunkle Augenringe, als hätte sie nicht viel geschlafen. Die langen blonden Haare waren nachlässig zusammengebunden.
Im Radio liefen Nachrichten, aber seine Eltern drehten sie nicht lauter wie sonst. Sein Vater wirkte angespannt und trank den Kaffee im Stehen. Dann wischte er sich einmal über den Schnauzbart, schob die Brille mit dem Zeigefinger die Nase hinauf und zog die Krawatte fest.
Mit ernster Miene sagte er zu Martin: »Man steigt zu keinem Fremden ins Auto, das weißt du?«
»Ja, ich weiß.« Das hatten sie ihm schon tausend Mal gesagt.
»Ich meine es ernst, hörst du?«
Martin nickte. Ganz hinten in seinem Kopf klagte die Stimme aus der Nacht.
»Gut.« Er boxte Martin spielerisch gegen die Schulter und küsste Mama schnell auf den Mund. »Viel Spaß in der Schule.«
Dann ging er zur Arbeit.
Zehn Minuten später wurde Martin von Kuhni abgeholt, und sie gingen gemeinsam zur Schule. Kuhni war der Stärkste in der Klasse und sein bester Freund, obwohl ihre Väter sich nicht besonders leiden konnten. Sie waren beide Stürmer in der E-Jugend und legten sich gegenseitig die Tore auf, während die Väter nur die Tore ihrer Söhne zählten.
Auf dem Weg in die Schule trat Kuhni gegen jeden dritten Zaun und schrie: »Scheiß Italiener!«
Es war der 14. Juli 1982, und Deutschland hatte drei Tage zuvor das WM-Finale verloren.
»Scheiß Zoff!« Martin trat gegen einen anderen Zaun. Er hatte nichts gegen den italienischen Torhüter, im Gegenteil, er mochte seinen Namen sogar. Dino Zoff war ein super Name, aber es war auch super, gegen einen Zaun zu treten, und dafür musste man eben jemanden beschimpfen.
»Scheiß Rossi!« Kuhni war wieder dran.
»Scheiß Tardelli!«
»Scheiß Altobelli!«
»Scheiß Zoff!« Martin fiel kein anderer Italiener mehr ein, also begann er wieder von vorn.
Beim nächsten Zaun wurden sie jedoch von einem wütenden Bauern erwischt. Er stank nach Alkohol und spuckte einen großen weißen Speichelbatzen nach ihnen. Verdutzt wichen sie zurück. Ein Erwachsener, der spuckte? Was war da los? Sie rannten davon und lachten, bis sie die Schule erreichten. Für eine Weile hatte Martin den Gesang in seinem Hinterkopf vergessen.
In der Pause ging er mit Kuhni hinter das Schulhaus, um einen Tennisball gegen die Wand zu kicken. Sie achteten nicht auf ihre Umgebung, und plötzlich stand Christian aus der Sechsten, der bullige Sohn des Mayr-Bäckers, bei ihnen. Er baute sich vor Martin auf und trat ihm mit dem Knie in die Eier. Martin krümmte sich vor Schmerz. Grob stieß ihn Christian gegen die rauhe Wand und trat ihm noch mal in die Eier. Martin keuchte und jaulte und versuchte, sich zu schützen. An Gegenwehr dachte er nicht, alles ging so schnell, und Christian war viel größer.
Aber Kuhni dachte an Gegenwehr, er dachte immer an Gegenwehr. Mit einem Wutschrei sprang er Christian in den Rücken und klammerte sich an seinen Hals. Sofort waren Christians Freunde Alex und Michl da und zerrten Kuhni weg. Martin verstand es nicht, die beiden waren sonst netter als die anderen Großen und ließen sie meist mitbolzen.
»Was hat er euch denn getan?«, rief Kuhni und versuchte, sich loszureißen.
Lehrer kamen hier hinten selten vorbei.
»Nichts«, erwiderte Alex, der seinen rechten Arm gepackt hatte.
Martin hielt sich die Unterarme vors Gesicht und drehte den linken Oberschenkel vor seine schmerzpochenden Eier. Christian stieß ihn wieder an die Wand, Martins Hinterkopf knallte gegen den rauhen Putz.
»Was soll das dann?« Kuhni wand sich weiter im Griff der Älteren, aber Alex und Michl waren zu stark.
»Sein Opa ist krank«, sagte Alex.
»Was?«, rief Martin. Was hatte das mit ihm zu tun?
»Halt’s Maul!« Christian drückte ihn noch einmal gegen die Wand, schwächer diesmal, dann ließ er von ihm ab. Mit den Händen in den Taschen trottete er davon. Im Vorbeigehen rempelte er Thomas an, der mit einem blauen Auge in die Schule gekommen war.
»Was sollte das jetzt?«, fragte Martin, die Hände auf die Knie gestützt. Er spuckte aus, der Speichel war nicht blutig.
»Vergiss es.« Kuhni legte ihm den Arm um die Schulter. »Vergiss es einfach. Der Christian ist ein Arschloch.«
Nach der Pause hatten sie Religion. Martin und Kuhni steckten die Köpfe zusammen und beschimpften Christian leise. Sie wünschten ihm die Beulenpest an den Hals, stinkenden Augeneiter und ständigen Dünnschiss bis an sein Lebensende, dass er für alle Zeiten mit einer Plastiktüte am Arsch herumlaufen musste, wenn er mal vom Klo herunterwollte. Bei der Vorstellung musste Kuhni laut lachen.
Plötzlich war Pfarrer Scherer bei ihnen, die dicken Wangen aufgeplustert, das Gesicht rot bis zur Halbglatze hinauf. Wenn es ihm zu viel wurde, zog er Schüler an den Haaren.
»Nur die unartigen, nur die unartigen«, betonte er immer gegenüber den Eltern, und die glaubten ihm. Er war der Pfarrer, er durfte nicht lügen. Diesmal zog er jedoch nicht nur, er packte Kuhni hinter den Ohren am Schopf und riss ihn vom Stuhl. »Sei endlich still!«
Der Stuhl fiel polternd um.
»Au!« Kuhni strampelte mit den Beinen und schlug mit den Händen nach dem Griff des Pfarrers.
»Still, hab ich gesagt!« Schnaufend schleifte Pfarrer Scherer ihn durchs halbe Klassenzimmer. Dabei stieß Kuhni mit dem Knie gegen Evas Pult und fluchte.
»Was hab ich gesagt?« Unerbittlich zerrte Pfarrer Scherer ihn weiter, bis vor zur Tafel. Er atmete heftig, das weiße Hemd war ihm aus der Hose gerutscht, und er stopfte es mit der Linken wieder hinein. Dann erst ließ er Kuhni los. »Was hab ich gesagt?«
Schweigend rappelte sich Kuhni auf und schlich zurück auf seinen Platz. Er gab keine Antwort, der Pfarrer gab ihm Strafarbeiten.
Die ganze Stunde sagte Kuhni nichts mehr, und Martin wagte nicht, ihn anzusprechen. Nur kurz murmelte er: »So ein Arschloch.«
Um Kuhnis Mundwinkel zuckte ein Grinsen, er hatte es gehört. Mit dem Bleistift schrieb er auf sein Löschblatt: Wunschbrunnen. Mit guten Münzen.
Martin nickte.
Und so holte er Kuhni nach dem Mittagessen ab. Der war wieder mal nicht im schmutzig grünen Haupthaus seiner Eltern, sondern im kleinen Nebenhaus bei seinem Opa. Im Stall schimpfte lautstark eine Kuh, die Schwalben stürzten von hoch oben herab in die geöffneten Fenster.
»Wo wollt ihr hin?«, fragte Kuhnis Großvater und zwinkerte Martin zu. »Ein paar Mädchen nachsteigen?«
»Nein!« Martin lachte. Er mochte den alten Herrn Kuhn, er ließ ihn manchmal mit dem Traktor fahren, wenn er auf dem Feld half.
»Zum Spielplatz«, log Kuhni.
»Gut«, sagte sein Opa. »Aber fahrt nicht auf der Straße. Auf dem Gehweg ist es sicherer.«
Sie versprachen es und radelten los. Am Spielplatz hielten sie nur kurz an und sammelten Thomas auf, weil der ein blaues Auge hatte und nicht nach Hause wollte. In seinen Speichen klemmte ein abgegriffenes Eichelass, und Martin ärgerte sich, dass er keine Karte hatte. Kuhni hatte zwei Joker.
Gemeinsam fuhren sie weiter zu den nächsten Bahngleisen, die in zehn Kilometern Entfernung durch den Wald führten. Sie nahmen gekieste Waldwege, weil sie da alle drei nebeneinander Platz hatten. Unterwegs redeten sie weder über das Auge noch das nächtliche Singen noch über Christian. Sie alberten herum und lachten, und Martin freute sich über jeden Vogelgesang. Die Luft unter den Bäumen war kühl und voll und lebendig. Manchmal hoben sie die Vorderräder an und schauten, wer am weitesten auf dem Hinterrad fahren konnte. Dabei riss sich Martin fast das hintere Schutzblech an einer vorstehenden Wurzel ab.
Irgendwann erreichten sie die Unterführung, wo der Waldweg den Bahndamm kreuzte. Sie warfen ihre Räder zu Boden und durchwühlten ihre Geldbeutel und Hosentaschen nach jedem Zehnerle darin. Zehnerle – Groschen – brachten am meisten Glück, das wusste jeder. Zusammen besaßen sie elf Stück. Elf war eine gute Zahl, auch wenn sie ungerade war.
Sie stiegen zu den Gleisen hinauf. Sorgfältig legten sie die Münzen nebeneinander, sechs auf die Schiene auf ihrer Seite, fünf auf die andere. Dann setzten sie sich an die Böschung gleich neben der Unterführung und warteten.
»Wisst ihr, wann der nächste Zug kommt?«, fragte Thomas.
»Die fahren einmal in der Stunde«, sagte Kuhni.
»Mann, das kann dauern.« Thomas löste einen faustgroßen Granitbrocken aus dem Gleisbett und warf ihn hinab.
»Ich komme weiter«, rief Kuhni, packte ebenfalls einen Brocken und schleuderte ihn zwischen die Bäume. Mit einem dumpfen Geräusch versank er im weichen Waldboden.
Martin wog einen Brocken in der Hand, holte weit aus und kam nicht weit. Er traf gleich den ersten Baum, eine fette Eiche. Rindenstücke spritzten ab.
Kuhni und Thomas lachten, aber Martin lächelte nur. Ab jetzt zielte er nur noch auf die Bäume. Die Weite war ihm egal, sollten die anderen doch ihren Wettkampf austragen. Er wollte Rinde spritzen sehen, Wunden in Bäumen aufreißen. Leise summte er das Lied der Stimme vor sich hin.
»Was ist das?« Kuhni sah ihn misstrauisch an.
»Ich weiß nicht«, sagte Martin schnell. »Hab ich im Radio gehört.« Und hastig sang er: »Drah di net um, der Kommissar geht um.«
Kuhni kniff die Augen zusammen, aber Thomas fiel sofort mit ein: »Drah di net um …«
Und dann sangen sie lauthals zu dritt.
»Drah di net um.«
Steine flogen in den Wald.
»Der Kommissar geht um.«
Rinde spritzte.
Wunde um Wunde wurde in die ersten Bäume gerissen. Auch die anderen zielten längst auf die Stämme.
»Stopp!« Kuhni rannte zu den Bäumen hinab und zog sein Taschenmesser, das er immer bei sich hatte.
Es war das alte Messer seines Opas, und die Klinge war matt und fleckig. Trotzdem war sie scharf und länger als die der Schweizer Offiziersmesser, die alle anderen Kinder besaßen.
Kuhni ritzte in die Rinde: Der Kommissar war da.
Dann ging das Messer reihum, und jeder schnitt irgendwelche Worte und Initialen in die Bäume. Schließlich kratzte Martin ein Kreuz ins Holz. Er machte beide Balken breit und tief.
In dem Moment rauschte hinter ihnen ein Güterzug mit dunklen Kesselwagen voller Öl oder Gas vorbei. Sie rannten die Böschung halb hoch und warteten den letzten Wagen ab, dann sprangen sie auf die Gleise und suchten fieberhaft nach ihren Münzen. Sie fanden nur noch drei, alle anderen waren von den Stahlrädern zu weit fortgerissen worden. Drei waren genug, für jeden eine.
Mit den Münzen in der Hosentasche radelten sie zurück, um sie in den Brunnen vor Waldkirchen zu werfen. Plattgedrückte Zehnerle waren ideal zum Wünschen.
»Ich wünsch mir eine Burg«, rief Thomas unterwegs. »Mit Waffenkammern und Verliesen.«
»Du darfst dir nichts wünschen, was du dir auch kaufen kannst«, sagte Kuhni.
»Aber ich kann mir keine Burg kaufen«, sagte Thomas. »Die kostet bestimmt eine Million.«
»Mehr«, sagte Martin. »Viel mehr.«
»Da siehst du. Also kann ich mir keine Burg kaufen.«
»Aber du könntest. Wenn du das Geld hättest.«
»Ich hab’s aber nicht. Darum geht’s doch.«
»Nein. Was man kaufen kann, ist ausgeschlossen. Der Brunnen behandelt Reiche und Arme gleich.«
Martin dachte, dann könnte er ja auch Armen wie Reichen eine Burg beschaffen. Dann würde er sie auch gleich behandeln.
Thomas fragte: »Darf ich mir dann wünschen, reich zu sein?«
»Nein. Du darfst dir Gesundheit wünschen und so.«
»Aber ich bin gesund! Warum soll ich mir das wünschen?« Sein Veilchen war dunkel und dick, aber das würde von allein verheilen. Das tat es immer.
»Dann wünsch dir doch, der beste Gitarrist der Welt zu werden«, schlug Martin vor. »Dann wirst du auch stinkreich.«
»Aber ich will kein Musiker werden. Auf keinen Fall!«
»Und du darfst niemandem verraten, was du dir wünschst«, warnte ihn Kuhni. »Sonst geht es nicht in Erfüllung.«
Also sprachen sie nicht mehr über ihre Wünsche. Weil sie aber an ihre Wünsche dachten, sprachen sie erst einmal gar nicht. Stattdessen sangen sie laut: »Der Kommissar geht um.«
Es war jedoch nicht laut genug, um die Stimme in Martins Kopf zu übertönen. Auch wenn er sie kurz vergaß, sie war immer da. Und mit ihr ein Echo der Angst und inneren Leere der vergangenen Nacht.
Aber nicht mehr lange, dachte Martin. Er würde sie einfach fortwünschen.
***
Der Wunschbrunnen war kaum größer als Martins altes aufblasbares Planschbecken. Er bestand aus groben, hellgrauen Steinen und hatte weder Verzierungen noch ein Dach. Er stand auf der freien Fläche vor der kleinen Marienkapelle, ein kleines Stück außerhalb von Waldkirchen. Die Kapelle wurde kaum noch genutzt, und die Sonne stand inzwischen so tief, dass der Schatten der umstehenden Buchen auf ihn fiel. Die Jesusfigur am Kreuz neben der Kapellentür hatte den Kopf von dem Brunnen abgewendet.
»Weil das Wünschen was Heidnisches ist, sagt meine Oma«, erklärte Thomas, als sie ihre Räder abstellten.
»Quatsch«, sagte Kuhni. »Der hält den Kopf auf fast jedem Kreuz so schief.«
»Weil er stirbt«, vermutete Martin. »Da hängt der Kopf eben einfach so runter.«
»Wisst ihr, was komisch ist?«, fragte Thomas. »Balken kommen immer aus einer Zimmerei, und Joseph ist der einzige Zimmermann in der Bibel. Vielleicht hat er die Balken für das Kreuz seines Sohnes gemacht?«
»Quatsch!« Kuhni schubste ihn zur Seite. »Damals gab’s viel mehr Zimmermänner!«
»Aber es könnte sein«, beharrte Thomas.
»Warum sollte er das tun?«, fragte Martin. »Jesus war sein Sohn! Wer hilft anderen, den eigenen Sohn zu töten?«
Thomas zuckte mit den Schultern. »Vielleicht wusste er nicht, wofür die Balken waren. Er hat einfach nur geliefert.«
»Quatsch«, sagte Kuhni noch einmal und ging zum Brunnen hinüber. Zwei Meter vor ihm drehte er sich um und tippelte das letzte Stück rückwärts. Er atmete tief durch und warf seine Münze mit der rechten Hand über die linke Schulter ins Wasser. Lautlos murmelte er dazu Worte. Dann kam er zurück, ohne noch einmal hinter sich zu sehen. Man durfte seinem Wunsch auch nicht nachblicken.
»Ich als Zweiter!« Thomas sprang zum Brunnen und vollführte das gleiche Ritual. Er hielt sogar die Augen geschlossen, und sein Wunsch dauerte länger.
Als Letzter stellte Martin sich an den Brunnen. Sein Blick fiel auf den gekreuzigten Jesus, der dem Brunnen wie er den Rücken zuwandte. Vielleicht wandte er sich gar nicht ab, sondern hatte sich nur etwas wünschen wollen, doch keine Münze besessen.
Unsinn, dachte Martin, das ist nicht der echte Jesus, nur eine Figur. Und der echte hatte keine Wünsche, denn er sagte: Nicht mein Wille, sondern deiner geschehe.
Martin schloss die Augen, um sich auf seinen Wunsch zu konzentrieren. Seine Hand war feucht, er hatte Angst, die Münze am Brunnen vorbeizuschmeißen, und schlurfte rückwärts, bis seine Fersen den Stein berührten. Umdrehen durfte er sich nicht. Dreimal atmete er tief durch, dann warf er das Zehnerle über seine Schulter.
Ich wünsche mir, dass die Stimme aus meinem Kopf verschwindet.
Platsch. Er hatte getroffen.
Für immer.
Als er zu den anderen zurückkehrte, sang die Stimme weiter ihr Klagelied. Jetzt, da er nach ihr lauschte, sogar noch deutlicher als vor dem Wunsch.
»Wie schnell erfüllen sich die Wünsche?«, fragte er Kuhni.
»Nicht sofort«, sagte der. »Mehr weiß keiner.«
Sie warteten noch einen Moment, bis sie erneut zum Brunnen rübergehen konnten, ohne ihre Wünsche zu gefährden.
Im Brunnen lagen zahlreiche Münzen, nicht nur Zehnerle. Und nicht alle waren platt gefahren. Dabei wusste doch jeder, dass normale nicht einmal halb so gut halfen. Niemand fischte die Münzen heraus, weil er nicht den Wunsch eines anderen sabotieren wollte. Ganz unten waren sogar noch einige Reichsmark und Groschen, hatte Martins Vater erzählt, weil sich damals die Leute viel gewünscht hatten.
Ganz am Rand lag ein Hamster mit gebrochenem Genick. Er war noch nicht lange tot.
»Der sieht aus wie der vom Christian«, sagte Thomas.
»Hamster sehen alle gleich aus«, sagte Kuhni.
»Nein.«
»Doch. Der sieht auch aus wie der von meiner Schwester.«
»Ist das ihrer?«, fragte Martin.
Kuhni zuckte mit den Schultern. »Glaub nicht.«
»Wer wirft denn einen Hamster in einen Wunschbrunnen?« Martin konnte den Blick nicht von dem toten Tier abwenden. Es war, als würde die Stimme in seinem Kopf über dessen Tod klagen.
»Vielleicht, weil es ein größeres Opfer ist als eine Münze?«
»Aber man muss eine Münze reinwerfen! Das ist die Regel.«
Thomas nickte. »Der sieht auch nicht aus, als wäre er vom Zug platt gefahren worden. Der Hamster hilft überhaupt nicht.«
Martin sah Kuhni an, doch der zuckte nur wieder mit den Schultern und biss sich auf die Lippe. »Dürfte nicht.«
»Und warum tut das dann einer?«
»Das ist doch klar, oder?«, sagte Kuhni. »Warum kommt man heute denn her?«
Martin sah ihn unsicher an. Was war heute? Er wusste es nicht, und Kuhni sagte nichts. Man durfte nicht über seine Wünsche reden. Was musste man sich heute wünschen?
»Oder es ist einfach ein Tierquäler«, sagte Thomas.
»Idiot!« Kuhni schubste ihn vom Brunnen weg.
Und dann kamen ältere Jungs und vertrieben sie.
***
»Wo warst du?«, schrie Martins Vater und riss ihn am Kragen ins Haus. Sein Griff war grob, er bebte am ganzen Körper.
»Ich …«
»Hausarrest!« Er schlug Martin die flache Hand auf den Hintern, was er noch nie getan hatte. Noch nie hatte Martin ihn so wütend erlebt.
»Aber ich war doch nur spielen mit Kuhni!« Martin warf die Zimmertür hinter sich zu. Das war ungerecht, er hatte nichts getan.
Als die Tür sich Augenblicke später vorsichtig wieder öffnete, schrie er: »Raus! Das ist mein Zimmer!«
»Martin …« Seine Mama trat ein.
Sein Vater rief ihr hinterher: »Er ist zu jung!«
»Ich war nur spielen!« Martin saß auf dem Bett und verschränkte die Arme. »Seit wann ist man dafür zu jung? Höchstens zu alt!«
Seine Mama lächelte. »Wir haben uns nur Sorgen gemacht.«
»Warum?«
»Weil ihr in den Wald gefahren seid. Alex hat euch gesehen.«
Petzer, dachte Martin.
Seine Mama setzte sich auf die Bettkante. Martin rückte ein Stück weg, doch ihre Hand erreichte ihn trotzdem. Sie strich ihm über den Kopf.
»Aber ich darf in den Wald.«
»Normalerweise schon.« Sie seufzte. »Aber nicht, wenn sie gesungen hat.«
Martin starrte sie an. »Wer?«
»Du hast sie gehört.« Seine Mama strich ihm noch einmal über den Kopf.
Martin nickte stumm, obwohl es keine Frage gewesen war. Er sagte nicht, dass er sie noch immer hörte.
»Alle in Waldkirchen können sie hören. Und immer, wenn sie singt, muss in den nächsten sieben Tagen einer sterben.«
Martin presste die verschränkten Arme fester an seinen Körper. »Wer?«
Seine Mama schüttelte den Kopf. In ihren Augen schimmerten Tränen, die sie rasch fortblinzelte.
»Ist sie böse?«, fragte er.
»Nein. Sie warnt uns. Sie warnt uns seit Jahrhunderten. Sie ist eher eine gute Fee oder ein Engel, auch wenn sie uns Leid verkündet. Doch sie hilft uns, damit klarzukommen, damit … umzugehen.«
Martin nickte.
Sie zog ihn an sich. »Keine Angst, dir passiert nichts, das lassen wir nicht zu. Hörst du? Keinem Kind passiert etwas, das lassen wir nicht zu.«
Dankbar schmiegte sich Martin an sie, auch wenn er es nicht ganz begriff. Aber er glaubte ihr, und nur darauf kam es an.
Später sang seine Mama ihm ein Schlaflied. Er schloss die Augen, ohne wegzudämmern. Sanft küsste sie ihn auf die Stirn und ging aus dem Zimmer. Er dachte an den toten Hamster und lauschte auf die Stimme in seinem Kopf. Er versuchte, in den fremden Worten einen Namen zu entdecken. Doch er verstand nichts.
Kuhni hatte gesagt, heute sei klar, was man sich wünschte. Aber Martin hatte sich nur die Stimme fortgewünscht. Was, wenn alle anderen Waldkirchner sich gewünscht hatten, nicht zu sterben? Würde es dann ihn treffen, weil er als Einziger übrig war?
Nein. Der Hamster gilt nicht.
Und seine Mama hatte versprochen, dass ihm nichts geschah. Sie hatte es versprochen. Er streichelte das Stoffmeerschwein, das er mit ins Bett genommen hatte, und drückte es an sich.
***
Am nächsten Morgen fragte Martin beim Frühstück: »Als letztes Jahr Oma gestorben ist, warum hat sie da nicht gesungen?«
»Das war Krebs«, sagte seine Mama. »Sie singt nur, wenn jemand gewaltsam durch andere zu Tode kommt. Nicht bei Krankheiten. Verstehst du?«
Martin nickte ernsthaft.
»Und nicht bei Selbstmord«, ergänzte sein Vater, der auch heute den Kaffee im Stehen trank. »Das ist ganz wichtig. Niemand kann die anderen durch Selbstmord freikaufen.«
»Herbert!«
»Du warst der Meinung, er ist alt genug.«
»Aber nicht für alles. Und … er konnte sie hören. Dann muss er doch erfahren, wer sie ist.«
»Wofür bin ich nicht alt genug?«, fragte Martin, aber seine Eltern wollten ihm nichts weiter sagen.
»Beeil dich mit dem Frühstück«, sagte seine Mama. »Du kommst sonst zu spät.«
In der Schule schubste Christian wieder Jüngere herum, und er war nicht der Einzige. Alle waren nervös, angespannt, aufgekratzt. Martin, Kuhni und Thomas blieben zusammen und da, wo sie von den Lehrern gesehen wurden. Religion hatten sie zum Glück erst wieder nächste Woche. Manche Kinder fehlten, aber keiner glaubte ernsthaft, dass sie eine Sommergrippe hatten.
»Ängstliche Eltern«, flüsterte Kuhni, und Martin nickte.
Die letzte Stunde fiel aus, weil sich der Gemeinderat zu einer nicht öffentlichen Sondersitzung traf.
»Wollen wir am Nachmittag kicken?«, fragte Kuhni, als sie zusammenpackten.
»Ich hab Hausarrest«, sagte Martin.
»Dein Vater ist im Gemeinderat, der merkt das nicht.«
»Aber meine Mama.«
»Ich komme mit«, sagte Thomas. »Meinen Eltern ist es egal, ob ich heimkomme oder nicht.«
Martin verabschiedete sich und trottete nach Hause. Seine Mama hatte ihm leckere Pfannkuchen mit Zucker und Marmelade gemacht und spielte mit ihm den ganzen Nachmittag, bis sein Vater heimkam. Er sah erschöpft aus, sein Gesicht schien aus verwittertem Granit zu sein.
Martins Mama ließ den Playmobil-Indianer los. »Habt ihr etwa schon was beschlossen?«
Sein Vater nickte langsam.
»Und was?«
Er schüttelte den Kopf und sah für einen Augenblick zu Martin. Eine stumme Begründung, warum er nichts sagte.
»Ich geh ja schon.« Martin stand trotzig auf und wollte aus dem Wohnzimmer stapfen.
Sein Vater hielt ihn an der Schulter fest und sagte: »Bleib da. Ich darf eh nicht darüber reden.«
Trotzdem fragte seine Mama: »Habt ihr schon … beides beschlossen?«
Wieder nickte sein Vater.
»Und beim zweiten …« Mit einem Blick auf Martin brach auch sie ab.
Er nickte wieder, ganz langsam nur. Seine Mundwinkel zuckten, und für einen Moment schloss er die Augen, als könnte er so die Traurigkeit in ihnen verbergen.
Sie schniefte, dann riss sie sich zusammen.
»Was ist los?«, fragte Martin. Hielten sie ihn für blind? Er sah doch ihre stummen Blicke.
»Nichts, Schatz«, sagte seine Mama, als könnte sie noch irgendeine Fassade aufrechterhalten. »Dir wird nichts passieren.«
»Und dir und Papa?«
»Auch nichts.« Sie sah ihn mit großen Augen an. »Natürlich nicht.«
»Stimmt das?«, fragte Martin seinen Vater, weil er es von beiden hören wollte.
Der nickte erneut. Aber sein Gesicht blieb traurig.
***
Es war noch nicht richtig dunkel, als Martin ins Bett geschickt wurde. Das letzte Sonnenlicht kroch unter den gestreiften Vorhängen hindurch und fiel vor dem Fensterbrett zu Boden. Martin war hellwach und fragte sich, wo dort draußen diese Fee lebte, die so furchterregend sang. Ob irgendwer sie schon mal gesehen hatte, oder ob sie sich niemandem zeigte. So wie Gott.
Durch die Tür hörte er seine Eltern reden, und er schlich barfuß hinaus, um sie zu belauschen. Was hatte sein Vater mit dem Gemeinderat beschlossen?
Vorsichtig kauerte sich Martin hinter den breiten Pfosten des Treppengeländers und linste hinab. Seine Eltern standen im Flur, und sein Vater trug ein schwarzes Hemd, schwarze Hosen und die schwarzen Bergstiefel. Obwohl sie flüsterten, konnte Martin das meiste verstehen.
»Wann holt dich der Doktor ab?«, fragte seine Mama.
»Um halb zehn. Er klingelt nicht, um …«
»Gut.« Sie seufzte. »… wirklich das Richtige?«
»Das weißt du doch. Nur so kann es keine Kinder treffen. Niemand sollte seine Kinder beerdigen müssen.«
»Ja. Nur dass du …«
Martin biss sich auf die Lippe. Er zitterte plötzlich. Was bedeutete das alles? Würde seinem Vater doch etwas geschehen? Warum trug er Schwarz wie auf einer Beerdigung? Er wollte aufstehen und laut »Nein!« schreien. Nein! Weiter konnte er nicht denken. Der Gesang der Fee drängte sich aus dem Hinterkopf nach vorn.
»Es ist noch nicht klar, wer von uns sieben …«, sagte sein Vater. »Keiner wird es erfahren. Auch du nicht.«
Was bedeutete das nun wieder? Wenn ihm etwas geschehen würde, würde man es doch erfahren, oder?
»Ich werde es merken«, widersprach seine Mama.
»Du wirst es nur ahnen, nicht wissen.«
»Doch.« Sie nickte und presste die Faust gegen den Mund. Dann nuschelte sie etwas, das Martin nicht verstand.
Sein Vater warf sich einen langen schwarzen Umhang über, und Martin hätte fast vor Erleichterung gelacht. Es sah aus wie Fasching. Dann stülpte er sich eine schwarze Kapuze über den Kopf, die alles bis zu den Schultern bedeckte und oben spitz zulief. Es gab nur zwei winzige Löcher für die Augen. Sein Vater sah nun aus wie ein Henker und stapfte mit schweren Schritten aus dem Haus. Seine Eltern küssten sich nicht zum Abschied wie sonst, und jeder Gedanke an ein Lachen war in Martin gestorben.
Seine Mama sank auf dem ausgetretenen Läufer zu Boden und schluchzte. Dabei presste sie die Faust fest auf die Lippen, als könnte sie so alle Geräusche erdrücken.
Leise schlich Martin in sein Zimmer zurück. Schnell kletterte er unter den Vorhang auf das Fensterbrett. Von da konnte er den Großteil des Hofs überblicken, doch seinen Vater sah er nicht. Inzwischen war es dunkel geworden, aber aus den Fenstern fiel Licht nach draußen. Sein Vater musste noch in der Tür direkt unter dem Fenster stehen, im toten Winkel. Irgendwann würde Martin in der Laibung einen Spiegel anschrauben, wie er es in dem Handbuch für Detektive gesehen hatte.
Es dauerte nicht lange, bis Dr. Weiher auftauchte. Er trug seinen weißen Kittel wie sonst nur in der Praxis und war zu Fuß. Mit ihm kamen vier Gestalten in schwarzen Umhängen und mit Kapuzen, wie Martins Vater sie übergezogen hatte. Der trat unter Martins Fenster hervor und zu ihnen. Sie nickten sich kurz zu, keiner gab dem anderen die Hand. Gemeinsam gingen sie langsam weiter, sein Vater reihte sich vorn rechts ein.
Martin musste wissen, wohin sie gingen, was sie tun würden. Was sein Vater tun würde. Es war mehr als brennende Neugier, er hatte Angst um ihn. Ohne darüber nachzudenken, zog er seine Jeans über die Schlafanzughose, das kurzärmelige Oberteil sah aus wie ein T-Shirt. Hastig riss er das Fenster auf und kletterte hinaus. An den Rahmen geklammert, ließ er die Füße so weit wie möglich hinabbaumeln und sich dann fallen. Barfuß prallte er auf den Boden und rollte sich ab. Es tat kaum weh. Er hatte sich eine dicke Hornhaut antrainiert, indem er ständig barfuß über scharfkantigen Splitt lief.
Sofort schnellte Martin wieder hoch und lief los. Er musste sich beeilen, um seinen Vater nicht aus den Augen zu verlieren. Solange er ihn sehen konnte, hatte er keine Angst, denn dann war er ja nicht allein. Nur ein kurzes Stück musste er rennen, dann war er nah genug an der Gruppe. Die schwarzen Kapuzen gingen im Gleichschritt. Martin erkannte seinen Vater nicht, aber er wusste, es musste die Gestalt rechts vorne sein. Die rechts hinten auf keinen Fall, sie war zu klein.
Außer ihnen war niemand auf der Straße, und die Straßenlampen brannten heute nicht. Das wenige Licht kam vom Mond, den Sternen und aus den erleuchteten Fenstern. Bei den meisten waren jedoch Vorhänge und Jalousien zugezogen. Martin hielt sich dicht an den Zäunen und Hecken, huschte möglichst schnell durch die wenigen Lichtflecken und nahm Verteilerkästen, Laternenpfähle und Mülltonnen als Deckung. Manchmal tauchte er in Einfahrten, um nicht gesehen zu werden. Wenn er auf einen spitzen Stein trat, gab er keinen Laut von sich.
Die Kapuzenträger sahen sich nie um, sie schritten stumm voran. Zweimal hielten sie an und sammelten schweigend jeweils eine weitere vermummte Gestalt ein. Während sie sich begrüßten und neu formierten, ließ Martin seinen Vater keinen Moment aus den Blick, um ihn nicht zu verlieren. Es war wie bei dem Hütchenspiel, und Martin musste sich höllisch konzentrieren. Sein Vater marschierte jetzt ganz sicher links in der zweiten Reihe. Es waren sieben schwarze Kapuzen.
Martin achtete auf seinen Vater und darauf, nicht erwischt zu werden, und plötzlich erreichten sie den Hof von Kuhnis Eltern. Feierlich bog die Prozession von der Straße, und Martin fragte sich, ob sich auch Kuhnis Vater der Gruppe anschließen würde. Doch niemand wartete mit schwarzer Kapuze, die meisten Fenster waren dunkel.
Martin schlich in die offene Einfahrt gegenüber und kauerte sich hinter den anschließenden Zaun. Von hier konnte er alles überblicken.
Der Doktor läutete beim Nebenhaus, in dem Kuhnis Großeltern wohnten. Das war anders als bisher. Hatte sein Vater nicht auch von sieben gesprochen?
Sekundenlang reagierte niemand. Drei Kapuzenträger drängten sich am Doktor vorbei und klopften laut gegen die Tür.
Im Haupthaus nebenan ging das Licht an, oben in Kuhnis Zimmer. Sein Kopf erschien im Fenster, und Martin konnte von seinem Platz aus nur ahnen, wie sein Mund einen Schrei formte. Dann war der Kopf wieder verschwunden.
Das Lied der Fee drängte sich hartnäckig in Martins Bewusstsein, und Angst kroch ihm unter die Haut. Es half nicht mehr, dass er seinen Vater ganz in der Nähe wusste, er sah ja nur schwarze Kapuzen.
Im Nebenhaus öffnete sich langsam die Tür, und Kuhnis Oma trat in den Rahmen. Sie stand aufrecht und reckte den Kopf in die Höhe, aber sie zitterte. Die Kapuzen schüttelten stumm den Kopf. Trotzig blieb sie stehen, aber zwei Gestalten drängten sie zur Seite und holten Kuhnis Opa aus dem Haus. Er war bleich und wirkte viel älter als noch gestern.
Die Tür vom Haupthaus wurde aufgerissen, und Kuhni stürmte heraus. »Nein, nicht ihn!« Seine Stimme überschlug sich, der Schrei war voller Verzweiflung.
Martin wurde von Angst gebeutelt. Er begriff, aber er wollte nicht begreifen. Seine Hand krallte sich in den Zaun. Das konnte nicht sein.
Kuhnis Opa schüttelte nur den Kopf.
Zwei Kapuzen stellten sich Kuhni stumm in den Weg. Kuhni warf sich ihnen mit erhobenen Armen entgegen.
»Das ist nicht gerecht!«
Die Kapuzen waren größer und stärker, andere sprangen ihnen zu Hilfe, und sie hielten ihn fest. Martin wusste nicht mehr, welche Kapuze sein Vater war, er hatte ihn im Getümmel verloren.
Kuhni schrie und trat und schlug um sich. Die Kapuzen sagten noch immer nichts. An ihren Stimmen hätte man sie erkannt, doch so wusste niemand, wer gekommen war, Kuhnis Opa abzuholen.
»Es ist okay«, krächzte der mit bebender Stimme.
Kuhnis Oma schluchzte und hielt sich am Türrahmen fest. Sie hielt den Kopf nicht mehr erhoben.
»Nein, ist es nicht!«, brüllte Kuhni. »Du bist gesund! Du bist doch gesund!«
Kuhnis Vater kam aus dem Haus. Er trug nur ein Unterhemd und hatte die Arme vor der Brust verschränkt. Er knurrte die Kapuzen an: »Lasst meinen Sohn los. Ich kümmer mich um ihn.«
»Aber, Papa …«, fing Kuhni an.
Die Kapuzen ließen ihn los, standen aber weiterhin zwischen ihm und seinem Opa.
»Kein Aber! Ab ins Haus.«
»Nein!«
»Was hab ich gesagt?« Sein Vater löste die Arme voneinander und machte einen Schritt auf ihn zu.