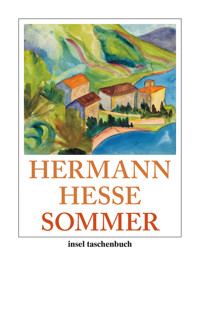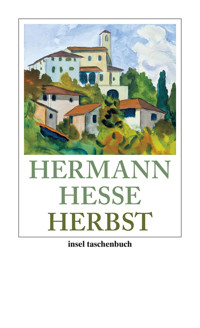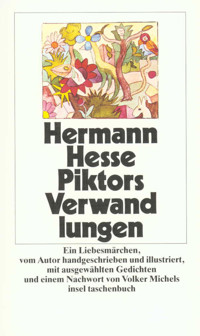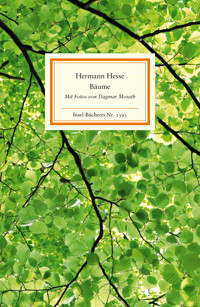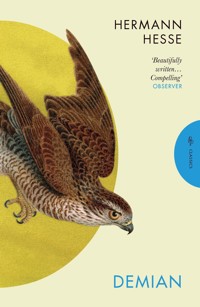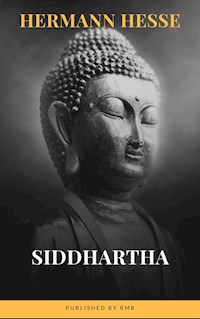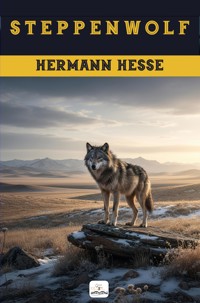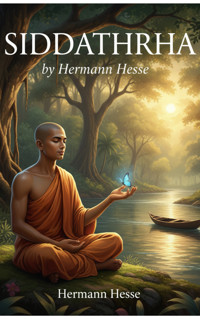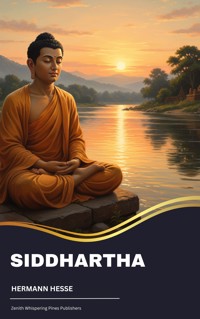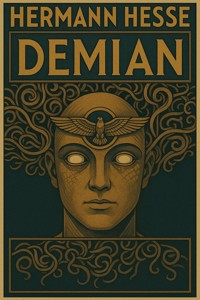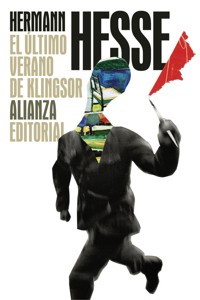Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Phoemixx Classics Ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Aus Indien Hermann Hesse - Überdrüssig der allzulangen Seßhaftigkeit und Gebundenheit an sein erstes, 1907 in Gaienhofen am Bodensee gebautes Haus, begab sich Hesse, damals 34jährig und Vater von drei Kindern, auf die längste Reise seines Lebens. Das Reiseziel war Indien, das Land, in welchem seine Großeltern und Eltern zur Verbreitung des protestantischen Christentums missioniert hatten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nachts im Suezkanal
S
eit zwei Stunden wird das Schiff von Moskitos belästigt; es ist sehr warm, und die heitere Stimmung vom Mittelmeer hat sich erstaunlich rasch verloren. Viele fürchten sich einfach vor der berüchtigten Hitze im Roten Meer, die meisten aber kehren von kurzen Ferien und Besuchen in der Heimat zurück oder reisen zum ersten Male aus, und für sie alle beginnt jetzt erst die Heimat unterzusinken, und mit der Wärme, dem Sand, den frühen Sonnenaufgängen und den Moskitos überfällt sie der Osten, den sie alle nicht lieben, obwohl und weil sie draußen ihr Geld verdienen. Nur im Restaurant der zweiten Klasse zechen ein paar junge Deutsche, die meisten Passagiere sind schon in den Kabinen. Der ägyptische Quarantänebeamte, der unser Schiff seit Port Said begleitet, marschiert mißmutig auf und ab.
Ich versuche zu schlafen. Ich lege mich in meiner winzigen Kabine aufs Bett, über mir saust schnurrend der elektrische Fächer, im kleinen runden Fensterloch steht schwarzblau die heiße Nacht, knisternd singen die kleinen Stechmücken. Seit Genua war keine Nacht an Bord so still; seit Stunden kein Geräusch als das leise Rollen eines Eisenbahnzuges von Kairo, der auf dem langen öden Damm auftauchte, in gespenstischer Nachbarschaft vorüberschnob und wunderlich im Röhricht der weiten kahlen Landschaft verschwand.
Noch ehe der Schlummer kommt, schreckt mich das plötzliche Verstummen der Maschine auf. Wir liegen still. Ich kleide mich an und gehe aufs Oberdeck. Ringsum eine unerhörte Stille, vom Sinai her kommt der abnehmende Mond, bleiche Sandhaufen schauen im vorübergleitenden Blick entfernter Scheinwerfer tot und glanzlos auf, im unendlichen schwarzen Wasserstreifen blinken grelle giftige Reflexe, unterm schweren matten Mond zucken hundert Seen, Sümpfe, Lachen, Binsenteiche gelb und lieblos aus der traurigen Ebene. Unser Schiff fährt nicht mehr, kein Ruf oder Pfiff, es liegt regungslos, verzaubert, aber voll tröstender Wirklichkeit in der Wüste.
Auf dem Hinterdeck treffe ich einen kleinen, eleganten Chinesen aus Schanghai. Er lehnt aufrecht an der Brüstung und verfolgt die Scheinwerfer mit seinen dunklen, klugen Augen, und er lächelt dazu so hübsch wie immer. Er kann das ganze Shi-King auswendig, er hat alle chinesischen Examina gemacht und jetzt auch noch einige englische, er spricht über das Mondlicht über dem Wasser zart und nett in geläufigem Englisch und macht mir Komplimente über die schönen Landschaften Deutschlands und der Schweiz. Es fällt ihm nie ein, China zu rühmen, aber wenn er Lobendes über Europa zu sagen hat, klingt es bei aller Höflichkeit so überlegen, wie wenn der große Bruder nett ist und dem kleineren zu seinen starken Armen gratuliert. Wir wissen alle, daß in China gerade in diesen Tagen die große Revolution neu beginnt, die vielleicht dem Kaiser den Kopf kosten wird, und unser kleiner feiner Mann aus Schanghai weiß sicher weit mehr als wir und ist vielleicht gar nicht zufällig gerade jetzt unterwegs. Aber er ist still und arglos wie ein Berggipfel in der Sonne und strahlt in seiner höflich verschanzten Heiterkeit alle irgend unbequemen Fragen mit einer gewinnenden Sonnigkeit zurück, die uns alle verwirrt und mich entzückt.
Am Ufer erscheint ein lichter kleiner Fleck. Es ist ein weißer Hund, er läuft eine kleine Strecke weit den Strand entlang, streckt den mageren Hals lang aus und schaut zu uns herüber. Aber er bellt nicht. Er schaut eine Weile scheu und still herüber, riecht am trüben Wasser und trabt lautlos davon, immer der schnurgeraden Uferlinie nach.
Der Chinese redet von den europäischen Sprachen, er rühmt die Bequemlichkeit des Englischen und den Wohllaut des Französischen, er bedauert entschuldigend, daß er nur ganz wenig Deutsch und gar kein Italienisch gelernt hat. Er lächelt dazu lieb und wohlgestimmt und folgt mit den feuchten, klugen Augen den Bewegungen der Schiffslichter.
Unterdessen fahren zwei große Dampfer langsam und unendlich behutsam an uns vorüber. Unser Schiff ist am Ufer angebunden. Der große Kanal ist kostbar und gebrechlich und wird wie Gold geschont.
Ein englischer Beamter aus Ceylon tritt zu uns. Wir stehen lange und sehen ins tote Wasser, der Mond beginnt schon wieder zu sinken. Ich habe das Gefühl, ich sei seit Jahren von der Heimat fort. Nichts spricht zu mir, nichts ist mir nah und lieb, nichts tröstet mich als unser gutes Schiff. Die paar Bretter und Klammern und Lichter sind alles, was ich habe, und es macht mich unruhig, nach so viel Tagen plötzlich den vertrauten Herzschlag der Maschine nimmer zu hören und zu spüren.
Der Chinese redet mit dem englischen Beamten über Gummipreise, und ich höre immer wieder das Wort Rubber, das ich vor zehn Tagen noch nicht kannte und das mir jetzt so geläufig ist, das beherrschende Wort des Ostens. Er redet sachlich, hübsch und höflich, und er lächelt immerzu im fahlen elektrischen Licht, wie ein Buddha.
Der Mond hat seinen kleinen Bogen beschrieben, er neigt sich und versinkt hinter den grauen Schutthalden, und mit ihm versinken die hundert kühlen, übelwollenden Blinklichter der Sümpfe und Seen, die Nacht steht dick und schwarz, scharf durchschnitten von den Lichtbahnen der Scheinwerfer, die ebenso unheimlich und lautlos und unendlich geradlinig sind wie der furchtbare Kanal selber.
Abend in Asien
A
bends Ankunft in Penang. Im Eastern and Oriental Hotel (dem schönsten Europäerhotel, das ich auf der hinterindischen Halbinsel traf) ward mir eine fürstliche Wohnung von vier Räumen angewiesen, vor der Veranda klatschte das braungrüne Meer an die Mauer, und im roten Sande standen groß und ehrwürdig die abendlichen Bäume. Die rotbraunen und gelben Segel vieler Dschunken, gebaut wie starksehnige Drachenflügel, leuchteten im letzten Tageslicht, dahinter der weiße Sandstreifen des Penangstrandes, die blauen siamesischen Berge und alle die winzigen, dick bewaldeten Koralleninselchen der wundervollen Bucht.
Nach Wochen eines unbequemen Wohnens in der beängstigend schmalen Schiffskabine genoß ich vor allem eine gute Stunde lang die Weite meiner Räume; ich probierte die ausschweifend bequemen Liegestühle des luftigen Vorzimmers, wo alsbald ein kleiner Chinese mit Philosophenaugen und Diplomatenhänden lautlos Tee und Bananen auftrug, ich badete im Baderaum und wusch mich im Ankleidezimmer. Dann kostete ich im hübschen Speisesaal bei ganz guter Tafelmusik zum erstenmal mit leiser Enttäuschung das üble Essen eines englisch-indischen Hotels. Inzwischen war eine tiefe, schwarze Nacht ohne Sterne heraufgekommen, die großen unbekannten Bäume rauschten wohlig im lauen, schweren Winde, und große unbekannte Käfer, Zikaden und Hummeln sangen, schwirrten und schrien überall heftig mit den scharfen eigenwilligen Stimmen junger Vögel.
Ohne Hut und in leichten Schlafschuhen trat ich auf die breite Straße hinaus, rief einen Rikschamann heran, stieg mit frohem Abenteuergefühl in den leichten Wagen und sprach mit Kaltblütigkeit meine ersten malayischen Worte, welche der flinke, starke Kuli so wenig verstand wie ich die seinen. Er tat, was jeder Rikschamann in diesem Falle tut, er lächelte mir mit seinem guten, kindlich bodenlosen Asiatenlächeln herzlich zu, wendete sich um und lief in frohem Trab davon.
Und nun erreichten wir die innere Stadt, und Gasse für Gasse, Platz für Platz, Haus für Haus glühte in einem erstaunlichen, unerschöpflichen, intensiven und doch wenig geräuschvollen Leben. Überall Chinesen, die heimlichen Herrscher des Ostens, überall chinesische Läden, chinesische Schaubuden, chinesische Handwerker, chinesische Hotels und Klubs, chinesische Teehäuser und Freudenhäuser. Dazwischen je und je eine Gasse voll Malayen oder Klings, weiße Turbane auf dunkelbärtigen Köpfen, blanke, bronzene Männerschultern und stille, ganz mit Goldschmuck behängte Frauengesichter rasch von einer Fackel beleuchtet, lachend oder aufheulend dunkelbraune Kinder mit dicken Bäuchen und wunderschönen Augen.
Hier gibt es keinen Sonntag, hier gibt es keine Nacht; ohne Ende und ohne sichtbare Pause geht die gelassene, gleichmäßige Arbeit weiter, nirgends nervös und übertrieben, überall fleißig und heiter. Klug und geduldig kauert auf hohem Brett der kleine Straßenhändler über seiner Bude, still und würdevoll arbeitet am Rande der brausenden Straße der Barbier, zwanzig Arbeiter klopfen und nähen in der Werkstatt eines Schuhmachers, freundlich breitet ein mohammedanischer Kaufmann auf niederen, breiten Ladentischen seine schönen Tücher aus, die aber fast alle aus Europa stammen. Japanische Dirnen sitzen kauernd am Steinrand der Gosse und girren wie fette Tauben, aus chinesischen Freudenhäusern glänzt golden der wohlbestellte steife Hausaltar, hoch über der Straße in offenen Veranden hocken alte Chinesen mit kühlen Gebärden und heißen Augen beim aufregenden Glücksspiel, andre liegen und ruhen oder rauchen und hören der Musik zu, der feinen, rhythmisch unendlich komplizierten und exakten chinesischen Musik. Köche sieden und braten auf der Gasse, Hungrige speisen an langen Brettertischen gesellig und feinschmeckerisch und sicher für zehn Cents nicht schlechter, als ich im Gasthaus für drei Dollar gegessen habe, Fruchthändler bieten unbekannte Früchte an, phantastische Erfindungen einer müßigen, überreichen Vegetation, kleine Buden haben ihre ärmlichen Güter, eine Handvoll getrocknete Fische oder drei Häuflein Betel, sorgsam mit Kerzen beleuchtet. Hier wandeln im verschwenderischen Licht, das namentlich der Chinese liebt, unverändert alle Gestalten der östlichen Märchen, nur die Könige, Wesire und Henker sind zum Teil verschwunden, gleichwie vor Jahrhunderten arbeitet der geschickte Barbier, tanzt die geschminkte Dirne, lächelt ergeben der Diener und blickt stolz der Herr, wie immer kauern wartend die Träger und Arbeitsuchenden, kauen Betel und erzählen einander Geschichten.
Ich besuchte ein chinesisches Theater. Da saßen still und rauchend die Männer, still und teeschlürfend die Frauen, vor ihrer hohen Empore turnte gefährlich auf schwankem Brett der Teeschenk mit mächtigem Kupferkessel. Auf der geräumigen Bühne saß eine Schar Musikanten, das Drama begleitend und seinen Takt kunstvoll betonend; auf jeden betonten Schritt des Helden fiel ein betonter Schlag der weichtönenden Holztrommel. Es wurde in alten Kostümen ein altes Stück gespielt, von dem ich wenig verstand und nicht ein Zehntel sah, denn das Stück ist lang und wird durch Tage und Nächte fortgespielt. Da war alles gemessen, studiert, nach alten heiligen Gesetzen geordnet und in rhythmischem Zeremoniell stilisiert, jede Gebärde exakt und mit ruhiger Andacht ausgeführt, jede Bewegung vorgeschrieben und voll Sinn, studiert und von der ausdrucksvollen Musik geführt. Es gibt in Europa kein einziges Opernhaus, in dem Musik und Bewegungen des Bühnenbildes so tadellos, so exakt und glänzend harmonisch miteinandergehen wie hier in dieser Bretterbude. Eine schöne, einfache Melodie kehrte häufig wieder, eine kurze, monotone Weise in Moll, die ich mir trotz aller Bemühungen nicht einprägen konnte und die ich später tausendmal wieder hörte, denn es war gar nicht, wie ich meinte, stets dieselbe Tonfolge, sondern es war die chinesische Grundmelodie, deren zahllose Variationen wir zum Teil kaum wahrnehmen können, da die chinesische Tonleiter viel kleiner differenzierende Töne hat als unsre. Was uns dabei stört, ist der allzu reichliche Gebrauch von Pauke und Gong; im übrigen ist diese Musik so fein und klingt abends von der Veranda eines festlichen Hauses so lebensfroh und oft so leidenschaftlich, lustbegierig, wie nur irgendeine gute Musik bei uns daheim es tun kann. Im ganzen Theater war außer der primitiven elektrischen Beleuchtung nichts Europäisches und Fremdes; eine alte, durch und durch stilisierte Kunst schwang ihre alten, heiligen Kreise weiter.
Leider ließ ich mich verführen, danach auch noch ein malayisches Theater zu besuchen. Da prangten grelle, wahnsinnige Kulissen von grotesker Häßlichkeit, von dem Chinesen Chek May in wohlgeglückter Spekulation auf die Affeninstinkte der Malayen gemalt, eine Parodie auf alle Entgleisungen europäischer Kunst, das ganze Theater von einer beiselhaften Drolligkeit und Hoffnungslosigkeit, die nach kurzem, krampfhaftem Lachvergnügen unerträglich wird. In üblen Kostümen spielten, sangen und tanzten malayische Mimen in varieteehafter Weise die Geschichte von Ali Baba. Hier wie später überall sah ich die armen Malayen, liebe, schwache Kinder, rettungslos an die bösesten europäischen Einflüsse verloren. Sie spielten und sangen mit oberflächlicher Geschicklichkeit, neapolitanerhaft heftig und manchmal improvisierend, und dazu spielte eine moderne Harmoniummaschine.
Als ich spät die innere Stadt verließ, klangen und glühten hinter mir die Gassen weiter, noch die halbe Nacht hindurch, und im Hotel ließ ein Engländer zu einsamem Nachtvergnügen ein Grammophon oberbayerische Jodlerquartette spielen.
Spazierenfahren
N
ichts Schöneres als bei gutem Wetter in Singapur spazieren zu fahren! Man nimmt ein Rikschawägelchen, setzt sich hinein und hat nun außer der übrigen Aussicht immerzu den beruhigenden Blick auf den Rücken des ziehenden Kuli, der im Takt seines wiegenden Trabes auf- und niederhüpft. Es ist ein nackter, goldig gelbbrauner Chinesenrücken und darunter ein Paar nackte, starke, athletisch ausgebildete Beine von derselben Farbe, dazwischen eine verwaschene Badehose aus blauem Leinen, deren Farbe mit dem gelben Körper und der braunen Straße und mit der ganzen Stadt und Luft und Welt ganz delikat zusammenklingt. Daß auch die meisten Straßenbilder delikat und harmonisch aussehen, dafür müssen wir ebenfalls den Chinesen dankbar sein, die sich zu kleiden und zu tragen verstehen und deren hunderttausendköpfiges Gewimmel in Blau, Weiß und Schwarz die Gassen füllt. Dazwischen schreiten stolz und heldenhaft mit schwarzbraunen, hageren Gliedern und asketischen Augen hochgewachsene Tamilen und andere Indier, deren jeder auf den ersten Blick wie ein entthronter Radscha aussieht, die aber allesamt, nicht besser als die Malayen, mit negerhafter Hilflosigkeit auf jeden Importartikel hereinfallen und sich kleiden wie Dienstmägde am Sonntag. Man sieht da wunderschöne, dunkle, nobel blickende Menschen genau in denselben schreienden, grellen, schonungslos farbigen Kostümen einhergehen, wie sie etwa auf heimatlichen Maskenbällen von jungen phantasievollen Ladengehilfen getragen werden – wahre Karikaturen von Trachten! Die klugen Kaufleute aus unserem Westen haben die indischen Seiden und Leinen entbehrlich gemacht, sie färbten Baumwolle und druckten Kattune viel greller, viel indischer, jubelnder, wilder, giftiger, als sie je in Asien gesehen worden waren, und der gute Indier samt dem Malayen ist ein dankbarer Kunde geworden und trägt um seine bronzenen Hüften die billigen, farbengrellen Stoffe aus Europa. Zehn solche indische Figuren genügen, um eine belebte Straße farbig unruhig zu machen und in ein Stück unechten „Orient“ zu verwandeln. Aber sie kommen hier nicht auf, sie mögen noch so königlich schreiten und noch so papageienhaft leuchten, sie werden umschlossen und erstickt und still zugedeckt von dem diskreten gelben Volk aus China, das in hundert Straßen dicht und fleißig haust und wimmelt, von der uniformen, ameisenartigen Menge der Chinesen, von denen keiner in Farben schwelgen und seine Person zum König oder Hanswurst herausputzen will, deren unendlicher Schwarm in Blau, Schwarz und Weiß die ganze Stadt Singapur erfüllt und beherrscht.
Den Chinesen verdanken wir auch die langen, ruhigen, wohltuend gleichmäßigen Straßenzüge, wo Haus an Haus blau und bescheiden in der blauen stillen Reihe steht und jedes das andere hält und gelten läßt und hebt, mindestens so fein und diskret wie in Paris. Den Engländern aber verdanken wir die breiten, schönen, reinen, bequemen Wege, die anmutvollen Gartenvorstädte und die herrlichen Baumpflanzungen, die vielleicht das Schönste von ganz Singapur sind.
Da ist gleich vorn am Meere, mitten zwischen den protzigen Gebäuden und weiten, schönen Sportplätzen, die mittags so leer und kahl und unwahrscheinlich groß in der unbarmherzigen Sonne glühen, die mächtige Esplanade, eine fürstlich breite Allee von alten, herrlichen Bäumen, eine immer kühle, immer schattige, ehrwürdige Riesenhalle aus Laub und Ästen. Hier ist es schön am frühen Vormittag zu fahren, wenn über dem glänzenden Meer und über den ungezählten Schiffen und Segeln und schaukelnden Booten die heftige Sonne schräg herabbrennt und hinter Meer und Schiffen und Inseln den ganzen Horizont entlang phantastisch in Form von Türmen und riesigen Bäumen die steilen, weißen Morgenwolken stehen. Und es ist schön am Mittag, wenn ringsum alles in der Hitze kocht und brütet. Da ist die Einfahrt aus der blendenden Glut in diese dunkle Baumkühle nicht anders als der Schritt von einem sommermittäglichen Marktplatz in einen heilig kühlen Dom mit dunkeln Gewölben. Am Abend aber ist das schräg einfallende Licht voll Gold und Wärme, vom Meer weht frisch der duftende Wind, aufatmende Menschen fahren vergnügt in weißen Kleidern spazieren und spielen Ballspiele auf grünen, flachen Plätzen, deren Rasen im Abendlicht edelsteingrün leuchtet. Und nachts, da fährt man in die Esplanade ein wie in eine Zauberhöhle, in den kleinen Lücken zwischen den Baumkronen hängen grünfunkelnd die Sterne, im selben kühlen Feuer schimmern die Schwärme der Leuchtkäfer, und auf dem Meere schwimmt mit tausend roten Augen die geheimnisvolle Lichterstadt der Schiffe.
Ohne Ende sind die Gartenstraßen der äußern Stadt. Da fährst du auf glatten, feinen, äußerst gepflegten Wegen immerzu, und überall zweigen stille Wege ab und führen durch grüne reiche Baumgärten zu stillen, luftigen Landhäusern, deren jedes Heimweh weckt und Glück zu hegen scheint, und über dir und um dich her atmet ruhig und lebendig die wunderbare Baumlandschaft, stundenlang, ein Park ohne Ende, mit Bäumen, die an Eichen und an Buchen, an Birken und an Eschen erinnern, die aber alle ein wenig ausländisch und märchenhaft schauen und größer, höher, üppiger sind als unsere Bäume.
Plötzlich sind wieder Häuser da, man fährt an Werkstätten, Läden und ernsthaftem Chinesenbienenleben vorüber, vergoldetes Porzellan und hellgelbe Messingwaren glänzen in Schaufenstern, fette indische Händler sitzen auf niederen Ladentischen zwischen Haufen von Seidenstoffen oder lehnen neben Schaukasten voll Diamanten und grünen Jettsteinen. Das heftige Straßenleben erinnert wohlig an italienische Städte, entbehrt aber völlig des wahnsinnigen Gebrülls, mit dem in Italien jeder Streichhölzerbub seine Bagatelle ausschreit.
Wieder kommen niedere Häuser, Bäume dazwischen, halbländliche Vorstadtluft, und plötzlich ist man unter Kokospalmen. Niedere Hütten, mit Palmblättern gedeckt, Ziegen, nackte Kinder, ein Malayendorf und, soweit der Blick reicht, tausend und wieder tausend Palmen streng und kahl, darunter flimmernd das weißlichgrüne Tageslicht.
Und kaum hat das Auge sich angepaßt und kaum hat das Bewußtsein mit Genuß den heftigen Kontrast zwischen geradlinig stilisierter Palmenwelt und laubig weicher, wirrer Parklandschaft verzeichnet, da geht alles wankend auseinander, erschrocken fällt der Blick in eine ungeheure Weite, man ist am Meere, an einem ganz neuen, stilleren und weiten Meere mit flachem Palmenstrand und wenig Booten, und hinten im Bogen liegt mit blauen Hügelsilhouetten Insel an Insel, alles überragt und klein gemacht durch die große Form eines chinesischen Segels, das mit hundert feinen Rippen wie ein Drachenflügel in den Himmel sticht.
Augenlust
W
enn aus der Flasche, die mein Boy eben öffnet, ein turmhoher Ifrit emporrauchte und mir die Erfüllung dreier Wünsche gewährte, so würde ich ohne Besinnen sagen: Gesund sein, eine schöne, junge Geliebte bei mir haben und über zehntausend Dollar verfügen.
Alsdann würde ich eine Rikscha nehmen und einen Extra-Rikscha-Kuli für die Pakete und würde in die Stadt fahren, die ersten paar tausend Dollar lose in der Tasche. Ich würde nicht auf die bettelnden Kinder hören, die sich zum Entsetzen meiner Schönen mit dem leidenschaftlichen Ausruf: „O father, my father!“ um mich drängen. Dem kleinen elfjährigen Chinesenmädchen hingegen, das täglich vor den Hotels seinen fliegenden Handel mit Spielsachen betreibt, würde ich einen Dollar schenken. Sie ist, wie gesagt, elf Jahre alt, und ihr Wuchs und Aussehen ist noch weit kindlicher und minderjähriger; dennoch geht sie ihrem Straßenhandel schon seit sechs Jahren nach. Sie hat mir das selbst erzählt, doch würde ich es nicht weiterberichten, wenn nicht ein alter Singapurer es mir bestätigt hätte. Das kleine, schmächtige Mädel hat das süße Kindergesicht, das hübsche Chinesen oft bis zum Alter bewahren, aber sie hat gescheite, kühle Augen und ist vielleicht das hoffnungsvollste und smarteste Chinesenkind von Singapur, was sie auch sein muß, denn es leben seit Jahren fünf Personen von ihrer Arbeit, und ihre Mutter geht, so oft sie kann, Sonntags zum Spielen nach Johore. Die Kleine trägt einen wundervollen Zopf, schwarze, weite Hosen und eine verschossene blaue Bluse, und es wird dem ältesten Überseer nicht gelingen, sie beim Feilschen und Scherzen einen Augenblick in Verlegenheit zu bringen. Leider hat sie noch sehr wenig Kapital und noch keine Marktübersicht, aber das wird kommen, und vielleicht ist es auch reine Klugheit von ihr, daß sie gerade mit Kinderspielsachen handelt, so lange ihr leichtes Kinderfigürchen und ihr glattes Kindergesicht diesen Handel suggestiv unterstützen. Später wird sie mit Gegenständen handeln, die wohlhabende junge Herren brauchen, dann wird sie heiraten und ihr Geschäft in Porzellan, Bronzen und Altertümern machen, und schließlich wird sie nur noch spekulieren und Geld verleihen und die Hälfte ihres Vermögens in ein wahnsinnig luxuriöses Privathaus verbauen, wo in viel zu vielen Zimmern viel zu viele Lampen brennen und wo der riesige Hausaltar von Gold funkeln wird.
Sie soll also ihren Dollar haben, und nachdem sie ihn ohne Erstaunen und ohne vielen Dank eingesteckt hätte, würden wir gegen die High Street hin fahren. Erst würde ich noch in einer Seitenstraße beim besten Rottangflechter halten lassen und für mich und meine Liebste je einige Liegestühle bestellen, die beste Arbeit aus dem fehlerlosesten und biegsamsten Material, jeder Stuhl unsern Körpermaßen bequem angepaßt und mit einem kleinen Teegestell, einem kleinen Bücherkästchen, einem Zigarettenbehälter und spaßeshalber mit einem schönen, feingeflochtenen Vogelkäfig versehen.
In der High Street würden wir zuerst bei einem indischen Juwelier vorfahren. Diese Leute haben zuviel Verbindung mit Europa und verstehen selten mehr, ihre Sachen so naiv und edel zu fassen wie früher, sie arbeiten nach englischen und französischen Dessins und beziehen aus Idar und Pforzheim, aber ihre Steine sind meistens schön, und mit Geduld und Sorgfalt würde ich sicher sein, mindestens ein edles, goldenes Armband mit Rubinen und eine dünne, zarte Halskette mit bleichen, bläulichen Mondsteinen zu finden. Zeit hätten wir ja genug, und die Händler mögen in Asien sein wie sie wollen, jedenfalls ist ihre Zeit und Geduld und Höflichkeit unermessen, und du kannst ruhig zwei Stunden lang einen Laden besehen und nach allen Waren und Preisen fragen, ohne etwas zu kaufen.
Lachend würden wir dann einen chinesischen Laden betreten, wo vorn Blechkoffer und Zahnbürsten, im nächsten Raum Spiel- und Papiersachen, im nächsten Bronzen und Elfenbeinschnitzereien und im hintersten alte Götter und Vasen zu haben sind. Hier dringt der