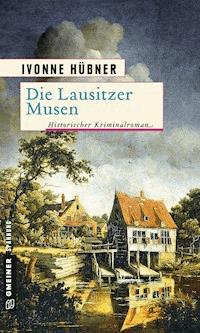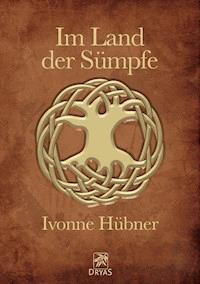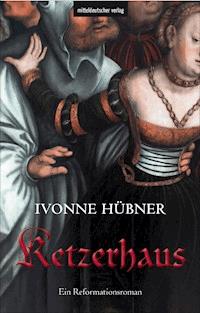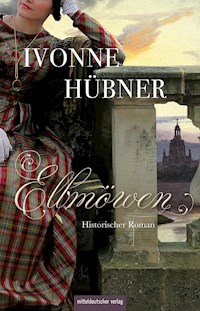18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Du formst das Glas, das Glas formt dich.« Niederschlesien zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Tommys Zuhause ist die Glashütte. Seit seinem fünften Lebensjahr steht er im Dienst der Hüttenherren Seibert. Obwohl die Arbeitsbedingungen unmenschlich sind, scheitern Tommys Versuche, der Hütte den Rücken zu kehren. Nicht zuletzt wegen der Fabrikantentochter Elli Seibert, die ihm immer wieder Halt gibt. In den umstürzlerischen Kriegsjahren, in deren unheilvollen Sog auch die nächste Generation gerissen wird, ringen Elli und Tommy gegen alle Widerstände um ihre Liebe. Ivonne Hübner erzählt die Geschichte einer großen, zerbrechlichen Liebe in düsteren Zeiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 750
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Schlesien, 1905: Tommis Zuhause ist die Glashütte. Seit seinem fünften Lebensjahr steht er im Dienst der Hüttenherren Seibert. Die schwere Arbeit an der Seite seines Vaters, der eintönige Alltag und die strenge Stiefmutter verlangen dem Jungen alles ab. Und dann ist da auch noch Elli Seibert, die Tochter des Hüttenherrn, die ihn immer wieder spüren lässt, dass sie aus völlig verschiedenen Welten kommen. Ihre blonden Zöpfe, die weißen Kleider, ihre Überzeugung, dass ihr die Welt zu Füßen liegen muss. Und doch übt sie eine Faszination auf Tommi aus, die er sich nicht erklären kann. Ein schrecklicher Hüttenunfall ändert alles und knüpft ein unsichtbares Band zwischen ihm und Elli, das ihr Leben für immer verändern wird.
Ivonne Hübner
Aus Salz und Asche
Roman
Meinen Urgroßeltern Willi und Lotte
und meinen Großeltern Werner und Lilo
in liebevoller Erinnerung und Dankbarkeit gewidmet
PrologScherben und Tod
Oktober 2019
Dass mit dem Gelände etwas nicht stimmte, konnte man sehen und riechen. Zuerst war bei Jeschkes die gesamte Südmauer der Scheune um fast einen halben Meter abgesackt. Danach hatte sich ein seltsamer Geruch ausgebreitet. Es war ganz klar, dass mit dem Gelände etwas nicht stimmen konnte. Dieses knotige Unkraut, trotz des kalkhaltigen Bodens. Das sollte dort eigentlich nicht wachsen – und erst dieser Gestank! Im Spätsommer war das passiert, als sowieso fast alles unter Wasser stand. Der Geruch hing über der Aue. Es musste etwas getan werden.
Deshalb setzte man alle möglichen Gerätschaften ein, um herauszufinden, warum Jeschkes Scheune absackte, immer weiter absackte. Selbst den dümmsten Bauern fielen diese hellen Rechtecke auf, die sich deutlich vom Rest der Ödnis, östlich der alten Glashütte, abzeichneten. Sehr deutlich sogar. In eines der Rechtecke ragte Jeschkes Scheune mit der abgesackten Mauer.
Bald sah das Gelände aus wie ein Campingplatz, übersät von Planen und Zelten ohne Böden. Welch eine Aufregung im Dorf, in dem doch sonst nie etwas passierte! Weiße, undurchsichtige und unüberwindbare Wände aus Zeltbahnen wurden um das Flurstück herum aufgestellt. Die Übertragungswagen von Fernsehen und Rundfunk kamen erst nach den Zeitungsfritzen. Landrover und Pick-ups zerfurchten die Ränder der Brache. Ein Imbisswagen stellte sich gleich neben die Zufahrt, ein ziemlich junger Heimatforscher sank bis zum Schaft seiner Stiefel in den Matsch der Reifenspuren. Eine alte Dame im Jogginganzug gesellte sich zu ihm, wohl wissend, dass er ihr alles erzählen würde, was er aufgeschnappt hatte, ohne dass sie ihn hätte ausfragen müssen. Er redete einfach drauflos.
Die alte Dame war früher Sportlehrerin gewesen. Sie war hier geboren worden und würde wohl auch hier sterben. Sie war schon hier gewesen, als die Dorfschule noch keine Kneipe und das Land noch eine saftige Überflutungsfläche war. Sie war schon hier gewesen, bevor Bauer Jeschke expandierte und bevor die Scheune absackte.
Die Dame hieß Stine Domaschek und war eigentlich keine neugierige Person. Doch nun starrte sie geradezu auf die Zeltbahnen. Der Herbstwind zerzauste ihr Haar. Weiße Strähnen peitschten ihr ins Gesicht. Sie wartete, bis sich ihre Nase ans Modrige gewöhnt haben würde, wartete auf einen anderen Geruch. Vielleicht würde er über den Zaun aus Zeltbahnen wehen. Ein Geruch nach heißem Glas und Asche. Unwillkürlich strich sie über den Anhänger ihrer Halskette, ertastete die filigran gearbeitete Rose. Ein altmodisches Stück, kaum größer als ein Daumennagel, aber beständig. Die Kettchen hatten gewechselt, bestimmt schon an die zehn Mal. Der Anhänger aber hatte in all der Zeit nur einmal repariert werden müssen. In den Wirren der Zwanzigerjahre musste das gewesen sein. Stine trug die Kette mit dem Rosenanhänger nur selten. Das Glas in der Bleifassung verströmte beim Anlegen immer nur einen Moment lang ein wenig Kälte, bevor es die Wärme ihrer Haut annahm. Stine war keine Frau, die Schmuck trug. War es nie gewesen. Heute aber hatte sie ihn angelegt. Heute, nach so langer Zeit. Sie strich über den Anhänger. Einige Haarsträhnen verfingen sich im Kettchen. Geduldig stand Stine da und beobachtete die flatternden Zeltbahnen.
Ein junger Polizist, dick eingepackt wie ein kränkelndes Kind, trat aus dem abgesperrten Bereich heraus. Er hielt eine Currywurst in der Hand. Stine wartete, bis der junge Mann aufgehört hatte, in den schwarzen kleinen Kasten an seiner Epaulette zu sprechen. Sie atmete tief durch. Dann fragte sie ihn, ob man in den Hosentaschen der Toten Glasklumpen gefunden habe.
»Glasklumpen?«, fragte der Beamte zurück, schob sich ein großes Stück Wurst in den Mund, schmatzte mit vollen Backen und sah sich verwundert um.
Er dürfe keine Auskünfte die Exhumierung betreffend erteilen. Natürlich nicht.
Wie viele Leichen schließlich geborgen wurden, stand später in der Lokalzeitung. Wie häufig Polizei und Presse bei Stine auf Kaffee und Kuchen einkehrten, sollte nie jemand fragen. Dass ihr die meisten Namen derer, die man ausgrub, noch einfielen, wunderte selbst sie.
I.Feuer und Sand
1905–1918
Vom Bettchen ins Beet
Der übliche muffige Geruch bekam in der Sonnenhitze eine weiche Note. Wenn die Pflänzchen aus ihren Töpfen genommen wurden, tanzten ihre Stängel um die haarigen Unterarme des Gärtners. Die Sonne schien durch die Härchen an den Armen und die Stängel. Eigensinnig wie Glasfäden.
Wenn Tommi sich auf die Zehenspitzen stellte, konnte er die Hügel aus schwarzer Erde auf der Tischplatte erkennen. Krümel blieben an der Stirn des Gärtners kleben, wenn er sich mit dem Arm darüberwischte. Drinnen war es viel heißer als draußen.
»Vom Bettchen ins Beet«, hatte Gärtner Bruno Winkler zu dem Jungen gesagt.
»Vom Rotzlöffel zur linkischen Glasmacherfresse«, zischte seine Frau. Über jede Kleinigkeit konnte Grete Winkler sich aufregen. Am schlimmsten für sie waren Brunos Gemächlichkeit und seine Angewohnheit, mehr Zeit mit seinen Pflänzchen zu verbringen als mit ihr.
Gretes Rockzipfel blieb am Türscharnier hängen. Sie verzog das Gesicht und griff das Ärmchen des Kindes noch fester. Tommi hatte zum Sofa im Anbau gewollt, wo ihm der Gärtner gern zu sitzen erlaubte. Mit strenger Miene stieg Grete über die Schwelle ins Freie, die kleinen Finger jetzt fest in der Faust.
Wind von Osten sauste fast ungehindert durch das karge Buchengeäst. Das Frühjahr 1905 tat sich schwer. Die Winklerin zog den Kopf ein, schlug den Kragen der Kutte hoch. Für jeden ihrer großen Schritte machte Tommi zwei kleine. Er drehte sich immer wieder zum Gewächshaus um.
Vom Bettchen ins Beet. Ob die Pflänzchen dann nicht frören?, hatte der Junge den Gärtner gefragt. Der hatte einige davon in den Kübel unter dem Tisch geworfen. Die mickrigen kämen nicht ins Beet. Ob die nicht noch im Bettchen bleiben könnten? Aber nein, die seien doch zu schwach und würden es nicht schaffen. Wie zu dünnes Glas, das nicht halten würde. Die Schwachen müssten aussortiert werden. So sei das überall.
Grete Winkler sah zu dem Jungen an ihrer Hand hinunter: »Verseuchtes Gesocks!«, knurrte sie Tommi an und zerrte ihn über das buckelige Gelände. Vorbei an der Baugrube, vorüber an Erdhaufen, auf denen der Löwenzahn schon eine Handbreit hochgewachsen war. An den Gleisen spitzte die Frau die Ohren. War das rhythmische Schnaufen einer Dampflok zu hören? Der Trampelpfad führte schnurgerade von der Baustelle über die Schienen direkt zur Arbeitersiedlung. Ausgetreten von all jenen, die sich den Umweg über den Bahnübergang sparen wollten.
Die Ansammlung von Häuschen dahinter konnte kaum als Dorf bezeichnet werden. Allenfalls als Kaff. Man ließ dieses Fleckchen schneller hinter sich, als man seinen Namen aussprechen konnte. Kam man von Norden, musste man das Wasser überqueren, um überhaupt dorthin zu gelangen. Ein trügerisches, gemeines Wasser, ein tückischer Bachlauf, der eigentlich ein Fluss war, der im Spätsommer anschwoll und alles mitnahm, was nicht niet- und nagelfest war.
Von Süden kommend war man noch geblendet von der idyllischen Ortschaft, die man gerade hinter sich gelassen hatte. Nicht wenige, die aus dieser Richtung kamen, glaubten, die letzte Fluchtmöglichkeit, den letzten Abzweig übersehen zu haben und hier, im wohl hässlichsten aller Orte im vergessensten aller Landstriche versehentlich gelandet zu sein. Denn so sah es hier aus: eine eintönige Häuserreihe, bröckeliges Fachwerk mit grauen, löchrigen Strohdächern.
Fragte man die Bewohner dieses Dorfes, wo man sich befand, antwortete der eine: »Im Königreich Preußen«, ein anderer: »In der Oberlausitz« und der Nächste: »In der Provinz Schlesien.« Ein ganz Blitzgescheiter mochte antworten: »In Preußisch-Schlesien«, und einer, der es noch genauer nahm, sagte allenfalls: »Im Bezirk Liegnitz.« In einem aber waren sich alle einig: Man befand sich nicht in Sachsen.
Zu einem der einfachen Häuser mit Strohdach zerrte Grete Winkler nun den kleinen Tommi. Keine dieser Behausungen passte zur anderen, eine jede bestach durch noch mehr Hässlichkeit als die vorherige. Die Gärten ragten nach hinten aufs Feld hinaus, und niemand wusste so richtig, wo der eigene endete und der des Nachbarn begann.
Und auf der anderen Seite der Gleise, von wo die Gärtnerin grimmig das kleine Kind hinter sich herzog, lag die alles überragende Fabrik. Nicht minder hässlich als die Siedlung und doch viel mehr als schlichte Hässlichkeit: Auch Staub und Gestank verbreitete sie – und das Gefühl, in der Falle zu sitzen. Wenn sich tatsächlich einmal jemand in dieses Kaff verirrte – wozu es eigentlich keinen Anlass gab, denn außer fünf qualmenden Riesenschornsteinen und einem Wasserturm gab es hier nichts weiter zu sehen –, dann konnte einem schon das Herz in die Hose rutschen.
Tommi verbarg eine Hand in der Manteltasche. Er konnte das Steinchen klacken hören, das er vor sich herkickte, und behielt das Haus seines Vaters im Auge. Es wurde unaufhaltsam größer.
Dort, wo Grete ihn schweigend ablieferte, zog Tommi die Hand aus der Tasche und streckte sie der Mutter entgegen.
»Machen wir das ins Beet? Aus dem Bettchen ins Beet, Mama?« Als wollte er sie zu etwas Großem überreden.
In der guten Stube schlug die Uhr, begleitet von einem schleifenden Ticken. Hedwig Domaschek ließ das Taschentuch sinken und unterdrückte den Husten. Sie strich ihrem Jungen über das dichte lockige Haar. Dann nahm sie ihm behutsam das schlaffe Pflänzchen aus der Hand.
»Das wird nichts mehr.«
Tommi umschloss das Pflänzchen, das die Mutter auf den Tisch gelegt hatte, behutsam mit beiden Händen und rannte zur Hintertür.
Sie hätte ihn ohnehin nicht aufhalten können.
Hedwig liebte ihn so sehr, dass sie seinem älteren Bruder gegenüber häufig ein schlechtes Gewissen hatte. Tommi, das Sonntagskind, das man als Montagskind in die Papiere eingetragen hatte. Wie lange hatte der Kindsvater mit der Hebamme gestritten? Sonntag hätte in der Urkunde stehen müssen. Nicht Montag! Eine Elf im Datum, nicht die Zwölf – in unheilvoller Nachbarschaft zur Dreizehn! Hedwig hatte sich extra beeilt. Hatte entgegen den Kommandos der Hebamme jede Wehe mitgenommen, hatte sich aufgerissen, damit es ein Sonntagskind wurde. Dann die Auseinandersetzung! Auf der Taschenuhr der Hebamme war es Punkt null Uhr gewesen, also Montag. Doch die Pendeluhr, die Hermann und Hedwig Domaschek zur Hochzeit geschenkt bekommen hatten und deren Federn gesummt hatten auf dem Karren, den ganzen Weg von Böhmen bis hierher, die hatte erst gegongt, als Tommi längst draußen war. Der Beweis: Er hatte aufgehört zu schreien, als es gongte. Also musste er schon am Sonntag auf der Welt gewesen sein. Die Hebamme hatte sich nicht überzeugen lassen, und so wurde Tommi von Amts wegen ein Montagskind. Für Hermann und Hedwig hingegen blieb er ein Sonntagskind. Mit viel Glück und viel Verstand. Nur Sonntagskinder können das Reiterlein auf dem mittleren Stern der Deichsel des Großen Wagen sitzen sehen.
Hedwig sah ihm lächelnd hinterher, während der Junge durch den Garten rannte. Von der Tischkante zum Spülstein, zur Kochmaschine, zum Türrahmen tastete sie sich voran. Der Husten hielt sie auf. Als der Anfall sich legte, schlurfte sie weiter über die Steinplatten, die Hermann noch vor Tommis Geburt gelegt hatte, damit sie es ein bisschen komfortabel hatten. Einen Moment lang hielt sie unter dem Vordach inne und sah zum Himmel. Es ist zu kalt für das Pflänzchen, hätte sie dem Jungen gern zugerufen, hatte aber keine Luft dafür. Beim Husten hielt sie sich an ihrer Schürze fest. Die spannte über ihrem Bauch. Als sie die Augen wieder öffnete, fiel ihr auf, dass es aus dem Stroh des Vordachs rieselte. Regen. Schon wieder Regen. Sie umklammerte die Türklinke und spürte das Zittern in ihren angestrengten Oberschenkeln – eine gebrechliche Frau von neunundzwanzig Jahren. Ihre Rückenschmerzen kreuzten sich mit den Gedanken an all die Handgriffe, die noch zu tun waren, bis Hermann aus der Glashütte herüberkommen würde.
Ein dumpfes Geräusch von draußen und ein beherzter Tritt inwendig rissen sie aus ihrer Versunkenheit. Sie sah zu, wie Tommi mit der Hacke die Brache aufschlug und das kleine, schlaffe Grün in die Erde steckte.
Mit einem stolzen Lächeln rannte er zu Hedwig zurück. Die Finger wieder in seinen widerspenstigen Locken, deutete sie auf ein leeres Einmachglas, das sie am Brunnen vergessen hatte, und erklärte dem Jungen, dass es das Pflänzchen darunter wärmer hätte. Tommi lief hin und stülpte das Glas über das kraftlose Stängelchen mit den zerknautschten Blättern, die sich bereits dunkel färbten.
Am Abend wurde es laut im Hause Domaschek. Tommi saß zerknirscht am Tisch, bekam den Grießbrei nicht hinunter. Sein Vater lief in der Küche auf und ab, redete mit den Händen und schimpfte mit dem Mund. Hedwig strich mit der einen Hand über ihren Leib und mit der anderen über Johanns Kopf. Sie lächelte Tommi aufmunternd zu. Doch der Brei wollte bei alldem Geschrei nicht rutschen. Tommi dämmerte, dass sein Bruder irgendetwas angestellt hatte. Vielleicht hatten die Eltern herausbekommen, dass Tommi und Johann abends in die Keksdose griffen. Nicht jeden Abend. Aber doch manchmal.
»Er ist erst zwölf, Hermann, lass es jetzt gut sein.«
Doch Hedwigs Worte führten nur dazu, dass Hermann seine mühsam errungene Beherrschung wieder verlor. Er stemmte sich mit den Händen auf die Tischplatte, Johann genau gegenüber, und fixierte den Buben mit strenger Miene. »Er wird auch nicht älter als zwölf, wenn er nicht tut, was man ihm sagt! Sieh ihn dir an!«
»Ja doch.« Hedwig nahm Johanns Kinn zwischen ihre dünnen Finger. »Vielleicht ist ja nichts reingekommen.«
»Vielleicht nicht.« Der Vater brauste abermals auf und rutschte halb unter den Tisch. »Vielleicht aber doch! Hab ich dir nicht gesagt, du sollst dir den Mund einschmieren?«
»Ja, Vater.« Johanns Stimme konnte sich nicht zwischen Trotz und Ärger, Furcht und Selbstmitleid entscheiden. Für Tommi war Johann der Größte. Johann kam im Apfelbaum bis ganz nach oben, wohin sie eigentlich nicht durften. Johann fing die Hechte im Wehr mit bloßen Händen. Johann rannte von allen am schnellsten, tauchte am tiefsten und konnte die Steine am weitesten werfen. Es verunsicherte Tommi, dass der große Bruder jetzt den Kopf hängen ließ. »Ja, hast du gesagt, Vater. Ich hab’s vergessen.«
»Vergessen.« Hermann hob die Hände zur Decke. »Vergessen! Der Tod wird nicht vergessen, an unsere Tür zu klopfen …«
»Hermann, ich bitte dich!«
»Er kann das ruhig hören, Hedwig! Er schneidet sich die Lippen auf, schön! Wunderbar! Wer hatte das Rohr vor dir?«
Johann zuckte die Achseln. »Ich weiß nicht. Ist doch egal jetzt!«
»Nein, das ist nicht egal! Du schmierst dir die Lippen ein, wenn du an die Pfeife gehst! Damit sie nicht reißen! Das predige ich seit Jahr und Tag, und mein eigener Herr Sohn schafft das nicht!«
»Die meisten machen’s nicht, weil’s Weiberkram ist und peinlich, Vater!«
»Blödsinn! Peinlich ist, wenn der Sohn des Hüttenmeisters nach seiner ersten Charge tot umfällt!«
»Aber Hermann!« Hedwig erhob sich ächzend. Sie musste sich seitlich zwischen Küchenschrank und Tisch entlangschieben. »Hier fällt heut niemand tot um.« Ihr Lächeln galt Tommi. »Du machst dem Kleinen Angst!«
Hermann drehte sich nach seinem Jüngsten um. »Soll er ruhig Angst haben! Der wird sich die Lippen mit Melkfett einpinseln, und wenn ich’s rot einfärbe! Er wird sich nicht den Mund aufreißen, damit alles reinkommt!«
»Herrje!« Hedwig schleppte sich die schmale Holztreppe hinauf. Die meisten Stufen knarrten. Tommi folgte ihr. Das Geländer bebte unter ihrer Hand. Der Junge wollte gern, dass sie ihn hinauftrug, so wie früher. Aber das schaffte seine Mutter nicht mehr. Am Kopf der Treppe setzte ein Hustenanfall ein, weshalb sie ihm auch an diesem Abend keine Gutenachtgeschichte würde erzählen können. Tommi kroch unter die Decke, die Mutter strich ihm über den Kopf, wandte beim Husten das Gesicht ab und verließ die Bubenstube.
Wer behauptet, dass der Frühling magische Kräfte hat? Es folgten längere Tage, es gab weniger Frost, aber keine Magie. Das spürte auch Hedwig, die kaum mehr aus dem Bett aufstand. Sie spürte es und das Kind in ihrem Leib spürte es auch. Wenn es einen trifft, weiß man es einfach. Wie ein Ziehen in der Brust und ein Kribbeln im Nacken, ein Rieseln den Rücken hinunter. Jemand sagt: Es ist Zeit für dich!
Eines Abends setzte sich Hedwig zu Tommi in die Bubenstube. Johann war nun schon seit Wochen im Krankenhaus. Der Fabrikarzt, Doktor Murna – den man auch gern Doktor Murrer nannte, weil er genauso viel Lust hatte, Patienten zu untersuchen, wie die Patienten Lust hatten, krank zu sein, und bei dem man rätselte, was schäbiger war: sein Klappmesser oder er selbst – ordnete an, die Mundstücke der Glasmacherpfeifen in kochendes Wasser zu tunken. Er nannte es Sterilisation und die meisten Männer verstanden nicht, was er damit meinte. Diese Bemühungen nutzten aber nichts, wenn täglich viele zerschnittene Münder die Mundstücke aufnahmen. Tommi vermisste seinen Bruder. In die Heilanstalt fuhr Hermann allein.
Tommi ließ das Kästchen in Hedwigs Hand nicht aus den Augen. Eine Längsfalte bildete sich zwischen seinen Brauen, und Hedwig ertappte sich bei dem Gedanken, dass sie gerne sehen würde, was daraus würde, wenn Tommi groß wäre. Sie klappte den Deckel hoch und entnahm dem Kästchen eine Kette, legte sie in die kleine Hand. »Für das Mädchen, das du heiraten wirst.«
»Aber ich heirate doch dich, Mama.«
Hedwig strich ihm durchs Haar. Dieses Ziehen in der Brust, das Kribbeln im Nacken, das Rieseln den Rücken hinunter. Es ist Zeit für dich!
»Tommi, du bist ein Sonntagskind und wirst gut durchs Leben kommen.« Auf die Gefahr hin, dass der Kleine sie nicht verstand, nickte sie nachdrücklich. »Du hast einen langen Weg vor dir, Tommi. Mein Weg geht langsam zu Ende, er war lang. Johann wird nicht so weit gehen. Aber du, mein Herz, du hast eine lange, lange Strecke vor dir.« Sie schloss die Knabenhand um die Kette, und Tommi spürte die kleinen Unebenheiten des Anhängers. Das Glas in der Bleifassung verströmte nur einen Moment lang ein wenig Kälte, bevor es die Wärme der Haut annahm. Tommi strich über den Rosenanhänger. Hedwig wartete ab, bis der Junge die Kette wieder freigab, und legte sie zurück ins Kästchen. Sie nahm es nicht wieder mit ins Schlafzimmer, sondern schob es ins obere Schrankfach. Ganz nach hinten, hinter die Bettwäsche.
Das Kästchen hatte Tommi bald vergessen. Doch das Pflänzchen goss er jeden Tag. Selbst bei Regen. Weil der Regen ja nicht unter das Einmachglas gelangen konnte. Er zupfte Unkraut und setzte Regenwürmer an die Stelle. Bald war die Erde so schwarz und locker, dass das Wasser gleich versickerte. Tommi sah den Rinnsalen zu.
Erde zu Sand zu Erde
Keine drei Wochen später starb Hedwig. Das war an Karfreitag im Jahre 1905. Jeden verwunderte, dass es ausgerechnet Karfreitag sein musste. Als hätte sie es sich so ausgesucht. Während Hermann versuchte, seinen Jungs beizubringen, dass die Mutter nicht mehr am Leben war, starb auch das kleine Mädchen, das eben erst geboren worden war.
In dem tristen Dorf gab es keine Kirche, nur eine kleine Friedhofskapelle. Erst am Grab weinte Hermann. Als Tommi fragte, ob sie endlich zu Mama nach Hause gehen könnten, zischelte Tante Pernille ihm etwas zu und tippte mit ihren spitzen Fingern auf seine Beinchen, die von der Kirchenbank hinunterbaumelten.
Zu Hause war Mama nicht. Zu Hause weinte der Vater, und Tommi traute sich nicht in seine Nähe.
Tommi goss seine Pflanze. Selbst bei Regen. Die Blätter wuchsen in die Breite und in die Länge. Die Pflanze war inzwischen zu groß für das Einmachglas. Tommi goss, die schwarze Erde soff alles.
Als die Pflanze Tommi bis zu den Knien reichte, folgte Johann der Mutter und der Schwester nach und wurde neben ihnen beerdigt. Diesmal schluchzte Hermann laut in der Friedhofskapelle.
Und auch Hermanns Bruder – Pernilles Gatte – starb und wurde neben Johann beigesetzt.
Es sollten noch einige folgen. Die schwarze Erde schluckte sie alle.
Wer die Seuche auf der Hütte eingeschleppt hatte, konnte nicht geklärt werden. Jahre später sollte Tommi begreifen, dass sein Bruder, der Onkel und die vielen Arbeiter sich die Lues geholt hatten: von den Mundstücken vorn an den Glasmacherpfeifen. Hineingekrabbelt war die Lues in die rissigen Lippen, die man vergessen hatte einzufetten, weil die meisten das Einfetten für Weiberkram hielten. Hineingekrabbelt wie ein falscher Freund. Und der hatte sie alle dahingerafft.
Der Vater ging auf die Glashütte, und Tommi begriff, dass seine Mama, sein Bruder und die kleine Schwester unter einem Blumenbeet vergraben lagen – an einem Ort, wo sehr viele Menschen unter Beeten begraben lagen. Der Junge fragte sich, ob sie nass würden, wenn man die Blumen goss. Er goss sie dennoch, sah dem Grün beim Wachsen zu und bekam Ärger, weil er alles, was man von ihm verlangte, zu langsam tat.
Die Hüttenherren, Thaddäus Seibert und sein Sohn Karl, kondolierten nach Ostern kurz angebunden. »Schlimme Sache«, sagte Seibert senior, und danach wurde nie wieder darüber gesprochen.
Schlimme Sache, hallte es in Hermann Domascheks Gehörgängen nach. Er versuchte seine Angelegenheiten zu ordnen und nahm Pernilles Hilfe an.
Tommi konnte Tante Pernille nicht leiden. Er schaffte es auch nicht, ihren Namen richtig auszusprechen, und die Variante Vanille machte sie richtig wütend. Pernille kam jeden Tag. Sie wusch Wäsche, kämmte ihm das widerborstige Haar und wischte mit einem mit Spucke – ihrer Spucke – angefeuchteten Tuch über die blasigen Fensterscheiben und über einen Haarwirbel auf Tommis Kopf, der ihr nicht recht passte. Sie zog ihn am Ohr, wenn er nicht stillhielt, und zwickte ihn in die Wange, wenn er die Marmelade nicht richtig aus dem Gesicht wusch. Die Marmelade brachte sie von zu Hause mit. Das war das Gute an ihr.
Hermann musste Tommi mit in die Fabrik nehmen. Wer sollte sonst auf den Jungen aufpassen? Außerdem war es für ihn höchste Zeit zu lernen, welche Geräte ein Glasmacher benutzte. Tommi war schließlich nicht der einzige Junge, der seine Tage damit zubringen würde, Glasscherben, Kohlenstaub, Sand und Holzwolle zusammenzufegen, zu sortieren, wegzutragen, herbeizuschaffen und niemandem im Weg zu stehen.
Die meiste Zeit wartete er auf Anweisungen und pulte an den Blasen an seinen Handballen und Fingerzwischenräumen herum. Es war gut, dass Tommis Freund Anton gemeinsam mit ihm anfing. Es war allerdings nicht gut, dass die beiden andauernd über irgendetwas kicherten. Unter Prügeln lernten sie, dort zu sein, wo man sie brauchte. Und zwar zackig! Zackig fiel Tommi schwer.
Sie lernten, der Hitze aus dem Weg zu gehen und dass der versengte Geruch von nun an zu ihnen gehören würde und dass das Wichtigste der Sand war.
»Aus der Erde wird der Sand geholt. Von tief unten. Mit großen Eimerkettenbaggern, Eimer so groß wie die Fäuste von Rübezahl.«
Hermann erzählte sämtliche Geschichten, die er von seinem Vater gehört hatte. Die vom Jägerstein und der gläsernen Gewehrkugel und das Märchen des sich von selbst rot färbenden Glases. Die Geschichten über den auf der Hütte herumstreunenden Durandl kannte Tommi längst. Durandl half den Eltern, die Kinder unter der Knute zu halten. Er sah alles, hörte alles und war überall zugleich oder huschte zumindest sehr schnell von Ort zu Ort. Tommi fürchtete sich vor Durandl. Natürlich. Es war ja Sinn und Zweck, sich vor dem Hüttengeist zu fürchten und auf die Erwachsenen zu hören. Mehr noch als vor dem Christkind oder dem Zahnmännchen fürchteten sich die Glasmacherjungs vor dem Glashüttengeist.
In jedem Schatten vermutete Tommi ihn. Er stellte nicht infrage, dass Durandl ihn auch zu Hause heimsuchen könnte, wenn er etwas anstellte, und Tommi stellte andauernd etwas an in der rußigen heißen Ofenhalle oder im Packschuppen.
Anton war genau wie Tommi fünf Jahre alt, als er im Sommer begann, auf der Hütte zu arbeiten. Tommi mochte zwar der Sohn des Hüttenmeisters sein, doch Anton war schneller und gewandter als er. Hermann bemerkte es erst gar nicht, dass die Belegschaft seinen Sohn einen tranigen Guckindieluft nannte. Der schlafe ja im Gehen ein! Wenn der so weitermache, könne man den Kühlofen abschaffen. Einem Thomas Domaschek würden die Glastafeln beim Tragen in den Händen heruntertempern.
Hermann beobachtete seinen Sohn und dessen gemächliche Bewegungen, von denen der Nebenmann schnell angesteckt werden konnte. Doch Hermann erkannte bald, dass sein Sohn nicht langsam war, sondern bedacht. Seine Konzentrationsfähigkeit würde ihm eines Tages zugutekommen. Den würde nichts aus der Ruhe bringen, und wenn ein Glasofen in die Luft ginge.
Hermann beobachtete den Jungen also und war überrascht, dass Tommi sein Vaterherz aufgehen ließ, obwohl doch stets Johann sein Liebling gewesen war.
Am Ende einer jeden Schicht schlief der Hosenmatz gegen eine kalte Mauer gelehnt und ließ sich vom Vater heimtragen. Tommi merkte nicht, wie Hermann ihm die rußige Rotznase putzte und ihm über das Haar strich: »Du formst das Glas. Das Glas formt dich.«
Pernille schor Tommis dichte dunkelbraune Locken bis auf wenige Millimeter. Von nun an schwitzte er weniger, wenn er zwischen den drei Öfen herumlief. Drei Hafenöfen gab es dort, wahre Ungetüme. Backöfen des Durandl, kreisrund, heiß und gefährlich. Rundherum verliefen Arbeitsbühnen, auf denen die Glasmacher, deren Gehilfen und die Kölbelmacher standen wie auf Brettern, die die Welt bedeuteten. Ihre Welt.
Manchen Abend saß Tommi, wenn er nicht schlafen konnte, am Fenster und schaute hinüber zum Glashaus. Manchmal sah Tommi Bruno Winklers Gestalt zwischen den Pflanzen hin und her huschen, als wäre er der Geist des Gewächshauses. Wenn Tommi ihn erspähte, wurde seine Einsamkeit einen Moment lang erträglicher; die Pendeluhr in der guten Stube schlug scheppernd achtmal, neunmal, und das Glashaus blieb erleuchtet bis spät in die Nacht. Wie ein funkelnder Glasstein. Grünlich blau glitzernd. So wie die Glassteine, die der Vater aus der Hütte heimbrachte und mit denen sie im Garten die Beete einfassten. Große Klunker. So schwer, dass Tommi sie nicht hochheben konnte. Die Glasfabrik thronte über allem, und doch überstrahlte das leuchtende Gewächshaus Tommis ganze Welt.
Manchmal weinte Tommi vor dem Einschlafen, weil ihm das Schlaflied fehlte, die weiche Wärme seiner Mutter, ihr Duft nach Kernseife und Gurkensud. Und ihm fehlten die Geschichten, die Johann ihm manchmal vor dem Schlafen erzählt hatte. Johanns Bett stand noch immer dem seinen gegenüber. Tommi lag meist abgewandt. Der Fünfjährige ertrug den Anblick des leeren Bettes nicht. Die Abwesenheit seines Bruders erdrückte ihn. Diese Einsamkeit verkrallte sich in seine Brust, schraubte sich hoch zu seiner Kehle und schnürte ihm die Luft ab. Weinen half nur wenig. Der warme Schlag der Pendeluhr und das vertraute Ruckeln eines durchfahrenden Güterzuges lullten den Jungen schließlich ein. Er nahm das Alleinsein wie ein neues Familienmitglied an. Sein Vater wünschte nicht, dass Tommi sich an ihn klammerte. Es verweichliche den Jungen, hatte Pernille gemeint, und die musste es ja wissen. Doch blieb der Kleine stets in Hermanns Nähe. So, als müsse er sich vergewissern, dass der Vater noch da war und nicht auch noch verschwinden würde wie alle anderen.
Als im Spätsommer 1905 das Schloßenwetter, Dauerregen mit Hagel und Sturm, den Fluss über seine Ufer treten ließ, war Tommis Pflanze genauso groß wie er selbst. Sie war das einzige Wesen, das die sintflutartigen Regengüsse zu begrüßen schien. Tommi, hin- und hergerissen von Angst und Faszination, klammerte sich an seinen Vater, der mit Wasserschöpfen beschäftigt war. Er schöpfte zu Hause, er schöpfte auf der Glashütte. Das Dorf war mit Wasserschöpfen beschäftigt. Mit einem kleinen Topf rannte Tommi zwischen Hermanns Beinen umher. Obwohl der Junge ihm keine Hilfe war, mochte Hermann ihn in dieser Zeit in seiner Nähe haben. Tommi war alles, was ihm noch geblieben war, und er musste ihn behüten. Er liebte ihn. Auf seine Weise. Doch auch das gestand Hermann sich nicht ein und Tommi konnte es nicht ahnen. Der Vater schaute jeden Abend, bevor er selbst schlafen ging, zu ihm hinein und vergewisserte sich, dass sein Sohn zugedeckt war. Es schmerzte Hermann, wie ähnlich er seiner Mutter sah.
In jenem wie in jedem Jahr hielt man dem Wasser stand. Das kannte man ja. Es kam und ging. Manches Jahr kam mehr, manches Jahr kam weniger. Es füllte die Baugrube neben der Fabrik. Wie ein aufgerissener Mund klaffte sie zwischen Bahndamm und Gewächshaus. Mit jeder Karre Erde, die herausgeschöpft wurde, erschien die daneben befindliche Glasfabrik kleiner und nichtiger. Jeden Tag verließen Fuhrwerke, gefüllt mit Erde und Schlamm, den Ort. Wohin Wasser und Erde gebracht würden, hatte Tommi den Gärtner gefragt. Bruno hatte nur mit den Schultern gezuckt. Später wollte man Tommi einreden, Bruno Winkler sei nicht die hellste Kerze auf der Torte. Für Tommi aber war er immer einer der Schlauesten. Doch gegen das Wasser wusste selbst Bruno keinen Rat und schob es mit der Schaufel aus dem Gewächshaus hinaus. Das Wasser breitete sich auf den Auen und Äckern aus. Die Wiesen waren bevölkert von Störchen und Reihern, die nach Fröschen suchten.
Das Hochwasser schwängerte die Luft mit Muffigkeit. Die Feuchtigkeit durchdrang alles. Sogar die Betten waren klamm. Das Vieh harrte muhend und blökend in den Ställen aus, solange das Wasser auf den Wiesen stand. Doch mächtiger und stärker als das Wasser war das Feuer hinter den Mauern der Hütte. Tommi fragte sich manchmal, ob dieses große heiße Feuer all das Wasser verdampfen könnte.
Die Menschen hielten das Wasser aus. Sie hielten die Hitze aus.
Wicken und Winden arbeiteten sich genauso wie das Wasser am Torbogen Seibert & Sohn Richtung Firmenschild hoch und verbargen die Stellen, an denen das Ocker abblätterte. Kleine violette Blüten in der Sonne. Der Torbogen verband das Bürohaus mit der Hütte. Ein mächtiger Torbogen, zwischen den beiden Anlagen gespannt wie eine Brücke zwischen Leben und Tod, Freud und Leid, Genusssucht und Elend, Wahnsinn und Logik, nur dass diese Brücke nicht begehbar war.
Und bevor Wohnsitz einzugsfertig war, lebten die Fabrikanten Seibert in einer geräumigen Wohnung in der nahegelegenen Kleinstadt. Thaddäus Seiberts Büroräume neben der Hütte boten kaum genug Komfort, um länger als nötig dort zu verweilen, obschon er anstrebte, ein paar Räume bewohnbar zu machen, um die wichtigen Leute der Branche dort empfangen zu können. Thaddäus’ zweite Frau und die gemeinsame Tochter Eleonore kamen nur für kurze Besuche in das Fabrikdorf und nur, solange sie den Lärm und den Rauch aushielten, und das war für den Alten gerade lange genug.
Thaddäus Seibert und Hermann Domaschek durchquerten die Schmelzhalle, die von den Öfen auf sommerliche Temperaturen gebracht wurde. Drei Öfen mit je acht Häfen, aus denen die Männer die geschmolzene Glasmasse bargen, indem sie mit dem unteren Ende der Glasmacherpfeife durch das Arbeitsloch ins rot Glühende stießen und eine Portion davon aufdrehten. Der Senior und sein Hüttenmeister marschierten an der Hitze vorbei Richtung Kontor.
»Ich bezahl dich, damit du mit beiden Händen arbeitest!«, schnauzte Seibert im Vorübergehen einen Kölbeljungen an, der darauf wartete, dass die Glasmasse geborgen werden konnte. Der Kölbeljunge nahm die Hand aus der Tasche. Es musste gewartet werden, bis Seibert und Meister Domaschek die Türen hinter sich geschlossen hatten. Bei offenen Türen durfte das Arbeitsloch nicht geöffnet werden. Das wusste jeder, und Thaddäus Seibert sollte das ebenfalls wissen. Jeder wusste, dass beim Bergen der Schmelzmasse kein Luftzug, nicht einmal ein Hauch, die empfindlichen Druckverhältnisse in der Hütte aus dem Gleichgewicht bringen durfte. Bei über tausend Grad war das Gemenge fast einen Tag lang aufgeschmolzen worden. Wasserstoff und Stickstoff konnten leicht den falschen Weg nehmen.
Hermann wandte sich zu dem Jungen um, der verschmitzt über Seibert grinste. Hermanns rechter Zeigefinger schnellte empor. Der Junge brachte seine Gesichtszüge in Ordnung.
Im Kontor war es vergleichsweise kühl. Seibert setzte sich schwerfällig hinter seinen mächtigen Schreibtisch und ging ohne Umschweife die Bücher durch. Es hatte erneut Reklamationen gegeben. Das kannte man. Die Kunden fanden immer etwas auszusetzen. Einem Maler war das Glas zu bucklig und zu blasig, einem Pastor zu schlierig, einem Architekten nicht dünn genug. Irgendwer wusste es immer besser und schickte die Ware unverzüglich zurück auf die Hütte. Seibert & Sohn würden sie irgendwem zum Spottpreis unterjubeln und den Verlust den Arbeitern vom Gehalt abziehen.
Wieso das Glas aus Seiberts Fabrik so mangelhaft war, interessierte Hermann nicht. Sie waren noch jede Scheibe losgeworden. Thaddäus Seiberts Analysen waren Hermann egal. Ihn interessierte vielmehr, wie seine Leute mit den erneuten Kürzungen zurechtkommen sollten. Seit Hedwigs Tod fühlte er sich, als wäre er aus der Zeit gefallen. Während Thaddäus Seibert sich in seinen Ausführungen erging, überlegte Hermann, ob Tommi und Anton wieder etwas anstellten und ob er sich auf seine Gehilfen verlassen konnte, die auf die Kleinsten aufpassen sollten.
»Wir müssen an der Rezeptur der Trockenplatten arbeiten«, unterbrach Thaddäus Seibert Hermanns Gedanken.
Seibert hatte einen Narren an fotografischem Trockenglas gefressen. Die Herstellung solcher Glasplatten als Trägermaterial für die Fotoemulsion war teuer und vergleichsweise ineffizient. Man musste stets rechnen, täglich aufs Neue kalkulieren. Bedachte man, wie wenige Menschen eine Fotokamera besaßen, war die Produktion fotografischer Trockenplatten ein völlig verrücktes Unterfangen. Und erst die Werbekosten! Andererseits priesen Seibert & Sohn seit Jahren schon im Briefkopf der Firma solcherart Fotoglas an, wie auch Belegeglas für Spiegel. Das produzierten Hermann und seine Männer genauso wenig wie Trockenglas für Fotografien.
Es war noch gar nicht lange her, da hatte so ein neunmalkluger Schreiberling vom Adressbuchverlag Anstoß an diesem Etikettenschwindel genommen. Der alte wie der junge Seibert hatten Besserung gelobt, entweder die falsche Reklame aus dem Briefkopf zu entfernen oder die Produktion von fotografischen Trockenplatten und Spiegelglas in Angriff zu nehmen. Nichts davon war bisher geschehen.
»Wie macht sich der Junge?«
Hermann begriff nicht sofort, wer gemeint war, und erwiderte mit einiger Verzögerung: »Gut, danke.« Er wies auf das Buch, das Thaddäus Seibert vor sich aufgeschlagen hatte. »Übernehmen wir den Auftrag fürs Bilderglas oder lehnen wir wieder ab? Ein Museum?« Hermann beugte sich weiter vor, um den Auftraggeber entziffern zu können. Er hatte noch nie einen Fuß in ein Museum gesetzt.
»Ja. Ein Museum.« Hörbar zog Seibert die Luft ein. Es war allgemein bekannt, dass plan gestrecktes Bilderglas meisterliche Feinarbeit war. Entspiegeltes, dabei aber spiegelglattes Glas würde der Reputation der Firma sicherlich guttun. Experimente mit dem Eisenoxidgehalt in der Mischung hatten bislang allerdings keine zufriedenstellenden Ergebnisse geliefert, außerdem verfälschte der Farbstich des Glases die Farben des gerahmten Bildes. Das wusste jeder, doch bevor der Briefkopf erneut für Aufregung beim Adressbuchverlag sorgte, sollte man das Glas tunlichst auf den Markt bringen.
»Nein, das lassen wir besser … Der Neubau erlaubt das wohl kaum«, antwortete Seibert, fingerte an seinem Vollbart herum und hob den Blick nicht von den Papieren. »Meine Frau wird mich umbringen, wenn ich eine neue Produktlinie ankurbele. Sie wissen doch, wie Frauen sind.« Hermann wusste es nicht. Er hatte das Gefühl, gar nichts zu wissen. Weil Hermann nichts sagte, schaute Seibert kurz auf. »Ach ja …« Seibert tippte mit den Fingern einen flotten Marsch auf die Tischplatte. »Also, jedenfalls wollen wir dieses Jahr den Grundstein legen.«
Bis zum Schluss hatte Hermann dem Firmenklatsch keinen Glauben schenken wollen, dass Thaddäus Seibert, dessen Bücher hinten und vorn nicht stimmten, ein neues Anwesen neben das Fabrikgelände hinsetzen lassen wollte. Es war ein Affront gegenüber den Arbeitern, die ständig Lohnkürzungen hinnehmen mussten und wie Urzeitmenschen hausten.
Hermann ließ sich die letzten Bestellungen aushändigen. Er war beinahe schon aus dem Kontor hinaus, da rief Seibert ihn noch einmal zurück: »Die bemängelten Aufträge …« Thaddäus Seibert sah nicht auf. »Die machen wir noch mal. Haben Aufschub bis Monatsende. Sorgen Sie dafür, dass diese Aufträge zur höchsten Zufriedenheit ausgeführt werden.« Mit ausgestrecktem Finger wies er auf die Zettel in Hermanns Hand. Damit war der Hüttenmeister entlassen.
In der nächsten Zeit fühlte Hermann sich vom alten Seibert beobachtet.
Genauso hatte es sich früher angefühlt, wenn sein Lehrmeister ihn beaufsichtigt hatte. Wann war das gewesen? In den Achtzigern? Ja, nachdem die Tschechen die Mehrheit im Böhmischen Landtag errungen hatten, kurz bevor die deutschsprachigen Böhmen von den Tschechen aus dem Land vertrieben worden waren, weil die sich als die Erstgeborenen verstanden hatten. Hermanns tschechischer Lehrmeister hatte es ihm schwergemacht. Damals hatte Hermann mit dem Blei-Erz-Zusatz im Gemenge Probleme gehabt und hätte beinahe seinen Gesellenbrief riskiert. Von edlem Kristallglas, der Balance von Salz und Asche, verstand hier kaum jemand etwas.
Thaddäus Seibert meinte, sein grünstichiges Kalk-Natron-Glas sei für Bilder in Museen geeignet? Der hatte doch noch nie seine Nase vor durchscheinendes Bleioxid-Glas gehalten! So durchscheinend, als wäre es gar nicht da. Klar wie Luft. Hedwig hatten die Berge gefehlt. Bis zum Schluss hatte sie sich mit dem platten flachen Land Niederschlesiens nicht anfreunden können. Hermann fehlte dieses Glas.
Als Hüttenmeister hatte er die Aufgabe, den Glasbläsern auf die Finger zu gucken, oder besser gesagt: auf die Münder. Für das Endprodukt war er nicht verantwortlich. Er sorgte dafür, dass unterm Strich die geforderte Stückzahl an bestellten Tafeln fertig war. Und zwar in der besten Qualität, die seine Männer hinbekamen.
Hermann beobachtete seinen Sohn. Die Mutter fehlte. Das sah ein Blinder mit Krückstock. Die meiste Zeit verbrachte Tommi in der Fabrik. Auf jede neunstündige Schicht folgten vierundzwanzig freie Stunden. Im Umkreis von fünf Meilen gab es keine Frau, der Hermann mit seinem hitzegegerbten Gesicht und den abgeschliffenen Schneidezähnen gefallen würde. Das Röhrchen des Mundstücks schliff die Schneidezähne oben und unten halbrund ab, schnitt in die Lippen, in die Zunge, wenn man nicht aufpasste. Tommi sollte das alles erspart bleiben. Hermann würde ihn aus der Hütte nehmen, sobald sich eine Gelegenheit böte.
Die Lösung lag nahe: Pernille. Keine Schönheit, aber stolz und sogar fleißig.
Tommi traute sich nicht, ihr ins Gesicht zu sehen, wenn sie sich am Esstisch gegenübersaßen. Er fürchtete sich vor ihrem Blick aus den kleinen, eng stehenden und tief liegenden Augen. Ein Blick, so glasklar, hart und streng – nicht einmal Grete Winkler guckte so auf ihn herab.
Pernille fand andauernd etwas an ihm auszusetzen. Am Tisch sitze er geduckt wie ein Dieb, beklagte sie sich bei Hermann. Oder er stütze beim Essen die Ellbogen auf. Dann sah Hermann zu seinem Buben hinüber und versetzte ihm einen Hieb gegen den Hinterkopf.
Als die Mutter noch gelebt hatte, durfte bei Tisch geredet werden. Man hatte sich so viel zu erzählen, wenn man sich nach einem langen Tag erst abends wiedersah. Pernille hingegen duldete nicht, dass das Gute, das sie gekocht hatte, durch Geschwätz verdorben wurde. Sie verlangte, dass Hermann dies Tommi beibrachte – mit dem Gürtel. Tommi schrie und weinte. Weinte um seine Mutter, den großen Bruder, das kleine Schwesterchen, um sich selbst und weil er wollte, dass Pernille wieder verschwand.
Sie verschwand aber nicht. Im Gegenteil. Jeden Tag brachte sie irgendwelches Zeug aus dem Haus mit, das sie von ihrem Mann geerbt hatte und das verkauft werden sollte: Blumenvasen, Teppiche, Körbe mit Wäsche. Das Schlimmste aber war, dass alles nach ihr roch. Pernilles Geruch nach Mottenkugeln und Stärkepulver vertrieb bald den frischen Duft der Mutter.
Tommi riss von zu Hause aus. Es wurde ihm zur Gewohnheit. Das Problem beim Ausreißen war allerdings, dass er immer wieder gefunden wurde, und dann überzeugte Pernille Hermann davon, dass Tommi eine Tracht Prügel verdient habe. Später, wenn Pernille schlief, kam sein Vater reuig zu ihm, hielt ihn fest umschlungen und weinte um ihn, um seine Frau, um seinen ältesten Sohn und um das kleine Mädchen, über das sie sich so gefreut hatten, und um sich selbst. Manchmal schlief er dann in Johanns verlassenem Bett.
Tommi ging trotz allem stiften. Wenn Pernille ihn in der Bubenstube einsperrte, stieg der Junge aus dem Fenster, ließ sich bis zur Dachkante gleiten und hangelte sich an der Traufröhre hinunter.
Bruno Winkler störte es nicht, wenn sich der Junge im Gewächshaus versteckte. Der Gärtner lag zusammengerollt auf dem Sofa im Nebenraum. Dort, wo alles lagerte, was nicht ins Gewächshaus passte: hauptsächlich Töpfe, Säcke mit Mulch zum Düngen und jede Menge Geräte. An allem haftete der Duft von Erde und Sonne und einer sorglosen Zeit.
Solange Tommi am Fuße des Sofas hockte und mit Stöckchen und Steinchen spielte, vergaß er Pernille und den Vater, der sich so sehr verändert hatte, und er vergaß auch seinen eigenen Kummer. Wenn Bruno aufwachte, strich er dem Jungen über den Schopf, ließ ihn manchmal an seiner Bierflasche nippen und ging dann nach Hause zu Grete. Es bekümmerte ihn nicht, dass ein so kleiner Junge allein in einem Gewächshaus saß.
Manchmal wachte Tommi davon auf, dass er getragen wurde. Dann schlang er seine Ärmchen um den Hals des Vaters und begann leise zu weinen. Kaum war zu Hause die Tür ins Schloss gefallen, straffte sich auch schon Pernilles schmaler Mund zu einem blassen Strich und sie begann zu zetern, zu schreien und zu wüten. Die Schande, die der Junge über sie bringe, war das eine Thema, die Tracht Prügel, die er verdiene, das andere.
An so manchem Abend konnte Tommi die Scheiben des Büfetts unten in der guten Stube klirren hören. Leise und rhythmisch. Einmal hatte er sich getraut hinunterzuschleichen. Pernille schien durch die mit winzigen Gardinen verhängten Scheiben der Schranktüren zu spähen, als suche sie eine bestimmte Tasse oder so etwas. Mit den Händen stützte sie sich auf das mit Spitzendeckchen geschmückte Gesims. Tommis Vater stand dicht hinter ihr. Vier weiße Beine nebeneinander. Ein Birkenwäldchen. Der Kopf des Vaters kippte in den Nacken. Den Blick starr zur Decke gerichtet, mühte er sich mit raschen Bewegungen ab und röchelte, als bekäme er keine Luft. Tommi war sich nicht sicher, ob er dem Vater zu Hilfe eilen sollte. Sein Bauchgefühl – ein mulmiges – sagte ihm, er solle schleunigst wieder verschwinden. Das Büfett mit Ahornfurnier hatte Pernille mit ins Haus gebracht.
Das Wasser lief ab, wie es immer abgelaufen war. Die Brachen und Felder trockneten. Der muffige Geruch der überschwemmten Ländereien wich allmählich dem würzigen Duft der sich gelb und rot färbenden Blätter und dann dem metallisch-rußigen des schwarzen Schnees.
Tommi fuhr Schlitten mit Anton und glitt auf Kufen über den zugefrorenen Fluss. Eiskristalle in den Wimpern blickte er in die weiß überzogenen Kiefern. Der Junge vergaß manchmal, dass er allein war. Seine Einsamkeit hingegen vergaß er nie.
Köder an der Angel
Mit dem Frühling 1906 veränderte sich die Baugrube. Der Abtransport von Erde war endlich abgeschlossen. Stattdessen wurden Steine angeliefert. Glutrote Ziegel. Sie kamen mit der Eisenbahn. Die Waggons wurden auf die Gleise zur Fabrik umgeleitet, die ursprünglich für die Anlieferung von Quarzsand und Kohle gedacht waren.
Die Glasmacher, die eigentlich Besseres zu tun gehabt hätten, wuchteten die Ziegel mit Handkarren an den Rand der Baugrube. Sie rührten Mörtel an. Tommi saß auf einem Erdhaufen und besah sich die Sache.
Der Frühling vom Sommer überwuchert wie ein zu schnell wachsendes Gestrüpp. Es war schlagartig so heiß geworden, dass Pernille den obersten Knopf ihres engen Kragens zu öffnen wagte. Fenster und Türen des Gewächshauses standen Tag und Nacht sperrangelweit offen.
Tommis Grünzeug in der hinteren Ecke des Gartens hatte so kräftig ausgesamt, dass es mehrere Quadratmeter bedeckte. Die Bienen freuten sich über die vielen blau-violetten Blüten und die Frauen aus der Nachbarschaft kamen, um beim Ernten der Blätter zu helfen. Die Blätter rochen nach Wasser, und wenn die Sonne lange darauf schien, nach Gurke. Die Nachbarinnen verarbeiteten das Grünzeug zu Salaten, Suppen oder verwendeten es als Beilage. Was von den Blättern übrig blieb, verfütterte man an die Kaninchen und Hühner. Darüber hinaus stritt sich jede blitzgescheite Hausfrau mit Bruno Winkler über den Namen dieses eigenwilligen Gewächses.
Für Tommi stellte das merkwürdige Grünzeug den Geist seiner Mutter dar. Die sternförmigen Blüten der Pflanze erinnerten ihn an ihre strahlenden dunkelblauen Augen. Natürlich teilte er mit niemandem solche Gedanken. Jeder würde ihn für beschränkt halten. Wenn er auch vergaß, die Hühner zu füttern, beim Sensen der Wiese trödelte, nicht daran dachte, das Heu zu wenden, Wasser aus dem Brunnen zu holen oder Asche auszustreuen – seine Pflanzen zu gießen vergaß er nie.
Christi Himmelfahrt musste schon eine ganze Weile zurückliegen, denn der Hochzeitskranz von Hermann und Pernille trocknete an der Haustür vor sich hin. Selbst den Vögeln war es zu heiß zum Zwitschern. Die Pferde verließen kaum den Stall, und die geschorenen Schafe verkrochen sich in den warmen Schatten.
Tommi beschloss, der Mittagshitze zu entfliehen und im angrenzenden Wäldchen nach Regenwürmern zu buddeln. Hier im Dickicht vermischte sich der beißende Geruch nach Kienäpfeln mit dem von Heckensträuchern.
Die Würmer wollte Tommi an seine Angel knüpfen. Er wollte den fettesten Wurm für den größten Hecht finden. Sein Vater hatte ihm vom Alten erzählt, einem uralten Hecht, schon viele hätten versucht, ihn zu fangen, doch niemals sei ein Wurm fett genug gewesen, um ihn anzulocken.
Tommi war recht konzentriert bei der Suche, er stach seine Schippe in die Erde, wühlte sie auf und zog gerade das Ende eines besonders prächtigen Exemplars in die Länge, als ihn eine Stimme bei der Arbeit störte. »Was ist das?«
Tommi hob den Blick. Vor ihm stand ein Mädchen. Weiße Schleifen im gelben Haar. Die Locken lagen glänzend auf ihren Schultern, sie trug ein weißes Strickjäckchen über dem karierten Kleid, das ihr fast bis zu den Füßen reichte. Weiße Strümpfe steckten in glänzend schwarzen Riemenschühchen. Tommi war barfuß.
»Das ist ein Regenwurm. Bist du dumm, oder was?«
»Nein. Ich bin Eleonore Franziska Seibert.« Tommi schnaubte. »Meinem Papa gehört die Fabrik. Er baut meiner Mama und mir ein Schloss. Was machst du mit dem Regenwurm?«
»Der kommt als Köder an die Angel. Was für ein Schloss?«
»Ich glaub, du bist dumm. Das Schloss …« Das Mädchen deutete mit ausgestrecktem Arm Richtung Mauergerippe. »Das gehört alles mir.« Ihre beiden Ärmchen beschrieben einen Kreis. »Das ALLES!«
»Auch das Glashaus?« Tommi erhob sich, ließ den Wurm fallen und steckte die Hände in die Hosentaschen. Besorgt schaute er zum Gewächshaus hinüber.
»Das ganz besonders.«
Tommi wurde es eng um die Brust. Er konnte den Blick nicht vom Treibhaus wenden, schluckte trocken, dann nahm er Schwung. Er war groß und stark für sein Alter, das Mädchen eher zierlich. Mit beiden Händen stieß er sie vor die Brust. Das Mädchen flog tatsächlich einen Meter nach hinten, kam hart auf dem Boden auf und fing augenblicklich an zu plärren. Tommi nahm die Beine in die Hand.
Das nützte aber nichts, denn noch am selben Abend standen der alte Seibert, eine sehr schöne Frau und Eleonore Franziska Seibert vor der Tür des Hüttenmeisters Domaschek. Das Mädchen machte ein angestrengt wütendes Gesicht, über das Tommi lauthals gelacht hätte, wäre die Lage nicht so ernst gewesen.
Der Junge habe das Mädchen geschubst, vermeldete der alte Seibert.
»Ich war das nicht. Durandl war’s!«
Tommi bezog die Prügel des Jahres.
Hermann verbot ihm, je wieder einen Fuß auf die Baustelle zu setzen, und meinte, es dabei bewenden lassen zu können. Pernille sah das anders. Sie verlangte, Hermann solle den Jungen in seiner Stube einsperren und das Fenster vernageln, und ließ ihn darben bei Wasser und Brot. Sechs Tage lang. »Einen Tag für jedes Lebensjahr«, predigte sie, als ob das etwas helfen würde. »Der soll lernen, wem er ein Dach über dem Kopf zu verdanken hat!«
Pernille bekam nicht mit, dass Hermann dem Jungen Obst und Bratenstücke aufs Zimmer brachte: garniert zwar mit Moralpredigten, aber doch köstlich.
Tommi igelte sich in seinem Bett ein und schwor sich, an Eleonore Franziska von und zu Hochnase Rache zu üben. Die weißen Schleifchen in ihrem sommerblonden Haar jedoch vergaß er nie wieder.
Als seine Gefangenschaft aufgehoben wurde, huschte Tommi doch wieder ins Treibhaus, ließ sich von Bruno Geschichten über Pflanzen erzählen und lauschte den leiernden Liedern auf eiernden Schellackplatten. Die Kurbel bediente Tommi mit höchster Hingabe. Hermann und Pernille bekamen von seinen Ausflügen nichts mit. Inzwischen blieben seine Ausflüge meistens unbemerkt. Die beiden hatten inzwischen ganz andere Sorgen.
Niemanden wunderte es, dass die Witwe des einen Bruders nun das Regiment im Hause des anderen führte. Doch alle wunderten sich, dass Pernille schwanger wurde. Dass das überhaupt noch ging? Tommi hörte Grete Winkler sagen, man solle nicht das erste Kind bekommen, wenn man so alt sei; wenn’s schon mit Hermanns Bruder nicht geklappt habe, solle sie es lieber ganz sein lassen.
Thaddäus Seibert sei ebenfalls alt und habe mit der zweiten Frau noch ein Kind gekriegt, erwiderte Bruno. Keiner von beiden bemerkte, dass Tommi sie belauschte.
»Bei den Männern ist das egal. Die Frauen sollten nicht so alt sein. Das geht doch schief«, sagte Grete, und die Weiber im Dorf warteten gespannt den Gang der Dinge bei Pernille Domaschek ab.
Im Spätsommer des Jahres 1906 kam das Schloßenwetter schubweise, sodass das Flüsschen zwar anschwoll, jedoch nicht über die Ufer trat. Das Grundwasser stieg allerdings. In der Seibert’schen Baugrube stand das Wasser wochenlang kniehoch und ockergelb und verströmte einen metallischen Geruch, der sich über das Fabrikgelände legte. Die Bauarbeiten pausierten.
Bei Pernille Domaschek ging tatsächlich etwas schief. Die Vorahnung der Dorfweiber bestätigte sich, sobald die Kunde vom neuen Kind und dessen Eigenartigkeit die Runde gemacht hatte. Nicht dass irgendetwas während der Schwangerschaft oder bei der Entbindung falschgelaufen wäre. Das nicht. Doch mit dem Kind stimmte etwas nicht. Das stellte sich in den ersten Wochen heraus, und die Domascheks blieben das vorherrschende Gesprächsthema im Dorf. Wenigstens trug das Neugeborene einen segensreichen Namen. Die Höflichkeitsbesuche der Dorfweiber bei der Wöchnerin und dem Neugeborenen hatten etwas Sensationshungriges an sich. Jeder wollte sehen, was am Gerücht, der kleine Christian habe ein einfältiges Antlitz, dran sei. Man sprach Hermann Mut zu, seine Hoffnung in einen neuen Versuch oder ganz auf Tommi zu legen.
In der Volksschule war Tommi nicht gerade mit Feuereifer dabei. Schulischer Ehrgeiz wurde den Glasbläsern nicht nachgesagt. Seine rasche Auffassungsgabe half ihm durch die Schulzeit. Das einzig Gute am Unterricht war, dass er niemanden mehr brauchte, der ihm vorlas. In Anbetracht von Christians Bedürftigkeit fand sowieso niemand mehr Zeit und Ruhe dafür. Überhaupt musste Tommi sich nun bei den meisten Dingen selbst behelfen.
Der Lehrer war geduldig, der Rohrstock tanzte nur bei richtigen Vergehen wie einer vergessenen Schiefertafel, Zuspätkommen oder Einschlafen, Flüstern und Lachen während des Unterrichts. Tommi begriff rasch: Wenn die Kinder arge Blasen an den Händen hatten oder wenn sie gerade von der Schicht kamen und sich deshalb eines Vergehens schuldig machten, schlug der Lehrer weniger hart zu.
Manchmal beobachtete Tommi den kleinen Christian und Pernille. Christian war ein freundliches Kind. Er strahlte jeden Menschen an. Wenn Pernille auf das Baby einredete, kam ihm ihre ruhige Stimme merkwürdig vor. Einmal ertappte Tommi sie bei etwas, das er nie für möglich gehalten hätte, und das auf ihren Lippen erstarb, sobald die Stiefmutter ihn bemerkte: ein Lächeln, schief und ungeübt, aber immerhin.
Mit etwas Verspätung, nämlich um die Jahreswende 1906/07 herum, als seine Werkswohnung fertig eingerichtet war, gratulierte Thaddäus Seibert seinem Hüttenmeister zum neugeborenen Sohn. Die Familie Domaschek bedachte er mit einem Neujahrskarpfen. Den Tratsch über den kleinen Christian Domaschek bekamen die Hüttenherren gar nicht mit. Thaddäus Seibert hatte andere Sorgen.
Er machte sich Gedanken um die Finanzen. Und seine Frau Alma machte sich Gedanken um die Gesundheit ihres Gemahls.
Thaddäus hatte stets das Gefühl, alles spiele gegen ihn: seine Gesundheit, die treulosen Finanziers, der frühe Tod seiner ersten Frau, die Ansprüche seiner zweiten, das gezierte Gehabe seiner Tochter und das Ungestüm seines einzigen Sohnes. An Tagen wie diesen fragte er sich, ob seine Firma jemals fotografische Trockenplatten und Belegeglas für Spiegel zustande bringen würde. Das Tafelglas wurde von Saison zu Saison besser. Doch noch immer war es nicht gut genug. Thaddäus wusste, er musste besseres Glas machen, wenn er seine Schulden abtragen wollte.
Der Neuschnee blieb nicht mehr liegen. Matsch und Dreck, wohin das Auge reichte. Ein Darmwind entfleuchte dem Alten beim Anblick der Baustelle. Einen Moment lang ließ der stechende Schmerz in seinen Eingeweiden nach. Mit einem heftigen Ruck zog Thaddäus die Gardinen vor und schlurfte zurück in sein Bett. Er schaute sich auf seinem Nachttisch nach Lektüre und diesen alkoholischen Tropfen um, die es ihm leichter werden ließen. Fehlanzeige.
Er hörte Almas Schritte. Mit einer Mappe unter dem Arm trat sie in sein Schlafgemach. Er durfte von seiner Frau nicht verlangen, hier zu leben. Am Rande der zivilisierten Welt. In der Stadt, so klein sie auch war, hatten sie und Elli es viel bequemer. Er fragte sich, ob das Glasmacherdorf der geeignete Platz für seine Tochter war.
»Bitte unterschreib.« Alma setzte sich neben ihren Mann auf die Bettkante, streifte wie zufällig seine Stirn mit den Fingerspitzen und ratterte die Belange herunter, deretwegen sie eigens hier heraufgekommen war. »Karl ist ins Quarzsandwerk unterwegs.« Das Quarzsandwerk lag weit im Westen. »Wegen der Qualität der letzten Charge.«
Thaddäus wusste, dass der Quarzsand einwandfrei war und die Tagesreise nicht nötig gewesen wäre. Daran lag es also nicht. An irgendeiner Stelle im Prozess musste etwas schiefgegangen sein. Thaddäus hatte sich doch neulich erst mit dem Gemengemeister – … Dings … wie hieß er gleich noch? – getroffen. Der war ein Kauz, nicht von hier, sondern aus dem Nachbardorf. Dem Dorf mit der Kirche. Da waren die Leute sowieso aus anderem Holz geschnitzt. Und was der sich zu kontern herausgenommen hatte! Zu wissen, wie Glas gemacht werde, bedeute nicht, Glas machen zu können. Was für ein Affront!
Thaddäus spürte, wie sein Herz angaloppierte beim Gedanken an den Gemengemeister – Timbert. Genau! Alfons Timbert hieß der Mann. Timbert war für die Mischung zuständig. Die Mischung aus Salz und Asche, Quarzsand und Glasgalle, Kalk und Holzkohle. Hermann Domaschek war der Hüter des Rezepts, und Alfons Timbert behauptete, ein und dasselbe Rezept könne Hunderte, ja Tausende Qualitäten von Glas hervorbringen.
Nein. Es musste andere Ursachen für das bucklige, blasige Glas geben. Davon war Thaddäus überzeugt.
Es konnte an der Länge des Zylinders liegen, der aus dem glühenden Glaskölbchen geblasen wurde. Es konnte daran liegen, dass der Glasmacher die glühende Glaskugel zu langsam oder zu schnell gedreht hatte. Es konnte daran liegen, wie langsam oder schnell man das aufgeschnittene Rechteck im Streckofen bügelte, bis es eine Scheibe von wenigen Millimetern Dicke ergab. Es konnte an der Qualifikation der Glasmacher liegen. Es konnte an einem feinen, kaum merklichen Luftzug in der Werkhalle liegen, der die Temperatur verfälschte und somit eine Charge ruinierte. Durch Fensterglas mit Blaseneinschlüssen oder Buckeln oder Schlieren ließ sich schlecht gucken.
Anfangs hatte Thaddäus noch gut mit Reklamationen leben können. In letzter Zeit fühlte sich jede einzelne wie ein Tritt in die Eingeweide an.
Es konnte alle möglichen Ursachen haben, dass Seiberts Glas bloß mittelmäßig war. Und – das hätte er bei Gott schwören können – wäre er bei besserer Gesundheit, würde er einen Spion bei der Konkurrenz einschleusen, um ein anderes Rezept zu ergattern. Thaddäus war einst von Ehrgeiz und Furchtlosigkeit beseelt gewesen. Heutzutage war er froh, wenn sich der Gang zur Toilette nicht anfühlte wie ein beschissener Marathonlauf. »Verdammter Mist.«
»Nun fluch doch nicht, mein Lieber.«
»Karl macht sich zum Gespött der Leute, wenn er in Hohenbocka den Quarzsand beanstandet. So was spricht sich doch herum, Alma! Der muss aufgehalten werden.« Karls Augenmerk sollte auf einem geregelten Ablauf der Schichten und dem Schichtwechsel sowie der Koordination der Aufträge liegen. Karl musste das große Ganze im Blick behalten, anstatt sich im Quarzwerk herumzutreiben. Man wusste doch, wie gnadenlos die Hüttenaufsicht war! Wie oft kamen die Inspekteure unangekündigt und wie schnell mussten dann die unter Zwölfjährigen aus der Halle verschwinden! Solche Dinge sollte Karl überblicken und nicht einer spontanen Eingebung folgen! Doch Thaddäus wusste, wie überflüssig sein Groll war. Karl war längst unterwegs.
»Was für ein Irrsinn!«, ächzte Thaddäus bei dem Versuch, sich aufzusetzen.
»Ja, mein Lieber.«
»Eine dämliche Idee!«
»Ja, Liebster. Übrigens …« Alma zückte einen Brief, der bereits geöffnet war. Wieder einer dieser Briefe, bei dessen Anblick ihm die Galle überlief. Wieder einer dieser Briefe mit gewichtigem Stempel und Wörtern, die kein Mensch auszusprechen vermochte. Was hatten sie diesmal zu beanstanden? Den Etikettenschwindel im Briefkopf? Die fehlenden Spezialitäten, die beworben, aber nicht produziert wurden? Die Qualität eines Produkts? Den Preis eines Produkts? Die beschädigte Lieferung eines Produkts? Die verspätete, verfrühte, sonst wie falsche Lieferung eines Produkts? Wollte sich ein Partner aus dem Staub machen, ohne zu zahlen? So wie es schon einige gemacht hatten?
Alma las ihm die Beschwerde eines Konkurrenten bezüglich der vorgegaukelten Spezialitäten vor, rezitierte sie wie ein Gedicht, das sie beide längst kannten, und Thaddäus hörte gar nicht richtig hin. Er betrachtete seine wunderschöne junge Frau und ihm kam mit einem Mal der Gedanke, vielleicht war es sogar eine Gewissheit, dass sie diese Kämpfe ohne ihn würde ausfechten müssen und es sogar schaffen konnte.
Das Gedicht war zu Ende, Alma hob den Blick, zog die Augenbrauen in die Höhe und wartete auf Thaddäus’ Meinung. Er drückte die Fingerspitzen in die schmerzende Stelle unter den Rippen und zuckte die Achseln. Alma steckte das Schreiben in die Mappe und trommelte unschlüssig mit den Fingern darauf.
»Raus mit der Sprache«, sagte Thaddäus, der spürte, dass der Brief nicht der einzige Grund für Almas Besuch an seinem Krankenbett war. »Ich habe von Bauer Jeschke ein Angebot für ein Pony bekommen.« Thaddäus hatte die Angelegenheit um das Pony verdrängt. Er stöhnte auf. »Ich weiß, mein Lieber, ich dachte nur, wir sollten darüber reden.«
Inzwischen war Thaddäus davon überzeugt, dass Alma ihn heute umbringen wollte: Karl auf Abwegen, der Beschwerdebrief und obendrein Bauer Jeschke mit einem Pony! Wie um alles in der Welt sollte ein einziger Mann das aushalten? »Ist es nicht der denkbar ungünstigste Moment für ein Pony?«
»Nicht aufregen, mein Liebling. Ich fürchte, noch so ein Angebot wird es nicht geben. Und stell dir vor, wie sehr sich die Kleine freuen würde.«
Es mochte die Eigenart der Frauenzimmer sein zu denken, jedes Geschäft sei eine günstige Gelegenheit. Thaddäus wusste, dass auf jedes noch so verlockende Angebot stets ein noch besseres folgte. Er wusste allerdings auch, dass die Frauen sich mit der Geduld schwertaten. »Na schön. Es muss aber bei Jeschkes eingestallt bleiben, bis das Haus …«, es stieß ihm bitter auf, »… mit allem Drum und Dran fertig gebaut ist.«
Alma fiel ihm um den Hals.
Heut war so ein Tag, an dem Thaddäus das Gefühl hatte, sein letztes Stündlein habe geschlagen. Nicht einmal die Aussicht auf die Fertigstellung des Herrenhauses weckte seine Lebensgeister. Das Herz raste, setzte zwischendurch aus, raste weiter. Dazu die Umtriebe in seinem Gedärm. Kalter Schweiß und Appetitlosigkeit waren noch seine geringsten Sorgen. Thaddäus setzte auf den Frühling. Dann würde es besser werden mit seiner Gesundheit. Sein überbordender Ehrgeiz hatte sein Herz angegriffen und seinen einzigen Sohn unter Druck gesetzt. Die Glasmacher standen Tag und Nacht im Schichtdienst an den Öfen, bliesen Glas, so gut es eben ging. Trotz aller Repressalien war er ein guter Geschäftsmann. Aus dem Nichts hatte er die Firma aufgebaut. Mittelklassiges Glas für die Mittelschicht. War das etwa verwerflich? Seine Tochter wuchs im Luxus auf, weil Alma ihr keinen einzigen Wunsch abschlagen konnte, und so würde sie es auch weiterhin halten. Man konnte sich mit Tafelglas einen Namen machen. Thaddäus fragte sich zum ersten Mal, ob er Spezialitäten wie Bilderglas und Fotoglas überhaupt noch wollte. Jedenfalls brauchte Elli alle möglichen Spezialitäten in ihrem Leben, aber sicherlich kein Spezialitätenglas.
Die Völker haben Holz gehackt
Das Frühjahr 1907 kam mit langsamen Schritten. Im Mai noch immer Aprilwetter. Heiter bis wolkig, dreizehn Grad, kein Regen an Thaddäus’ fünfzigstem Geburtstag. Man beschloss, die großen Tische ohne Schirme im Wäldchen aufzubauen, damit die ganze Dorfgemeinschaft, die Glasmacher und die Familie Platz fanden.
Thaddäus machte eine gute Figur. Die ganze Großfamilie, selbst der Anhang aus erster Ehe, war angereist.
Vielleicht bemerkte nicht nur Bruno Winkler, dass Alma Seibert jedes Mal zusammenzuckte, wenn ihre Tochter sich an sie wandte. Anstatt ihr wohlwollend über die Wange zu streichen, kritisierte Alma die mangelnde Qualität der Wäschestärke und den immer wieder zusammenfallenden Kragen am Kleid des Kindes, als ob Elli für die Wäsche selbst verantwortlich wäre. Sie solle weniger hüpfen, solle stillsitzen, sich nicht so kindisch aufführen. Dabei war sie gerade einmal sieben. Alma sah sich verzweifelt nach dem Kindermädchen um, das an diesem Nachmittag immer wieder die Nähe eines bestimmten Glasmachergesellen suchte. Vielleicht bemerkte nicht einmal Bruno Winkler, wie Karl Alma anschaute. Und Almas Erleichterung, als Karl seine kleine Halbschwester auf den Stuhl an der Vespertafel drückte.
Niemandem war Thaddäus’ emotionales Repertoire so geläufig wie Karl: Es reichte von Sanftmut bis Jähzorn. Er war zwölf Jahre alt gewesen, als die Mutter starb. Wie man es Karl anerzogen hatte, hatte er nur im Geheimen unter dem Verlust der Mutter gelitten. Dem Vater jedoch war der Kummer seines Sohnes nicht verborgen geblieben. Er hatte ihm über seinen Kummer hinweggeholfen: mit einem Reitpferd.
Der Wind zerrte an der Tischwäsche. Eine Nachtigall brachte die Kapelle im Pavillon aus dem Takt.