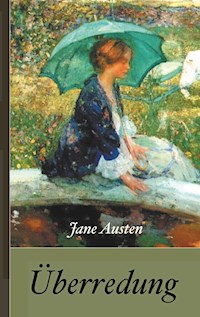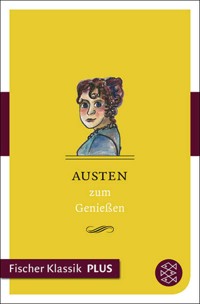
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur. Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK. »Wozu leben wir, wenn nicht um unseren Nachbarn Anlass zum Lachen zu geben und dafür umgekehrt über sie zu lachen.« – Mit hemmungsloser Ironie entlarvt Jane Austen soziale Konventionen und entdeckt menschliche Schwächen nicht allein bei unserem Gegenüber. Ihre gedankliche Schärfe und erzählerische Raffinesse machen sie zu einer der ersten Autorinnen der Moderne, die nur scheinbar den vorgegebenen gesellschaftlichen Regeln folgt: »Das Vergnügliche einer Beschäftigung garantiert nicht unbedingt deren Schicklichkeit.« – Der vorliegende, komplett neu übersetzte Band unternimmt einen genussvollen Rundgang durch das Gesamtwerk Jane Austens und entdeckt diese beliebte Autorin neu.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Jane Austen
Austen zum Genießen
Herausgegeben von Michael Adrian
Anthologie
Aus dem Englischen von Michael Adrian
Fischer e-books
Mit dem Autorenporträt aus Metzlers Lexikon Weltliteratur. Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK.
Verstand und Gefühl
Die lieben Verwandten
Mrs. John Dashwood billigte ganz und gar nicht, was ihr Mann für seine Schwestern zu tun beabsichtigte. Das Vermögen ihres lieben kleinen Jungen um dreitausend Pfund zu schmälern, hieße, ihn in erschreckendem Ausmaß ärmer zu machen. Sie bat ihn, die Angelegenheit noch einmal zu überdenken. Wie konnte er es vor sich selbst verantworten, sein Kind, und zwar sein einziges Kind, einer so großen Summe zu berauben? Und welchen denkbaren Anspruch konnten die Miss Dashwood, die doch nur halbbürtig mit ihm verwandt waren, was in ihren Augen verwandtschaftlich eigentlich gar nicht zählte, auf eine Großzügigkeit dieses Ausmaßes haben. Es war doch allgemein bekannt, dass man zwischen den Kindern eines Mannes aus verschiedenen Ehen keinerlei Anhänglichkeiten unterstellen konnte; und warum wollte er sich und ihren armen kleinen Harry ruinieren, indem er sein ganzes Geld seinen Stiefschwestern vermachte?
»Es war der letzte Wunsch meines Vaters«, erwiderte ihr Gatte, »dass ich seine Witwe und Töchter unterstützen sollte.«
»Er wusste bestimmt nicht, was er sagte; zehn zu eins, dass er zu diesem Zeitpunkt etwas wirr im Kopf war. Wäre er bei Sinnen gewesen, hätte er nicht im Traum daran gedacht, dich zu bitten, die Hälfte deines Vermögens deinem eigenen Kind vorzuenthalten.«
»Er hat sich keine bestimmte Summe ausbedungen, liebe Fanny; er bat mich nur ganz allgemein, sie zu unterstützen und ihnen ihre Lage angenehmer zu gestalten, als es in seiner Macht stand. Es wäre vielleicht auf das Gleiche hinausgelaufen, wenn er es ganz mir überlassen hätte. Er konnte ja schwerlich davon ausgehen, dass ich sie vernachlässigen würde. Aber da er mir das Versprechen abnahm, musste ich es ihm wohl geben: Zumindest dachte ich das in der Situation. Das Versprechen wurde folglich gegeben und muss eingelöst werden. Etwas muss für sie getan werden, wenn sie Norland einmal verlassen und sich ein neues Zuhause suchen.«
»Also gut, es soll ja auch etwas für sie getan werden, aber dieses Etwas müssen nicht dreitausend Pfund sein. Bedenke«, fügte sie hinzu, »dass das Geld, wenn man sich einmal von ihm getrennt hat, nie wieder zurückkehrt. Deine Schwestern werden heiraten, und es wird für immer verloren sein. Wenn es unserem armen kleinen Jungen allerdings irgendwann einmal zurückerstattet werden könnte –«
»Aber gewiss«, sagte ihr Mann sehr ernst, »das wäre ein bedeutender Unterschied. Die Zeit könnte kommen, wo Harry es bedauert, dass wir auf eine so stattliche Summe verzichtet haben. Sollte er zum Beispiel einmal eine große Familie haben, dann wäre sie eine höchst willkommene Ergänzung.«
»Allerdings wäre sie das.«
»Vielleicht wäre es dann für alle Beteiligten besser, wenn der Betrag halbiert würde. Fünfhundert Pfund für jede von ihnen würden eine gewaltige Vergrößerung ihres Vermögens bedeuten.«
»Oh, das wäre zweifellos eine Großtat! Wo ist der Bruder, der auch nur halb so viel für seine Schwestern täte, selbst wenn sie wirklich seine Schwestern wären! Dabei sind sie ja nur Stiefschwestern! Aber du bist eben von Natur aus großzügig!«
»Ich möchte mir auf keinen Fall vorwerfen lassen, geizig zu sein«, erwiderte er. »In diesen Dingen tut man lieber zu viel als zu wenig. Wenigstens kann niemand behaupten, ich hätte nicht genug für sie getan: Nicht einmal sie selbst dürften sich mehr ausrechnen.«
»Was sie sich ausrechnen mögen, kann man nicht wissen«, sagte die Dame, »aber wir sollten uns über ihre Erwartungen nicht den Kopf zerbrechen: Die Frage ist, was du dir leisten kannst.«
»Gewiss – und ich denke, ich kann es mir leisten, ihnen fünfhundert Pfund pro Kopf zu geben. Wie die Dinge stehen, wird jede von ihnen beim Tod ihrer Mutter auch ohne Aufbesserung von mir über dreitausend Pfund ihr Eigen nennen – ein mehr als ausreichendes Vermögen für eine junge Frau.«
»Das ist es allerdings. Und tatsächlich scheint mir, dass es ihnen doch gar nicht auf eine Aufbesserung ankommen kann. Sie werden zusammen über zehntausend Pfund verfügen. Wenn sie heiraten, dann werden sie zweifellos eine gute Partie machen, und wenn sie nicht heiraten, können sie alle sehr bequem von den Zinsen ihrer zehntausend Pfund leben.«
»Das ist nur zu wahr, und deshalb weiß ich nicht, ob es alles in allem nicht ratsamer wäre, statt für sie etwas für ihre Mutter zu tun, solange sie noch lebt – etwas in Richtung einer Leibrente, meine ich. Meine Schwestern würden deren wohltuende Auswirkungen genauso spüren wie sie. Einhundert im Jahr, und sie wären alle vollkommen sorgenfrei.«
Seine Frau zögerte jedoch ein wenig mit ihrer Zustimmung zu diesem Plan.
»Zweifellos«, sagte sie, »ist das besser, als fünfzehnhundert Pfund auf einen Schlag zu verlieren. Wenn allerdings Mrs. Dashwood noch fünfzehn Jahre lebt, sind wir richtig hereingefallen.«
»Fünfzehn Jahre! Meine liebe Fanny, sie dürfte kaum halb so viel machen.«
»Sicher nicht; aber bedenke nur, die Leute leben immer ewig, wenn sie von irgendwoher eine Rente bekommen; und sie ist sehr kräftig und gesund und kaum vierzig. Eine Leibrente ist eine überaus ernste Angelegenheit, Jahr für Jahr steht sie immer wieder auf dem Plan, und man wird sie nicht mehr los. Du weißt nicht, worauf du dich da einlässt. Ich habe die Unannehmlichkeiten von Leibrenten praktisch hautnah miterlebt. Meine Mutter hatte durch das Testament meines Vaters gleich drei solcher Renten für pensionierte alte Diener am Bein, und es ist erstaunlich, wie lästig sie es fand. Zweimal im Jahr musste ausgezahlt werden; dann war da die Schwierigkeit, es den Betroffenen zukommen zu lassen; und einmal hieß es über einen von ihnen, er sei gestorben, und später stellte sich heraus, dass das gar nicht stimmte. Meine Mutter hatte das Ganze ziemlich satt. Ihr eigenes Einkommen gehörte ihr nicht, sagte sie, solange solche unbefristeten Ansprüche darauf bestanden; und es war umso unschöner von meinem Vater, weil andernfalls das Geld meiner Mutter frei zur Verfügung gestanden hätte, ohne Einschränkungen irgendwelcher Art. Das hat mir eine solche Abscheu vor Leibrenten eingeflößt, dass ich mich für meinen Teil ganz sicher um nichts in der Welt auf die Zahlung einer solchen festnageln lassen würde.«
»Es ist gewiss nicht angenehm«, entgegnete Mr. Dashwood, »einen solchen jährlichen Aderlass an seinem Einkommen zu erleben. Das eigene Vermögen, wie deine Mutter zu Recht sagt, gehört einem nicht. Darauf festgelegt zu sein, regelmäßig an jedem Zahltag eine solche Summe auszuzahlen, ist alles andere als wünschenswert: Es nimmt einem die Unabhängigkeit.«
»Zweifellos; und am Ende wird es einem nicht einmal gedankt. Sie wähnen sich abgesichert, du tust nur das, was von dir erwartet wird, und für Dankbarkeit ist da gar kein Raum. Wenn ich du wäre, würde ich auf jeden Fall immer nur nach eigenem Ermessen handeln. Ich würde mich nicht darauf festlegen, ihnen irgendetwas Jährliches zu bewilligen. Es mag in manchen Jahren unangenehm genug sein, von unseren eigenen Ausgaben hundert oder auch nur fünfzig Pfund abzuknapsen.«
»Ich glaube, da hast du recht, Schatz. Wir sollten die Idee einer Rente begraben; was immer ich ihnen gelegentlich zukommen lasse, wird ihnen weitaus mehr nützen als eine jährliche Unterstützung. Sie würden ja doch nur auf größerem Fuße leben, wenn sie sich eines höheren Einkommens sicher wären, und hätten am Ende des Jahres nicht einen Groschen mehr. So wird es gewiss am besten sein. Ein Geschenk von fünfzig Pfund, hier und da, wird allen eventuellen Geldsorgen vorbeugen und das Versprechen, das ich meinem Vater gegeben habe, doch wohl großzügig einlösen.«
»Das wird es mit Sicherheit. Um die Wahrheit zu sagen: Ich bin in meinem tiefsten Innern sowieso davon überzeugt, dass dein Vater gar nicht daran dachte, dass du ihnen überhaupt Geld gibst. Die Unterstützung, die er im Sinn hatte, bezog sich nur auf Dinge, die man vernünftigerweise von dir erwarten kann: zum Beispiel nach einem gemütlichen kleinen Haus für sie Ausschau zu halten, ihnen beim Umzug zu helfen oder ihnen je nach Jahreszeit Fisch und Wild und so weiter zu schenken. Ich gehe jede Wette ein, dass er nichts sonst gemeint hat; alles andere wäre auch merkwürdig und unvernünftig. Überlege nur einmal, mein lieber Mr. Dashwood, wie überaus bequem deine Stiefmutter und ihre Töchter von den Zinsen auf siebentausend Pfund leben können, abgesehen von den tausend Pfund, die jedes der Mädchen hat, was jeder von ihnen fünfzig Pfund im Jahr einbringt, und natürlich werden sie davon ihre Mutter für die Verpflegung bezahlen. Zusammengenommen werden sie über fünfhundert im Jahr verfügen, und was in aller Welt brauchen vier Frauen mehr? Sie werden so günstig leben! Ihr Haushalt wird sie so gut wie nichts kosten. Sie werden keine Kutsche haben, keine Pferde und kaum Bedienstete. Sie werden keine Besucher bei sich aufnehmen und können unmöglich irgendwelche Unkosten haben! Bedenke nur, wie angenehm sie es haben werden. Fünfhundert pro Jahr! Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie sie auch nur die Hälfte davon ausgeben wollen, und da erscheint der Gedanke, dass du ihnen noch etwas drauflegst, doch ziemlich absurd. Eher wird es möglich sein, dass sie dir etwas geben.«
»Du meine Güte«, sagte Mr. Dashwood, »ich glaube, du hast vollkommen recht. Mein Vater konnte mit seiner Bitte eigentlich gar nicht mehr gemeint haben, als was du sagst. Jetzt ist es mir vollkommen klar, und ich werde meiner Verpflichtung durch Hilfestellungen und Freundlichkeiten der Art, wie du sie beschrieben hast, gewissenhaft nachkommen. Wenn meine Mutter in ein neues Haus umzieht, werde ich ihr bereitwillig zu Diensten sein, um sie einzuquartieren, soweit ich kann. Auch ein kleines Möbelgeschenk könnte dann willkommen sein.«
»Bestimmt«, gab Mrs. John Dashwood zurück. »Eines muss dabei freilich erwogen werden. Als dein Vater und deine Mutter nach Norland zogen, haben sie zwar das Mobiliar von Stanhill verkauft, aber das ganze Porzellan, Silberbesteck und Bettzeug behalten, das deine Mutter nun geerbt hat. Ihr neues Haus wird daher nahezu komplett ausgestattet sein, sobald sie es bezieht.«
»Das ist zweifellos ein wichtiger Aspekt. Eine Hinterlassenschaft nicht ohne Wert! Dabei hätte manches von dem Besteck unsere eigenen Bestände hier gar nicht schlecht ergänzt.«
»Ja; und das Frühstücksservice ist viel schöner als das, das wir haben. Meiner Meinung nach um einiges zu schön für jeden Haushalt, den sie sich jemals werden leisten können. Aber so ist es halt nun mal. Dein Vater hat nur an sie gedacht. Und das eine muss ich schon sagen: dass du ihm keine übermäßige Dankbarkeit oder Beachtung seiner Wünsche schuldest, denn wir wissen nur zu gut: Hätte er gekonnt, wie er wollte, dann hätte er eigentlich alles auf der Welt ihnen vermacht.«
Dies war ein bestechendes Argument. Es verhalf seinen Vorsätzen zu der Entschlossenheit, an der es ihnen noch gefehlt haben mochte; und so befand er schließlich, dass es absolut unnötig, wenn nicht sogar ausgesprochen unschicklich wäre, mehr für die Witwe und die Kinder seines Vaters zu tun, als die Art von Nachbarschaftshilfe zu leisten, auf die ihn seine Frau hingewiesen hatte.
Aus: Sense and Sensibility, Kap. 2
Flanellwesten und Rheumatismus
Barton Park war ungefähr eine halbe Meile von ihrem Cottage entfernt. Auf dem Weg durch das Tal waren die Damen daran vorbeigekommen, doch konnten sie es von zu Hause aus nicht sehen, weil ein Hügel den Blick verdeckte. Es war ein großes, stattliches Haus, und die Middletons pflegten einen Lebensstil, bei dem sowohl auf Gastfreundschaft als auch auf Eleganz großer Wert gelegt wurde. Erstere diente zu Sir Johns Zufriedenheit, Letztere zu der seiner Gattin. Es verging kaum ein Tag, an dem sie nicht Freunde bei sich einquartiert hatten, und sie verkehrten mit mehr Menschen der unterschiedlichsten Art als irgendeine andere Familie in der Umgebung. Das Wohlergehen von beiden hing davon ab, denn mochten sie sich in Naturell und Umgangsformen auch noch so sehr unterscheiden, so waren sie sich in einer Hinsicht doch sehr ähnlich: nämlich in jenem vollständigen Mangel an Talent und Geschmack, der ihren Beschäftigungen, soweit sie sich nicht irgendeiner Form von Geselligkeit verdankten, äußerst enge Grenzen setzte. Sir John war Jäger, Lady Middleton Mutter. Er jagte und schoss, und sie hielt ihre Kinder bei Laune, und das war auch schon alles, was ihnen zu Gebote stand. Lady Middleton hatte den Vorteil, dass sie ihre Kinder das ganze Jahr über verziehen konnte, während Sir John seinem eigenen Zeitvertreib nur die Hälfte des Jahres nachgehen konnte. Ständige Verabredungen bei sich zu Hause und auswärts glichen jedoch alle Unzulänglichkeiten der Natur und der Erziehung aus, sorgten bei Sir John für gute Laune und gaben seiner Frau Gelegenheit, ihr gutes Benehmen unter Beweis zu stellen.
Lady Middleton hielt sich auf die Eleganz ihrer Tafel und ihrer häuslichen Einrichtungen einiges zugute und schöpfte aus dieser Art von Eitelkeit das meiste Vergnügen bei ihren Partys. Die Befriedigung aber, die Sir John aus ihrer Geselligkeit bezog, war wesentlich realer; er liebte es, mehr junge Leute um sich zu versammeln, als sein Haus zu fassen vermochte, und je lauter diese waren, desto größeren Gefallen fand er an ihnen. Für die gesamte Jugend der näheren Umgebung war er ein Segen, trommelte er doch im Sommer unentwegt Gesellschaften zusammen, um es sich bei kaltem Schinken und Huhn im Freien gutgehen zu lassen, während er im Winter genügend private Bälle veranstaltete, um jede junge Dame zufriedenzustellen, die nicht unter dem unersättlichen Appetit einer Fünfzehnjährigen litt.
Es war ihm stets eine große Freude, wenn eine neue Familie in die Gegend zog, und von den neuen Bewohnern, die er sich in sein Cottage in Barton geholt hatte, war er in jeder Hinsicht entzückt. Die Miss Dashwood waren jung, hübsch und ungekünstelt. Dies genügte, um sich seiner guten Meinung zu versichern; denn ungekünstelt zu sein, war alles, was einem hübschen Mädchen noch fehlte, damit seine Persönlichkeit so einnehmend wurde wie sein Äußeres. Sein freundliches Gemüt ließ ihn liebend gerne jenen helfen, deren Lage sich im Vergleich zu früher verschlechtert zu haben schien. Sich seinen Nichten gegenüber gefällig zu erweisen, verschaffte ihm daher die echte Zufriedenheit eines guten Herzens; eine Familie aber, die nur weibliche Mitglieder hatte, in sein Cottage ziehen zu lassen, verschaffte ihm darüber hinaus die ganze Befriedigung eines Jägers, ist doch ein Jäger, wenn er auch nur die Angehörigen seines Geschlechts respektieren kann, die ebenfalls Jäger sind, selten darauf erpicht, deren Jagdleidenschaft dadurch zu fördern, dass er ihnen zu einer Wohnung auf seinem eigenen Landgut verhilft.
Mrs. Dashwood wurde mit ihren Töchtern an der Haustüre von Sir John begrüßt, der sie aufrichtig in Barton Park willkommen hieß und den jungen Damen gegenüber, als er sie in den Salon führte, erneut sein schon am Vortag geäußertes Bedauern zum Ausdruck brachte, dass es ihm nicht gelungen war, ein paar adrette junge Männer für sie einzuladen. Sie würden, sagte er, außer ihm nur noch auf einen Herrn treffen, einen engen Freund, der zurzeit in Barton Park wohne, aber weder besonders jung noch besonders unterhaltsam sei. Er hoffte, dass sie die Überschaubarkeit der Gesellschaft entschuldigten, und konnte ihnen versichern, dass dergleichen nicht noch einmal vorkomme. Zwar hatte er am Vormittag verschiedene Familien besucht, um die Zahl seiner Gäste vielleicht doch noch etwas zu vergrößern, aber der Mond schien hell in diesen Nächten, so dass alle Welt bereits mehr als genug Verabredungen hatte. Zum Glück war Lady Middletons Mutter im Lauf der vergangenen Stunde in Barton eingetroffen, und da es sich bei ihr um eine fröhliche und umgängliche Frau handelte, hoffte er, die jungen Damen würden es nicht so langweilig finden, wie sie vielleicht befürchteten. Die jungen Damen fanden es wie ihre Mutter völlig ausreichend, auf zwei ihnen völlig unbekannte Menschen zu treffen, und hatten an mehr keinen Bedarf.
Mrs. Jennings, Lady Middletons Mutter, war eine gut gelaunte, fidele, dicke ältere Frau, die viel redete, sich ausgesprochen wohl zu fühlen schien und einen eher gewöhnlichen Eindruck machte. Sie erzählte Witze und lachte in einem fort und hatte, noch bevor man mit dem Essen fertig war, viele launige Dinge zum Thema Liebhaber und Ehemänner zum Besten gegeben, der Hoffnung Ausdruck verliehen, dass sie ihre Herzen nicht in Sussex gelassen hätten, und behauptet, dass sie rot würden, ob das nun stimmte oder nicht. Marianne, die dies um ihrer Schwester willen ärgerte, betrachtete Elinor, um zu sehen, wie sie mit diesen Übergriffen zurechtkam, wobei Elinor viel mehr unter ihren besorgten Blicken litt als unter den abgedroschenen Spötteleien einer Mrs. Jennings.
Vom Auftreten her zu urteilen, schien Oberst Brandon kaum geeigneter, mit Sir John befreundet, als Lady Middleton, mit ihm verheiratet, oder Mrs. Jennings, Lady Middletons Mutter zu sein. Er war schweigsam und ernst. Doch gab er keine unangenehme Erscheinung ab, obwohl Marianne und Margaret einen geborenen alten Junggesellen in ihm sahen, denn er hatte die fünfunddreißig schon überschritten; und wenn seine Züge auch nicht die eines attraktiven Mannes waren, so machte er doch einen wachen und klugen Eindruck, und sein Benehmen verriet den echten Gentleman.
Keiner der Versammelten zeichnete sich durch irgendetwas aus, das ihn für einen näheren Umgang mit den Dashwoods empfohlen hätte. Doch neben Lady Middletons kühler Ausdruckslosigkeit, die besonders abschreckend war, wirkten Oberst Brandons Ernst und selbst der burschikose Frohsinn Sir Johns und seiner Schwiegermutter geradezu interessant. Lady Middleton schien erst an etwas Vergnügen zu finden, als ihre vier lärmenden Kinder nach dem Essen ins Zimmer stürmten und an ihr herumzerrten, ihre Kleider in Unordnung brachten und jedem Gespräch, das sich nicht auf sie bezog, ein Ende bereiteten.
Am Abend fand man heraus, dass Marianne zu musizieren verstand, und forderte sie auf, etwas vorzuspielen. Das Klavier wurde geöffnet, man war bereit, sich verzaubern zu lassen, und Marianne, die sehr gut singen konnte, ging auf ihren Wunsch einen Großteil der Lieder durch, die Lady Middleton bei ihrer Hochzeit mit in die Familie gebracht hatte und die womöglich seitdem in unveränderter Position auf dem Instrument lagen. Zur Feier dieses Ereignisses hatte die gnädige Frau die Musik nämlich aufgegeben, obwohl sie, wie ihre Mutter sagte, eine ausgezeichnete Klavierspielerin gewesen war und sie, wie sie selbst sagte, die Musik sehr schätzte.
Marianne erntete mit ihrem Auftritt großen Applaus. Sir John brachte seine Bewunderung am Ende eines jeden Lieds genauso lautstark zum Ausdruck, wie er sich mit den anderen unterhielt, während es erklang. Lady Middleton ermahnte ihn mehrfach, fragte sich, wie man beim Musikhören auch nur einen Augenblick unaufmerksam sein konnte, und bat Marianne, ein bestimmtes Lied zu singen, das diese soeben beendet hatte. In der ganzen Gesellschaft hörte ihr nur Oberst Brandon zu, ohne sich hingerissen zu geben. Er machte ihr einzig das Kompliment seiner Aufmerksamkeit und stieg bei dieser Gelegenheit in ihrer Achtung, die sich die anderen mit ihrem beschämenden Mangel an Kunstsinn verständlicherweise verscherzt hatten. Das Vergnügen, welches ihm die Musik bereitete, erreichte zwar nicht jene ekstatischen Höhen, auf denen er das von Marianne hätte nachempfinden können, aber im Vergleich mit der fürchterlichen Unempfänglichkeit der anderen verdiente es Respekt. Auch war sie vernünftig genug zu bedenken, dass ein Mann von fünfunddreißig Jahren aus dem Alter heftiger Gefühle und außerordentlicher Genussfähigkeit vielleicht schon heraus war. Sie war fest dazu entschlossen, mit dem vorgerückten Alter des Obersten so nachsichtig zu sein, wie es das Mitgefühl erforderte.
[…]
Mrs. Jennings war eine Witwe mit einem stattlichen Wittum. Sie hatte nur zwei Töchter, die beide respektabel unter die Haube gebracht waren, so dass ihr nun nichts mehr zu tun blieb, als auch noch den Rest der Welt zu verheiraten. Sie verfolgte dieses Ziel mit dem ganzen Eifer, den ihr Einfluss ihr erlaubte, und ließ keine Gelegenheit verstreichen, Hochzeiten unter allen jungen Leuten ihrer Bekanntschaft zu planen. Sie verfügte über die bemerkenswerte Gabe, jede Verliebtheit sofort zu entdecken, und hatte schon oft das Überlegenheitsgefühl genossen, einer jungen Dame die Röte ins Gesicht und die Eitelkeit auf neue Höhen schießen zu lassen, indem sie Anspielungen auf ihre Macht über diesen oder jenen jungen Mann machte. Genau diese Form von Scharfblick erlaubte ihr auch schon kurz nach ihrer Ankunft in Barton mit Bestimmtheit zu verkünden, dass Oberst Brandon sehr in Marianne Dashwood verliebt war. Sie hatte es an dem ersten Abend, den sie überhaupt zusammen verbrachten, eigentlich schon vermutet, weil er ihrem Gesang so aufmerksam zuhörte; und als die Middletons den Besuch erwiderten und im Cottage dinierten, wurde der letzte Zweifel beseitigt, denn er hörte ihr schon wieder zu. Es war also beschlossene Sache. Sie war absolut davon überzeugt. Sie wären ein perfektes Paar, denn er war reich und sie attraktiv. Es lag Mrs. Jennings sehr am Herzen, Oberst Brandon gut verheiratet zu sehen, seitdem sie ihm durch ihre Verwandtschaft mit Sir John erstmals begegnet war; und es lag ihr ohnehin immer am Herzen, einem hübschen Mädchen zu einem guten Ehemann zu verhelfen.
Der unmittelbare Vorteil, den sie selbst daraus bezog, war nicht unerheblich, denn es war eine unerschöpfliche Quelle von Scherzen auf Kosten beider. In Barton Park machte sie sich über den Oberst lustig und im Cottage über Marianne. Ersterem war ihre Spöttelei, soweit sie nur ihn selbst betraf, wahrscheinlich vollkommen gleichgültig; Letzterer aber war sie zunächst ganz unverständlich, und als sie begriff, worum es ging, wusste sie nicht, ob sie eher über ihre Absurdität lachen oder ihre Unverschämtheit missbilligen sollte. Sie hielt sie nämlich für eine herzlose Stichelei über das fortgerückte Alter des Obersten und seine trostlose Lage als alter Junggeselle.
Mrs. Dashwood, die einen Mann, der fünf Jahre jünger war als sie selbst, nicht für so steinalt halten konnte, wie es der jugendlichen Einbildungskraft ihrer Tochter vorkam, erlaubte sich, Mrs. Jennings von dem Vorwurf freizusprechen, sich über sein Alter lustig zu machen.
»Aber wenigstens, Mama, kannst du doch die Absurdität der Anschuldigung nicht leugnen, auch wenn du nicht an eine böse Absicht glaubst. Oberst Brandon ist gewiss jünger als Mrs. Jennings, aber alt genug, um mein Vater zu sein; und wenn er jemals lebhaft genug war, um sich zu verlieben, dann müssen derartige Gefühle für ihn schon lange der Vergangenheit angehören. Es ist einfach zu lächerlich! Wann ist ein Mann denn überhaupt vor solchen Witzeleien gefeit, wenn ihn nicht einmal sein Alter und seine Gebrechlichkeit schützen?«
»Gebrechlichkeit!«, sagte Elinor, »du nennst Oberst Brandon gebrechlich? Ich kann mir gut vorstellen, dass dir sein Alter wesentlich größer erscheint als unserer Mutter, aber du wirst doch wenigstens bemerkt haben, dass ihm seine Gliedmaßen den Dienst noch nicht versagen?«
»Hast du nicht gehört, wie er über sein Rheuma klagte? Und ist das nicht die verbreitetste Gebrechlichkeit, wenn jemand im Alter abbaut?«
»Mein liebstes Kind«, sagte ihre Mutter lachend, »bei diesem Tempo musst du ja in ständiger Furcht vor meinem Verfall leben; und es muss dir wie ein Wunder vorkommen, dass ich das fortgeschrittene Alter von vierzig erleben durfte.«
»Mama, du weißt genau, wie ich es meine. Ich weiß sehr wohl, dass Oberst Brandon noch nicht das Alter hat, in dem seine Freunde befürchten müssten, dass er bald eines natürlichen Todes stirbt. Er kann noch zwanzig Jahre leben. Aber mit fünfunddreißig kann es nicht mehr um eine Ehe gehen.«
»Vielleicht«, sagte Elinor, »sollte es mit fünfunddreißig und siebzehn lieber nicht um eine gemeinsame Ehe gehen. Aber sollte sich durch Zufall einmal eine Frau finden, die alleine steht und siebenundzwanzig ist, würde ich Oberst Brandons fünfunddreißig Jahre nicht für einen Einwand dagegen halten, dass er sie heiratet.«
»Eine Frau von siebenundzwanzig Jahren«, sagte Marianne nach einer kurzen Pause, »kann nicht darauf hoffen, jemals wieder zu lieben oder geliebt zu werden. Wenn sie unter schlechten häuslichen Umständen leidet oder nur wenig besitzt, dann kann ich mir vorstellen, dass sie sich darauf einlässt, die Aufgaben einer Pflegerin zu übernehmen, um die Versorgung und Sicherheit einer Ehefrau zu erlangen. Sollte er also eine solche Frau heiraten, wäre dies nichts Unschickliches. Es wäre eine Übereinkunft zum gegenseitigen Nutzen, und die Welt wäre es zufrieden. In meinen Augen wäre es überhaupt keine Ehe, aber das hat nichts zu besagen. Ich sähe darin nur einen geschäftlichen Tauschvorgang, bei dem jeder auf Kosten des anderen zu profitieren versucht.«
»Ich weiß, dass es unmöglich ist«, erwiderte Elinor, »dich davon zu überzeugen, dass eine Frau von siebenundzwanzig Jahren für einen Mann von fünfunddreißig etwas empfinden kann, das der Liebe nahe genug kommt, um ihn zu einem begehrenswerten Gefährten für sie zu machen. Aber ich muss dagegen protestieren, dass du Oberst Brandon und seine Frau dazu verurteilst, aus dem Krankenzimmer gar nicht mehr herauszukommen, nur weil er zufällig gestern, an einem überaus nasskalten Tag, über einen leichten rheumatischen Schmerz in seiner Schulter klagte.«
»Aber er sprach von Flanellwesten«, sagte Marianne, »und für mich ist eine Flanellweste ausnahmslos mit Schmerzen, Krämpfen, Rheuma und allen möglichen Unpässlichkeiten verbunden, von denen die Alten und Schwachen geplagt werden.«
»Hätte er lediglich starkes Fieber gehabt, dann würdest du dich bei weitem nicht so über ihn erheben. Gib zu, Marianne, haben die gerötete Wange, das tiefliegende Auge und der rasende Puls eines Fiebernden für dich nicht etwas Faszinierendes?«
Aus: Sense and Sensibility, Kap. 7/8
Stolz und Vorurteil
Mr. Darcys Stolz
Nach dem Tee erinnerte Mr. Hurst seine Schwägerin an den Kartentisch – doch vergeblich. Aus vertraulicher Quelle hatte sie erfahren, dass Mr. Darcy nicht zu spielen wünschte, und Mr. Hurst musste bald einsehen, dass auch seinem offenen Werben kein Erfolg beschieden war. Sie versicherte ihm, dass niemand Karten spielen wollte, und das Schweigen der versammelten Gesellschaft zu diesem Thema schien ihr recht zu geben. Mr. Hurst blieb folglich nichts anderes übrig, als sich auf einem der Sofas auszustrecken und einzuschlafen. Darcy nahm ein Buch zur Hand, Miss Bingley tat es ihm gleich, und Mrs. Hurst, die im Wesentlichen damit beschäftigt war, an ihren Armbändern und Ringen herumzuspielen, schaltete sich hin und wieder in das Gespräch ihres Bruders mit Miss Bennet ein.
Miss Bingleys Aufmerksamkeit war nicht weniger darauf gerichtet, Mr. Darcys Fortschritte in seinem Buch im Auge zu behalten, als ihr eigenes zu lesen; und sie stellte dauernd irgendwelche Fragen oder schaute auf die Seite, die er aufgeschlagen hatte. Sie konnte ihn jedoch nicht für ein Gespräch gewinnen; er beantwortete lediglich ihre Frage und las weiter. Schließlich, durchaus erschöpft von dem Versuch, sich mit ihrem eigenen Buch zu vergnügen, das sie sich nur ausgesucht hatte, weil es der zweite Band des seinigen war, gähnte sie herzhaft und sagte: »Wie angenehm es ist, einen Abend auf diese Weise zu verbringen! Im Grunde genommen gibt es kein größeres Vergnügen, als zu lesen! Alles andere ermüdet einen so viel schneller als ein Buch! Wenn ich einmal mein eigenes Haus habe, wäre ich todunglücklich, wenn es dort nicht eine ausgezeichnete Bibliothek gäbe.«
Niemand antwortete. Also gähnte sie nochmals, warf ihr Buch beiseite und blickte auf der Suche nach Zerstreuung im Zimmer umher; als sie hörte, dass ihr Bruder Miss Bennet gegenüber von einem Ball sprach, wandte sie sich abrupt zu ihm um und sagte:
»Übrigens, Charles, denkst du ernsthaft an einen Tanzabend in Netherfield? Ich würde dir raten, bevor du dich dazu entschließt, erst die Wünsche der hiesigen Gesellschaft zu erfragen; ich müsste mich schon sehr irren, wenn da nicht einige unter uns wären, für die ein Ball eher eine Strafe als ein Vergnügen ist.«
»Wenn du Darcy meinst«, rief ihr Bruder, »der kann zu Bett gehen, bevor der Tanz beginnt, wenn er möchte – was aber den Ball angeht, der ist beschlossene Sache; und sobald Nicholls genug Weiße Suppe vorbereitet hat, schicke ich die Einladungen raus.«
»Mir würden Bälle unendlich viel besser gefallen«, erwiderte sie, »wenn man sie anders aufzöge; aber so, wie sich eine solche Veranstaltung üblicherweise abspielt, hat sie etwas unsäglich Ermüdendes. Es wäre sicher sehr viel vernünftiger, wenn die Unterhaltung und nicht der Tanz im Vordergrund stünden.«
»Sehr viel vernünftiger, liebe Caroline, das glaube ich gern, nur mit einem Ball hätte es dann nicht mehr so viel zu tun.«
Miss Bingley entgegnete nichts und erhob sich bald darauf, um sich im Zimmer zu ergehen. Sie war von anmutiger Gestalt und hatte einen gefälligen Gang, aber Darcy, auf den das alles zielte, blieb unerbittlich in sein Buch vertieft. In ihrer Verzweiflung entschied sie sich für einen letzten Versuch, wandte sich zu Elizabeth und sagte:
»Miss Eliza Bennet, folgen Sie meinem Beispiel und drehen Sie eine Runde durch den Raum. Glauben Sie mir, das ist sehr erholsam, wenn man so lange in ein und derselben Haltung dagesessen hat.«
Elizabeth war überrascht, stimmte aber sofort zu. Auch mit dem eigentlichen Objekt ihrer höflichen Anteilnahme hatte Miss Bingley Glück; Mr. Darcy blickte auf. Er fand die Beachtung, die sie Elizabeth auf einmal schenkte, so auffällig wie diese selbst und klappte unbewusst sein Buch zu. Sofort wurde er aufgefordert, sich den beiden anzuschließen, lehnte aber mit der Bemerkung ab, er könne sich nur zwei Gründe dafür vorstellen, dass sie gemeinsam im Raum auf und ab gingen, von denen jeder gegen eine Beteiligung seinerseits spreche. »Was konnte er wohl damit meinen? Sie wollte um alles in der Welt wissen, was er gemeint haben könnte« – und fragte Elizabeth, ob sie ihn denn verstanden habe?
»Nicht im Geringsten«, lautete die Antwort, »aber verlassen Sie sich drauf, er möchte streng mit uns sein, und die sicherste Weise, ihn zu enttäuschen, ist, nicht weiter nachzufragen.«
Miss Bingley indes war es nicht gegeben, Mr. Darcy in irgendeiner Hinsicht zu enttäuschen, und so beharrte sie auf einer Erklärung seiner zwei Gründe.
»Ich habe überhaupt nichts dagegen, sie zu erklären«, sagte er, sobald sie ihn zu Wort kommen ließ. »Entweder Sie verbringen den Abend auf diese Weise, weil Sie einen vertraulichen Umgang miteinander pflegen und geheime Dinge zu besprechen haben, oder es ist Ihnen bewusst, dass Ihre Figuren im Gehen ganz ausgezeichnet zur Geltung kommen – im ersten Fall wäre ich Ihnen komplett im Wege, und im zweiten kann ich Sie viel besser bewundern, wenn ich am Feuer sitze.«
»Also, schockierend!«, rief Miss Bingely aus. »So etwas Abscheuliches habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Wie wollen wir ihn dafür bestrafen, solche Reden zu führen?«
»Nichts leichter als das, wenn man nur will«, sagte Elizabeth. »Wir alle können uns gegenseitig triezen und ärgern. Necken Sie ihn, lachen Sie ihn aus. So vertraut, wie Sie mit ihm sind, müssen Sie doch wissen, wie das geht.«
»Nein, ich weiß es leider nicht. Glauben Sie mir, das hat mich meine Vertrautheit noch nicht gelehrt. Gemütsruhe und Geistesgegenwart necken! Nein, nein – ich fürchte, da wird er uns mit Leichtigkeit Paroli bieten. Und was das Auslachen angeht, so werden wir uns doch, wenn ich bitten darf, nicht die Blöße geben, zu lachen, ohne zu wissen, worüber. Mr. Darcy kann sich beglückwünschen.«
»Über Mr. Darcy darf nicht gelacht werden!«, rief Elizabeth. »Das ist ein seltener Vorzug, und ich hoffe, es wird auch ein seltener bleiben, denn für mich wäre es ein großer Verlust, viele solcher Bekannter zu haben. Ich lache nun mal von Herzen gern.«
»Miss Bingley«, sagte er, »traut mir mehr zu, als überhaupt möglich ist. Der klügste und der beste aller Menschen, ja, die klügsten und besten ihrer Taten können von jedem ins Lächerliche gezogen werden, der nichts Höheres kennt, als aus allem einen Witz zu machen.«
»Gewiss«, erwiderte Elizabeth, »gibt es solche Menschen, ich hoffe jedoch, dass ich nicht zu ihnen zähle. Ich hoffe, niemals etwas lächerlich zu machen, das klug oder gut ist. Torheiten und Unsinn, Marotten und Ungereimtheiten belustigen mich in der Tat, wie ich gerne zugebe, und ich lache über sie, wann immer ich kann. Aber von genau solchen Schwächen sind Sie wahrscheinlich frei.«
»Davon ist vermutlich niemand frei. Jedoch habe ich mich mein Leben lang immer bemüht, Schwächen zu vermeiden, die einen souveränen Verstand dem Spott preisgeben.«
»Wie etwa Eitelkeit und Stolz.«
»Ja, Eitelkeit ist wahrlich eine Schwäche. Stolz aber – wo wirkliche geistige Überlegenheit herrscht, wird man den Stolz stets gut im Griff haben.«
Elizabeth wandte sich ab, um ein Lächeln zu verbergen.
»Ihre Untersuchung Mr. Darcys ist abgeschlossen, vermute ich«, sagte Miss Bingley, »und was bitte ist das Ergebnis?«
»Ich bin vollkommen davon überzeugt, dass Mr. Darcy nicht einen einzigen Fehler hat. Er gibt es selbst unumwunden zu.«
»Nein«, sagte Darcy, »ich habe nichts dergleichen behauptet. Ich habe Fehler genug, aber es sind hoffentlich keine, die dem Intellekt Abbruch tun. Für mein Temperament lege ich lieber nicht die Hand ins Feuer. Ich glaube, es ist zu unnachgiebig – zumindest ist das die Meinung der Leute. Ich kann die Torheiten und Laster anderer nicht so schnell vergessen, wie ich sollte, genauso wenig wie die Kränkungen, die man mir zufügt. Ich lasse mich nicht gleich von jeder Schmeichelei beeinflussen. Man könnte vielleicht sagen, dass ich vom Temperament her nachtragend bin. Ist meine gute Meinung einmal verloren, dann für immer.«
»Das ist nun wirklich eine Schwäche!«, rief Elizabeth. »Unversöhnlicher Groll wirft allerdings einen Schatten auf die Persönlichkeit. Aber Sie haben sich Ihren Fehler gut ausgesucht. Lachen kann ich über ihn nicht. Vor mir sind Sie sicher.«
»Es gibt, glaube ich, in jedem Naturell eine Veranlagung zu irgendeinem besonderen Übel, einer natürlichen Schwäche, über die auch die beste Erziehung nicht hinweghelfen kann.«
»Und Ihre Schwäche ist die Neigung, alle Welt zu hassen.«
»Und Ihre«, erwiderte er lächelnd, »ist es, sie absichtlich misszuverstehen.«
»Lassen Sie uns ein wenig Musik machen«, rief Miss Bingley, die eines Gespräches überdrüssig war, an dem sie keinen Anteil hatte. »Louisa, du wirst verzeihen, wenn ich Mr. Hurst wecke.«
Ihre Schwester hatte rein gar nichts dagegen, das Klavier wurde geöffnet, und Darcy war, nach kurzem Nachdenken, nicht unglücklich darüber. Er spürte, dass es gefährlich werden konnte, Elizabeth zu viel Aufmerksamkeit zu widmen.
Aus: Pride and Prejudice, Kap. 11
Mr. Darcys Charakter
Bis Elizabeth in den Salon von Netherfield trat und unter den dort versammelten Rotröcken vergeblich nach Mr. Wickham Ausschau hielt, war ihr nie in den Sinn gekommen, er könnte möglicherweise gar nicht anwesend sein. Hätte sie die vergangenen Geschehnisse genauer durchdacht, dann hätte sie durchaus Gründe finden können, an ihrer Gewissheit, ihm zu begegnen, zu zweifeln. Sie hatte ihre Garderobe mit mehr als üblicher Sorgfalt gewählt und sich in Hochstimmung darauf vorbereitet, sein Herz, wo es etwa im Einzelnen noch nicht bezwungen war, vollends zu erobern, ganz im Vertrauen darauf, dass es nicht mehr Widerstand leisten würde, als im Laufe eines Abends zu überwinden wäre. Nun aber kam ihr schlagartig der Verdacht, dass man ihn bei der Einladung der Bingleys an die Offiziere absichtlich übergangen hatte, um Mr. Darcy einen Gefallen zu tun; und obwohl das nicht ganz stimmte, wurde seine Abwesenheit von seinem Freund Mr. Denny, an den Lydia sich ungeduldig wandte, zur unwiderruflichen Tatsache erklärt, und er berichtete ihnen, dass Wickham sich am Vorabend genötigt gesehen hatte, geschäftlicher Dinge wegen in die Stadt zu fahren, und noch nicht zurückgekehrt war. Mit einem vielsagenden Lächeln fügte er hinzu:
»Ich glaube nicht, dass seine Geschäfte ihn gerade jetzt so beansprucht hätten, wenn er nicht einem bestimmten Herrn hier in diesem Raum hätte aus dem Weg gehen wollen.«
Diesen Teil seiner Information bekam Lydia nicht mit, sehr wohl aber Elizabeth, und da er sie davon überzeugte, dass Darcy ebenso sehr für Wickhams Abwesenheit verantwortlich war, wie wenn ihre erste Vermutung zugetroffen hätte, verschärfte ihre gegenwärtige Enttäuschung ihren gesammelten Unmut über Mr. Darcy so sehr, dass sie kaum in der Lage war, mit leidlicher Höflichkeit auf die freundlichen Erkundigungen zu reagieren, mit denen dieser im nächsten Moment an sie herantrat. Aufmerksamkeit, Nachsicht, Geduld mit Darcy hieß, Wickham zu beleidigen. Sie war entschlossen, kein Wort mit ihm zu wechseln, und konnte ihre denkbar schlechte Laune nicht einmal im Gespräch mit Mr. Bingley ganz überwinden, dessen blinde Parteilichkeit sie aufregte.




![Emma (Centaur Classics) [The 100 greatest novels of all time - #38] - Jane Austen. - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/ba91eea69a27a8fd52d9e1952c7c4a74/w200_u90.jpg)