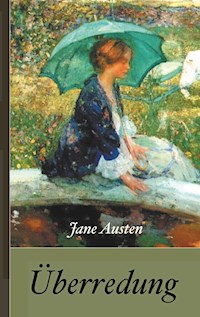8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manesse
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach dem Tod des Vaters müssen die Schwestern Elinor und Marianne Dashwood aus dem herrschaftlichen Haus in ein kleines Cottage in Devonshire umziehen. Während die besonnene Elinor still leidet, stürzt sich die impulsive, sprunghafte Marianne Hals über Kopf in die Liebe zu einem begehrten Frauenschwarm ... Die Geschichte zweier ungleicher Schwestern markiert den Beginn von Jane Austens Romanwerk und besticht durch kunstvollen Handlungsbau, glänzende Charakterzeichnungen und virtuose Dialoge.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 593
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Nach dem Tod des Vaters müssen die Schwestern Elinor und Marianne Dashwood aus dem herrschaftlichen Haus in ein kleines Cottage in Devonshire umziehen. Während die besonnene Elinor still leidet, stürzt sich die impulsive, sprunghafte Marianne Hals über Kopf in die Liebe zu einem begehrten Frauenschwarm …
Die Geschichte zweier ungleicher Schwestern markiert den Beginn von Jane Austens Romanwerk und besticht durch kunstvollen Handlungsbau, glänzende Charakterzeichnungen und virtuose Dialoge.
JANE AUSTEN (1775–1817) wurde in Steventon, Hampshire, geboren und wuchs im elterlichen Pfarrhaus auf. Nach Meinung ihres Bruders führte sie »ein ereignisloses Leben«. Sie heiratete nie. Ihre literarische Welt war die des englischen Landadels, deren wohl kaschierte Abgründe sie mit feiner Ironie und Satire entlarvte. Psychologisches Feingefühl und eine lebendige Sprache machen ihre scheinbar konventionellen Liebesgeschichten zu einer spannenden Lektüre. Die jüngsten Verfilmungen ihrer Romane wie »Emma« (1996) mit Gwyneth Paltrow oder »Stolz und Vorurteil« (2005) mit Keira Knightley waren Kassenschlager.
Inhaltsverzeichnis
Erstes Buch
Kapitel 1
Die Dashwoods waren lange in Sussex ansässig gewesen. Ihre Besitzung war groß, und ihre Residenz, Norland Park, lag mitten in ihren Gütern, wo sie schon seit Generationen so wohlanständig gelebt hatten, daß sie sich des besten Rufs bei ihren Nachbarn erfreuten. Der verstorbene Eigentümer war Junggeselle gewesen; er wurde sehr alt und hatte viele Jahre seines Lebens eine treue Gefährtin und Haushälterin in seiner Schwester. Doch ihr Tod, der zehn Jahre vor seinem eigenen eintrat, brachte eine große Veränderung in seinem Heim mit sich; denn, um ihren Verlust zu ersetzen, lud er die Familie seines Neffen, Mr. Henry Dashwood, in sein Haus ein und empfing damit den gesetzlichen Erben der Norland-Güter, die er ihm auch zu vermachen gedachte. In seiner und seiner Nichte Gesellschaft sowie deren Kinder brachte der alte Herr seine Tage bequem hin. Seine Anhänglichkeit an sie alle wuchs. Die beständige Aufmerksamkeit seinen Wünschen gegenüber, die nicht von bloßem Eigennutz, sondern von Herzensgüte herrührte, schenkte ihm alles erdenkliche Behagen, dessen er in seinem Alter bedurfte; und die Heiterkeit der Kinder verschönte sein Dasein.
Mr. Henry Dashwood hatte aus erster Ehe einen Sohn; von seiner jetzigen Frau drei Töchter. Der Sohn, ein verläßlicher, geachteter junger Mann, war durch das Vermögen seiner Mutter reichlich versorgt, denn es war beträchtlich gewesen, und die Hälfte fiel ihm bei seiner Volljährigkeit zu. Dementsprechend vergrößerte er noch seinen Reichtum durch seine eigene bald darauf folgende Heirat. Darum war für ihn die Erbschaft der Norland-Besitzungen nicht so wichtig wie für seine Schwestern; denn ihr Vermögen konnte, unabhängig von dem, was ihnen durch ihres Vaters Erbe zufallen würde, nur gering sein. Ihre Mutter besaß nichts, und ihr Vater hatte nur siebentausend Pfund zur eigenen Verfügung; denn der restliche Anteil aus dem Vermögen seiner ersten Frau war ebenfalls ihrem Sohn vorbehalten, er hatte nur eine Leibrente davon.
Der alte Herr starb: sein Testament wurde eröffnet, und wie fast jedes Testament brachte es ebensoviel Enttäuschung wie Genugtuung. Er war weder so ungerecht noch so undankbar, seinem Neffen den Besitz vorzuenthalten; aber er hinterließ ihn zu solchen Bedingungen, die den Wert des Legates zur Hälfte herabminderten. Mr. Dashwood war es mehr um seine Frau und seine Töchter zu tun als um sich selbst oder seinen Sohn: aber für diesen Sohn und für den Sohn dieses Sohnes, ein Kind von vier Jahren, war alles derart vorgesehen, daß er von sich aus keine Möglichkeit hatte, diejenigen sicherzustellen, die ihm die Liebsten waren und eine Versorgung am meisten nötig hatten, etwa durch eine Belastung des Besitzes oder durch einen Verkauf seiner wertvollen Wälder. Das Ganze war zugunsten dieses Kindes festgelegt, das bei seinen gelegentlichen Besuchen mit Vater und Mutter in Norland die Liebe seines Onkels gewonnen hatte mit dem Charme, der bei zwei- oder dreijährigen Kindern ganz selbstverständlich ist: einer undeutlichen Aussprache, einem dringenden Verlangen, sich durchzusetzen, mit vielen kleinen schlauen Tricks und reichlichem Lärm, so daß es die gesamte Aufmerksamkeit übertraf, die ihm seit Jahren seitens seiner Nichte und deren Töchter zuteil geworden war. Zwar beabsichtigte er nicht, unfreundlich zu sein, und als Zeichen seiner Liebe zu den Töchtern hinterließ er jedem der drei Mädchen eintausend Pfund.
Zuerst war Mr. Dashwood tief enttäuscht; aber er war von heiterem und zuversichtlichem Naturell und konnte billig hoffen, noch viele Jahre zu leben und bei sparsamer Lebensweise eine beträchtliche Summe von dem Ertrag eines schon großen und sofort steigerungsfähigen Besitzes beiseite zu legen. Aber die Fortune, die so zögernd gekommen war, blieb ihm nur zwölf Monate treu. Er überlebte seinen Onkel nicht länger; und zehntausend Pfund einschließlich der überkommenen Legate war alles, was für seine Witwe und Töchter blieb.
Sobald man ihn in Lebensgefahr wußte, wurde nach seinem Sohn gesandt, und Mr. Dashwood legte ihm mit der ganzen Kraft und Dringlichkeit, die seine Krankheit gebieten mochte, die Sorge für seine Stiefmutter und Schwestern ans Herz.
Mr. John Dashwood war nicht so tief bewegt wie die übrige Familie, doch stand er unter dem Einfluß der zu solchem Zeitpunkt so in ihn gesetzten Erwartung und versprach, alles in seiner Macht Liegende zu tun, um sie sorgenfrei zu machen. Sein Vater war durch diese Versicherung erleichtert, und Mr. John Dashwood hatte dann Zeit zu überlegen, wieviel bei vorsichtiger Schätzung in seiner Macht zu tun lag.
Er war kein schlecht veranlagter junger Mann, wenn nicht eine gewisse Kaltherzigkeit und ein gewisser Egoismus in der Tat schlechte Veranlagungen sind; doch war er im allgemeinen gut beleumundet, denn er führte sich mit Anstand bei der Erledigung seiner gewohnten Pflichten auf. Hätte er eine liebenswürdigere Frau geheiratet, wäre er noch angesehener gewesen; er hätte sogar selbst liebenswerter werden können; denn er war sehr jung, als er heiratete, und sehr verliebt in seine Frau. Doch war Frau John Dashwood eine wahre Karikatur seiner selbst: noch engherziger und noch egoistischer.
Während er seinem Vater das Versprechen gab, erwog er innerlich, das Vermögen seiner Schwestern durch ein Geschenk von je eintausend Pfund zu vergrößern. Dazu fand er sich tatsächlich in der Lage. Die Aussicht auf viertausend im Jahr neben seinem gegenwärtigen Einkommen und außer der restlichen Hälfte von seiner eigenen Mutter Vermögen wärmte ihm das Herz und befähigte ihn, großzügig zu sein. Ja, er würde ihnen dreitausend Pfund geben: das wäre freigebig und ansehnlich! Es wäre genug, sie gänzlich sorgenfrei zu machen. Dreitausend Pfund! Er konnte eine so beträchtliche Summe erübrigen, ohne daß es ihm schwerfiel. Er dachte den ganzen Tag darüber nach und noch viele darauf folgende Tage, ohne daß es ihn reute.
Kaum war die Beerdigung seines Vaters vorbei, als Frau John Dashwood, ohne ihrer Schwiegermutter Mitteilung über ihre Absicht zu machen, mit ihrem Kind und ihren Dienstboten eintraf. Niemand konnte ihr das Recht zu kommen bestreiten. Das Haus gehörte ihrem Mann vom Ableben seines Vaters an; doch war ihre Taktlosigkeit um so größer und hätte einer Frau in Mrs. Dashwoods Situation mit nur gewöhnlichen Empfindungen höchst unangenehm sein müssen. Aber zu ihrem Charakter gehörte ein so ausgeprägtes Ehrgefühl, eine so romantische Großmut, daß jede Kränkung dieser Art, von wem immer erteilt oder empfangen, für sie eine Quelle steten Abscheus bedeutete. Frau John Dashwood war von niemandem in der Familie ihres Mannes je wohlgelitten gewesen; doch hatte sie bis jetzt nie Gelegenheit gehabt, ihnen zu zeigen, mit wie wenig Rücksicht auf die anderen sie handeln konnte, wenn sich die Möglichkeit bot.
Mrs. Dashwood empfand mit so stechendem Schmerz dieses widerliche Benehmen und verachtete dafür ihre Schwiegertochter so sehr, daß sie bei deren Ankunft das Haus für immer verlassen hätte, wenn nicht die Bitten ihrer ältesten Tochter sie veranlaßt hätten, über die Richtigkeit des Auszugs nachzudenken – und ihre zärtliche Liebe für ihre drei Kinder sie dann bestimmte zu bleiben und um derentwillen einen Bruch mit ihrem Bruder zu vermeiden.
Elinor, eben die älteste Tochter, deren Rat so folgenreich war, besaß Verstandesschärfe und Urteilskraft, die sie befähigten, obwohl erst neunzehn, ihrer Mutter beizustehen und zu ihrer aller Vorteil diesem Übereifer in Mrs. Dashwood entgegenzuwirken, der sonst zu Unbedachtsamkeit geführt hätte. Sie hatte ein warmes Herz; ihr Naturell war liebenswürdig und ihre Gefühle heftig; doch wußte sie sich zu beherrschen – eine Fähigkeit, die ihre Mutter sich noch aneignen mußte und die eine ihrer Schwestern beschlossen hatte, niemals zu erwerben.
Mariannes Anlagen waren in vieler Hinsicht denen Elinors ziemlich gleich. Sie war empfänglich und klug; aber in allem überschwenglich, ihre Schmerzen und Freuden waren maßlos. Sie war großmütig, freundlich, anziehend, alles, nur nicht vorsichtig. Die Ähnlichkeit zwischen ihr und ihrer Mutter war erstaunlich.
Elinor sah mit Sorge, wie ihre Schwester ihren Gefühlen ausgeliefert war, was aber Mrs. Dashwood schätzte und unterstützte. Sie steigerten einander jetzt in der Heftigkeit ihrer Leidempfindung. Der Schmerz der Trauer, der sie anfänglich überwältigte, wurde mit Absicht erneuert, dann begehrt und wieder und wieder heraufbeschworen. Sie gaben sich ihm gänzlich hin, Steigerung des Elends in jedem nur möglichen Gedanken daran anstrebend und entschlossen, jeden Trost in Zukunft abzuwehren. Auch Elinor war tief getroffen: aber sie vermochte doch zu kämpfen, an sich zu halten. Sie konnte mit ihrem Bruder beraten, konnte ihre Schwägerin bei ihrer Ankunft empfangen und ihr mit angemessener Aufmerksamkeit entgegenkommen; und sie vermochte ihre Mutter zu einer ähnlichen Reaktion und zu ähnlicher Duldsamkeit zu bewegen.
Margaret, die andere Schwester, war ein gutmütiges, nettes Mädchen; doch da sie schon Mariannes Romantik großenteils in sich eingesogen hatte, ohne deren Empfänglichkeit zu besitzen, bemühte sie sich nicht, mit dreizehn ihren älteren Schwestern ähnlich zu werden.
Kapitel 2
Frau John Dashwood machte sich nun zur Herrin auf Norland, und ihre Schwiegermutter und ihre Schwägerinnen wurden in den Stand von Gästen herabgesetzt. Als solche wurden sie immerhin von ihr mit ruhiger Höflichkeit behandelt und von ihrem Mann mit soviel Freundlichkeit, wie er für jemanden außer für sich selbst, seine Frau und sein Kind, aufbringen konnte. Ja, er drängte sie, sogar mit einigem Eifer, Norland noch als ihr Heim anzusehen; und da Mrs. Dashwood keinen Plan so annehmbar fand, als dazubleiben, bis sie in der Nachbarschaft ein Haus gefunden hatte, kam sie seiner Aufforderung nach.
Ein Verbleiben an einem Ort, wo alles an ihr früheres Glück erinnerte, entsprach ganz ihrem Wunsch. In Zeiten der Heiterkeit konnte niemand aufgeräumter sein als sie oder in bedeutenderem Grade jene zuversichtliche Glückserwartung besitzen, die das Glück selbst ausmacht. Doch im Schmerz mußte sie ebenso von ihrer Phantasie fortgetragen werden, und sie war gleich fern vom Trost wie in der Freude, ohne Maß.
Frau John Dashwood billigte keineswegs, was ihr Mann für seine Schwestern tun wollte. Dreitausend Pfund vom Vermögen ihres lieben Söhnchens zu nehmen, würde ihn an den Bettelstab bringen. Sie bat ihn, die Sache nochmals zu überdenken. Wie konnte er es vor sich selbst verantworten, sein Kind, sein einziges, einer solchen Riesensumme zu berauben? Und welchen möglichen Anspruch konnten schon die Fräulein Dashwood erheben, die ihm nur zur Hälfte blutsverwandt waren, eine Verwandtschaft, die sie gar nicht als solche erachtete – Anspruch auf seine Freigabe einer so hohen Summe? Erfahrungsgemäß war nicht anzunehmen, daß zwischen Kindern aus verschiedenen Ehen Liebe existierte; und warum sollte er sich und ihren armen kleinen Harry ruinieren, indem er all sein Geld seinen Halbschwestern zuschanzte?
»Es war meines Vaters letzte Bitte an mich«, erwiderte ihr Mann, »daß ich seiner Witwe und den Töchtern helfen sollte.«
»Er wußte nicht, was er redete, meine ich; zehn gegen eins war er verwirrt zu dem Zeitpunkt. Wäre er ganz bei Verstand gewesen, hätte er dich niemals darum gebeten, die Hälfte deines Vermögens deinem eigenen Kind zu entziehen.«
»Er bestand nicht auf einer bestimmten Summe, meine liebe Fanny; er bat mich nur im allgemeinen, ihnen beizustehen und ihre Lage erträglicher zu machen, als es in seiner Macht lag. Vielleicht hätte er es ebensogut ganz mir überlassen. Er konnte kaum annehmen, daß ich sie vernachlässigen würde. Aber da er das Versprechen verlangte, mußte ich es ihm doch geben: zumindest dachte ich damals so. Das Versprechen ist also gemacht, und es muß gehalten werden. Etwas muß für sie geschehen, wenn sie Norland verlassen und sich in einem neuen Heim einrichten.«
»Na, dann laß etwas für sie geschehen. Aber das Etwas muß doch nicht gleich dreitausend Pfund sein. Bedenke«, fügte sie hinzu, »wenn man sich einmal vom Geld getrennt hat, kommt es nicht mehr zurück. Deine Schwestern werden heiraten, und es ist für immer dahin. Wenn es wirklich je deinem armen kleinen Knaben zurückerstattet werden könnte …«
»Ja sicher«, sagte ihr Mann todernst, »das wäre ein großer Unterschied. Die Zeit könnte kommen, daß Harry es bedauert, daß man sich von einer so großen Summe trennte. Wenn er eine zahlreiche Familie haben sollte, wäre es eine angenehme Beisteuer.«
»Aber ganz bestimmt wäre es das!«
»Dann wäre es vielleicht für alle Teile besser, wenn die Summe um die Hälfte verringert würde. Fünfhundert Pfund wären ein wunderbarer Vermögenszuwachs für sie!«
»Oh, jenseits aller Vorstellung! Welcher Bruder auf Erden würde für seine Schwestern halb soviel tun, selbst wenn es seine richtigen Schwestern wären! Und wie es hier liegt – nur Stiefschwestern! Aber du bist dermaßen generös!«
»Ich würde ungern etwas Gemeines tun«, antwortete er, »man sollte bei solchen Gelegenheiten lieber zuviel als zuwenig tun. Wenigstens kann niemand finden, ich hätte nicht genug für sie getan. Sogar sie selbst können kaum mehr erwarten.«
»Das weiß man nicht, was sie erwarten«, sagte die feine Frau, »aber wir können doch nicht über ihre Erwartungen nachdenken: die Frage ist, was du erschwingen kannst.«
»Natürlich; und ich denke, ich vermag fünfhundert Pfund für jede aufzubringen. Auf diese Weise hätten sie ohne Hinzutun aus meinem Vermögen jede über dreitausend Pfund beim Tod ihrer Mutter – ein sehr ansehnliches Vermögen für eine junge Dame.«
»Ganz bestimmt ist es das; und ich finde wirklich, daß sie keinerlei Beisteuer verlangen können. Sie werden zehntausend Pfund unter sich zu teilen haben. Wenn sie heiraten, sind sie sichergestellt oder im Wohlstand, und wenn nicht, können sie alle miteinander sehr bequem von den Zinsen von zehntausend Pfund leben.«
»Wie recht du hast! Und darum frage ich mich, ob es nicht angebrachter wäre, etwas für ihre Mutter bei ihren Lebzeiten zu tun als für sie – so etwas wie eine Rente, dachte ich. Meine Schwestern würden die guten Folgen ebenso spüren wie sie selbst. Einhundert pro Jahr würde sie alle bestens versorgen.«
Seine Frau zögerte etwas, ihre Zustimmung zu seinem Plan zu geben.
»Sicher«, sagte sie, »ist es besser, als sich von fünfzehnhundert Pfund sofort zu trennen. Anderseits, wenn Mrs. Dashwood fünfzehn Jahre leben sollte, sind wir gänzlich hereingefallen.«
»Fünfzehn Jahre! Fanny, Liebe, sie hat nicht mehr halb so lang zu leben!«
»Sicher nicht; aber wenn du dich mal umsiehst, leben die Leute immer ewig, wenn sie eine Rente bekommen, und sie ist sehr kräftig und gesund und noch keine vierzig. Eine Rente ist ein ernstes Risiko; sie läuft und läuft Jahr um Jahr, und man kann sie sich nicht mehr vom Hals schaffen. Du ahnst nicht, was du tust. Das Elend mit den Renten kenne ich zur Genüge. Denn meine Mutter mußte sich meines Vaters Testament zufolge mit der Zahlung an drei hochbetagte Dienstboten herumschleppen, und es ist unglaublich, wie zuwider ihr das war. Zweimal jedes Jahr mußten die Renten bezahlt werden. Und dann der ganze Umstand, sie zu ihnen zu bringen, und dann hieß es, eine von ihnen sei gestorben, und hinterher war es gar nicht so. Meine Mutter hatte es wirklich satt. Ihre Einkünfte gehörten ihr nicht mehr, sagte sie, mit solchen dauernden Ansprüchen darauf; und es war reichlich rücksichtslos von meinem Vater, denn andernfalls wäre das Geld ganz zur Verfügung meiner Mutter gewesen, ohne jede Einschränkung. Das hat bei mir solchen Abscheu gegen Renten verursacht, daß ich mich keinesfalls auf eine solche Zahlung festnageln ließe, nicht um alles in der Welt.«
»Es ist bestimmt etwas Unerfreuliches«, entgegnete Mr. Dashwood, »einen solchen jährlichen Abzug in Kauf zu nehmen. Das Vermögen gehört einem nicht mehr selbst, wie deine Mutter richtig bemerkt. An die regelmäßige Leistung einer solchen Summe an jedem Rententag gebunden zu sein, ist keineswegs erstrebenswert; es nimmt einem die Unabhängigkeit.«
»Zweifellos; und schließlich dankt es dir keiner. Sie halten sich für gesichert; tue du nicht mehr, als was erwartet wird, es bringt sowieso keine Dankbarkeit ein. Wenn ich du wäre, würde ich ganz nach eigenem Gutdünken handeln. Ich würde mich nicht binden, ihnen jährlich etwas zu bewilligen. Es könnte in wenigen Jahren sehr schwierig sein, einhundert oder auch nur fünfzig Pfund von unseren eigenen Unkosten abzuzweigen.«
»Du hast sicher recht, mein Liebes; man sollte in dem Fall besser keine Rente aussetzen; was immer ich ihnen gelegentlich zukommen lasse, ist ihnen von viel größerer Hilfe als eine jährliche Entschädigung, denn sie würden doch bloß auf größerem Fuß leben, wenn sie mit einem größeren Einkommen rechneten, und wären deshalb nicht um ein Sixpence reicher am Jahresende. Es ist bestimmt die beste Form: ein Geschenk von fünfzig Pfund hier und da, das schützt sie vor der schlimmsten Geldnot und wird, meine ich, weitgehend mein Versprechen meinem Vater gegenüber erfüllen.«
»Aber sicher wird es das. Um ehrlich zu sein, ich bin innerlich überzeugt, daß dein Vater gar nicht wollte, daß du ihnen überhaupt Geld geben solltest. Der Beistand, den er meinte, war jedenfalls nur solcherart, wie man ihn vernünftigerweise von dir erwarten konnte; zum Beispiel, daß du ein nettes kleines Haus für sie suchen hilfst, ihnen beim Umzug behilflich bist, ihnen Geschenke wie Fische und Wild zur Jagdzeit sendest und dergleichen mehr. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, daß er nichts weiter gemeint hat; andernfalls wäre es tatsächlich sehr seltsam und unvernünftig von ihm gewesen. Überlege nur, mein lieber Herr und Meister, wie unwahrscheinlich bequem deine Stiefmutter und ihre Töchter von den Zinsen von siebentausend Pfund leben können, außer den tausend Pfund der Mädchen, was jeder je fünfzig Pfund im Jahr einbringt, und dann, natürlich, werden sie davon ihrer Mutter Kost und Logis bezahlen. Im ganzen werden sie fünfhundert im Jahr haben, und was, in aller Welt, können denn vier Frauen noch mehr wollen? – Sie werden so billig wirtschaften! Ihre Haushaltung läuft gar nicht ins Geld. Sie brauchen keinen Wagen zu halten, keine Pferde und kaum Personal; sie werden keinen Verkehr pflegen und können keinerlei Unkosten haben! Bedenke nur, wie gut sie es haben werden! Fünfhundert im Jahr! Ich kann mir wirklich gar nicht vorstellen, wie sie nur die Hälfte davon ausgeben wollen; und wenn du ihnen noch mehr geben willst, so ist das ein ganz absurder Gedanke. Sie werden vielmehr in der Lage sein, dir etwas zu geben.«
»Auf Ehre«, sagte Mr. Dashwood, »ich glaube, du hast vollkommen recht. Mein Vater konnte mit seinem Ansinnen an mich nichts anderes meinen, als was du sagst. Ich sehe jetzt ganz klar und will meine Verbindlichkeit strikt erfüllen durch solche Hilfeleistungen und Freundlichkeiten ihnen gegenüber, wie du sie beschreibst. Wenn meine Mutter in ein anderes Haus umzieht, werden meine Dienste ihr gern zur Verfügung stehen, um sie so gut wie nur möglich unterzubringen. Ein kleines Möbelstück als Geschenk wird ihnen dann ganz willkommen sein.«
»Bestimmt«, erwiderte Frau John Dashwood. »Trotzdem müssen wir uns aber eins vor Augen halten: als deine Eltern nach Norland zogen, wurden zwar die Möbel von Stanhill verkauft, aber das ganze Porzellan, das Silber und die Wäsche wurden gerettet und sind nun auf deine Mutter übergegangen. Ihr Haus wird darum fast komplett ausgestattet sein, sobald sie es bezieht.«
»Das ist natürlich eine wichtige Überlegung. Tatsächlich eine wertvolle Hinterlassenschaft! Doch würde etwas von dem Silber eine sehr erfreuliche Ergänzung unseres eigenen hier gewesen sein.«
»Ja; und das Frühstücksservice ist doppelt so hübsch wie das zu diesem Haus gehörige. Viel zu hübsch, finde ich, für irgendein Haus, das sie sich leisten können. Aber so ist das nun. Dein Vater hat nur an sie gedacht. Und ich muß schon sagen, daß du ihm keinen besonderen Dank schuldest, noch seinen Wünschen Gehorsam; denn wir wissen nur zu gut, daß, hätte er es gekonnt, er fast alles auf der Welt ihnen vermacht hätte.«
Dieses Argument war durchschlagend. Es bestimmte seine Intentionen, denen es bis dahin an Entschlußkraft gefehlt hatte; und endlich entschied er, daß es absolut unnötig, wenn nicht sogar höchst taktlos wäre, für die Witwe und die Kinder seines Vaters mehr zu leisten als solche Art nachbarlicher Hilfe, wie es seine eigene Frau ihm nahegelegt hatte.
Kapitel 3
Mrs. Dashwood blieb mehrere Monate lang auf Norland; nicht weil sie dagegen war, auszuziehen, als der Anblick jedes vertrauten Winkels allmählich nicht mehr eine heftige Gemütsbewegung in ihr hervorrief – denn als ihre Lebensgeister wieder erwachten und ihre Seele auch anderer Regungen fähig wurde, als ihren Schmerz durch melancholische Erinnerungen zu steigern, strebte sie ungeduldig fort und war unermüdlich in ihren Erkundungen nach einer angemessenen Bleibe in der Nähe von Norland; denn weit weg von der geliebten Umgebung zu ziehen, war ihr unmöglich.
Jedoch konnte sie kein Objekt in Erfahrung bringen, das sowohl ihren Vorstellungen von Behaglichkeit und Ruhe als auch der sparsamen Vorsicht ihrer ältesten Tochter entsprach, deren praktisches Urteil verschiedene Häuser, die ihrer Mutter gefallen hätten, als zu groß für ihr Einkommen zurückgewiesen hatte.
Mrs. Dashwood war von ihrem Mann in Kenntnis gesetzt worden von dem feierlichen Versprechen seines Sohnes zu ihren Gunsten, was seinen letzten irdischen Betrachtungen Trost verliehen hatte. Sie bezweifelte die Ehrlichkeit seiner Zusicherungen ebensowenig, wie er selbst sie bezweifelt hatte, und dachte um ihrer Töchter willen mit Befriedigung daran, obwohl sie, was sie persönlich anging, überzeugt war, daß sie mit einer viel geringeren Versorgung als siebentausend Pfund überreich versehen sei. Auch um des Stiefsohns willen und ihrer selbst war sie hocherfreut; und sie machte sich Vorwürfe, ungerecht gewesen zu sein, da sie ihm Großmut nie zugetraut hatte. Sein aufmerksames Betragen ihr und seinen Schwestern gegenüber überzeugte sie, daß er sich ihr Wohlergehen angelegen sein lasse, und eine lange Zeit baute sie fest auf seine freigebigen Absichten.
Die Verächtlichkeit, die sie schon in einem sehr frühen Stadium der Bekanntschaft für ihre Schwiegertochter Fanny empfand, steigerte sich erheblich bei näherem Kennenlernen ihres Charakters, wozu ein halbjähriger Verbleib in der Familie Gelegenheit bot; und vielleicht hätten trotz der Wahrung höflicher Formen oder mütterlicher Zuneigung der letzteren die beiden Damen unmöglich so lange zusammen wohnen können, wenn nicht ein besonderer Umstand in den Augen von Mrs. Dashwood den Aufenthalt ihrer Töchter auf Norland hätte wünschenswert erscheinen lassen.
Dieser Umstand war eine wachsende Vertrautheit zwischen ihrer ältesten Tochter und dem Bruder von Frau John Dashwood, einem salonfähigen und netten jungen Mann, der ihnen bald nach dem Einzug seiner Schwester auf Norland vorgestellt wurde und der seitdem die meiste Zeit dort verbrachte.
Manche Mutter würde die Neigung der beiden aus Vernunftgründen unterstützt haben, denn Edward Ferrars war der älteste Sohn eines sehr reich verstorbenen Mannes; und manche hätte sie unterdrückt aus Gründen der Vorsicht, denn außer einer geringen Summe hing sein ganzes Vermögen vom Testament seiner Mutter ab. Aber Mrs. Dashwood war von beiden Überlegungen frei. Es genügte ihr, daß er anscheinend liebenswert war, ihre Tochter liebte und daß Elinor seine Neigung erwiderte. Es war gegen alle ihre Grundsätze, daß der Vermögensunterschied ein Paar trennen sollte, das durch die Ähnlichkeit der Veranlagung gegenseitig angezogen war; und daß Elinors Charakter nicht von jedem, der sie kannte, anerkannt würde, war für ihre Begriffe unmöglich.
Edward Ferrars konnte ihre gute Meinung weder durch besondere Vornehmheit der Person noch durch sein Auftreten gewinnen. Er war nicht hübsch, und seine Manieren verlangten Vertrautheit, damit sie erfreulich wurden. Er war zu schüchtern, um sich selbst ins rechte Licht zu setzen; aber wenn seine natürliche Scheu überwunden war, zeigte sein Betragen alle Merkmale eines offenen, liebesfähigen Herzens. Sein Verstand war hell und durch Erziehung tüchtig entwickelt. Aber er war nicht mit Talenten oder Anlagen begabt, die den Wünschen seiner Mutter und Schwester entgegenkamen, die ihn gern als einen Besonderen – sie wußten selbst nicht was – gesehen hätten. Sie erwarteten, daß er in dieser Welt sich auf irgendeine Weise auszeichnete. Seine Mutter wollte ihn am politischen Leben interessieren, um ihn ins Parlament oder mit Berühmtheiten des Tages in Verbindung zu bringen. Frau John Dashwood wünschte es ebenso; aber in der Zwischenzeit, bis eine dieser Segnungen erreicht sein würde, hätte es ihren Ehrgeiz befriedigt, wenn er eine Barutsche1 kutschiert hätte. Aber Edward hatte keinen Hang zu berühmten Männern und Barutschen. Alle seine Wünsche richteten sich auf häusliche Behaglichkeit und ein ruhiges Privatleben. Glücklicherweise hatte er einen jüngeren Bruder, der vielversprechender war. Ref 1
Edward war schon eine Reihe von Wochen im Hause, bevor er ein wenig von Mrs. Dashwoods Aufmerksamkeit auf sich zog, denn sie befand sich damals in solcher Trauer, daß sie ihrer Umgebung gegenüber gleichgültig war. Sie merkte nur, daß er still und unaufdringlich war, und mochte ihn deswegen gern. Er störte nicht den Jammer ihrer Seele durch unangebrachte Konversation. Dann wurde sie herausgefordert, ihn beifälliger zu betrachten, als Elinor eines Tages eine zufällige Bemerkung über den Unterschied zwischen ihm und seiner Schwester machte – ein Kontrast, der ihn ganz entschieden ihrer Mutter anempfahl.
»Es genügt mir«, fand sie, »zu sagen, er ist anders als Fanny. Das genügt schon, das enthält alles Liebenswerte. Ich liebe ihn bereits.«
»Ich glaube schon, du wirst ihn gernhaben«, sagte Elinor, »wenn du ihn besser kennst.«
»Ihn gernhaben!« antwortete ihre Mutter mit einem Lächeln. »Ich kann nicht Zustimmung mit einem der Liebe nachstehenden Gefühl empfinden.«
»Du könntest ihn achten.«
»Ich habe nie begriffen, wie man Achtung von Liebe trennen kann.«
Mrs. Dashwood gab sich nun Mühe, ihn kennenzulernen. Ihre entgegenkommende Art verscheuchte bald seine Zurückhaltung. Sie nahm sofort alle seine Vorzüge wahr; die Überzeugung, daß er Elinor schätzte, förderte ihr Charakterstudium; aber sie war sich seines Wertes wirklich sicher: und selbst seine ruhige Art, die ihren Vorstellungen, wie ein junger Mann werben sollte, widersprach, dünkte sie nicht länger uninteressant, sobald sie erkannte, wie warm sein Herz und wie liebevoll sein Naturell war.
Kaum daß sie in seinem Umgang mit Elinor irgendein Anzeichen von Liebe gewahrte, betrachtete sie ihre feste Verbindung als sicher und sehnte ihre Heirat – so bald wie möglich – herbei.
»In wenigen Monaten, meine liebe Marianne«, sagte sie, »wird Elinor mit größter Wahrscheinlichkeit ihr Leben lang versorgt sein. Wir werden sie vermissen. Aber sie wird glücklich sein.«
»Aber Mama, was sollen wir denn ohne sie machen?«
»Mein Liebes, es wird kaum eine Trennung bedeuten. Wir werden wenige Meilen voneinander entfernt wohnen und werden einander täglich sehen. Du wirst einen Bruder gewinnen, einen wirklichen, liebevollen Bruder. Ich habe die allerhöchste Meinung von Edwards Herz. Aber du blickst ernst drein, Marianne; ist dir die Wahl deiner Schwester nicht recht?«
»Vielleicht«, sagte Marianne, »betrachte ich sie mit einiger Überraschung. Edward ist sehr liebenswürdig, und ich mag ihn gern. Trotzdem ist er nicht gerade die Art von jungem Mann – etwas fehlt ihm; seine Erscheinung ist nicht überwältigend; er hat nicht die Verve, die ich von dem Mann erwarte, der meine Schwester ernstlich an sich binden möchte. Seinen Augen fehlt all der Geist, das Feuer, die gleichzeitig Tugend und Intelligenz verraten. Und außerdem, Mama, glaube ich, er hat nicht wirklich Geschmack. Musik scheint ihn kaum anzurühren; und obwohl er Elinors Zeichnungen sehr bewundert, ist es nicht die Bewunderung eines Kenners. Trotz seiner häufigen Aufmerksamkeit, wenn sie zeichnet, ist es offensichtlich, daß er nichts davon versteht. Er bewundert als Liebhaber, nicht als Kenner. Um mich zufriedenzustellen, müßte sich beides verbinden. Ich könnte nicht mit einem Mann glücklich sein, dessen Geschmack nicht gänzlich mit dem meinen übereinstimmt. Er muß auf alle meine Empfindungen eingehen: dieselben Bücher, dieselbe Musik müssen uns beide bezaubern. Oh, Mama, wie so ohne Feuer, ohne Schwung war Edward, als er uns gestern abend vorlas! Es tat mir für meine Schwester leid. Doch sie ertrug es mit so viel Haltung, schien es kaum zu bemerken. Ich konnte fast nicht mehr still sitzen. Diese herrlichen Zeilen, die mich oft ganz trunken gemacht haben, mit so unerschütterlicher Reglosigkeit, so schrecklicher Gleichgültigkeit vorgetragen zu hören!« Ref 2
»Eine einfache und elegante Prosa hätte ihm sicher mehr gelegen, dachte ich zwischendrin; aber du mußtest ihm ja Cowper * geben.«
»Na, Mama, wenn er bei Cowper nicht auflebt! – aber wir müssen eben Geschmacksunterschiede zubilligen. Elinor teilt nicht meine Gefühle, und darum kann sie darüber hinwegsehen und glücklich mit ihm sein. Aber es hätte mein Herz gebrochen, wenn ich ihn geliebt und gehört hätte, mit wie wenig Gefühl er las. Mama, je besser ich die Welt kenne, desto mehr bin ich davon überzeugt, daß ich nie einem Mann begegne, den ich wirklich lieben kann. Ich verlange zuviel! Er muß alle Vorzüge von Edward haben, aber seine Erscheinung und sein Auftreten müssen seine Güte mit allem nur möglichen Charme krönen.«
»Vergiß nicht, daß du noch nicht siebzehn bist, mein Liebes. Noch ist es zu früh, an einem solchen Glück zu zweifeln. Warum solltest du weniger vom Glück begünstigt sein als deine Mutter? Nur in einem sollte dein Schicksal anders sein, meine Marianne!«
Kapitel 4
»Elinor«, sagte Marianne, »es ist doch schade, daß Edward so gar nichts vom Zeichnen versteht!«
»Nichts vom Zeichnen versteht!« rief Elinor aus. »Wie kommst du denn darauf? Ja, er zeichnet nicht selbst, aber er betrachtet doch die Arbeiten der andern mit großem Vergnügen; und du kannst mir glauben, es fehlt ihm nicht an natürlichem Geschmack, obwohl er keine Gelegenheit hatte, ihn auszubilden. Wäre er je dazu angehalten worden, er hätte sicher gut gezeichnet. Er mißtraut seinem Urteil in derlei Dingen so sehr, daß er nur ungern seine Meinung über ein Bild äußert; aber er hat einen angeborenen Zugang und selbstverständlichen Geschmack, die ihn im allgemeinen ganz richtig urteilen lassen.«
Marianne wollte sie nicht kränken und sprach nicht weiter davon. Aber die von Elinor erwähnte freundliche Zustimmung, die anderer Leute Zeichnungen in ihm weckte, war weit entfernt von dem begeisterten Entzücken, das nach ihrer Meinung allein den Namen Geschmack verdiente. Obwohl innerlich über ihre Fehleinschätzung lächelnd, rechnete sie ihrer Schwester das so hervorgerufene blinde Eintreten für Edward hoch an.
»Ich hoffe, Marianne«, fuhr Elinor fort, »du hältst ihn nicht im ganzen für geschmacklos. Das kannst du, glaube ich, wirklich nicht, denn du benimmst dich ihm gegenüber sehr herzlich, und wenn das deine Meinung wäre, könntest du doch nicht einmal höflich zu ihm sein.«
Marianne wußte nicht recht, was sagen. Sie wollte auf keinen Fall die Gefühle ihrer Schwester verletzen; aber zu sagen, was sie nicht glaubte, war ihr unmöglich. Nach einer Weile erwiderte sie: »Sei nicht böse, Elinor, wenn meine Anerkennung sich nicht in allem und jedem mit deinem Sinn für seine Vorzüge deckt. Ich hatte nicht so viele Gelegenheiten, seine verborgenen Neigungen, seine Geschmacksrichtungen zu ästimieren wie du. Aber ich habe die größte Hochachtung vor seiner Güte und seinem gesunden Menschenverstand. Ich halte ihn für überaus schätzenswert und liebenswürdig.«
»Ganz bestimmt«, sagte Elinor lächelnd, »könnten seine besten Freunde mit einem solchen Kompliment nicht unzufrieden sein. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie du dich noch wärmer ausdrücken könntest.«
Marianne war froh, daß man ihrer Schwester so leicht gefallen konnte.
»Ich finde«, redete Elinor weiter, »an seinem Verstand und an seiner Güte kann niemand zweifeln, der ihn oft genug gesehen hat, um ihn in ein offenes Gespräch zu verwickeln. Sein hervorragender Verstand und seine Grundsätze können nur von jener Schüchternheit verdeckt werden, die ihn allzu oft verstummen läßt. Du kennst ihn gut genug, um seine Gradlinigkeit zu würdigen. Aber über seine verborgenen Neigungen, wie du sie nennst, bist du durch besondere Umstände noch weniger im Bild als ich. Er und ich waren mitunter oft zusammen, während du von meiner Mutter aus tiefempfundener Liebe völlig mit Beschlag belegt wurdest. Ich habe ihn doch oft getroffen, habe seine Empfindungen studiert und seine Meinung über literarische Gegenstände und Geschmack gehört; im ganzen wage ich zu behaupten, daß sein Verstand empfänglich ist, seine Freude an Büchern ganz groß, seine Phantasie lebhaft, sein Urteil treffend und ausgewogen und sein Geschmack erlesen und rein. Bei näherer Bekanntschaft gewinnen alle seine Fähigkeiten ebenso wie seine Umgangsformen, seine Erscheinung. Auf den ersten Blick ist sein Auftreten sicher nicht einnehmend. Sein Äußeres kann kaum hübsch genannt werden, bis man den ungewöhnlich guten Ausdruck seiner Augen und die vorherrschende Sanftheit seiner Gesichtszüge wahrnimmt. Gegenwärtig kenne ich ihn so gut, daß ich ihn sogar nett finde – oder wenigstens beinahe. Was meinst du, Marianne?«
»Wenn es mir jetzt nicht so geht, Elinor, dann sicher später. Und wenn du mich heißt, ihn wie einen Bruder zu lieben, will ich keine Unvollkommenheit mehr in seinem Gesicht entdekken, wie ich jetzt keine in seinem Herzen sehe.«
Elinor zuckte bei dieser Feststellung zusammen und bedauerte, daß sie sich zu der Wärme solcher Überschwenglichkeit hatte verleiten lassen, als sie von ihm gesprochen hatte. Sie spürte, daß Edward sehr hoch in ihrer Achtung stand, und hielt dies für gegenseitig; aber sie brauchte eine größere Gewißheit, um Mariannes Überzeugung von ihrer Zusammengehörigkeit teilen zu können; sie wußte, daß das, was Marianne und ihre Mutter sich in einem Augenblick einbildeten, sie schon im nächsten glaubten – daß für sie Wünschen gleich Hoffen war und Hoffen Erwarten. Sie versuchte, den wahren Stand der Dinge ihrer Schwester zu erklären.
»Ich will es nicht abstreiten«, sagte sie, »daß ich sehr viel von ihm halte – ihn überaus schätze, daß ich ihn gern mag.«
Hier brach Marianne in Empörung aus.
»Ihn schätzen! Ihn gern mögen! Kaltherzige Elinor! Ach, schlimmer noch! Du schämst dich ja, anders als kaltherzig zu sein. Gebrauche noch einmal diese Worte – und ich gehe hinaus.«
Elinor mußte lachen. »Entschuldige«, sagte sie, »und glaube mir, daß ich dich nicht beleidigen wollte, wenn ich so ruhig über meine eigenen Gefühle rede. Glaube mir, daß sie stärker sind als ich es ausgesprochen habe. Kurz, glaube mir, daß sie ebenso wie sein Wert und die Ahnung – nein, die Hoffnung, daß er mich liebt – gerechtfertigt sind und nicht übereilt, nicht überschwenglich. Aber weiter darfst du nicht gehen. Ich bin ja keineswegs seiner Verehrung für mich sicher. Es gibt Augenblicke, in denen ich an deren Ausmaß zweifle; und ehe er seine Gefühle gestanden hat, möchte ich doch, wie du verstehen wirst, alles, was meine Vorliebe für ihn fördern könnte, vermeiden und mich nicht hineinsteigern oder glauben, es sei mehr, als es ist. Im Innern fühle ich wenig, fast gar keinen Zweifel an seiner Zuneigung. Aber es gibt auch anderes zu erwägen außer seiner Neigung. Er ist weit davon entfernt, unabhängig zu sein. Wie es mit seiner Mutter wirklich steht, können wir nicht wissen. Aber nach Fannys gelegentlicher Erwähnung ihres Betragens und ihrer Ansichten waren wir nie veranlaßt, sie uns liebenswert vorzustellen; und ich müßte mich sehr täuschen, wenn Edward selbst nicht wüßte, daß es viele Konflikte gäbe, wenn er eine Frau heiraten wollte, die weder ein großes Vermögen noch hohen gesellschaftlichen Rang hat.«
Marianne war verblüfft darüber, wie weit ihre und ihrer Mutter Phantasie die Wahrheit überflügelt hatte.
»Und du bist wirklich nicht mit ihm verlobt!« sagte sie. »Aber es wird bestimmt bald geschehen. Doch wird diese Verzögerung zwei Vorteile mit sich bringen. Ich werde dich nicht so bald verlieren, und Edward wird noch mehr Gelegenheit haben, seinen natürlichen Geschmack an deiner Lieblingsbeschäftigung zu entwickeln, was dir so unerläßlich für dein künftiges Glück zu sein scheint. Ach! Wenn er durch deine Inspiration nur so sehr angeregt würde, daß er selbst zeichnen lernte, wie entzückend wäre das doch!«
Elinor hatte ihrer Schwester ihren wahren Eindruck preisgegeben. Sie konnte die Neigung zu Edward nicht in einem so weit gediehenen Stadium betrachten, wie es Marianne angenommen hatte. Manchmal legte er ein derart schwungloses Wesen an den Tag, das, wenn nicht Gleichgültigkeit, so doch etwas ähnlich wenig Versprechendes zum Ausdruck brachte. Ein Zweifel an ihren Gefühlen, falls er ihn spürte, hätte in ihm kaum mehr als Unruhe geweckt; es hätte wohl nicht einmal zu jener Niedergeschlagenheit gereicht, die ihn häufig befiel. Eine vernünftigere Begründung mochte in der abhängigen Lage zu suchen sein, die ihn daran hinderte, seinen Gefühlen nachzugeben. Sie wußte, daß seine Mutter es ihm gegenwärtig weder zuhause behaglich machte, noch ihm auch eine Zusicherung gab, er könne einen eigenen Hausstand gründen, wenn er nicht Rücksicht auf ihre Wünsche bezüglich seiner Karriere nahm. Dessen eingedenk, war es Elinor unmöglich, gelassen zu reagieren. Sie war weit davon entfernt, auf dieses Ergebnis seiner Zuneigung abzustellen, das ihre Mutter und Schwester für ausgemacht hielten. Nein, je länger sie beisammen waren, desto mehr mußte sie seine Zuneigung bezweifeln und hielt sie manchmal ein paar quälende Minuten lang für nicht mehr als Freundschaft.
Doch was immer die Grenzen wirklich waren, es genügte, seine Schwester, sobald sie es bemerkte, zu beunruhigen und sie gleichzeitig (was noch übler war) ungezogen zu machen. Sie ergriff die erste Gelegenheit, ihre Schwiegermutter vor den Kopf zu stoßen, indem sie so ausdrücklich über die großen Erwartungen ihres Bruders sprach und von Mrs. Ferrars entschiedenem Vorsatz, ihre Söhne gut zu verheiraten, und von der Gefahr, irgendeiner jungen Frau den Hof zu machen, die versuchte, ihn zu verführen, daß Mrs. Dashwood weder so tun konnte, als wüßte sie von nichts, noch sich bemühen, ruhig zu bleiben. Sie gab ihr eine Antwort, die ihre Verachtung zeigte, und verließ das Zimmer; dabei beschloß sie, was immer nun die Unannehmlichkeit und Kosten eines plötzlichen Umzugs ausmachen würden, so sollte doch ihre geliebte Elinor nicht eine Woche länger solchen Unterstellungen ausgesetzt sein.
In dieser Gemütsverfassung erreichte sie ein Brief durch die Post, welcher ein zeitlich hochwillkommenes Angebot enthielt. Es war die Offerte eines kleinen Hauses zu sehr günstigen Bedingungen; es gehörte einem mit ihr verwandten, einflußreichen und begüterten Gentleman in Devonshire. Der Brief stammte von dem Herrn selbst und war in einem Ton echt freundlicher Gefälligkeit abgefaßt. Er habe gehört, daß sie dringend eine Wohnung suche, und obwohl das ihr hiermit angebotene Haus nur ein Cottage sei, versichere er ihr, daß alles ihr nötig Scheinende getan werde, falls sie es annähme. Er bestand darauf, nach Beschreibung der Einzelheiten von Haus und Garten, daß sie mit ihren Töchtern nach Barton Park, seiner eigenen Residenz, komme, von wo aus sie selbst entscheiden könnte, ob Barton Cottage, denn die Häuser lagen in derselben Gemarkung, durch anstehende Veränderungen für sie annehmbar gemacht werden könnte. Es schien ihm wirklich viel daran gelegen zu sein, sie unterzubringen, und sein ganzer Brief war so wohlwollend gehalten, daß er seine freudige Wirkung auf seine Verwandte nicht verfehlte; um so mehr in einem Augenblick, in dem sie unter dem kalten und fühllosen Betragen ihres näheren Anhangs litt. Sie brauchte keine Bedenkzeit oder Nachfrage. Ihr Entschluß stand fest, noch während sie las.
Die Lage von Barton – in einer so weit von Sussex entfernten Grafschaft wie Devonshire – noch vor wenigen Stunden Grund genug, als Nachteil abzulehnen, war nun ihr größter Vorteil. Die Nachbarschaft von Norland zu verlassen, war kein Schrekken mehr, sondern erstrebenswert; ja, es war eine Gnade im Vergleich zu dem Elend, fortgesetzt Gast ihrer Schwiegertochter zu sein; und für immer von diesem geliebten Heim fortzuziehen war weniger schlimm, als es zu bewohnen oder zu besuchen, solange dieses Frauenzimmer dort Herrin war. Sie dankte Sir John Middleton sofort für sein Entgegenkommen und bestätigte die Annahme seines Vorschlags; dann eilte sie, beide Briefe ihren Töchtern zu zeigen, um ihrer Zustimmung vor Absendung ihrer Antwort sicher zu sein.
Elinor hatte schon immer gemeint, es sei klüger, sich in einiger Entfernung von Norland niederzulassen als in unmittelbarer Nachbarschaft. Von daher konnte sie sich der Absicht ihrer Mutter, nach Devonshire zu ziehen, nicht widersetzen. Auch das Haus, wie es Sir John beschrieb, war von so einfachem Zuschnitt und die Miete so ungewöhnlich niedrig, daß ihr kein Grund zum Widerspruch blieb. Und so, obgleich der Plan ihre Vorstellungen nicht beflügelte und ein Fortzug aus der Umgebung von Norland jenseits ihrer Wünsche lag, machte sie nicht den Versuch, ihre Mutter von der Übersendung ihrer Einwilligung abzubringen.
Kapitel 5
Kaum war die Antwort abgeschickt, gönnte sich Mrs. Dashwood das Vergnügen, ihrem Stiefsohn und dessen Frau zu eröffnen, daß sie ein Haus habe und ihnen nicht länger zur Last fallen wolle, als bis alles für ihren Einzug hergerichtet sei. Sie hörten es mit Verblüffung. Frau John Dashwood sagte nichts; aber ihr Mann hoffte höflich, daß sie sich nicht weit von Norland niederlassen werde. Zu ihrer großen Genugtuung konnte sie antworten, daß sie nach Devonshire ziehe. – Edward wandte sich hastig um, als er das hörte, und wiederholte mit erstaunt betroffener Stimme, deren es keiner Erklärung bedurfte: »Devonshire! Wollen Sie wirklich dort hinziehen? So weit weg von hier! Und in welche Gegend?« Sie beschrieb die Lage, vier Meilen nördlich von Exeter.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!




![Emma (Centaur Classics) [The 100 greatest novels of all time - #38] - Jane Austen. - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/ba91eea69a27a8fd52d9e1952c7c4a74/w200_u90.jpg)