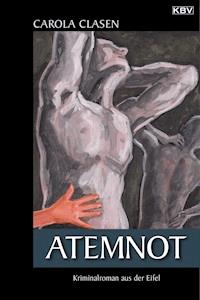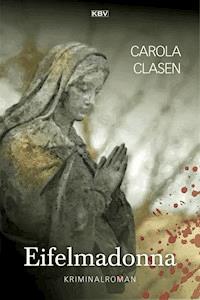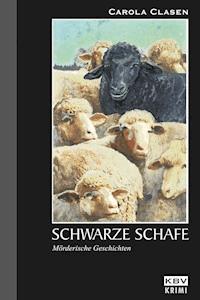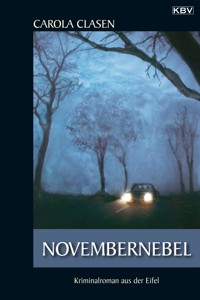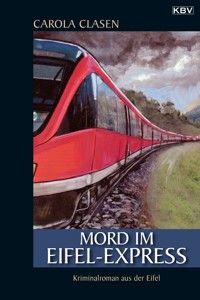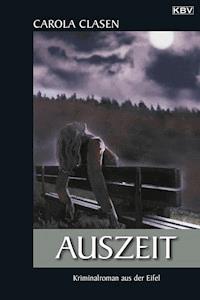
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: KBV
- Kategorie: Krimi
- Serie: Sonja Senger
- Sprache: Deutsch
Am Waldrand stehen im fahlen Licht der Nacht die nackten Fichtenstämme des Kermeters wie Skelette... Auf einem düsteren Wanderparkplatz bei Heimbach zerrt eine dunkle Gestalt eine Frauenleiche aus dem Kofferraum ihres Wagens und legt sie auf einer Holzbank ab. Wie eine müde Wanderin scheint sie schließlich dazusitzen und die Aussicht in das nächtliche Tal zu genießen. Sonja Senger hat im Trierer Polizeipräsidium das Handtuch geworfen, um Rückversetzung nach Köln gebeten und sich vor dem Dienstantritt eine Auszeit erstritten. Der Eifel ganz den Rücken zu kehren fällt ihr schwer. So macht sie sich auf die Suche nach einem kleinen Wochenendhaus im Nationalpark Eifel. Doch die tote Frau vom Wanderparkplatz bringt plötzlich Unruhe in ihre Bemühungen. Und bei dieser einen Toten bleibt es nicht ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carola Clasen
Auszeit
Bisher von der Autorin bei KBV erschienen:
»Novembernebel«
»Das Fenster zum Zoo«
»Tot und begraben«
»Auszeit«
»Schwarze Schafe«
»Wildflug«
»Mord im Eifel-Express«
»Spiel mir das Lied vom Wind«
»Tote gehen nicht den Eifelsteig«
Seit 1998 schreibt Carola Clasen Kriminalromane, die in der Eifel spielen. Auch mit ihren Kurzgeschichten und Lesungen hat Carola Clasen sich einen Namen in der Region gemacht. Die »Queen of Eifel-Crime« ist Mitglied im Syndikat, lebt und arbeitet in Hürth.
Carola Clasen
Auszeit
1. Auflage 20042. Auflage 20073. Auflage 2013
© KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheimwww.kbv-verlag.deE-Mail: [email protected]: 0 65 93 - 998 96-0Fax: 0 65 93 - 998 96-20Redaktion, Satz: Volker Maria Neumann, KölnUmschlagillustration: Ralf KrampDruck: CPI books, Ebner & Spiegel GmbHPrinted in GermanyPrint-ISBN 978-3-937001-43-2E-Book-ISBN 978-3-95441-021-7
Für meinen Vater
Prolog
Der Regen setzt am Nachmittag ein. Nach und nach überzieht sich der Himmel mit einer geschlossenen Wolkendecke. Da ist abzusehen, dass es nicht bei einem Schauer bleiben wird. Und in der Tat entwickelt sich das Ganze im Laufe der folgenden Stunden zu einem beständigen Landregen – weniger kräftig, dafür um so dauerhafter –, der die Menschen von den Straßen vertreibt. Die Tropfen fallen wie Bindfäden ohne Umschweife herab und überziehen alles mit einem nassen, glänzenden Film.
Es ist ein Samstag und der 1. November.
Weit nach Mitternacht biegt ein weißer Kombi auf dem Bergrücken des Kermeter von der L 15 auf einen leeren Wanderparkplatz ab. Die Reifen rumpeln durch Pfützen, und ihre Spuren versinken im Matsch. Dicht am Waldrand kommt der Wagen zum Stehen. Die Scheinwerfer verlöschen, die Scheibenwischer stehen still, das Motorengeräusch verebbt. Eine Weile tut sich weiter nichts, nur der Fahrer scheint reglos in die Nacht zu sehen und zu horchen, während der Regen aufs Autodach prasselt.
Ist er verabredet? Ein heimliches Rendezvous? Ein dunkles Geschäft?
Als alles ruhig bleibt und nicht einmal ein Vogel schreit, klackt leise die Fahrertür. Sie wird aufgeschoben und ein Fuß in Gummistiefeln auf den aufgeweichten Boden gesetzt. Der Fahrer zieht sich am Lenkrad in die Höhe und blickt sich suchend um.
Nach der Geliebten? Nach dem Geschäftspartner?
Verhüllt in einen langen, weiten, dunklen Mantel – so, wie die Regentropfen daran abperlen, muss es sich um eine Art Wachsmantel handeln –, eine Kapuze tief ins Gesicht gezogen, eine Pelerine lässt die Schultern breit und die Statur gedrungen erscheinen.
Dann gibt der Fahrer das Warten auf. Die Tür wird abgeschlossen. Er trägt gelbe Gummihandschuhe, die in der Dunkelheit leuchten.
Zögernde Schritte durch Pfützen zum Kofferraum, immer noch schweifen die Blicke von der nahen Straße über den Parkplatz zum Waldrand, wo die nackten Fichtenstämme wie Skelette stehen.
Die Kofferraumklappe wird hochgezogen, ein kleines Licht geht daraufhin im Innern an und beleuchtet eine undefinierbare Unordnung. Vielleicht etwas Rotes oder etwas Helles könnte dem auffallen, der die Szene von nicht allzu großer Entfernung beobachtet. Aber da ist niemand unterwegs in dieser Regennacht.
Der Mantel hängt im Schlamm, als der Fahrer sich bückt, um sich im Kofferraum zu schaffen zu machen. Als er sich wieder aufrichtet, zerrt er einen Körper hervor. Den linken Arm um seinen Nacken gelegt, den rechten lässt er schlaff herunterhängen, an einem Ende baumelt der Kopf mit langen, blonden Haaren und am anderen Ende die Beine.
Eine kleine, zierliche Frau mit roter Jacke, Jeans und weißen Turnschuhen. Keine fünfzig Kilo. Und kein schöner Anblick. Haarsträhnen liegen über Stirn und Augen, aus ihrer Nase zwei Streifen geronnenes Blut, ihre geschwollene Zunge presst sich durch die Zähne ihres halb offenen Mundes, die Lippen sind ausgetrocknet und aufgesprungen. Die Handgelenke sind mit weißer Mullbinde verbunden und darüber mit Kabelbinder aneinandergefesselt.
Zum Schutz vor dem Einschneiden ins Fleisch?
Gefesselt sind auch die Fußgelenke. Der Fahrer dreht sich zur Seite, um mit dem Ellenbogen die Kofferraumklappe wieder zuzudrücken. Es gelingt ihm nicht. Immer wieder springt der Deckel auf und stößt gegen den Kopf der toten Frau, immer wieder geht das kleine Licht im Innern des Autos aus und an. Ein Schnauben ist zu hören. Wut, ein Fluch.
Schließlich lässt er die Frau von seinen Armen in den Matsch rutschen, obwohl er sie auch hätte ins Gras legen können, das wenige Meter entfernt beginnt, zwar auch nass ist, aber wenigstens nicht schlammig. Breitbeinig steht er über ihr, als er den Kofferraum endgültig verschließt und den Schlüssel einsteckt. Er bückt sich, schiebt die Hände unter die kleine Frau und hebt sie mühsam wieder auf.
Ein letzter Blick durchforstet die Umgebung. Eine rotweiße Schranke, verschlossen mit Kette und Vorhängeschloss, hindert den Unbefugten an der Weiterfahrt. Direkt hinter der Schranke gabelt sich der Weg. Links geht es über den Bergrücken des Kermeter hinab direkt ins Tal, rechts scheint der Weg im dunklen Nadelwald zu enden.
Aber er wählt keinen von beiden, als er sich an der Schranke vorbeidrückt, sondern stapft auf die Lichtung zu seiner Linken; ein sacht abfallendes Wiesenstück mit einzeln stehenden Bäumen. Seine eigenen Füße kann er nicht mehr sehen, doch noch so viel, dass er nicht über die nächsten Grasbüschel oder eine Bodenunebenheit stolpern oder auf dem durchweichten Boden ausrutschen wird. Er scheint Mühe zu haben in den Gummistiefeln. Vielleicht sind sie seinen Füßen noch ungewohnt. Er versinkt.
Auch die Last scheint schwerer zu werden mit jedem Schritt. Die kleine Frau sackt zwischen seinen Armen immer mehr durch. Ein paarmal muss er sie neu richten, wirft sie dazu ein kleines Stück hoch und fängt sie wieder auf.
Er geht schneller, sodass der Kopf der Toten gegen seine Brust schlägt und ihre Füße im Rhythmus seiner Schritte auf und ab schaukeln, die Schuhspitzen sich aneinanderreiben. Sie trägt weiße Turnschuhe.
Als er sich umdreht, ist die Wiese hinter ihm sauber und leer. Noch kann er die Straße sehen und das rote Licht am Kotflügel seines Autos. Er hat vergessen, den Blinker auszuschalten, als er auf den Parkplatz abbog; jetzt brennt die Parkleuchte als einziges Licht im nächtlichen Wald. Sie wird ihm heimleuchten, falls er sich verläuft. Er wird nicht lange brauchen, die Batterie hält das aus.
Er bleibt vor der letzten Holzbank unter einer Lärche stehen und lässt die kleine Frau auf die Sitzfläche rutschen. Sorgfältig rückt er den Kopf, der immer zur Seite fallen will, zurecht, zieht die Jacke gerade und die Ärmel über die weißen Mullbinden und sortiert auch Beine und Füße. Ein ordentliches Bild. Er hat Eisendraht dabei, mit dem er sie an die Lehne fesselt.
Er entfernt sich rückwärts gehend. Kann er sich nicht satt sehen? Prüft er den Anblick? Wie eine müde Wanderin, die den Ausblick ins Tal genießt, sieht sie aus. Wenn ihr Kopf nicht schon wieder zur Seite gefallen wäre. Ihre Jacke leuchtet weithin rot, das Gesicht weiß, die Haare golden. Man wird sie morgen sofort sehen, wenn man einen der beiden Wanderwege geht oder wenn ein Fahrzeug der belgischen Streitkräfte die Schranke passiert.
Er schnauft. Eine knappe halbe Stunde hat er nur gebraucht, ist außer Atem geraten bei der Anstrengung und kehrt an der Schranke vorbei auf den Parkplatz zurück. Die Parkleuchte schimmert rot durch den Regen ihm entgegen.
Er steigt ein, wirft den Motor an, schaltet die Scheinwerfer und die Scheibenwischer wieder ein, wendet in einem Zug und biegt zurück auf die L 15. Sie ist immer noch leer. Hinter ihm verschwimmen die Reifen- und Fußspuren, die eben noch zu sehen waren, im Regen.
1. Kapitel
Verloren hatte Hauptkommissarin Sonja Senger sich gefühlt, als sie vor fast sechs Wochen die Haustüre hinter sich ins Schloss fallen ließ, ihre Aktentasche auf die Kommode stellte und ihre Jacke an den Haken warf, ohne den Spiegel eines Blickes zu würdigen.
»Warum haben wir nie geheiratet?«, fragte sie leise und fast beiläufig, als sie das Wohnzimmer betrat. Jérôme, ihr Lebensabschnittsgefährte, kauerte an seinem viel zu kleinen Schreibtisch vor dem Fenster zur Straße, Bücher und Hefte türmten sich um ihn herum. Voltaire, der stumme Hund, und Balzac, der dunkelgraue Kater, liefen auf Sonja zu. »Ab jetzt habe ich viel Zeit für euch«, flüsterte sie.
»Was hast du gesagt?«
»Nichts.« Sie legte sich mit Katz’ und Hund aufs Sofa und schloss die Augen. Als die Sitzfläche nachgab, nahm ihre Nase ihn wahr, ein bisschen nach Ingwer roch er immer.
»Du bist früh heute.«
»Ja.«
»Warum?«
»Ich hatte keine Lust mehr.«
»Wir leben doch seit vielen Jahren glücklich zusammen ohne diesen, diesen ...«
»Trauschein«, half sie aus und öffnete ein Auge.
»Wenn du unbedingt willst, können wir das machen.«
So, wie er das sagte, verlor sie augenblicklich die Lust dazu. »Ich verzichte.«
Erlöst atmete er auf.
»Ich geh’ da nie wieder hin.«
»Alors!«
Alle Tragik ihres Daseins konnte von einem einzigen unpassenden, demütigenden, gefühllosen, ungerechten Bartmann-Satz herrühren, der seine Stellung als ihr direkter Vorgesetzter im Trierer Polizeipräsidium schamlos ausnutzte.
»Was hat er dieses Mal gesagt?«
»Darüber möchte ich nicht sprechen.«
»Es wäre ... stupide, deine Zukunft von einem Mann wie Bartmann abhängig zu machen«, ließ er sie wissen.
»Fass!«, murmelte sie in Voltaires Ohr. Aber der dachte nicht daran, sondern leckte Jérômes Hand. Wenigstens der Kater fauchte leise.
»Ich wäre froh, eine feste Anstellung zu haben. Mon dieu! Wasser in der Wüste.«
»Ich gehe zurück nach Köln.«
Ende, Schluss, Aus. Stille in der Drei-Zimmer-Wohnung in der Lindenstraße zu Trier, deren Miete bis jetzt von Sonja bezahlt wurde. Natürlich war es unvernünftig gewesen, nach einem Tobsuchtsanfall die Brocken hinzuwerfen und um Versetzung nach Köln zu bitten. Hatte sie vergessen, dass es dort nicht besser war?
Bis 1998 in Köln ansässig und bedienstet, davon fast zehn Jahre als Hauptkommissarin, hatte man sie aufgrund von Personalverschiebungen nach Trier entsandt. Sie hatte versucht, es als eine Chance zu sehen. Aber das war es nicht gewesen. In einem immer noch von Männern dominierten Beruf war sie vom Regen in die Traufe gekommen. Fünf Jahre ihres Lebens hatte sie ein Dasein gefristet. Es hatte ein paar nette Kollegen gegeben, hier wie da, ein paar von ihnen waren Freunde geworden, einer sogar mehr als das, Roman Zorn. Mit ihm hatte sie den zweiten großen Fall gehabt. Das war auch schon drei Jahre her. Aus diesem Fall stammte Voltaire, der stumme Jack-Russel-Mix.
Seit 1998 saß auch noch Balzac, der dunkelgraue Kater, in ihrem Wohnzimmer und sein Frauchen im Vollzug.
Zwei spektakuläre Fälle in fünf Jahren, das war nicht gerade überwältigend. Danach war sie mit Lappalien abgespeist worden.
Bartmann hatte sie heute Mittag nicht angefleht, ihre Entscheidung zu überdenken. Im Gegenteil. »Reisende soll man nicht aufhalten«, hatte er gesagt, im mitleidig säuselnden Ton, sofort zum Hörer gegriffen und in Köln nachgefragt, ob man Verwendung für sie hätte. Hatte man nicht.
»Wann?«, hörte sie Jérôme jetzt fragen.
»Im Moment ist dort keine Planstelle frei.«
»Ah! Daher weht der Wind.«
»Welcher Wind?«
»Der Hochzeitswind.«
Sonja kehrte ihm den Rücken zu und starrte die abgewetzte, dunkelrote Chenille der Sofalehne an. In Wahrheit hatte sie um eine Auszeit gebeten, um unbezahlten Urlaub, eine Bedenkzeit, um Verzug, um ... Sie konnte unmöglich nahtlos von einer Dienststelle in die andere gehen. Da warteten noch genug alte Kollegen in Köln, um ihr mit dem nötigen Spott zu begegnen.
»Diese Eifel hier wird dir fehlen.«
»Nicht, wenn ich meinen Traum verwirkliche.«
»Welchen meinst du?« Als hätte sie Hunderte!
»Das Eifelhäuschen.«
»Mon dieu!« Er hielt nicht viel von einem Wochenendhaus, in seinen Augen Spießersache, wie Schrebergärten, Dauercampingplätze und Sandburgen.
»Ein Bein in der Eifel, eines in Köln«, verteidigte Sonja ihren Traum. »Wenn ich bloß wüsste, wovon ich das bezahlen soll.«
Jérôme stand auf und schlurfte zurück an seinen Schreibtisch. Sie wusste, wenn sie lange genug schwieg und ihn nachdenken ließ, würde er eine Lösung finden. So war es immer. Sie seufzte hörbar, damit er sie nicht unterwegs vergesse. Danach erhob sie sich, streifte dicht hinter ihm vorbei in die Küche, nicht ohne eine Hand über seine Schulter laufen zu lassen, und setzte Wasser auf. Sie füllte Kaffeepulver auf den Grund der Kanne und arrangierte Tassen und Teller auf einem runden Tablett. Als sie die Keksschachtel öffnete, kam Voltaire zu ihr und bettelte. »Es gibt nichts«, flüsterte sie und legte den Finger auf den Mund.
Noch ehe das Wasser kochte, räusperte sich Jérôme. Und als Sonja es sprudelnd in die Kanne füllte, erklärte er: »Wenn wir meiner Erbtante Marie-Joe in der Provence ...«
»Was!« Der Wasserkocher fiel ihr fast aus den Händen. »Du hast eine reiche Tante? Wieso weiß ich davon nichts?«
Jérôme pflegte den Mantel des Schweigens über seine Vergangenheit zu legen. Er hatte Frankreich während des Studiums verlassen, er hatte keine Geschwister, seine Eltern waren schon vor langer Zeit gestorben, von einer Tante hatte er nie gesprochen. Schon gar nicht von einer reichen. Kein einziges Mal waren sie zusammen in seiner Heimat gewesen.
Jetzt rollte er mit dem Drehstuhl herbei, stoppte in der Küchentür und hielt sich mit beiden Händen am Rahmen fest. »Ich wollte nicht, dass du mich meines Geldes wegen liebst.«
»Ich liebe dich auch nicht, Quatsch, ich meine, das würde ich auch nie tun. Wann besuchen wir sie?«
»Immer langsam. Ma chère tante ...«
»Oh, das hört sich aber ziemlich reich an«, unterbrach sie ihn.
»Als während der Eiszeit die Mammuts starben und der Mensch nichts mehr zu jagen fand, begann er Besitztümer anzuhäufen, Land, Werkzeuge, Vorräte. Zu jener Zeit wurden Gier, Habsucht und ...«
Sonja winkte ab. Sie kannte seine Vorträge auswendig. »Wo wohnt sie?«
»In Draguignan, im Département Var, im Hinterland der Côte d’Azur.«
»Dort, wo die Schönen und Reichen wohnen?«
»Im Hinterland haben noch nie die Schönen und Reichen gewohnt.«
»Was nun?«
»Hab ich gesagt, sie sei reich?«
»Irgendwie schon.«
»Hab ich dir gesagt, sie hasst Tiere?«
»Tun das nicht alle Franzosen?«
Jérôme mochte keine Haustiere. Hunde ebenso wenig wie Katzen. Es handelte sich um eine Art mühsame Duldung, zu der er sich herabließ, die aber jeden Moment in Aggression umschlagen konnte. Voltaire und Balzac lebten – ohne es zu ahnen – auf dünnem Eis in der Lindenstraße zu Trier.
Aber Sonja ließ sich nicht beirren. Sie wollte diese herrlichen Aussichten! Nie wieder Bartmann! Vielleicht blieb ihr sogar Köln erspart. Nie mehr Kripo! Statt eines Eifelhäuschens ein Herrensitz? Alles kam jetzt auf das Bankkonto von ma chère tante an. Am Ende gar eine französische Landhochzeit? Eine neue Identität? Sonja Monteux! Klang das nicht nach Glück?
»Was ist mit dem Kaffee?«, unterbrach er ihre Visionen.
»Kommt.« Sie trug das Tablett zu seinem Schreibtisch, während er hinter ihr her rollte und dabei ein dünnes Hundebeinchen überfuhr. Voltaire jaulte auf. Aber Sonja überging die verabscheuungswürdige Tat, zu viel stand gerade auf dem Spiel. Stattdessen goss sie liebevoll Kaffee ein, gab die vorschriftsmäßige Menge Zucker und Milch dazu und rührte um.
»Ich kann ihr mal schreiben.«
Sie zog ein Blatt Papier aus der Schublade und legte einen Stift quer darüber.
»Hast du ein Foto von dir?«
»Ma chère tante wird von ihrem provenzalischen Hocker fallen, wenn sie sieht, wen du zu ehelichen gedenkst.«
Während der nächsten Stunden verfasste er einen dreiseitigen, reichlich schwülstigen Liebesbrief. Auf einer Seite erzählte er, wie sehr er seine geliebte und einzige Tante Marie-Jo seit Jahren vermisse, auf der zweiten erwähnte er sein aufregendes, aber völlig verarmtes Dasein als missverstandener Außenseiter-Archäologe, der unermüdlich nach seinem großen Fund unterwegs sei. Auf Seite drei wurde der Name Sonja Senger erstmalig urkundlich erwähnt.
Nach langem Suchen trieb er ein Foto auf, das sie und ihn zeigte, vor der Porta Nigra, geknipst von einem Passanten oder Kollegen. Dieser Mensch hatte Sonja auf dem falschen Fuß erwischt. Anstatt zu lächeln, hatte sie verkniffen in die Sonne geblinzelt.
Jérômes letzter Satz lautete: »Ich kann es nicht abwarten, dich wiederzusehen.«
Entweder hatte ma chère tante bereits das Zeitliche gesegnet, das Augenlicht verloren oder sie war des Lesens und Schreibens unkundig, jedenfalls geruhte sie während der folgenden sechs Wochen kein Lebenszeichen von sich zu geben.
Am Samstag, dem 1. November, sah Sonja ihn in aller Frühe seinen alten Lederkoffer packen. »Ich muss sehen, was da unten los ist.«
»Ah, ich verstehe, du willst in der Vergangenheit schwelgen. Ohne mich.«
»Ich kann nicht mit der Tür ins Haus fallen.«
»Bin ich eine Tür?« Sie beobachtete ihn, wie er sich auf der Suche nach Ausreden quälte.
»Es könnte lange dauern.«
»All die Frauen deines Lebens wieder aufzuspüren? Ich habe Zeit, wie du weißt. Warum rufst du nicht an? Gibt’s dort kein Telefon?«
»Über Geld redet man nicht am Telefon.«
Wenn er nicht wollte, wollte er nicht. »Hast du schon eine Fahrkarte?«, fragte Sonja.
»Habe ich.« Er klopfte auf die Brusttasche seines Hemdes.
»Hast du dein Diplom?«
Er nickte.
»Wann geht dein Zug?«
»Gleich.«
»Salut!«, schickte sie ihn weg und begleitete ihn nicht auf den Bahnsteig; sie beide hassten Abschiedsszenen.
Als er sie ein letztes Mal küsste, war er in Gedanken schon weit weg. Sie sah ihm nach, Balzac und Voltaire kauerten neben ihr auf der Fensterbank, und alle drei hatten gemischte Gefühle. Wie schnell er sich bereit erklärt hatte, nach Frankreich zu fahren, trotz seiner Abneigung gegen ein Wochenendhäuschen. Ob ihn das Heimweh plagte? Vielleicht würde er nicht zurückkehren, sich mit dem Scheck von ma chère tante absetzen, unauffindbar zwischen den Lavendelfeldern der Provence untertauchen. Bald eine junge, zarte Französin an seiner Seite, ein Haufen zerzauster, schmutziger Kinder zu seinen Füßen. Sonja, würde er sich fragen, wer ist Sonja? Und dabei eine seiner schwarzen Locken zurückwerfen und unrasiert zum Horizont blinzeln.
Die ersten Stunden verbrachte sie rast- und ratlos zwischen Sofa und Bett. Für die Bücher, die sie schon immer lesen wollte, fand sie nicht die Ausdauer, blätterte in einem, danach im nächsten und schlug auch das wieder zu. Versuchsweise tippte sie ihre alte Büro-Durchwahl ins Telefon. Am anderen Ende bellte eine unbekannte Männerstimme, jung war sie auf jeden Fall, jung und forsch. Sonja keuchte und simulierte einen Meuchelmord.
»Hallo! Hören Sie, wenn Sie mir Ihren Namen nicht sagen, kann ich nichts für Sie tun. Hallo! Wer sind Sie?«
Er würde sich mit Bartmann verstehen.
Im Schutz der frühen Dunkelheit schlich sie – unter Vortäuschung eines Hundespaziergangs – ein paarmal um das Trierer PP und versuchte, mit einem Opernglas unauffällig ihr Büro auszuspionieren, weil es ihr keine Ruhe ließ, nicht zu wissen, wer in Gottes Namen nun an ihrer Stelle verschlissen wurde. Umsonst lauerte sie am Straßenrand, in der Hoffnung die ehemaligen Kollegen mit dem Neuen herauskommen zu sehen. Das Licht in ihrem Büro brannte bis in die späte Nacht.
Jérôme meldete sich nicht. Ein gutes Zeichen?
Sie setzte sich an seinen PC, Balzac kroch zu ihr auf den Schoß. Sie meldete sich im Internet an und sah sich in den Angebotslisten verschiedener Immobilienmakler in der Region um. Mit wachsender Begeisterung blätterte sie durch die Objekte: Villen aus Jugendstil- und Gründerzeit, imposante Herrensitze, Guts- und Reiterhöfe, ländliche Anwesen aller Art. Ausgeklügelte Programme erlaubten es ihr, die Objekte virtuell zu begehen, einen Blick aus den Fenstern zu werfen und die Dicke der Mauern zu überprüfen. Damit vergingen die Stunden wie im Nu.
Gegen drei Uhr in der Frühe schickte sie eine Mail los. An eine gewisse Alice Bornheim, Immobilienmaklerin in Trier. Jetzt oder nie – ein Motto, das Sonja gefiel. Sie unterschrieb, um Alice Bornheim nicht zu verwirren, mit dem Namen des Absenders, Jérôme Monteux.
Bevor sich ihr Hirn endgültig in den Schlaf verflüchtigte, machte sie vor ihrem geistigen Auge eine Bestandsaufnahme der Dinge, die sie unbedingt auf einen Herrensitz mitnehmen wollte. Dazu gehörten das riesige, durchgesessene Sofa aus dunkelroter Chenille, mit den geschwungenen Holzfüßen, Ohrensessel und Fußbänkchen, ihr Schreibtisch mitsamt Drehstuhl, beides ausgemusterte Dienstmöbel aus dem PP, der staubige Kronleuchter über dem Esstisch, das wackelige hohe Eisenbett und die vielen, lieb gewonnenen Kleinigkeiten, ohne die sie niemals im Leben mehr auskommen würde, so wie Balzac, Voltaire und ... Jérôme.
2. Kapitel
Auch Vera Rumberg war Immobilienmaklerin. Am Montagmorgen begrüßte sie, wie jeden anderen Morgen, ihre Sekretärin Rebecca. Wieder nahm sie sich vor, ihr bei nächster Gelegenheit etwas Vernünftiges zum Anziehen zu kaufen, ihre abgetragenen Sachen störten sie. Die Pullover waren ausgeleiert und die Ärmel immer zu lang und hingen bis auf die Fingerspitzen herunter. Das sah nach geerbten Kleidungsstücken aus. Ein Parfüm hatte sie ihr schon geschenkt, aber sie schien es nicht zu benutzen. Und jeden Tag unter die Dusche schien sie auch nicht zu gehen. Hatte sie denn niemanden, der sie mal beiseitenahm und ihr das zusteckte?
»Hallo Rebecca! Schon zurück?«
»Ja. Miriam hat sich nicht mehr nach mir umgedreht.«
Rebecca brachte Miriam morgens zum Kindergarten und holte sie dort mittags auch wieder ab. Zwei- oder dreimal hatte Rebecca sich zu Beginn dieses Arrangements verspätet. Aufgelöst hatte Vera jedes Mal im Kindergarten angerufen. Aber Miriam und Rebecca hatten unterwegs jemanden getroffen und sich festgequatscht, am Ufer der Olef getrödelt oder etwas zu Hause vergessen. Es gab immer ganz einfache Erklärungen.
Veras Verantwortungsgefühl für Miriam war größer geworden, seitdem sie alleinerziehend war. Einmal war sie den beiden sogar gefolgt, hatte sie beobachtet und war sich danach hinterlistig vorgekommen.
Viel wusste sie nicht von Rebecca. Viel wollte sie von ihr auch nicht wissen. Sie hatte eine gute Menschenkenntnis. Der erste Eindruck ist immer der prägende. Und er hatte sich schließlich bestätigt.
Über den kleinen Empfangsraum ging Vera hinüber zum Gäste-WC, wo sie sich sorgsam die Hände wusch. Danach war das Eincremen Pflicht, wenn sie nicht völlig ausgetrocknete Haut haben wollte; wie ihre Mutter, deren Hände von papierdünner Haut umspannt wurden, wie Drachenflügel. Als Geschäftsfrau konnte sie sich das nicht leisten.
Außer Mutter und Robert gab es nicht mehr viele bekannte Gesichter. Eine Trennung – heutzutage alles andere als ungewöhnlich – war immer noch eine heikle Sache, die Unsicherheit und Ängste schürte. Auch im Falle Rumberg hatten sich danach Lager gebildet: Paare, die sich nicht entscheiden konnten, auf welche Seite sie sich stellen sollten, Frauen, die befürchteten, ihre Männer könnten auf die gleiche Idee kommen oder die Verlassene könne es nun gar auf ihre Männer abgesehen haben.
Niemals hätte Vera geglaubt, dass ihr das widerfahren könnte. Robert und sie waren ein eingeschworenes Team gewesen. Miriam hatte ihr Glück vollkommen gemacht.
Aber Anfang letzten Jahres hatte er aus heiterem Himmel plötzlich behauptet, sie betrüge ihn, er wisse alles, das sei für ihn das Ende. Trotz aller Beteuerungen konnte sie ihn nicht davon abbringen. Und ehe Vera sich versah, zog er aus und verlangte sogar die Scheidung. Manchmal dachte sie, er habe nur nach einem Vorwand gesucht, denn er brauchte nicht lange, um sich eine kleine Freundin zuzulegen, wie man ihr zutrug.
Vera war nicht der Typ, der bettelte. Sie beschloss, allein zurechtzukommen, und die Beschäftigung mit ihrer Zukunft lenkte sie ab. Sie nahm sich einen guten Anwalt und erreichte, dass sie mit Miriam im gemeinsamen Haus in Schleiden wohnen bleiben durfte. Robert rückte das Anfangskapital für eine Selbstständigkeit heraus, das kleine Immobilienbüro im Erdgeschoss. Bis dahin hatte Vera bei Mierkheim & Co. auf Provisionsbasis gearbeitet. Es blieb bei der Trennung, die teure Scheidung schien überflüssig, solange sich nicht eine der beiden Parteien neu binden wollte. Und danach sah es zurzeit nicht aus. Vera zumindest hatte vorläufig die Nase voll von Männern.
Für Miriam hatte sich kaum etwas geändert, es war fast besser geworden als zuvor. Robert war schon immer viel unterwegs gewesen, jetzt kam er wenigstens regelmäßig alle vierzehn Tage und nahm sie für ein Wochenende zu sich. Die Kleine konnte ansonsten in ihrem gewohnten Lebensumfeld bleiben.
Auch geschäftlich lief es ganz gut an, obwohl sie und ihr damaliger Chef eher das Gegenteil befürchtet hatten. Schließlich würde durch die strengen Auflagen des geplanten Nationalparks Eifel wertvolles Bauland unversehens verloren gehen und tabu sein. Im Gegenzug schien es aber unerwartet vielen Interessenten ein besonderes Privileg zu sein, innerhalb oder zumindest am Rande des ersten Nationalparks in Nordrhein-Westfalen wohnen zu dürfen.
Vera versuchte Freundinnen von früher, aus ihrer Kindheit und Schulzeit, wieder ausfindig zu machen. Vor allem aber brauchte sie einen zuverlässigen Babysitter. Ihre Mutter hatte ihr angeboten, zu ihr zu ziehen und Miriam zu versorgen. Aber so gut verstanden sie sich nicht. Mutter hatte ein sehr einnehmendes Wesen. Vera hatte dankend abgelehnt und Rücksichtnahme vorgetäuscht. In Wahrheit fand sie die Vorstellung, mit ihrer Mutter in einem Haus zu leben, beklemmend.
Im Mai dieses Jahres lernte sie dann glücklicherweise Rebecca im Penny Markt in Schleiden kennen, als sie im Kühlregal beide nach dem gleichen Brie griffen, ihre Hände sich dabei berührten und sie sich anlächelten: eine große, kräftige, blasse Frau mit rotem Wuschelkopf um die zwanzig. An der Kasse machte Miriam wieder Theater, weil ihr das Warten zu lang wurde. Rebecca stand gerade hinter ihnen und lenkte Miriam mit einer Handpuppe, einem kleinen Pinguin, ab, bis Vera alles in ihrer Einkaufstasche verstaut hatte. Miriam war fasziniert gewesen und hatte sofort das Gebrüll aufgegeben.
Draußen – ihre Autos standen nebeneinander – waren sie ins Gespräch gekommen. Vera hatte von ihrer Zeitnot gesprochen und Rebecca von ihrer erfolglosen Suche nach einem Job.
Vera hatte das Angebot sofort angenommen. Rebecca war ihr auf Anhieb sympathisch gewesen und schon am nächsten Morgen hatte sie vor der Tür gestanden, Miriam war ohne zu zögern mit ihr gegangen und hatte sich von ihr in den Kindergarten Im Auel am Stadtrand bringen lassen.
Eine halbe Stunde später war Rebecca zurück und befreite Vera von ihren Sorgen. Sie stellte sich ausgesprochen geschickt bei der Büroarbeit an. Pünktlich um zwölf Uhr holte sie Miriam wieder ab und hütete sie auch manchmal noch an den Nachmittagen und Abenden, wenn Vera Außentermine hatte. Es passte. Rebecca hatte ihr das Du angeboten, Vera hatte zwar angenommen, aber ihrerseits keinen Schritt in diese Richtung getan.
»Kann ich irgendetwas für Sie tun?«, erkundigte Rebecca sich, als Vera an ihr vorbei auf ihr Büro zusteuerte.
»Nein, danke. Doch! Hast du vielleicht Lust, heute Nachmittag Miriam zu hüten?« Rebecca schien das Babysitting gern zu übernehmen, und Vera konnte die Stunden nutzen und etwas für sich tun. Ein langes Wannenbad im Kerzenschein, mit ihrer Lieblingsmusik und einem guten Buch, sie hatte gerade einen neuen Val McDermid angefangen. Bei einer ausgiebigen Körperpflege konnte sie sich immer noch am besten entspannen und wirklich loslassen.
»Aber Sie haben heute Nachmittag keinen Termin.«
»Ich hätte nur gern ein wenig Zeit für mich selbst.«
»Oh, Entschuldigung. Natürlich.«
»Kannst du gegen vier Uhr bei mir sein?«
Rebecca nickte.
»Gab es Anrufe?«
»Ja. Wieder einer von diesen anonymen. Schrecklich. Da bekommt man es langsam mit der Angst zu tun, nicht wahr?«
»Ich nicht«, verkündete Vera forsch. Aber das war glatt gelogen. Kaum allein in ihrem Büro, ging sie zum Fenster, zog eines der Alu-Rollos auseinander und spähte hinaus, als könne der Anrufer sich irgendwie in der Nähe herumtreiben.
Diese Anrufe, die sie anfangs Roberts Neuer zugeschrieben hatte, die vielleicht die Lage ausspionieren wollte, gab es immer noch; im Büro und auch abends, wenn sie zu Hause war. Vielleicht war es jetzt Robert selbst, der wissen wollte, ob sie noch allein war. Sie war es. Mehr als ihr lieb war. Das Schweigen in der Leitung ging ihr durch Mark und Bein.
Es waren auch andere, unerklärliche Dinge geschehen. So hatte sie wiederholt Post ohne Absender erhalten, leere Seiten in einem Umschlag ohne Briefmarke oder E-Mails ohne Inhalt von einem undefinierbaren Absender.
Außerdem war sie felsenfest der Überzeugung, dass jemand in ihrer Abwesenheit in ihrem Haus ein- und ausging, ohne dass etwas gestohlen worden wäre, sie fühlte es einfach. Nicht Rebecca, nein, es war ein anderer Geruch da. Sie war sicher. Die Bilder auf der Kommode waren bewegt worden, sie sah es an den Staubrändern, eine Blumenvase auf der Fensterbank war gedreht worden, sie sah es an den Blüten, die sich gegen das Licht reckten, ein Kissen lag an einer Stelle, an der es vorher nicht gelegen hatte.
Einbildungen? Kleinigkeiten? Rebecca hatte verständnislos den Kopf geschüttelt, Robert gelächelt. Vera hätte das auch abgetan, wenn nicht anderes hinzugekommen wäre. Zum Beispiel die Sache mit der Kette. Eine absurde Geschichte. Wann war das gewesen? Vor einem Monat oder war es schon länger her? Vera blätterte in ihrem Kalender zurück und fand schließlich den 11. September, einen Termin in Hellenthal.
Rebecca hatte in ihrer Abwesenheit einen dringenden Abendtermin für sie gemacht, weil es den Klienten nicht anders passte, was sich allerdings später im Gespräch nicht bewahrheitete. Wie auch immer, nach der Besichtigung des Objektes, als die Interessenten schon wieder abgefahren waren, stellte Vera fest, dass sich ihr Auto nicht von der Stelle bewegen ließ. Sie hatte sehr nah am Grundstückszaun geparkt und gehofft, dass sich die Stoßstange nur im Maschendraht verfangen hatte. Sie war ausgestiegen, um nachzusehen.
Die Stoßstange war mit einer schweren Metall-Gliederkette und einem Steckschloss an den Zaun gekettet. In blankem Entsetzen war sie ein paar Schritte rückwärts gestolpert und wäre beinah eine Böschung hinuntergefallen. Sie hatte sich in alle Richtungen umgesehen, während sie mit zitternden Fingern Rebeccas Nummer ins Handy getippt hatte. Rebecca hatte versprochen, sofort einen Handwerker-Notdienst loszuschicken. Der kam auch, nach einer endlosen Zeit des Wartens. Mit einem Bolzenschneider half er ihr aus der Klemme.
Vergessen konnte sie den Abend nicht. Vor allem nicht die Angst, die sie da im Dunkeln mitten im einsamen Gelände gehabt hatte. Auch nicht das verdutzte Gesicht des Handwerkers und seinen Kommentar. »So etwas hab ich noch nicht erlebt! Haben Sie Feinde?«
Hatte sie Feinde?
Das Telefon klingelte, und sie fuhr zusammen.
»Vera? Alles klar bei dir?« Alice Bornheim wartete ihre Antwort nicht ab. Sie war eine Kollegin aus Trier. Sie schoben sich manchmal die Klienten zu. Durchaus unüblich zwischen Maklern, aber Alice sah das anders. Sie hatten sich auf einer Fortbildung des RDM in Mainz kennengelernt. »Ich habe hier einen Klienten für dich. Er sucht ein Objekt in der Nordeifel.«
»Ja.«
»Ja? Bitte schön. Keine Ursache. Das ist für das Ehepaar Schröder, das du mir geschickt hast. War ein dicker Fisch. Hoffentlich kommt ihr auch zusammen.«
»Danke.«
»Heute kurz angebunden? Was ist los?«
»Wahrscheinlich brauche ich mal Urlaub, ich weiß nicht, ich bin irgendwie kaputt.« Und sie fühlte sich verfolgt, aber das wagte sie nicht zu sagen.
»Urlaub? Was ist das?«, lachte Alice ins Telefon.
»Du hast recht.«
»Ich gebe ihm also deine Telefonnummer und dir seine. Er heißt Monteux. Ich nehme an, ein Luxemburger oder Belgier oder so. Häng dich da rein, meine Liebe.«
»Das werde ich.«
Erleichtert legte Vera auf, lehnte sich zurück und langte nach der Kölnischen Rundschau. Gleich würde sie die Telefonnummer in Trier anwählen, sie freute sich schon auf den Abend in der Wanne, blätterte bis zum lokalen Teil Eifelland und überflog die Überschriften und Immobiliengesuche und -angebote. Es war nichts Interessantes dabei.
Aber auf der nächsten Seite sah sie ihr plötzlich direkt in die Augen. Es durchfuhr sie wie ein Blitz, Gänsehaut auf den Armen, Zittern in den Knien. Vermisst in Olef. Ein kleines Foto über einem einspaltigen Artikel. Es handelte sich um Lisa Frohn, die seit Sonntagabend, dem 26. Oktober, nicht nach Hause gekommen sei. Ihre Eltern machten sich große Sorgen. Wo sie an diesem Abend gewesen sei, wüssten sie leider nicht. Sie sei in letzter Zeit so verändert gewesen, bedrückt und ruhelos. Erst habe ihr Freund sie im Stich gelassen, dann habe sie ihre Arbeit als Kellnerin verloren und sei zuletzt kaum noch ausgegangen, wo sie doch früher so ein liebes, freundliches Mädchen gewesen sei. Die Eltern hätten entsetzliche Angst, sie könnte in schlechte Gesellschaft geraten sein, man höre immer wieder von Verschleppungen, Drogenringen oder Ähnlichem. »Hoffentlich ist ihr nichts zugestoßen. Sie ist unser einziges Kind.«
Wer kennt diese junge Frau, wer hat sie zuletzt gesehen? Die Polizei bat um Mithilfe.
Vera ließ die Zeitung in ihren Schoß sinken, legte den Kopf in den Nacken und schloss für einen Augenblick die Augen. Lisa Frohn. Sie wusste nicht einmal, dass sie so hieß. Sie hatten sich ein paarmal gesehen. Aber wie lange war das her? Ein Jahr?
Es klopfte an ihrer Tür. Rebecca brachte Kaffee, wie immer um diese Zeit. Vera atmete auf. Sie war wirklich der einzige Lichtblick in ihrem Leben.
»Nimmst du dir auch eine Tasse?« Sie faltete die Zeitung so zusammen, dass Rebecca das Foto und den Artikel nicht sofort finden konnte, und legte sie auf den kleinen Tisch der Besucherecke.
Im gleichen Moment donnerte direkt unter dem Fenster des Maklerbüros ein Motorrad vorbei, und sie hielten sich beide die Ohren zu. Aus den Augenwinkeln sah sie einen schwarzen Schatten hinter den Jalousien vorüberfliegen, ein Helm blitzte in der Sonne kurz auf. Rebeccas Antwort ging im Motorengeräusch unter, aber sie nickte lächelnd.
3. Kapitel
Lars Bentrup drehte trotz Geschwindigkeitsbegrenzung weiter auf und verließ Schleiden über die B 265 in Richtung Gemünd. Am Morgen in seinem Wohnort Dreiborn gestartet, kam er gerade aus Hellenthal angebraust. Die Schnelligkeit, mit der sein Motorrad über den Asphalt fegte, gab ihm ein erhebendes Gefühl. Der Wind, das satte Brummen des Motors, die vorüberfliegenden Häuser hoben ihn in eine Art Zwischenebene, seelisch und körperlich, mit jedem Teilstrich, den die Nadel auf dem Tacho höher kroch. Nur Fliegen konnte schöner sein.
Er saß auf seiner grafitgrauen BMW R 100 R Classic, Baujahr ’98. Zu seinem Pool gehörten noch eine silberne GSX 750, Baujahr 2001, ein so genanntes »naked bike«, die er leider aufgrund mehr oder weniger unbekannter Vorkommnisse in ihre Einzelteile zerlegt hatte, und eine knallrote 450er KTM Enduro, sein Lieblingskind. Ein nicht angemeldeter Zweirad-Anhänger fristete in seiner Garage sein Dasein unter einer Plane.
Er war auf seiner täglichen Runde, die ihn immer wieder durch die selben Ortschaften führte. Von Nideggen im Norden bis zur belgischen Grenze im Süden. Westlich lagen Simmerath und Monschau auf seiner Route, im Osten Hellenthal, Schleiden und Heimbach. Auf diese Weise kreiste er praktisch weiträumig das Gebiet des zukünftigen Nationalparks Eifel ein, seine Heimat.