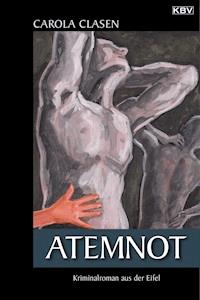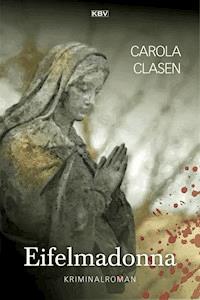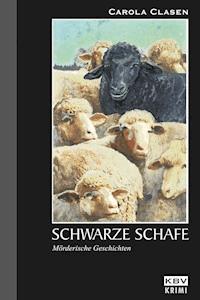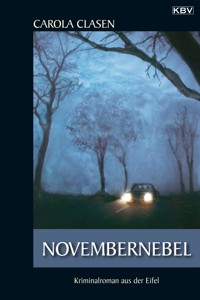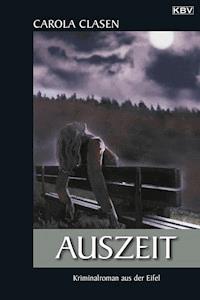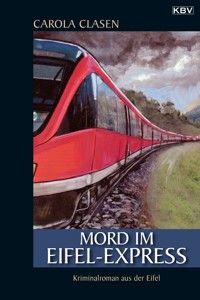Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Von einem Tag auf den anderen kostet eine Beerdigung im kleinen, beschaulichen Eifelort Oberprüm nur noch die Hälfte. Kein Wunder, dass die Konkurrenz den Leichenwagen von nun an nicht mehr aus den Augen lässt. Die Bestatter Paul und Peter Schlangensief haben offensichtlich eine todsichere Geschäftsidee entwickelt, dank derer sie allen anderen eine Nasenlänge voraus sind. Zur gleichen Zeit gibt der verwitwete Dachdecker Wilden eine Heiratsannonce auf. Als er endlich einen Brief und ein Foto erhält, verliebt er sich Hals über Kopf in die schöne Sybille. Sein Glück scheint perfekt. Doch dann geht es plötzlich mit seiner Gesundheit rapide bergab.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carola ClasenTot und begraben
Bisher von der Autorin erschienene Titel bei KBV:
»Novembernebel«
»Das Fenster zum Zoo«
»Tot und begraben«
»Auszeit«
»Schwarze Schafe«
Carola Clasen wurde 1950 in Köln geboren. Nach einem Sprachenstudium arbeitete sie bis zu ihrer Heirat in Belgien. Später veröffentlichte sie zahlreiche Kurzgeschichten im Rundfunk. 1998 erschien ihr erster Eifel-Kriminalroman »Atemnot«.
Carola Clasen
Tot und begraben
1. Auflage Mai 20032. Auflage Mai 2006
© 2003 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheimwww.kbv-verlag.deE-Mail: [email protected]: 0 65 93 - 998 96-0Fax: 0 65 93 - 998 96-20Redaktion, Satz: Volker Maria Neumann, KölnUmschlagillustration: Ralf KrampISBN 3-937001-03-4E-Book-ISBN 978-3-95441-020-0
Die Erde ist mein Körper,mein Kopf ist in den Sternen
(aus: »Harold and Maude«)
PROLOG
Die Brüder Peter und Paul Schlangensief waren mit dem Friedhof von Oberprüm aufgewachsen. Ihr Elternhaus lag direkt neben dem Friedhof und da sie nicht vor eines der seltenen Auto laufen sollten, schickte Elsbeth, ihre Mutter, sie zum Spielen auch auf den Friedhof. Hinter dem eisernen Tor und den hohen Ligusterhecken waren sie sicher wie in Gottes Armen.
Elsbeth hatte es nicht leicht gehabt und die Kinder allein aufziehen müssen, nachdem sich ihr Mann, Friedrich, schon in jungen Jahren von einem landwirtschaftlichen Fahrzeug hatte überfahren lassen. Paul und Peter waren vier und drei Jahre alt, als sie zu Halbwaisen wurden. Dazu kam ein genetischer Defekt. Sie hatten dunkelbraune Augen, dunkle Augenbrauen, dunkle Wimpern, aber schlohweiße Haare auf dem Kopf.
Sie hatten eine Handvoll Freunde, Klassenkameraden, vor allem Konrad Wilden, den Sohn des Dachdeckers. Jedenfalls bis zu jenem denkwürdigen Tag, an dem er das Wort gerufen hatte, dass Paul und Peter immer noch nicht aussprechen konnten. Mitten im Schulbus. Am hellen Mittag. Dann hatten es alle Kinder gerufen und sich halb tot gelacht. Das unaussprechliche Wort.
Danach wurden Paul und Peter zu Außenseitern, denn so etwas vergaß man nicht, dafür war das Leben nicht lang genug. Aber sie hatten einander, der Bruder den Bruder, und sie hatten den Friedhof.
Wenn die Kirchengemeinde von Sankt Salvator in Prüm nicht gesammelt hätte, wer weiß, was aus ihnen geworden wäre, vielleicht wären sie auf die schiefe Bahn geraten.
Anstatt sich mit der stattlichen Summe ein schönes Leben zu machen, hatte Elsbeth sie gewinnbringend angelegt, denn sie hatte Pläne mit ihren Söhnen.
Als sie die Schule beendet hatten, waren sie sechzehn und siebzehn Jahre alt (Paul hatte eine Ehrenrunde gedreht, um in Peters Klasse zu kommen) und eröffneten ihrer Mutter, dass sie Friedhofsgärtner werden wollten. Ein Leben ohne ihren Friedhof konnten und wollten sie sich einfach nicht vorstellen.
Elsbeth dachte, sie hätte sich verhört: »Was? Wollt ihr etwa bis an das Ende eurer Tage in einer grünen Latzhose und mit dreckigen Fingern herumlaufen, bei Wind und Wetter draußen arbeiten, für ein Gehalt, das man nicht Gehalt nennen kann. Wollt ihr das?«
Beide nickten in seltener Einigkeit. »Unbedingt.«
»Und wir wollen uns die Haare färben.«
»Jawohl«, bestätigte Paul tapfer, »schwarz.«
»Kohl-pech-raben-toten-schwarz. Das schwärzeste Schwarz aller Zeiten.«
»Kommt gar nicht infrage«, entschied Elsbeth, »ihr werdet Bestatter und eure Haare bleiben weiß, wie sie sind.«
So konnten sie wenigstens in der Nähe des Friedhofs bleiben.
Prompt machte Elsbeth sich bereits am nächsten Morgen auf den Weg in die Turmstraße zum Bestatter Zingsheim. Er war ihr etwas schuldig. Als sie sein Geschäft betrat, sah sie ihn durch einen Spalt des schwarzen, vergammelten Vorhangslinsen.
»Morgen«, rief sie fröhlich, setzte sich geräuschvoll auf einen Besucherstuhl und sah sich um. Das Büro war eines Bestatters nicht würdig, stellte ihr prüfender Blick fest. Es sah billig aus und abgeschabt, so wie sein gesamter Besitz renovierungsbedürftig war. Endlich huschte er nervös durch seinen Vorhang, erschien auf der Bildfläche und schnurrte eine unverständliche Begrüßung.
»Wie geht es dir, Wilhelm?«, fragte Elsbeth.
Zingsheim schlackerte mit seinem rot glänzenden, kahlen Kopf hin und her und brummte: »Man wird nicht jünger.«
»So ist es. Deswegen bin ich hier. Was soll aus deinem Geschäft werden, Wilhelm, wenn du zu alt zum Bestatten bist?«
»Was soll werden?«
»Leider hast du keinen Nachwuchs.« Elsbeth wusste, warum. Er war seit Friedrichs Tod kein richtiger Mann mehr. Gitta, seine Frau, hatte sich bei ihr darüber beklagt. (Warum soll es dir besser gehen als mir?, hatte Elsbeth sie getröstet.) Kein Wunder, nach einem Mord mag einem die Lust auf die Lust vergehen …
»Was kann ich für dich tun?«, fragte Zingsheim nervös, als könnte Elsbeth ihn jeden Moment auf sein delikates Handicap ansprechen.
»Paul und Peter wollen Bestatter werden.«
Er wechselte die Farbe.
»Nun, da es so ist, dachte ich du … du bist der Einzige, dir würde ich sie anvertrauen. Sie sind alles, was ich habe.«
»Ich glaube nicht, dass …«
»Der guten alten Zeiten wegen«, unterbrach Elsbeth ihn und verzog den Mund zu einem scheinheiligen Lächeln.
»Darüber muss ich nachdenken.«
»Tu das.« Elsbeth lehnte sich zurück, die Handtasche auf dem Schoß, die Hände darüber gefaltet, den schwarzen Strohhut auf dem Kopf. Sie hatte nicht vor zu gehen, bevor sie eine Zusage bekäme.
»Also gut«, gab er schließlich widerwillig nach, »ich kann sie hinterher aber auf keinen Fall ins Geschäft übernehmen, die Lage ist schlecht.«
»Paul und Peter verfügen über ein beträchtliches Vermögen«, lockte sie ihn leise und beiläufig und schubste dabei eine weiße Fluse von ihrem schwarzen Rock.
»Das wäre natürlich etwas anderes. Dann könnte man in der Zukunft über ein Bestattungshaus Zingsheim-Schlangensief nachdenken.«
Das übliche »Kommt gar nicht infrage« lag ihr bereits auf der Zungenspitze, aber sie hielt inne und ließ ein vages »Man wird sehen« hören, woraufhin Zingsheim sich in sein Schicksal ergab.
Er nahm sich der Brüder Schlangensief an und weihte sie in die Geheimnisse des Bestattungswesens ein, beginnend mit dem Anruf der Hinterbliebenen bis hin zur Bezahlung aller Rechnungen.
Zwei Jahre später verkündete er: »Wir wären jetzt soweit.
»Das hat aber lange gedauert.«
»Deine Söhne sind sehr ordentliche Bestatter geworden und haben sogar den Führerschein. Den habe ich bezahlt.«
»Das ist schön.«
»Nun können wir über die Fusion reden.«
»Über was?«
»Die Fusion. Zingsheim-Schlangensief«, erinnerte Zingsheim sie.
»Kommt gar nicht infrage.«
»Zwei Bestattungshäuser in Oberprüm, meinst du nicht das ist ein wenig übertrieben?«
»Wieso zwei, Wilhelm?«
Die Schlangensiefs meldeten ihr neues Gewerbe im Prümer Rathaus auf der Tiergartenstraße an. Im Standesamt, das für das Bestattungswesen zuständig ist, waren sie durch Zingsheim bereits hinlänglich bekannt. Dort wünschte man Glück und Erfolg. Dann mieteten sie den ehemaligen Friseursalon Belle in der Poststraße an, der am entgegengesetzten Ende von Zingsheims bald zu schließender Wirkungsstätte in der Turmstraße lag. Der Laden war für ein Bestattungshaus klein, aber auf der linken Seite stand seit vielen Jahren eine große Garage leer. Wenn sie ausgebaut würde, könnte man darin einen beeindruckenden Ausstellungsraum realisieren. Paul und Peter übernahmen die Innenrenovierung in Eigenregie – unter Elsbeths Anleitung.
Die Räumlichkeiten waren in einem verheerenden Zustand. Der Vormieter, ein schmuddeliger Luxemburger, hatte sich nicht lange halten können und musste alles panikartig verlassen haben. Peter hielt sich bei der Arbeit zurück und ging grübelnd im Laden auf und ab, bis er zu dem Schluss kam, dass man einen Teil der Ausstattung behalten sollte, so unterschiedlich war sie nicht von der des Bestatters. Auf jeden Fall sollte der »Kosmetik-Behandlungstisch« bleiben und das »Badezimmer«.
Elsbeth organisierte zwei schwarze Anzüge, eine repräsentative, schwarze Ledercouch mit zwei Sesseln und einem Rauchglastisch mit Chrombeinen, zwei Nussbaum-Schreibtische, zwei grüne Bankerlampen und zwei Lederdrehstühle. Dass hinter jedem Schreibtisch in Kürze ein überdimensionales Ölbild von einem Schlangensief-Ahnen hängen würde, erwähnte sie noch nicht. Eines vom Großvater, der 1949 bei der furchtbaren Militärbunker-Explosion ums Leben gekommen war, und eines vom Urgroßvater, der 1919 einem grandiosen Blitz inmitten seiner Wiesen und Weiden zum Opfer gefallen war. Ein drittes Bild vom ruhmlos verstorbenen, betrunkenen Vater Friedrich würde es definitiv nicht geben.
Fehlte noch das offizielle Bestatterzubehör: Kühlfach, Schaufeltrage, ein Zinksarg, eine Auswahl an Särgen – vom einfachen Kiefernsarg bis zum Luxus-Teak-Modell mitsamt Sargmatratzen, Sargdecken, Kissen, Leichendecken und Einweglaken. Zur Grundausstattung gehörte weiterhin ein Sortiment an Urnen, Grablampen und Vasen.
Die Schlangensiefs verfügten über einschlägige Verbindungen: Steinmetz, Blumenhändler, Grabpflege und Druckerei aus der Umgebung wurden nach dem Kriterium ausgewählt: Wer hat Krach mit Zingsheim? Zum Schluss erstand Peter in Bitburg einen gebrauchten, aber gut erhaltenen Leichenwagen. Er fand ein schönes Modell, einen Citroën, der noch keine sechzigtausend Kilometer gefahren war und sich mit seiner Hydropneumatik direkt in sein Herz schaukelte. Auf dem Dach, direkt neben der Antenne, ließ er eine kleine Standarte wehen, die rot-grüne Fahne der Stadt Prüm. Niemand konnte den Wagen mit Zingsheims verwechseln. Die Kunden konnten sicher sein, eine Beerdigung bei den Schlangensiefs würde auf jeden Fall immer eine echte Gegenveranstaltung werden. Und darum ging es doch.
»Wir brauchen einen seriösen Namen«, verkündete Peter nach reiflicher Überlegung und Absprache mit Paul, »Pax Domine, zum Beispiel.«
»Kommt gar nicht infrage.« Elsbeth entstieg pompös nach einer Probefahrt dem Leichenwagen und rief aus: »Es bleibt, wie es ist.« Dazu breitete sie die Arme aus, als wolte sie die halbe Stadt an ihren enormen Busen drücken.
»Pax Domine.« Peter und Paul konnten sehr stur sein.
»Nein.« Eilig floh Elsbeth ins Geschäft. Manchmal blieb ihr nur dieser Weg. Es wurde immer schwieriger, ihre Söhne bei der Stange zu halten. Je älter sie wurden, desto mehr schienen sie sich von ihr distanzieren zu wollen. Wenn sie ihnen Vorschriften machte, wurden sie geradezu aggressiv, besonders Peter, dabei war er als kleiner Junge einfach zu handhaben gewesen. Hatten sie als Kinder noch geglaubt, ihre Mutter hätte das Feuer erfunden, sahen sie sie jetzt manchmal an, als fürchteten sie, sie wolle gleich welches legen.
Dann trat eine längere Ebbe ein, die exakt fünf Jahre dauerte, während der das Geschäft vor sich hin dümpelte. Der Laden wollte einfach nicht richtig in Schwung kommen. Elsbeth litt. Monatelang sah sie durch ihr Küchenfenster mit wehem Blick in die Ferne, sprach von den Zeiten, als der Name Schlangensief in Oberprüm noch für Erfolg stand, und seufzte in regelmäßigen Abständen gotterbärmlich auf.
»Das hab ich mir alles ganz anders vorgestellt«, jammerte sie am Abend des 4. April, ließ sich erschöpft in ihren Ohrensessel fallen und stellte die Blues Brothers ab, die Paul und Peter zum x-ten Male abspielten.
»Wird schon werden«, tröstete Paul sie und angelte nach der Fernbedienung, aber Elsbeth schob ihn ungeduldig beiseite.
»Nichts wird. Ich komme erst zur Ruhe, wenn er dicht macht.«
»Wer denn nur?«
»Zingsheim.«
»Warum? Schlecht ist er nicht. Er hat …«
»Ich kann nicht mehr«, stöhnte sie auf.
Ihre Söhne verstanden kein Wort.
»Er war es nämlich, der euren Vater tot gefahren hat.«
»Zingsheim?«, schrien beide auf und erbleichten. »Du hast gesagt, der Traktor habe sich von allein …«
»Das hat er nicht. Ich wollte euch schonen, ihr wart doch noch kleine Kinder. In Wirklichkeit saß der Zingsheim drauf. Betrunken war er und wie! Hat euren Vater hinterrücks überfahren. Dieser … dieses …«
»Oh! Dieses miese Schwein«, fluchte Peter.
»Sag ich doch.« Elsbeth lehnte sich zurück und schloss erlöst die Augen, als Peter fragte: »Und du hast uns trotzdem zu ihm in die Lehre gegeben? Zu dem Mörder unseres Vaters? Wie konntest du!«
Und Paul hinzufügte: »Warum hast du ihn damals nicht angezeigt? Dann hätten wir Friedhofsgärtner werden können.«
»Ich hatte einen Plan.«
Betreten schwiegen alle, gingen in Gedanken die vielen Jahre durch, in denen Elsbeth das grausame Geheimnis tapfer für sich behalten hatte, ihre Söhne in die Höhle des Löwen geschickt hatte, nur um ihren Plan verwirklichen zu können. Eine großartige Leistung für jemanden, der nicht nur redselig war, sondern auch ausgesprochen rachsüchtig.
Aber sie war noch nicht fertig mit Zingsheim: »Er ist nicht nur der Mörder eures Vaters, ein habgieriger Bestatter, wie ihr selbst am Besten wisst, sondern auch kein richtiger Mann«, ergänzte sie mit gebrochener Stimme.
»Wie?«
»Kein richtiger Mann«, wiederholte sie und sah zur Zimmerdecke.
»Nein?«
»Warum haben Gitta und er keine Kinder?« Elsbeths Wagen röteten sich, da sie ins Detail gehen musste.
»Vielleicht, weil sie keine wollten?«
»Nein«, sie machte eine dramatische Pause. »Er ist nicht in der Lage, Kinder zu … na ja.«
»Zu zeugen?«, half Paul aus.
Sie nickte und errötete weiter.
»Er ist impotent?« Peter begann zu kichern und prustete los: »Ein impotenter Mörder also.«
»Das ist nicht lustig«, fuhr Elsbeth ihn an, sie hatte sich wieder gefangen und war bereit, für ihren Lebensplan zu kämpfen.
»Ist ja gut, Mutter.«
Es wurde still im Wohnzimmer der Schlangensiefs.
»Also gut«, verkündete Peter nach einer guten Weile, »er wird untergehen. So wahr wir Bestatter sind.« Sein Herz hing nicht an Zingsheim.
»Das wollte ich hören«, seufzte sie, schaltete den Fernseher wieder ein. Im Ersten lief inzwischen der Spätfilm, eine Schwarz-Weiß-Tragödie aus den Dreißigern. Sie lehnte sich zufrieden zurück und schloss ihre kleinen, braunen Augen für ein wohlverdientes Schläfchen, das sie gern im Ohrensessel absolvierte, bevor sie zu Bett ging.
»Und was machen wir jetzt?«, flüsterte Paul, als er sicher sein konnte, dass sie eingeschlafen war.
1. Kapitel
Natürlich war es mitten in der Nacht auf dem Friedhof friedlich und still, nur die Schritte der beiden Bestatter knirschten auf den sandigen Wegen. Peter ging forsch, als hätte er ein Ziel, Paul marschierte neben ihm in seinem typisch abgehackten Gang, als wollte er jeden Moment der Länge nach hinfallen. Als ein Kauz in der Ferne schrie, zuckte er zusammen und stolperte. Plötzlich blieb Peter stehen, legte den Finger auf den Mund und horchte in die Dunkelheit hinein.
»Hörst du das?«
Tatsächlich. Ein winziges Wimmern schien von ganz in der Nähe zu kommen. Paul erstarrte. Hinter ihm erhob sich ein frischer Grabhügel mit Kränzen und letzten Grüßen. Ein süßer Duft nach Erde und Mimosen erreichte ihn mit der nächsten Bö.
»Hermine Kall«, entzifferte er auf dem hölzernen Kreuz, »die hat Zingsheim erst heute Morgen beerdigt.«
»Und wenn sie noch lebt?«
»O Gott, das wäre furchtbar.«
»Wir müssen nachsehen. Schnell.«
Alles, was sie dazu brauchten stand im Schuppen neben dem Haupteingang; Spaten, Harke und Schubkarre. Auch der Sargwagen und die Seilwinde mit Hebevorrichtung der Bestatter war dort untergebracht. Aus unerfindlichen Gründen bestand Peter darauf, zwei großen Säcke Graberde oben aufzupacken, als hätten sie nicht genug zu schleppen. Als er sich bückte, klaffte seine Jacke auseinander und ein blütenweißes Einweglaken blitzte hervor. Aber sie waren in Eile, es galt Leben zu retten und so stellte Paul keine Fragen.
Atemlos kamen sie zu Hermine Kall zurück, Peter warf die Kränze beiseite und ließ seinen Bruder graben. Paul stand schließlich auf dem Sarg, bückte sich ächzend, hielt ein Ohr an den Deckel und schüttelte den Kopf: »Ich hör nichts mehr.«
»Hol sie trotzdem hoch.«
Er setzte die Klammern an der Unterseite des Sarges an, kletterte heraus, holte per Seilwinde den Sarg herauf und mit vereinten Kräften schoben sie ihn auf den Sargwagen.
»Was für ein Sarg!«
Er passte wahrhaft zu Hermine Kall, die eine der reichsten Witwen in Oberprüm gewesen war, die Metzgersfrau. Sie war von ihrem silbergrauen Mercedes von einem Tag auf den anderen umgestiegen in diesen – abgesehen von einigen Erdklumpen – glänzenden Sarg aus echtem, massivem und poliertem Mahagoni-Holz. Griffe und Kreuz waren aus purem Messing. Der Schliff Handarbeit. Ein Unikat. Ein Prachtstück.
»Getränkt mit dem Blut unschuldiger Tiere!«, klagte Paul an und begann ein Ave Maria zu deklamieren.
Währenddessen strich Peter versonnen über das Holz und sagte: »Es ist eine Schande, dass dieser sau-teure Sarg da unten vergammeln wird.«
»Nachdem Tausende von Tieren dafür ihr Leben lassen mussten«, unterbrach Paul sein Gebet.
»Praktisch umsonst, für zwei Stunden im Tageslicht und dann ab in die Dunkelheit, für immer und ewig. Welch eine furchtbare Verschwendung!«
Mühsam öffnete Peter den Sargdeckel und es offenbarte sich, was die beiden geahnt hatten: Zingsheim hatte schludrig gearbeitet.
Hermine Kall sah schrecklich aus, nicht etwa weil sie über neunzig und übersät von schwarzen Totenflecken war. Zingsheim hatte vergessen ihr die Augen zu schließen, die Kinnbinde war viel zu lose, die Hände lagen nicht gefaltet über der Brust und das Leichenhemd war obendrein hochgerutscht bis über die mageren Knie.
»Typisch Zingsheim«, schimpfte Paul, »oben hui und unten pfui.« Mitleid überkam ihn, und er begann ganz automatisch Hermine Kall herzurichten, als sein Bruder seinen Arm festhielt und sagte: »Warte.«
Peter beugte sich über die Tote, zog ihre spindeldürren Arme aus dem Leichenhemd und band die Schleife auf dem Rücken auf.
»Was machst du?«
»Psst. Willst du die ganze Stadt wecken?«
Das wären nicht viele Leute gewesen, denn der Stadtteil Oberprüm war mit hunderteinundzwanzig Einwohnern der zweitkleinste vor Steinmehlen. Und der Friedhof lag dazu noch außerhalb am Ende einer Sackgasse. Er war auch für die Stadt Prüm und die nördlich gelegenen Orte der Verbandsgemeinde zuständig.
»Psst. Weißt du, was dieses Leichenhemd kostet?«
»Natürlich weiß ich das. Neunundvierzig neunzig.«
»Richtig.« Peter stopfte das Hemd in die Hosentasche und fragte weiter: »Und die Sargmatratze mit Kissen?«
»Neunundsiebzig neunzig.«
»Richtig. Und dieser Sarg hier kostet?«
»Dreitausend?«
»Richtig.«
Fassungslos musste Paul mit ansehen, wie sein Bruder die nackte Tote vorsichtig aus dem Sarg hob, während er ihr seine starken, lebendigen Arme um Oberkörper und Beine legte, sie auf die aufgeworfene Erde bettete, das Einweglaken aus der Jackentasche zog und sie nahezu liebevoll darin einwickelte, nur um sie dann einfach hinabzurollen.
Mit einem dumpfen Knall kam Hermine Kall am Ende des Grabes auf.
Paul starrte ihr besorgt nach in die Tiefe und sagte: »Hoffentlich hat sie sich jetzt nichts getan.«
»Sie ist tot.«
»Erst Zingsheim und jetzt wir.« Höchst verloren sah Paul vom leeren Sarg über die aufgestapelten Kränze hinauf zum knochenweißen Mond und wieder zurück und fragte schließlich mit bebender Stimme über den Grabhügel: »Was hast du nur vor?«
»Wir werden diesen wunderbaren Sarg ein zweites und drittes Mal verwenden.«
Da wurde ihm schlagartig klar, dass Hermine Kall kein einziges Mal gewimmert hatte. Peter hatte von Anfang an nichts anderes gewollt als diesen Sarg, um … warum eigentlich?
»Warum?«
»Oh Mann, weil wir diesen impotenten Mörder vernichten müssen, natürlich.«
»Das ist eine Sünde.«
Peter war auf diesen Satz vorbereitet. Wenn man Paul eine Sache verkaufen wollte, musste man bibelfest sein.
»Nein«, antwortete er, wischte sich mit dem Leichenhemd den Schweiß von der Stirn und winkte ab. »Denn damals waren Särge auch nur Transportmittel. Du erinnerst dich an Jesus? Selbst den haben sie nur in einem Laken beerdigt.«
Paul dachte nach und sagte nach einer Weile: »Muslime dürfen heute noch nicht mit Sarg beerdigt werden. Kam neulich im Fernsehen.«
»Siehst du.«
»Aber Hermine Kall war erzkatholisch.«
»Ja?«
»Natürlich. Wie alle hier.«
»Ihr Pech.«
»Dann sollten wir sie wenigstens nach Mekka gucken lassen.«
»Von mir aus. Wo haben wir denn hier Mekka?«
Die beiden sahen sich um. Am Himmel war nur der Mond und eine Handvoll Sterne.
»Da drüben geht die Sonne immer auf«, entschied Paul und zeigte auf ihr Elternhaus. Hinter dem Wohnzimmerfenster flackerte das blaue Licht des Fernsehers. Mutter, durchjagte es ihn, wenn Elsbeth sie sehen würde! Ihre einzigen Söhne!
»Ich mach’s schon.« Er kletterte noch einmal hinab, drehte Hermine Kall vorsichtig mit dem Kopf in Richtung Mekka und murmelte eine Entschuldigung dabei.
»Beeil dich. Wir müssen von hier verschwinden. Wir können es ja nächstes Mal etwas sanfter machen.«
»Nächstes Mal?« Entsetzt schlug Paul sich mit den dreckigen Händen vor den Mund, verteilte die Graberde anschließend in seinem Gesicht und sah halb blind aus seinem Erdloch empor wie ein Maulwurf.
Peter reichte ihm die Hand und zog ihn hinauf, entleerte dann die beiden Säcke Graberde über Hermine Kall, um die fehlende Masse des Sarges auszugleichen, schaufelte das Grab wieder zu und trat die Erde platt. Seelenruhig legte er alle Kränze wieder oben auf und drapierte die Schleifen neu. Zum Schluss harkte er sogar den Weg und beseitigte alle Spuren ihrer Tat.
Zurück auf der Friedhofstraße schoben die Brüder Schlangensief den Sarg in ihren Leichenwagen und rollten mit Abblendlicht und niedrig laufendem Motor – fast lautlos und unsichtbar – vorbei an der schlafenden Elsbeth und erreichten die ersten Häuser von Oberprüm. Sie ließen die Villa des Dachdeckers Heinz Wilden links liegen und bogen wenig später am Marktplatz in die Poststraße ein.
Der Stadtteil Oberprüm lag knapp zwei Kilometer nördlich von Prüm – zwischen Tafel und Walcherath – auf einer Anhöhe in Hanglage und bestand fast nur aus Sackgassen. Eigentlich war der Ort selbst eine einzige Sackgasse. Es gab nur einen Weg hinein und hinaus; die Bergstraße. Gewendet werden musste am Marktplatz, den man umfahren konnte. Von dort gingen vier Sackgassen in alle Himmelsrichtungen. Hier befand sich auch die komplette Infrastruktur: Bushaltestelle, Metzger, Bäcker, der Allgemeinmediziner Dr. Michels, ein Kaufladen, wo man sowohl lose Bonbons als auch lose Schrauben erstehen konnte, ein Friseur, die Krater-Apotheke und die einzige Kneipe, der Kraterhof, vor dem im Sommer bei schönem Wetter Stühle auf dem Marktplatz standen. Alles weitsichtig angelegt und zugeschnitten für die Zukunft, in der Hoffnung, der Stadtteil Oberprüm werde wachsen und gedeihen.
Bei den vier Sackgassen handelte es sich um die Friedhofstraße, von der die Schlangensiefs gerade kamen, die Poststraße, auf der sich ihr Bestattungshaus befand, die Turmstraße sowie die Talstraße.
Oberprüm war ein glücklicher Ort. Er wurde im Jahre 1949, als am Prümer Kalvarienberg der Militärbunker in die Luft flog, fast völlig verschont. Lediglich ein leichtes Beben der Erde war damals zu verspüren gewesen, dem allerdings einige Häuser nicht hatten Stand halten können. Aber es hatte immerhin keine Toten gegeben. Für eine Katastrophe wie diese war Oberprüms erhöhte und – vom Krater aus gesehen – rückwärtige Lage ein Glücksfall. Die Stadt Prüm dagegen, im Tal und obendrein zu Füßen des Kalvarienberges, hatte es voll erwischt.
Die Einwohner Oberprüms kamen im Allgemeinen gut miteinander aus, bis auf wenige Ausnahmen. In Oberprüm war die Welt noch in Ordnung, auf jeden Fall war sie es bis zu dieser Nacht.
In der Poststraße stieg Paul aus und öffnete das Tor zum Hof, wobei ein ohrenbetäubendes Quietschen einsetzte. Peter fuhr den Wagen auf den Hof und Paul schloss das Tor. Sie warteten ein paar Minuten, ehe sie den leeren Sarg aus dem Leichenwagen hoben und ins Geschäft trugen. Bei grellem Neonlicht gingen Paul und Peter ihrer Arbeit nach, schüttelten das Kissen auf und weichten das Leichenhemd in einer Seifenlauge ein, befreiten den Sarg sorgsam von Erdklumpen und Grashalmen und klaubten Schnecken und Würmer ab. Sie schrubbten und wuschen und polierten und schoben ihn in den Ausstellungsraum auf ein Podest. Er sah aus wie neu. Erschöpft streckte Peter sich danach auf der schwarzen Ledercouch aus.
»Und was machen wir jetzt?«, fragte Paul.
»Das Leichenhemd kann gleich auf die Leine.«
Paul schob sich vom Sessel und schleppte sich ins Hinterzimmer. Während er das Leichenhemd wusch und wrang, ausschüttelte und schließlich mit Wäscheklammern an der Leine im Badezimmer befestigte, dachte er an die Ungerechtigkeit der Welt.
»Und was machen wir jetzt?« Er setzte sich neben Peter auf den Sessel und beobachtete ihn. Sein stummer Blick konnte Schlafende wecken, er musste nur lange genug sein Opfer anstarren, wie eine Schlange. Endlich öffnete Peter die Augen, verzog das Gesicht und brummte: »Warten.«
»Worauf denn?«
»Ob einer drauf kommt.«
Paul trommelte mit seinen Fingern auf den kleinen Rauchglastisch, auf dem die Prospekte für die Kunden lagen, als sein Blick wieder auf den Mahagoni-Sarg fiel.
»Wer soll ihn eigentlich bekommen?«, fragte er dann eher sich selbst als seinen schlafenden Bruder. »Eigentlich jemand, der ihn sich niemals im Leben hätte leisten können. Ein Armer … und ein Vegetarier dazu.« Wenn man etwas Schlechtes tut, dann sollte es wenigstens für einen guten Zweck sein.
Bis zum Sechswochen-Amt für Hermine Kall wechselten sich die Brüder auf dem Speicher ab. Tagsüber überwachte Paul von dort das Grab, Peter nachts. Die kurze Phase der Übergabe verbrachten sie mit dem Abendessen und einem Blick in die Blues Brothers.
Es war nicht einfach, Mutter Elsbeth die Situation zu erklären, ohne die Wahrheit zu sagen und ohne zu lügen. Als Paul sagte, er wolle auf dem Dachboden in sich gehen, log er nicht.
»Warum, Paul?«, fragte Elsbeth.
»Er hat kein Recht, so dick zu sein«, half Peter aus und fuchtelte hinter Elsbeth herum. Paul war nur unwesentlich dicker als sein Bruder. »Weil es so viele hungernde Kinder auf der Welt gibt.
»Ja«, haspelte Paul, »all die Kinder …«
Elsbeth schüttelte den Kopf und schimpfte: »Ihr macht mich noch wahnsinnig.« Dann knallte sie die Tür hinter sich zu, dass der Dachboden bebte, und stampfte die schmale Holztreppe hinunter. Peter winkte seinem Bruder schadenfroh zu und folgte ihr.
»Vergesst mich nicht!« Pauls zaghafte Stimme wurde leiser. Sein Magen knurrte bei dem Gedanken an eine Fastenzeit und er war nicht gern allein.
Das Halbdunkel des Speichers schien Geheimnisse zu bewahren. Das schmale Dachfenster warf ein Bündel Licht – voller Staubflusen und Insekten – auf die Holzdielen. Und obwohl er oft genug hier oben mit seinem Bruder von Kindesbeinen an gewesen war, kamen ihm die Gegenstände fremd vor, als stünden sie an einem anderen Platz und hätten eine andere Form angenommen und als gäbe es hier oben jemanden, der sie verrückte und veränderte.
Er hasste es benutzt zu werden, Mutters Vollstrecker zu sein und Peters gefährliche Pläne auszuführen. Es bestand doch die Gefahr, dass Mutter sich nach Zingsheims Untergang andere Opfer suchen, und dass Peter, einmal auf den Geschmack des Geldes gekommen, sich vermutlich bis ans Ende ihrer Tage der wiederholten Grabschändung schuldig machen würde. Eine Zeit der Lügen und Intrigen stand bevor, statt eines friedlichen Lebens auf dem Friedhof.
Und er? Er stellte sich ans Fenster, die Hände auf der Brüstung, den Kopf gegen die aufgestellte Scheibe gepresst und sah hinaus und schon breitete seine Angst die Flügel aus und huschte davon, erhob sich über die Häuserdächer von Oberprüm hinweg, zu den Hügeln des Prümtals hinauf bis zum Horizont und darüber hinaus und sein Herz wurde leichter.
Er sammelte Kräfte. Wenn es soweit war, musste er stark genug sein, nein zu sagen.
2. Kapitel
Zur gleichen Zeit, aber Hunderte von Kilometern entfernt, kaufte eine Frau in einem Kiosk die ZEIT. Bis auf die Rubrik »Kennenlernen« warf sie alles ungelesen in den nächstliegenden Papierkorb und ließ sich mit einem Taxi nach Hause fahren. Sie hängte ihre helle Jacke an die Garderobe und ging die Treppen hinauf. Mehrere Türen führten von der großzügig geschnittenen Diele ab. Hinter einer dämmerte Harald seinem Ende entgegen. Hinter einer anderen lag ihr Zimmer, mit großem Balkon und Blick auf den blühenden Garten. Immer dann, wenn der Garten fertig war, musste sie weiterziehen.
Sie schloss sich in ihrem Zimmer ein, zog die Vorhänge zu und breitete die Zeitungsseiten auf dem Fußboden aus.
Nach kurzer, eingehender Prüfung musste sie mit Bedauern feststellen, dass an diesem Wochenende auf dem freien Markt nur zwei Kandidaten in Betracht kamen, die ihren Vorstellungen entsprachen. Was sie erwartete, ließ sich schlecht in Worte fassen. Aber sie würde sofort wissen, wer zu ihr passte und wer nicht.
Sie setzte sich an den Sekretär und antwortete auf Büttenpapier mit kleiner, eleganter Schrift. Sie verfasste ein paar nichts sagende Sätze und unterschrieb mit Sybille P. Dann legte sie noch ein Foto bei, das sie an einer unbestimmten Uferpromenade zeigte. Sie trug darauf ein hellgraues Seidenkostüm und trotz schäumender Gischt auf den Wellen, krümmte sich keines ihrer dunkelblonden, langen Haare. Die Kostümjacke stand offen, darunter konnte man ein weißes Top erkennen und die Spur eines Busens. Um den sonnengebräunten Hals trug sie eine Perlenkette, am Ohr den passenden Ring. Eine Hand lag auf der Reling, sodass der rote Nagellack in der Sonne blitzte, ein Bein war etwas vorgestellt. Sie trug hohe Schuhe ohne Strümpfe, ihre Beine waren tadellos … und nackt.
Sie hatte an jedes Detail gedacht, besonders den richtigen Lichteinfall, der ihre Haut glatt und zart aussehen ließ und um Jahre jünger, als sie wirklich war. Man sah ihr nicht an, was sie hinter sich hatte. Auch nicht in Realität.
Sie adressierte den Brief an die ZEIT und eine fünfstellige Chiffre-Nummer. Als Absender gab sie das Postfach 2145 in Köln an und klebte die Umschläge zu. Bei einem Spaziergang warf sie die beiden Briefe noch am gleichen Abend ein.
Am folgenden Donnerstag kamen vier weitere Kandidaten hinzu, eine große Ausbeute.
Am 22. April stieg sie in Köln im Hotel Goldener Hof am Sudermannplatz ab. Dort bewohnte sie seit einigen Jahren die Nummer 42.
Nachdem ihr Elternhaus unter den Hammer gekommen war, war sie mit ihrer Mutter zunächst in ein kleines, billiges Hotel am nördlichen Stadtrand gezogen. Damals hatte sie sie noch ohne Bedenken über längere Zeiträume allein lassen können. Aber ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich und sie musste sie bald in einem Altenheim unterbringen, den städtischen Riehler Heimstätten im Norden Kölns, denn ein privates Altenheim konnten sie sich damals noch nicht leisten.
Als das Geld zu fließen begann, wollte Mutter dort nicht mehr weg. Sie hatte sich inzwischen eingewöhnt und scheute jede Veränderung.
Sie besuchte ihre Mutter nur ungern. Die Atmosphäre eines Altenheims bedrückte sie. Und das Verhältnis war nicht das innigste. Im Gegensatz zu ihrer Mutter gönnte sie sich jedoch eine bessere Unterkunft. Der Goldene Hof war nun ihre Anlaufstelle, wenn sie in Köln war, und die Nummer 42 eine elegante Suite. Hier deponierte sie das Wenige, das sie besaß, und die beiden Lederkoffer, die sie auf allen Reisen begleiteten. Es lag günstig, nicht weit vom Bahnhof und der Postfiliale, wo sie ihr Postfach unterhielt, und nicht weit von den Riehler Heimstätten.
Und es war gut gesichert. Die Fenster hatten abschließbare Griffe, die Tür konnte mehrfach verriegelt werden, und es gab einen Notrufknopf im Bad und neben dem Bett, der mit der Rezeption verbunden war.
Nachts saß Charly dort. Ein Mann, der Sicherheit versprach. Ein Muskelpaket. Einmal hatte sie den Notrufknopf geprüft, ohne sich in einem Notfall befunden zu haben. Es hatte keine fünf Sekunden gedauert, ehe er ihre Türe mit einem Nachschlüssel öffnete. Er hatte ihr verziehen und war geblieben. Er bewachte den Haupteingang, wenn er nicht bei ihr lag.
Das gute Gefühl, wirklich sicher zu sein.
Sie ließ ihre Koffer im Hotel zurück und sah nach ihrem Postfach. Der erste Brief war eingetroffen. Sie steckte ihn ungeöffnet in ihre Handtasche und ging über den Ebertplatz in den länglichen Park am Theodor-Heuss-Ring, der bis zum Rhein hinunterführte.
Als das Mädchen direkt vor ihr mit seinen Skates stürzte, war sie sofort zur Stelle. Die Haut über seinem knochigen Knie war aufgeschürft, Blut lief am Schienbein entlang auf die hohen Sportschuhe. Erst als die Kleine das Blut sah, begann sie zu weinen.
»Wie heißt du?«
»Sarah.« Sie mochte sechs Jahre alt sein.
»Wo wohnst du?«
»Da drüben. Und du?«
Sie zog eine Bonbontüte aus ihrer Handtasche. »Magst du eins? Ich wohne ganz in der Nähe. In einem Hotel. Dort kann ich dir den Dreck auswaschen und ein Pflaster auf die Wunde kleben.«
Sarah wickelte ein Bonbon aus und steckte es in den Mund. Ihre Hände waren ganz schwarz vor Dreck und auf einer Innenfläche blutete sie.
»Nein. Ich muss nach Hause«, sagte sie, stellte sich wieder auf ihre Skates und rollte davon. Enttäuscht sah sie dem Mädchen nach.
Den anschließenden Besuch bei ihrer Mutter hielt sie so kurz wie möglich. Nicht zum ersten Mal kam ihr der Gedanke, dass sie erzählen konnte, was sie wollte, dass ihre Mutter es nicht einmal bemerken würde, wenn sie alles nur erfinden würde. Aber dazu gehörte mehr.
Aus dem kleinen Vorrat an Spielsachen, der sich in einem ihrer Lederkoffer befand, zog sie am Abend ein Kartenspiel hervor und legte eine erste Patience. Und wie immer konnte sie nicht aufhören.
Neues Spiel, neues Glück.
In der Nacht klopfte es leise an ihre Türe, im verabredeten Rhythmus. Charly schob die Tür auf und schlich zu ihr. Sie hatten sich lange nicht gesehen. Er wusste, dass er keine Fragen stellen durfte, und er hielt sich daran. Sie liebten sich schweigend und er ging, wie er gekommen war.
Die sechs restlichen Antworten trudelten nach und nach ein. Am 29. April öffnete sie die Briefe. Die beigelegten Fotos heftete sie an den linken Papierrand, damit keine Verwechslungen eintreten konnten, wobei ihr auffiel, dass es ein Kandidat vorgezogen hatte, sein Äußeres geheim zuhalten. Das war nicht weiter schlimm, denn auf das Äußere kam es nicht an, aber sie fühlte sofort, um welche Art Papier es sich handelte. Es war dünn und billig, was er ihr auch erzählen würde, reich war er nicht.
Ein weiterer Bewerber fiel durch das Raster, da er sich leichtsinnigerweise statt eines Füllfederhaltes eines Kugelschreibers bedient hatte, der im Laufe des Briefes seinen Geist aufgab und mit Gewalt gezwungen wurde, die letzten Worte ins Papier zu drücken. Er entsprach nicht den minimalsten Anforderungen.
Die verbliebenen vier Briefe legte sie nebeneinander und wählte nach einem undefinierbaren Prinzip den Ersten.