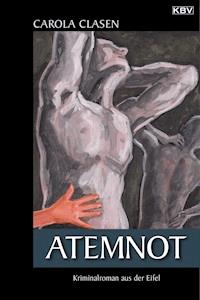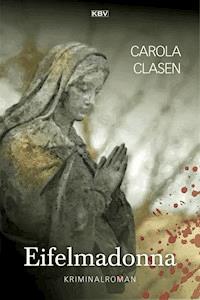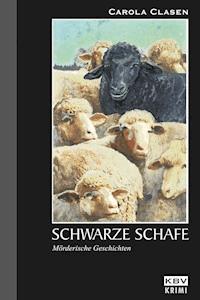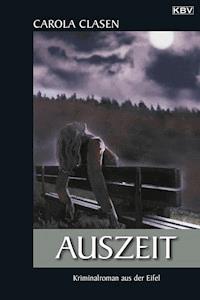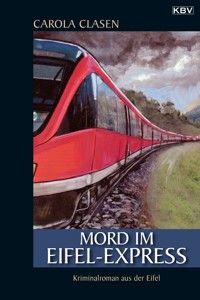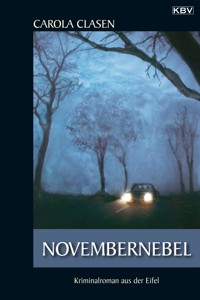
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: KBV
- Kategorie: Krimi
- Serie: Sonja Senger
- Sprache: Deutsch
Die Krimiautorin Julia Kirschbauer befindet sich nach einer Lesung in Trier auf einer einsamen nächtlichen Autofahrt nordwärts durch die Eifel. Zuerst kommt der Nebel... Dann kommt die Angst... Sie sieht nicht einmal mehr fünf Meter weit. Und dann sind da plötzlich diese grellen Scheinwerfer... Wenige Augenblicke später ist Julia Kirschbauer spurlos verschwunden. Die Trierer Kommissarin Sonja Senger wird mit dem Fall betraut. Gemeinsam mit ihrem undurchsichtigen Kölner Kollegen Roman Zorn begibt sie sich auf die Suche nach der vermissten Autorin und entdeckt dabei verborgene Eifler Eigenarten, die selbst der dichte Novembernebel nicht für immer verhüllen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carola ClasenNovembernebel
Bisher von der Autorin bei KBV erschienen:
»Novembernebel«»Das Fenster zum Zoo«»Tot und begraben«»Auszeit«»Schwarze Schafe«»Wildflug«»Mord im Eifel-Express«»Spiel mir das Lied vom Wind«»Tote gehen nicht den Eifelsteig«
Carola Clasen schreibt seit 1998 Kriminalromane, die in der Eifel spielen. Darunter ist auch die Reihe um ihre eigenwillige Kriminalkommissarin Sonja Senger. Auch mit ihren Kurzgeschichten und Lesungen hat Carola Clasen sich einen Namen unter den deutschen Krimiautorinnen gemacht. Sie ist Mitglied im »Syndikat« und lebt und arbeitet in Hürth.
Carola Clasen
Novembernebel
1. Auflage November 2001
2. Auflage November 2005
3. Auflage Dezember 2010
4. Auflage April 2012
© KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheim
www.kbv-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0 65 93 - 998 96-0
Fax: 0 65 93 - 998 96-20
Umschlagillustration: Ralf Kramp
Print-ISBN 978-3-934638-93-8
E-Book-ISBN 978-3-95441-018-7
Mein besonderer Dank gilt Ralf Kramp,der dieses Buch aus dem Feuer holte.
1. Kapitel
Norbert Zehren tötete für Geld. Einer musste es tun, wenn nicht er, dann ein anderer. Im Grunde war es ein Beruf wie jeder andere, wenn man kein sentimentaler Typ war, und das war er nicht. Schließlich waren die, die ihm ins Messer liefen, auch selbst schuld. Sie hatten jemanden provoziert, das hätten sie nicht tun sollen. Er reagierte nur darauf.
Er hatte rechtsrheinisch in der Kanzlei eines Anwaltes als Referendar angefangen. Viele verzweifelte Fälle wurden dort angeschwemmt, die aufgrund der komplizierten deutschen Rechtsprechung meist genau so verzweifelt die Kanzlei wieder verließen. Die Liste war lang und wurde täglich länger. Svenja Winter, die Sekretärin, konnte ein Lied davon singen. Sie telefonierten oft miteinander. Sie verwahrte seine Visitenkarten in einer Schublade und steckte sie denjenigen zu, die offensichtlich dringend Hilfe benötigten.
Norbert Zehren hatte nicht die Seiten gewechselt. Seine Arbeit begann jetzt da, wo die des Anwaltes aufhörte. Er gab diesen aussichtslosen Fällen die Freude am Leben zurück. Das plötzliche »Fehlen« einer Person löste eine Menge Probleme.
Der Name Norbert Zehren wurde mit der Zeit ein Geheimtipp und stand für gute Arbeit. Er war ein Dienstleister, Mord war sein Service. Aufträge, die darauf hinausliefen, der Zielperson einen Denkzettel zu verpassen und nur Angst und Schrecken einzujagen, lehnte er grundsätzlich ab. Er machte keine halben Sachen. Die Gefahr der Wiedererkennung war viel zu groß. Er war nicht umsonst kein einziges Mal während seiner zweiten Laufbahn aufgefallen, er stand in keiner Datei und hinterließ nie Spuren. Er war ein Ass. Seine Markenzeichen waren ein kleiner, roter Schnäuzer – trotz braunem Haupthaar – und ein schwarzer Jeep. In einer Großstadt wie Köln gibt es viele mit roten Schnäuzern und schwarzen Jeeps. Auffälligkeit am richtigen Platz; für ihn nur eine Frage des richtigen Moments. Die, die ihn sahen, bewusst sahen, konnten hinterher nicht mehr darüber reden. Ansonsten war er ein eher unscheinbarer Mann und selbstverständlich alleinstehend, was nicht heißen soll, dass er nicht manchmal die Dienstleistung einer Dame in Anspruch nahm. Jeder braucht von Zeit zu Zeit eine streichelnde Hand, auch ein harter Kerl wie Norbert Zehren.
Er arbeitete mit dem alten Jagdmesser seines Vaters, der eines Morgens bei Sonnenaufgang im volltrunkenen Zustand vom Hochsitz gefallen und nicht mehr aufgestanden war. Er war ein leidenschaftlicher Jäger gewesen und im Besitz einer Jagd im Bergischen Land. Er jagte Wildschweine, denen er nach dem Anschuss mit dem Jagdmesser den Gnadenstoß gewährte. Das Jagdmesser hatte einen Griff aus Elfenbein und steckte gewöhnlich in einem Schaft aus dunkelbraunem, glänzendem Sattelleder. Norbert Zehren trug es in die Unterseite seines linken Ärmels im Jackenfutter eingenäht. Die Klinge war blank, schmal und natürlich ungeheuer scharf und hinterließ einen sauberen Schnitt.
Norbert Zehren hatte die Jagd, das Haus und das Auto seines Vaters verkauft, behielt als einzige Erinnerung an ihn das Jagdmesser und wechselte den Beruf.
Sein Terrain war Köln.
Ein neuer Auftrag jedoch sollte ihn in die Eifel führen, in die Südeifel, nach Trier. Dort war er noch nie gewesen. Es war gefährlich, in einer Gegend zu arbeiten, in der man sich nicht auskannte. Er hatte mit dem Gedanken gespielt, abzulehnen, aber er brauchte dringend Geld, und das Angebot der vornehm klingenden Dame aus Marienburg war großzügig.
Ihr Anruf war gestern Vormittag gekommen und hatte ihn aus dem Bett einer schwarzhaarigen Schönheit geholt. Für eine Dusche blieb keine Zeit, also verteilte er reichlich After Shave auf seinem Oberkörper und zog sich an. Er sah ihr sofort an, dass sie eine besondere Kundin war. Sie schien allein in der großen Villa zu wohnen, allein mit ihrer Schwägerin, der sie aus irgendeinem Grund den Tod wünschte. Er fragte nicht, warum. Das war nicht seine Aufgabe.
Er brauchte nur Informationen zur Zielperson.
Frau Kirschbauer war zierlich, aber resolut, und wusste, was sie wollte. Sie wollte den Tod ihrer Schwägerin, Julia Kirschbauer, am 6. November für dreißigtausend Mark. Und sie wusste auch, wie es geschehen sollte. Er brauchte nicht sein Jagdmesser dazu. Julia Kirschbauer litt an einer schweren Angina Pectoris. Sie würde keine drei Tage ohne ihre Medikamente überleben.
»Meine Dame«, hatte er zu Bedenken gegeben, »den Tod abzuwarten ist viel gefährlicher als ...«
»Ich will es so«, hatte sie befohlen, mit einer harten Stimme, als schlüge sie zu.
»Es ist Ihre Tote.«
»So ist es.«
Ein glatter Stich wäre ihm lieber gewesen, aber bei dreißigtausend Mark konnte er nicht wählerisch sein.
Nach einer Pause fügte Frau Kirschbauer hinzu: »Sie hat einen Hund dabei. Den Hund will ich ebenfalls nicht wiedersehen.«
Norbert Zehren nickte.
Dann übergab sie ihm ein Foto und nannte ihm Uhrzeit und Aufenthaltsort am besagten Tag, nämlich um halb acht in der Akademischen Buchhandlung in Trier.
»Wieso ist die Buchhandlung um diese Uhrzeit nicht geschlossen?«, fragte Norbert Zehren.
»Sie ist ... Schriftstellerin, jedenfalls gibt sie sich dafür aus. Sie wird dort eine Lesung machen. Und danach nach Köln zurückfahren. Das ist der Moment, wo Sie zupacken sollten.«
Normalerweise ließ er sich nicht vorschreiben, wann er seine Arbeit auszuführen hatte, aber diese kleine entschlossene Frau war eine besondere Kundin.
Natürlich würde er den langsamen Tod der Julia Kirschbauer überwachen müssen. Keinesfalls konnte er auf die Schwägerin und ihre Annahme vertrauen, dass in drei Tagen alles gelaufen wäre. Er musste also eine gewisse Zeit in der Eifel verbringen. Vielleicht würden es mehr als drei Tage werden.
Er hasste die Eifel, bevor er sie gesehen hatte. Er stellte sie sich als eine baumlose Ebene vor, in der er vogelfrei und ohne Deckung arbeiten musste. Es war dort immer ein paar Grad kälter als in der Kölner Bucht. Der Schnee kam früher, von Stürmen und Regengüssen ganz zu schweigen. Es war November.
Und es würde dort vermutlich kein Kölsch geben.
Was für ein Job.
2. Kapitel
Außergewöhnliche psychische Belastungen führen oft zu schweren körperlichen Beschwerden«, hatte der Weißkittel mit wichtigem Blick erklärt.
»Schwachkopf«, fluchte Sonja Senger, als die Praxistür hinter ihr zuschlug, »ich habe nur Halsschmerzen.«
Später lag sie mit hochrotem Kopf und dickem Halswickel im abgedunkelten Schlafzimmer, eine rundliche Erhebung unter dem Laken, weiß wie eine Schneewehe.
Jerome redete am Telefon mit Bartmann, seine Stimme war dumpf und leise und schien weit weg. »Jerome Monteux. Ich bin ihr Lebens...abschnitts...gefährte.«
Sonja musste lachen, als sie hörte, wie er mit diesem Wort kämpfte, das er nicht mochte. Und das Lachen tat weh.
»Frau Senger hütet das Bett ... ja ... nein ... ja, Herr Polizeirat, Angina.«
»Polizeirat«, murmelte sie verächtlich und rief laut »Bakterielle« hinüber, weil er sonst wieder alles verharmlosen würde.
»Bakterielle«, echote er.
»Virulente.«
»Oder eher virulente ... auf jeden Fall ... wenn nicht ... ja ... nein. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Danke auch. Schöne Grüße, auch von Frau Senger selbst.«
»Wie kannst du ihn von mir grüßen? Und warum schlägst du dir die Hacken blutig, wenn du mit ihm sprichst?«
Aber ein Blick auf seine dicken Norwegersocken machte die Antwort überflüssig.
Er bediente sie, erfüllte all ihre Wünsche, saß an ihrem Bett und las flüsternd Krimis vor. Sie verschlief die Morde und Verhaftungen und beklagte sich bitterlich, dass er die Pointen vermasselte. Dann summte er leise Lieder von Patricia Kaas, die sie wieder friedlich machten. Als er nur noch ein Schatten seiner selbst war – schlaflose Nächte und endlose Vorwürfe zehrten an seinem mageren Körper –, legte er sich immer öfter neben sie, und sie dämmerten zusammen dahin, dem nächsten Morgen oder Abend entgegen.
Balzac, der dunkelgraue Kater, turnte lautlos zwischen ihnen herum, genoss die unverhoffte Ruhe, baute Kuhlen auf Bäuchen und in Kniekehlen und hüllte sie mit seinem Schnurren ein.
An irgendeinem Morgen wachte sie auf und schlich ins Badezimmer. Ihr Atem beschlug den Spiegel im Bad, sie malte ein großes V hinein, aber als sie sah, dass alles noch da war, die Falten, die grauen Haare und der Wunsch, dass es noch nicht so weit wäre, wischte sie es mit den Fingern wieder aus. Auf nackten Füßen lief sie die kalten Steintreppen hinunter zum Briefkasten. Es war nicht ein einziger Brief in der Zwischenzeit gekommen, nicht einmal eine Rechnung. Als hätte man sie da draußen schon abgeschrieben. Nur der Trierische Volksfreund hatte sie nicht vergessen, die Freitagsausgabe steckte sorgfältig gefaltet im Kasten. Der Nachbar vom ersten Stock links, der nicht so aussah, als hätte er es nötig, hatte sich in der Zwischenzeit bedient. Sie schlug gegen seine Haustür, als sie hinauflief und rief: »Das ist jetzt vorbei«.
Oben breitete sie den Trierischen Volksfreund auf dem Bettende aus und überflog die Neuigkeiten. Nach einer Weile stieß sie auf eine kleine Anzeige in der Rubrik »Veranstaltungen«.
»Jerome, hör zu, eine Lesung, hier in Trier, in der Akademischen Buchhandlung Interbook. Ein Krimi. Heute, am 6. November, um halb acht.«
»Hm.«
»Mord und Totschlag hier vor unserer Haustür. Wenn ich keine wirklichen Fälle mehr lösen kann, dann wenigstens die fiktiven. Er heißt übrigens Tod im Schnee.«
»Von wem?«, murmelte er verschlafen und zog die Stirn in Falten.
»Julia Kirschbauer.«
»Kenn ich nicht.«
»Ich auch nicht, aber du gehst für mich hin, ja?«, bettelte sie.
»Ich?«
»Bitte, das wäre wunderbar, du lässt dir ein Buch signieren und liest es mir vor«, schwärmte sie und sank seufzend neben ihn in die Kissen.
Am Abend ließ Jerome sie zurück – »unfreiwillig« wie er sagte, strich ihr sorgenvoll über die heiße Stirn und versprach ihr, alles, aber auch alles zu erzählen. Er lieh sich ihren Polo – es war zu spät und er zu träge für einen Abendspaziergang –, fuhr bis ins Parkhaus Treviris Passage am Rautenstrauchpark und stellte das Auto auf dem Frauenparkplatz nahe dem Ausgang im grellen Neonlicht ab. Nach ein paar Metern gelangte er durch die Fußgängerzone zum Frankenturm, einem Wohnturm aus dem 14. Jahrhundert, nach Franco von Senheim benannt. Ein wehrhaftes, rechteckiges Steinhaus mit hoch gelegenem Eingang, mit winzigen Fenstern und hohen Zinnen. Auf ihn folgte das Rote Haus mit dem stolzen Spruch:
Ante Romam Treveris stetit annis mille trecentis, perstet et aeterna pace fruatur. Amen (Vor Rom stand Trier tausenddreihundert Jahre, möge es ferner besteh’n, ewigen Friedens sich freu’n. Amen.)
Jerome murmelte ihn vor sich hin wie einen Rosenkranz und ignorierte die verwunderten Blicke der wenigen Passanten. Er kam zur Steipe, was nichts anderes als »Stütze« hieß; die Stützen, die die ehemals offene, laubenartige Halle des Erdgeschosses trugen. Hier tagte nach alter deutscher Sitte das Marktgericht. Die Steipe war höher als alle anderen Bauten hier am Hauptmarkt und zeigte die vier Stadtheiligen Petrus, Helena, Jakobus und Paulus. Jetzt tagte hier das Café Bley in schnöder Gegenwart, servierte den Damen mit Hut Obstkuchen mit Schlagsahne und ein Likörchen zum Hinunterspülen. Kleinstadt-Tratsch gab’s gratis dazu. Hätte Sonja ihn in ein Museum oder in eine der wundervollen Ruinen entsandt, vielleicht ins Amphitheater draußen vor den Toren der Stadt oder drüben in die Barbarathermen nahe dem Ufer der Mosel, ihn, den Archäologen aus Leidenschaft, dann wäre das sein Abend geworden. Aber eine Lesung sollte es sein. Jerome hatte ein unbestimmtes Vorurteil gegenüber Kriminalromanen, besonders wenn sie von Frauen geschrieben wurden. Doch er verzieh Sonja die berufliche Neugier, wie er ihr fast alles verzieh, auch den Umzug von Köln nach Trier vor einem Jahr, der ihn zum Pendler gemacht hatte. Kostbare Zeit verschwendete er in Zugabteilen oder auf der Autobahn. Aber ihr nicht zu folgen, wäre die schlechtere Lösung gewesen. Eines Tages würde sich vielleicht die Gelegenheit ergeben, hier in Trier zu arbeiten. Er wusste, dass Sonja darauf wartete, aber er war nicht der Typ, der solche Dinge vorantrieb. Sie mussten sich ihm schon in den Weg stellen, und wenn alles passte, dann würde er zugreifen, vielleicht. Er würde zumindest darüber nachdenken.
Die Veranstaltung hatte schon begonnen, als er die Akademische Buchhandlung in der Fleischstraße betrat. Hinter der historischen Fassade der Brasserie schräg gegenüber lockte gemütliches Licht, und er fuhr sich über die Lippen und dachte an den guten Bordeaux, den sie dort servierten. Viele Reihen grauer Plastikstühle standen in einem halben Rund, in der Mitte ein Gang, der direkt zu einem kleinen Tisch am oberen Ende führte, an dem die Autorin saß und innehielt, als die Glastür hinter ihm zuschlug und sie seine Schritte hörte. Der Buchhändler zeigte wortlos auf die unbesetzten Stühle in der letzten Reihe, aber Jerome hatte einen freien Platz ganz vorne direkt am Gang entdeckt. Er sah sich um, und seine Befürchtungen wurden Gewissheit: Er war in eine reine Frauenveranstaltung geraten. Das würde Sonja nur schwer wieder gutmachen können.
Jerome ließ sich auf den freien Stuhl fallen; die Beine lang ausgestreckt, lag er mehr als er saß und stellte fest, dass er doch neben einen Mann geraten war, auf dessen Schoß ein Buch lag: Tod im Schnee. Es sah gründlich gelesen aus, mit Eselsohren und Zetteln zwischen den Seiten und einem glänzenden Fettfleck auf dem Umschlag. Der Mann lächelte ihm freundlich zu.
»Sie kennen Julia Kirschbauer?«, versuchte Jerome flüsternd ein Gespräch.
Der Mann schüttelte den Kopf und ließ den Blick nicht von der Autorin, die einen Moment wartete, bis wieder Ruhe eingetreten war, und dann erneut begann. Ihre Stimme war dünn, und das Sprechen schien ihr Mühe zu bereiten. Sie stieß die Worte gepresst hervor und kämpfte sich durch ihre Geschichte, Satz für Satz. Sie trug eine blonde Pagenfrisur, eine Brille auf der kleinen Nase, hinter der ihre Augen winzig und weit weg schienen, und ein dunkelgraues Wollkostüm. Ihre Finger zupften ständig nervös an den Seiten, auch wenn es nichts umzublättern gab. Unter dem Tisch steckten ihre Beine in schwarzen Strümpfen den ganzen Abend über unbeweglich und leicht schräg in schwarzen Lackschuhen.
Nach einem Abschnitt sah sie hoch, mit einem schüchternen Blick, nippte kurz am Wasserglas, schob die Brille hoch, räusperte sich und fuhr fort. Ganz allmählich erst schien sie sich sicherer zu fühlen, und ihre Stimme wurde fester. Jerome prägte sich den Anblick ein, bemüht, keine Einzelheit zu vergessen, als sein Blick auf ein weiß-schwarzes Bündel neben ihr fiel. Es sah zuerst wie eine pelzige Handtasche aus, bevor es sich bewegte – und es bewegte sich lange nicht. Auf kurzen, dünnen Beinen saß er da, mit spitzen Ohren und dunklen, vorstehenden Käferaugen. Ein Hund. Er war keine Schönheit, hockte dort still und geduldig die ganze Zeit über, beobachtete die Leute und wartete auf das Zeichen zum Aufbruch, das kam, als die Autorin ihr Buch zuschlug und sagte: »Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.«
Und sie schien erleichtert, diesen Teil des Abends hinter sich gebracht zu haben, atmete tief ein und aus und faltete die Hände. Da erhob der Hund sich, legte die Vorderbeine auf ihren Schoß und wedelte mit dünnem, spitz zulaufendem Schwanz, hechelte mit herausbaumelnder Zunge, und sie strich über seinen Kopf.
Aus den Ausschnitten, die sie gelesen hatte, war Jerome nicht schlau geworden. Als Kostprobe gedacht, waren sie weder geeignet, ihren Stil zu erkennen noch die Story zu begreifen. Sie sollten Neugier wecken, verwirrten aber letzten Endes nur. Dagegen konnten seine wissenschaftlichen Referate über archäologische Entdeckungen, die er in Museen und Universitäten hielt, seine Zuhörer geradezu in Aufruhr versetzen. Die Vergangenheit war spannend wie ein Krimi, wenn man sich in jene Zeit versetzte, in der Verbrechen ebenso an der Tagesordnung waren wie sie es heute sind. Vielfach schlugen die Täter damals noch grausamer zu. Da wurde gnadenlos geköpft, gevierteilt, geteert und gefedert. Die Motive waren dieselben wie heute: Neid, Rache und Gier. Die ewigen menschlichen Schwächen. Jeromes Gedanken schweiften ab.
Nach einer Weile sah er den Buchhändler aus dem Nebenzimmer mit einem umfangreichen Blumenstrauß auftauchen, der in hellblaues Seidenpapier gewickelt war. Er überreichte ihn Julia Kirschbauer, sie steckte kurz die Nase in die Blumen und bedankte sich artig. Da er keine Anstalten machte, eine Vase herbeizuschaffen, legte sie den Blumenstrauß neben sich. Der Buchhändler schlug nun eine kleine Diskussionsrunde vor, sah ins Publikum, Reihe für Reihe, und hoffte auf eine rege Teilnahme. Und tatsächlich stellten die Damen der Autorin Fragen.
Sie habe immer schon ein ausgeprägtes Mitteilungsbedürfnis gehabt, erzählte sie mit einem zaghaften Lächeln, man habe ihr ein Talent zum Erzählen bescheinigt, schon in der Schule. Sie schreibe aber erst seit vier Jahren. Ihr nächstes Buch werde im Frühjahr erscheinen, der Titel sei schon festgelegt, aber sie könne und werde nichts darüber verraten.
»Natürlich nicht, das bringt Unglück«, sagte sie und machte ein geheimnisvolles Gesicht, »Ihnen und mir.«
»Und warum schreiben Sie gerade Kriminalromane?«, fragte eine kleine, grauhaarige Dame aus der letzten Reihe, hob den Zeigefinger und reckte sich.
»In meinen Kriminalromanen gibt es immer die Gerechtigkeit, die es im wirklichen Leben nicht gibt oder nur sehr selten. Das ist mir sehr wichtig. Ich möchte, dass meine Leser am Ende aufatmen.«
Die kleine, grauhaarige Dame nickte glücklich und lehnte sich entspannt zurück.
»Woher nehmen Sie Ihre Ideen?«, fragte eine andere.
»Sie liegen auf der Straße. Ich meine, lesen Sie aufmerksam die Zeitungen, die kleinen, unauffälligen Artikel auf den letzten Seiten. Es passiert so viel Furchtbares jeden Tag und überall. Familientragödien, Unfälle, Gewalt ...«
Nachdenklich wanderte ihr Blick zu den Fenstern.
»Und welches der drei Bücher, die Sie geschrieben haben, ist Ihr liebstes und bestes?«
Sie reagierte nicht sofort, als hätte sie die Frage nicht gehört. »Mein bestes?«, fragte sie endlich und wandte sich wieder ihrem Publikum zu, »das habe ich noch nicht geschrieben, hoffe ich wenigstens.«
Immer mehr Damen fühlten sich ermutigt, Fragen zu stellen. Auch nach ihrem Hund, und alle fanden ihn ganz »süß« und vor allem die Tatsache, dass er sie zu allen Veranstaltungen begleitete und brav wäre wie ein Engel und nicht ein einziges Mal gebellt hätte.
»Er ist stumm«, sagte Julia Kirschbauer.
»Oh!« Und Mitleid breitete sich aus im Foyer der Akademischen Buchhandlung wie eine Flutwelle.
Es artet in ein Kaffeekränzchen aus, dachte Jerome und sah zu seinem Nachbarn, der geduldig die Zeit abwartete, ohne die Absicht, die Veranstaltung vorzeitig zu verlassen oder eine Frage zu stellen. Der Buchhändler trieb die Veranstaltung voran und schlug nun eine Signiermöglichkeit vor, und das Interesse war groß. Er kredenzte den Damen dazu einen perlenden Wein, und alle griffen zu. Sie tranken sich ein bisschen Mut an und machten sich dann auf den Heimweg, denn es war schon spät für sie. Sie machten Andeutungen und ängstliche Gesichter, als könnte ihnen sonst was passieren, wenn sie noch länger blieben, da draußen in der finsteren Nacht. Hastig flatterten sie davon, auf der Flucht vor dem Bösen, das in Hauseingängen lauerte. Sie liebten wohl Verbrechen, aber nur auf dem Papier.
Auch der Mann neben Jerome erhob sich schließlich, ging die wenigen Schritte hinüber zum Tisch der Autorin und legte ihr wortlos sein zerlesenes Buch vor, und als sie fragte, ob er vielleicht seinen eigenen Namen oder eine Widmung wünschte, schüttelte er den Kopf. »Nur Ihr Name, das wäre sehr freundlich.«
»Würden Sie ›Für Sonja‹ hineinschreiben?«, fragte Jerome als Letzter, als die Damen schon alle die Buchhandlung verlassen hatten.
»Aber sicher. Für Sonja. Ihre Frau?«
»Sozusagen. Sie liebt Krimis.«
»Dann werden ihr sicher auch meine beiden anderen Bücher gefallen. Sie liegen dort drüben direkt neben dem Eingang, nicht zu verfehlen, die Cover ähneln sich, alle rot, also, wenn Sie möchten; Maar der Toten und Im Schatten der Burg.«
»Sicher kennt sie sie längst«, sagte Jerome, und sie lächelte dankbar für das Kompliment, das leicht von seinen Lippen kam.
Und dann beugte er sich zu ihr und sagte leise: »Ich bin überzeugt, dass sie ihr gefallen und dass sie wirklich gut sind, daran zweifle ich keinen Augenblick.«
»Danke.«
»Aber warum zerfleddern Sie sie?«
Irritiert sah sie ihn an. »Wie meinen Sie das?«
»Nun, Sie lesen hier ein Stück und dort ein Stück. Niemand begreift den Zusammenhang. Warum lesen Sie nicht einfach das erste Kapitel und klappen den Buchdeckel zu? Bieten Sie Ihren Zuhörern einen Einstieg. Wenn sie ihn nicht finden, werden sie sowieso nicht weiterlesen. Wissen Sie, was ich meine?«
»Ich ...«
»Sie werden sich besser dabei fühlen.«
Der Buchhändler unterbrach das Gespräch und stand mit einem pelzgefütterten Ledermantel in den Händen ungeduldig da. Julia Kirschbauer entschuldigte sich, nahm den Blumenstrauß auf und ging Richtung Ausgang. Der Hund wieselte mit tausend kleinen Hundeschritten hinter ihr her, ohne Halsband und Leine. Und da verließ auch der Mann, der am Eingang gestanden und in Julia Kirschbauers roten Büchern geblättert hatte, die Buchhandlung und folgte ihr, dicht und zügig, links über die Fleischstraße hinunter in Richtung Porta Nigra, sodass Jerome der Gedanke kam, dass er ihr folgte und vielleicht ein Gespräch suchte, unter vier Augen.
Ihr Wagen, ein dunkler Volvo Kombi mit Kölner Kennzeichen, stand neben dem Polo in der Treviris Passage. Sie verstaute gerade den Blumenstrauß und den Ledermantel sorgsam im Kofferraum, als Jerome das Parkhaus betrat. Der Hund kletterte munter bis zum Beifahrersitz hindurch, wo er seine Vorderpfoten auf dem Armaturenbrett postierte und auf die Abfahrt wartete.
Julia Kirschbauer erkannte Jerome und lächelte ihm noch einmal zu: »Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen«, sagte sie übers Autodach hinweg.
»Und ich Ihnen eine gute Heimfahrt.«
»Ja, danke. Das kann ich gebrauchen. Und ... danke. Sind Sie auch Autor?«
»Nein. Nur Archäologe. Aber es war mir ein Bedürfnis ... und ein Vergnügen.«
»Wissen Sie, ich glaube, Sie haben Recht. Aber mein Verleger ...«
»Ihr Verleger hat keine Ahnung.«
Sie lachte erleichtert auf.
»Sie sind die Schriftstellerin.«
»Ja«, sagte sie, »manchmal vergesse ich das fast. Ich habe Angst, er könnte meine Bücher nicht mehr drucken wollen.«
»Dann wäre er auch noch dumm. Fahren Sie vorsichtig.«
»Ja. Vielleicht sieht man sich einmal wieder.«
»Alles ist möglich.«
Als Jerome in der Lindenstraße hielt, vor seiner Haustür, sah er den Volvo über die Kaiser-Wilhelm-Brücke in dichten Nebel eintauchen. Ungewöhnlich tief hing er über der Mosel und dem Markusberg in dieser Nacht, eine Schicht nur, und der Himmel darüber war seltsam klar und sternenübersät. Dazu ein Mond, der fast voll war. Eine andere Welt da oben. Die Rücklichter verschwanden, als verlöschten sie, und er beneidete Julia Kirschbauer nicht um die weite Fahrt nach Köln.
Sonja thronte aufrecht in den Kissen, als sich der Schlüssel im Schloss drehte.
»Ich will einen vollständigen Bericht.«
Und da kam auch schon das Buch in hohem Bogen aufs Bett geflogen. »Das war das erste und letzte Mal.« Aber seine Stimme klang nicht drohend.
»Erzähl.«
Jerome kochte Kaffee für eine lange Nacht und beschwerte sich, in welche situation désastreuse Sonja ihn gebracht hatte, und wenn sie sich nicht in solch schlechter körperlicher Verfassung befunden, er auf jeden Fall die Veranstaltung sofort wieder verlassen hätte.
»Und, wie sah sie aus, was für ein Typ ist sie?«
»Weiß ich nicht, aber ich habe ihr nach der Vorstellung gesagt, was sie falsch gemacht hat.«
»Das darf nicht wahr sein. Die Ärmste!«
»Einer muss es ihr doch sagen.«
»Und ausgerechnet du fühlst dich dazu berufen?« Sonja drehte und wendete das Buch in ihren Händen. Ein blutrotes Taschenbuch. Auf dem Cover eine einsame Scheune in karger Winterlandschaft. Im Vordergrund ein riesiger Baum mit von Schnee tief hängenden Ästen, zwei schwarzen Rabenvögeln geduckt lauernd auf den vereisten Zweigen, Hügeln am Horizont, Feldwege, Spuren im Schnee und dahinter der schwarze Himmel ohne Sterne.
Jerome kam mit großen Kaffeebechern zu ihr, kroch unter ihre Decke. Und sie begann:
»Die Winter in der Eifel sind länger und härter als anderswo in Deutschland. Die großen Städte bieten Abwechslung, Licht und Wärme, täuschen über die Trostlosigkeit hinweg. Aber die großen Städte sind weit weg. Und hier ist nur verlassene Landschaft, dem Wind ausgesetzt, der gnadenlos Tag und Nacht über die Hügel peitscht. Die Dörfer und Straßen sind menschenleer, und die Einsamkeit wird größer mit jedem Tag, an dem die Sonne nicht durch die Wolken bricht ...«
Da verließ sie die Stimme, nur ein Krächzen blieb, und sie reichte Jerome das Buch hinüber mit halb geschlossenen Augen.
»Du«, war alles, was sie herausbrachte.
»... und die Tage im Dämmerlicht endlos werden. Und der Winter in dem Jahr, von dem ich berichten möchte, war eisiger und länger als die anderen zuvor. Er hatte seltsam früh angefangen, schon Anfang November hatte es die ersten Bodenfröste gegeben, und nun lag seit über einem Monat Schnee, der schmutzig gelb, voller Fuß- und Reifenspuren war und von den Spuren des heimgetriebenen Viehs, das jetzt in den schützenden Ställen stand. Das Futter würde knapp werden, die Ernte war miserabel gewesen, kaum Sonne und viel zu viel Regen, man würde Futter dazukaufen müssen ...«
Er wurde leiser, schloss die Augen über den Buchstaben, ließ die Worte ausklingen und schlief. Sonja neben ihm schnarchte gleichmäßig mit offenem Mund und merkte erst nach einigen Minuten, dass seine Stimme fehlte. Sie schubste ihn ungnädig an, bedeutete ihm weiterzulesen, nur mit einem drohenden Blick.
»... der einzige Treffpunkt, an dem sie zusammenkamen, wenn sie ihre Häuser verließen, war sonntagmorgens die Kirche und danach der Gasthof, wo die Männer an der Theke einen über den Durst trinken konnten, und die Frauen an den Tischen einen Kaffee tranken und schwatzten. Und dann zur Mittagszeit brachen die Frauen auf, um das Essen zuzubereiten, und die Männer folgten mit unsicherem Gang nach einer angemessenen Weile, hinaus in den eisigen Wind in ihre überhitzten Stuben, wo sie den Rest des Tages dahindämmern würden ...«
»Fini«, sagte Jerome und schloss leise das Buch. Und da sie nicht protestierte, konnte er es unbehelligt beiseitelegen. Erst Freitag, dachte er, und sie hatten das ganze Wochenende zur endgültigen Rekonvaleszenz. Balzac kroch unter seine Decke und grunzte zufrieden.
»Welch himmlischer Friede, mon vieux, wenn sie schläft.«
3. Kapitel
Der Nebel stand wie eine weiße Wand direkt vor den Scheinwerfern, ließ kein Durchkommen und kein Durchleuchten, brach das Licht nach wenigen Metern, dass es schwammig wurde und zerlief. Er hing tief bis auf den Boden, kreiste sie ein von allen Seiten, wie ein undurchsichtiges Tuch, das über sie geworfen war. Der Mittelstreifen war die einzige Orientierung, immer nur zwei Teilstücke weit konnte sie sehen, manchmal rechts die Begrenzungslinie und die kleinen Pfähle mit ihren silbernen Katzenaugen, sonst nichts. Keine Häuser, keine Hinweisschilder, keine Autos hinter ihr, keine, die ihr entgegenkamen, und es war kein Fortkommen zu erkennen, als stünde sie auf der Stelle. Die Straße war immer dasselbe Stück Straße.
Der Nebel schluckte alle Geräusche, die es draußen geben mochte, sogar das eigene Motorengeräusch klang dumpf und weit entfernt, wie durch viele Lagen dicker Watte. Die Scheiben waren feucht außen wie innen. Undurchsichtig geworden, zu Milchglas. Sie starrte hinaus, auf die Motorhaube und die weiße Wand davor, als könnte sie sie bezwingen, wenn sie nur wollte, wenn ihr Blick durchdringend genug wäre. Ihre Augen begannen zu brennen von der Anstrengung, tränten vom Windstoß des Gebläses und dem Staub, der tief in den Lüftungsschächten saß und aufgewirbelt wurde. Ihre Hände umklammerten das Lenkrad, packten manchmal fester zu, dass die Fingerknöchel weiß hervortraten im Licht, das die Nebelwand zurückwarf ins Innere des Autos. Blicke in die Seitenspiegel oder den Rückspiegel waren sinnlos.
Sie verringerte das Tempo weiter, der Tacho zeigte nur noch zwanzig Stundenkilometer. Sie musste auf dieser Straße bleiben, redete sie sich zu, musste es irgendwie schaffen, nur geradeaus, nur nicht vom Weg abkommen. Längst hatte sie das Radio abgestellt, das gnadenlose Gequatsche der aufgedrehten Moderatoren und ihre hämmernde, immer gleiche Musik hatten sie nervös gemacht, unruhiger als sie ohnehin schon war.
Es war ein gelungener Abend geworden, dachte sie und versuchte sich zu beruhigen, an Schönes zu denken. Die Angst, die sie vor jeder Lesung quälte, war bald verflogen, und sie hatte nur ganz zu Anfang an die kleine Sprayflasche in ihrer Handtasche denken müssen, ohne die sie nicht mehr leben konnte. Ein interessiertes Publikum in einer angenehmen Atmosphäre, kein Wort der Kritik. Das war nicht immer so. Sie hatte ganz andere Lesungen erlebt. Erste Zuhörer hatten nach wenigen Minuten das Weite gesucht. Niemand hatte auch nur eine einzige Frage gestellt oder das Bedürfnis gehabt, eines ihrer Bücher zu besitzen. Die Vorstellung, dass sie am Ende hochsehen würde, und die Buchhandlung wäre leer, das Publikum hätte sich davongeschlichen, war ein Albtraum.
Man wusste nie, wie eine Lesung werden würde.