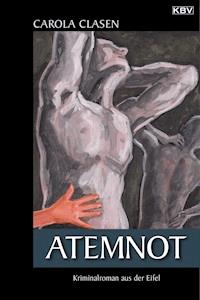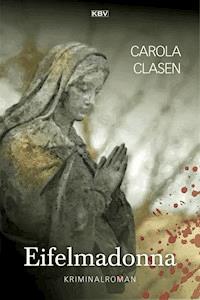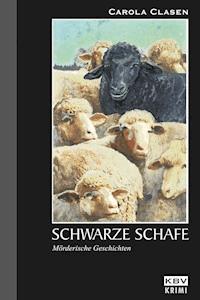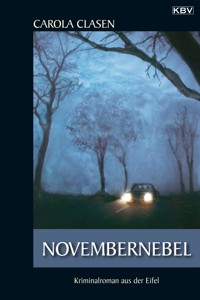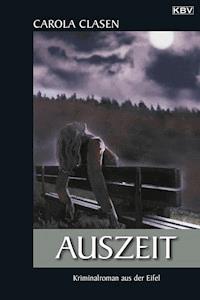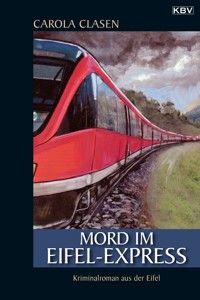Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: KBV
- Kategorie: Krimi
- Serie: Sonja Senger
- Sprache: Deutsch
Die Eifel ist in heller Aufruhr. Zu einem Fest in der Greifvogelstation Hellenthal reisen im Privat-Jet Karim bin Zayed Al Nahyan, einer der vielen Brüder des Emirs von Abu Dhabi und sein Lieblingsfalke Amir an. Die Presse überschlägt sich. So erfährt auch Sonja Senger von dem Ereignis, aber sie hat andere Sorgen. Sie pflegt ihren ausgewachsenen Blues in ihrem Forsthaus in Wolfgarten am Ende der Stromleitung. Jerome hat sie verlassen. Und auch als Kommissarin ist sie eigentlich weg vom Fenster, denn sie hat ihren Dienst in Köln nicht angetreten. Als sie einige Tage später bei einem Waldspaziergang einen verletzten Raubvogel findet, benachrichtigt sie die Greifvogelstation. Schnell steht fest, dass es sich um Amir handelt, der mit seinem Herrn längst wieder in Abu Dhabi sein sollte. Und eines ist klar: Karim bin Zayed Al Nahyan würde das Land nicht ohne seinen Lieblingsfalken verlassen. Niemals.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carola Clasen
Wildflug
Bisher von der Autorin erschienene Titel bei KBV:
»Novembernebel«
»Das Fenster zum Zoo«
»Tot und begraben«
»Auszeit«
»Schwarze Schafe«
Carola Clasen wurde 1950 in Köln geboren. Nach einem Sprachenstudium arbeitete sie bis zu ihrer Heirat in Belgien. Später veröffentlichte sie zahlreiche Kurzgeschichten im Rundfunk. 1998 erschien ihr erster Eifel-Kriminalroman »Atemnot«.
»Wildflug« ist ihr sechster Titel im Programm des KBV.
Carola Clasen
Wildflug
Originalausgabe
© 2006 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH,
Hillesheim
www.kbv-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0 65 93 - 998 96-0
Fax: 0 65 93 - 998 96-20
Umschlagillustration: Ralf Kramp
Redaktion, Satz: Volker Maria Neumann, Köln
ISBN 3-937001-88-3
E-Book-ISBN 978-3-95441-023-1
Ständiger Sonnenschein
erzeugt eine Wüste.
(arabisches Sprichwort)
1. Kapitel
Er öffnete eine Schreibtischschublade, holte seine Beretta heraus und legte sie so vor sich hin, dass der Lauf auf sein Gegenüber zeigte.
»O nein! Bitte erschieß mich nicht«, flehte Alex und rutschte vom Stuhl auf die Knie, sodass sein Kinn fast auf die Tischplatte schlug.
»Tz,tz,tz«, machte er, um ihn zu beruhigen, und zog langsam ein Kistchen zu sich heran, das einen doppelten Boden zu haben schien. Erst kam eine Lage Briefmarken zum Vorschein, die er in aller Ruhe bewunderte. Dann Patronen. Er zog das Magazin aus der Beretta, öffnete es und füllte es langsam und andächtig mit fünfzehn Patronen, neun Millimeter Parabellum. Jede einzelne unterzog er einer Begutachtung.
»Ich flehe dich an. Bitte! Lass uns noch mal über alles reden. Vielleicht schaff ich es ja doch, es war nur wegen der Hochzeit, ich hab ihr versprochen …«
»Tz, tz, tz«, wiederholte er. »Keine Sorge. Ich bin doch nicht blöd. Nach Eintritt des Todes fließt doch das Blut nicht mehr.«
»Siehst du«, sagte Alex irritiert, aber auch erleichtert, rappelte sich hoch und rutschte wieder auf seinen Stuhl.
»Ganz ruhig, mein Alter. Niemand wird dich erschießen. Die Pistole ist nicht für dich. Alles wird gut«, sagte er ohne hochzusehen und zog eine Schachtel mit Tabletten aus der Schublade. Er hielt sie so, dass die Aufschrift nicht zu erkennen war. »Ich hab hier was für dich. Die Dinger hier coolen dich ein bisschen runter, und dann ist alles halb so wild. Warte, ich hole nur Wasser.«
Er kam mit zwei Bierflaschen und einem Glas zurück, in dem sich die Tabletten schon auflösten. Das Wasser war milchig. »Trink das. Und du bist wie neu.«
Alex stürzte das Wasser hinunter, verzog das Gesicht, spuckte und fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. »Bah!«
»Schmeckt scheußlich, nicht wahr? Hilft aber. Nehm ich selbst manchmal.« Er köpfte die Bierflaschen an der Schreibtischkante. »Komm, darauf heben wir einen. Und dann machen wir eine kleine Spazierfahrt mit deinem Auto. Okay? Ich will dir was zeigen.«
»Eine Überraschung?«
»Ja, genau. Eine Überraschung.«
»Ich fahre«, sagte er und schob Alex auf den Beifahrersitz. »Schnall dich an.«
Es dauerte nicht lange, und die Augenlider seines Beifahrers wurden schwer, der Oberkörper im Sicherheitsgurt begann hin und her zu schwanken. Der Kopf schlug gegen die Seitenscheibe, dann gegen die Kopfstütze, dann fiel das Kinn auf die Brust, Arme und Beine wurden schlaff und fielen auseinander. Die linke Hand landete auf dem Schalthebel. Er schob sie ungeduldig beiseite.
Sie passierten Gemünd und Wolfgarten und ließen den Abzweig nach Heimbach rechts liegen. Bald kamen keine Häuser mehr. Der Wald zu beiden Seiten der Straße wurde größer und schwärzer und tiefer. Sie folgten der Straße nach Schwammenauel.
Er kannte die Strecke gut. Er fuhr sie nicht zum ersten Mal. Die Verkehrsschilder waren die Etappen zu seinem Ziel. Erst der Hinweis auf die Wildschweinpest, die Geschwindigkeitsbegrenzung auf fünfzig Stundenkilometer, das Überholverbot für Pkw und schließlich das Gefälle von acht Prozent.
Mit Blick auf das übergroße weiße Schild Unfallhäufige Stelle, auf dem zwei gefährliche Kurven rot markiert waren, hielt er an. Vor ihm lag ein gerades, steiles Stück Straße, das in eine Rechtskurve mündete, ehe es aus dem Blickfeld verschwand. Bäume, links eine Birke, rechts eine Gruppe Fichten, dazwischen ein Abhang, der ebenfalls an einer Baumreihe endete. Keine Seitenplanke säumte die Krümmung der Straße.
Licht aus, Gang raus, Handbremse hoch.
Ein Auto fuhr vorbei, unten langsam in die Kurve, die Rücklichter verschwanden hinter der nächsten Böschung, und er war wieder allein mit Alex. Über ihnen hing ein dunkler, wolkiger Himmel. Es war kurz nach Mitternacht.
Er zerrte Alex vom Beifahrersitz hinters Steuer, drückte seinen Kopf an die Kopfstütze, legte seine unbeholfenen Hände aufs Lenkrad, hakte die Finger ein, bückte sich, um seine schlaffen Beine und Füße zu sortieren.
Er hantierte länger dort unten herum, legte einen Gang ein und hatte plötzlich alle Mühe, den eigenen Kopf schnell genug aus der Tür zu ziehen, sie zuzuknallen, denn das Auto machte einen unkontrollierten Satz nach vorne.
Und dabei blieb es nicht. Es stürzte sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit hinab. Es schlingerte, stieß rechts gegen einen Begrenzungspfahl, links gegen die Birke und prallte schließlich frontal in die Baumreihe.
Genau wie beim ersten Mal, dachte er zufrieden.
Das Hinterteil des Wagens bäumte sich auf. Einen Moment stand das Fahrzeug fast senkrecht, ehe es zurück auf die Räder fiel. Glas und Blech zertrümmerten, Rauch stieg in den Himmel, die Bäume zitterten bis in die Wipfel. Es roch nach Gummi und Brand und Öl.
Er wartete einen Augenblick ab, lief dann die Straße hinab, um nach dem Rechten zu sehen. Er näherte sich vorsichtig. Aus der tief eingedrückten Motorhaube drang Qualm, die Windschutzscheibe war zertrümmert, die Scheibenwischer standen quer, Alex’ Körper lag auf dem Lenkrad, sein Gesicht zeigte in seine Richtung. Es war blutüberströmt.
Er zog sein Handy aus der Tasche, drückte den Notruf und meldete den Unfall.
Gut. Alles klar. Er rieb sich die Hände. Das war’s.
Am meisten hasste er es, danach den ganzen Weg zu Fuß nach Hause gehen zu müssen. Es gab andere, wirklich gute Stellen in der Nähe seines Wohnortes, aber keine war wie diese. Keine, von der man einen Unfall eher annehmen konnte.
Vor dem ersten Mal hatte er das Fahrrad seiner Frau in der Nähe postiert. Er selbst besaß keines. Wann kam ein Typ wie er auch schon zum Fahrrad fahren? Aber als er es nach dem Unfall aus dem Versteck holen wollte, war es nicht mehr da gewesen. Irgendein Idiot war ihm zuvorgekommen. Seine Frau hatte es bis jetzt nicht gemerkt. Er würde ihr bei Gelegenheit ein neues holen, ein viel schöneres.
Als er beim Schild Wildschweinpest angelangt war, hörte er die Sirene und sprang in die Böschung.
2. Kapitel
Staatsanwalt Bernd Wesseling saß in seiner Aachener Privatwohnung und trank mit seiner Frau Hilde Kaffee. Es war ein Freitagnachmittag, da gab es Kuchen bei Wesselings. Neuerdings. Hilde lief auch nicht mehr wie früher in bequemer Hauskleidung herum, sondern hatte sich in Schale geworfen. Kamelfarbener Hosenanzug, die Jacke hing über der Stuhllehne, ein braunes, knappes T-Shirt. Auch trug sie beileibe keine Hausschuhe, sondern braun-weiße Sneakers. Ihre Frisur schien gerade erst gekämmt, der Lippenstift war frisch.
Wesseling selbst war sowieso immer akkurat gekleidet und frisiert, das hatte er seiner Frau zu verdanken. Er mochte den Anblick, der sich ihm gegenüber bot, und lächelte seine Hilde zufrieden an.
Zwischen ihnen standen eine Kaffeekanne, ein Milchkännchen, ein Zuckertopf und eine Kuchenplatte mit zwei Stückchen Bienenstich. Zwei Stückchen Erdbeerkuchen warteten bereits auf den weißen Esstellern darauf, verspeist zu werden. Wesseling verströmte einen dezenten Herrenduft, der unmittelbar mit Hildes neuem Parfum konkurrierte.
Seit Hilde 2004 im Schwarzwald in Kur gewesen und mit einem gesunden Rücken und einem Schatten namens Schmidt nach Hause gekommen war, hatten sich viele Dinge im Hause Wesseling geändert. Hilde hatte ihn damals regelrecht erpresst. Wenn er, Bernd, nicht ab sofort dies und das täte und dies und das ließe, würde sie mit Herrn Schmidt auf und davon gehen. Für immer.
Herr Schmidt kam von »drüben«, wie sie sagte, als Bernd sich interessiert nach ihrer beider Ziel erkundigte. Nähere geografische Angaben wollte sie nicht machen. Schließlich sollte er sie nicht suchen und finden können.
Wesseling verstand die Welt nicht mehr. Hilde war am Osten nie etwas gelegen, im Urlaub sollte es immer der Süden sein. Je wärmer, je lieber.
»Was gibt es denn Neues, mein Lieber?«, fragte Hilde. Ein Happen Erdbeerkuchen verschwand zwischen ihren roten Lippen. Sie mahlte und legte den Kopf schief.
Früher hätte er geantwortet: »Je nun«, sich in Schweigen gehüllt und hinter einer Zeitung verschanzt. Über seine Arbeit sprach er nicht gern. Das nützte ihm nun nichts mehr. Das war Teil des Arrangements, das er eingegangen war, um Hilde nicht in den Osten ziehen lassen zu müssen.
Auch Herr Schmidt gehörte der Vergangenheit an. Sie hatten ihn bezwungen. Und irgendwie waren sie ihm heute noch dankbar für sein Auftauchen. Wesseling natürlich mehr über sein Abtauchen. Herr Schmidt hatte eine deutliche Spur hinterlassen.
Wesseling hatte Hilde versprochen, sie mehr an seinem Leben teilnehmen zu lassen und ihr mehr Zeit zu schenken und ab sofort einen Herrenduft zu benutzen.
Sie hatte versprochen, öfter einmal mit ihm auszugehen, in ein Konzert, oder zu wandern und nicht nur das Leben einer Hausfrau zu führen, wozu gehörte, dass sie sich immer nett anzog. Manchmal war es ihm fast schon zu modern, was sie trug, aber er würde den Teufel tun und etwas sagen.
Allein bei Hildes Wunsch, gemeinsam Mitglied in einem Fitness-Studio zu werden, war Wesseling hart geblieben. Wann immer sie das Thema zur Sprache brachte, war seine stoische Antwort: »Da gehe ich nicht hin, und wenn du dreimal gen Osten ziehst.« Alles hatte seine Grenzen. Wenn er jemals irgendeinen Sport – außer Wandern – betreiben sollte, dann an der frischen Luft. Das wollte Hilde nicht. Sie wollte sich nicht vom Wetter abhängig machen.
Bei einem Tanzkurs wurde Wesseling allerdings schwach.
Auch der freitägliche Kaffeeklatsch war ihm ein liebes Ritual geworden, das ein Wochenende einläutete. Ihre Ehe stand unter einem guten, neuen Stern. Auch wenn es irgendwo in Wesselings Dienstbereich Tote gab, lagen sie stets erst an zweiter Stelle.
Hildes Frage stand noch unbeantwortet im Raum, als er ihr Kaffee nachgoss und sagte: »Ich habe dir doch von diesem merkwürdigen, angeblichen Autounfall erzählt.«
»Natürlich«, posaunte Hilde stolz hinaus. »Ich bin auf dem Laufenden. Heute vor genau einer Woche, exakt am 5. Mai: Alexander Linden, noch keine dreißig, aus Heimbach. Laut Obduktion bewusstlos am Steuer durch eine Überdosis Schlaftabletten. Ein ausgehebelter oder blockierter Gaszug und ein Baum an der falschen Stelle waren ursächlich …«
»Psst«, machte Wesseling automatisch. Hilde wusste mehr als die Presse.
Sie sah sich um. »Wir sind allein, Bernd. Habt ihr endlich den Täter?«
»Nein, aber so wie es aussieht, einen ähnlichen Fall.«
»Oh Gott«, rief Hilde ehrlich bestürzt aus. Es irritierte Wesseling immer, wenn sie sich seine Fälle so zu Herzen nahm. »Schon wieder?«
»Im Gegenteil, er hat sich schon im Dezember letzten Jahres ereignet, aber wir haben es nicht gemerkt. Kurz vor Weihnachten.«
»Wie schrecklich, gerade an Weihnachten. Davon hast du mir nichts erzählt.«
»Es war auch kein Mordfall für uns, verstehst du, Hilde. Es schien uns ein Unfall zu sein. Der Tote wurde nicht obduziert, das Gaspedal wurde nicht untersucht. Die Akte kam gar nicht erst auf meinem Tisch. Das kann passieren. Du weißt, wie überlastet sie in der Rechtsmedizin sind.«
»Du hast es mir gesagt. Wie seid ihr denn dieses Mal draufgekommen?«
»Die Eltern des ersten Toten haben sich gemeldet, weil sie von dem Unfall in der Zeitung gelesen haben.«
»War die Unfallstelle die gleiche?«, setzte Hilde das Verhör fort.
Wesseling bejahte.
»Da stehen ja genug Bäume.«
»Hilde!«, ermahnte er sie entrüstet. »Als wir dann weitersprachen, kam noch mehr ans Tageslicht.«
»Was denn?«
Wesseling schüttelte den Kopf.
»Verstehe.«
»Das Auto von damals ist natürlich schon in der Presse verschwunden, aber die Eltern waren mit einer Exhumierung des Toten einverstanden.«
»Wie heißt er?«
»Das kann ich dir erst sagen, wenn feststeht, ob er wirklich ermordet wurde.«
»Gut«, beschloss Hilde das Verhör und ging zu ihrem Schlusssatz über: »Ich schweige wie ein Grab.«
Nun war alles gesagt. Wesseling hatte seine Schuldigkeit getan. Er lehnte sich zurück, seufzte und ließ seinen Blick über die kleine Bildergalerie schweifen, die an den Esszimmerwänden hing und Resultat seiner Zeichnungen war, die er während oder nach seinen diversen Wanderungen angefertigt hatte.
Manchmal kam ihm sein neues Leben richtig anstrengend vor. Er, seine Berichte wiederkäuend, und Hilde mit ihrer Fragerei. Aus ihr wäre eine gute Journalistin geworden. Und dann das Versprechen zum Schluss. Ich schweige wie ein Grab. Sicher, er hatte sie anfangs darum gebeten. Aber war es nötig, den Satz ständig zu wiederholen? Auch wenn er signalisierte, dass die bohrende Fragerei ein Ende hatte.
Heute nicht einmal das.
»Ich werde wohl Montag nach Schleiden müssen«, kündigte Wesseling an. »Man kann nicht alles vom Schreibtisch aus regeln.«
»Verstehe.« Hilde kratzte Kuchenkrümel zusammen und fragte beiläufig und ohne hochzusehen: »Darf ich vielleicht dieses Mal mit?«
Wesseling zuckte zusammen. »Im Prinzip, ja«, antwortete er zögernd und musterte seine Frau. Das hatte sie noch nie gefragt. »Natürlich kannst du mit. Wenn es dich interessiert.«
»Das tut es.«
»Dann gehen wir hinterher irgendwo schön essen.«
Hilde nickte. Nach einer Weile hob sie an: »Fährst du auch bei ihr vorbei?«
Wesseling zuckte schon wieder zusammen. Mit ihr konnte Hilde nur Sonja Senger meinen, die Hauptkommissarin aus Trier, mit deren Hilfe er vor zwei Jahren den Fall Alexander Kluska gelöst hatte. Drei Morde waren auf sein Konto gegangen, ehe er den Mut hatte, sich zu erhängen. Dies war nicht Sengers erste Serie gewesen. Sie schien ein Faible für Serien zu haben.
Ganz im Gegensatz zu ihm. Er hasste sie. Trotz aller Fortbildung in Psychologie – oder gerade wegen dieser Kurse. Solche Fälle streckten sich manchmal über Jahre, und er musste sich viel mehr vor Ort einbringen, als ihm lieb war, um den Täter zu verstehen, um einen Blick in seine Denkweise werfen zu können.
Senger hatte vor einiger Zeit angerufen. Nicht hier zu Hause, sondern im Büro der Staatsanwaltschaft. Er hatte Hilde nichts davon erzählt, weil er das Gefühl hatte, dass es zwischen den beiden Damen, die einander nie begegnet waren, eine latente, aber völlig unangebrachte Eifersucht gab. Was ihm einerseits schmeichelte, ihn andererseits aber auch beunruhigte.
Senger hatte sich nicht gut angehört. Kein Wunder. Er hatte ihr gleich gesagt, dass er meinte, ihr würde die Arbeit fehlen. Sie würde nach geistiger Nahrung hungern. Und so war es dann gekommen. Sie hatte ihn ausgefragt. Wie Hilde. Schlimmer noch. Sie hatte ihn sogar gefragt, ob er nicht einen Job für sie hätte. Irgendetwas Kleines, Unbedeutendes. Oder besser noch alte Akten, ungelöste Fälle zum Aufdröseln. Aber das durfte er nicht. Wer auch immer schuld an ihrer Misere war, das wollte er nicht beurteilen, letztes Jahr hatte er noch versucht, sich für sie stark zu machen, aber sein Einfluss hatte Grenzen. Diese Grenzen endeten vor den Toren der Stadt Köln.
Außerdem machte Senger wohl auch dieser windige Franzose zu schaffen, der sich für unwiderstehlich hielt. Schaumschläger, dachte Wesseling. Kam und ging, wie es ihm passte. Wesseling fragte sich, was Frauen an solchen Typen mochten.
Und, ja, wenn Hilde schon fragte, er würde gern nach Senger sehen. Auf einen Rum mit Tee, vielleicht. Hockte sie wirklich den lieben, langen Tag mutterseelenallein in ihrem winzigen Forsthaus in Wolfgarten?
»Vielleicht«, sagte er also mit reichlicher Verspätung und wohl etwas zu vorsichtig zu Hilde.
»Schon gut. Dann bleib ich eben hier.«
Wesseling hatte diesen Satz kommen hören. Braute sich da etwas zusammen? Er wollte nichts falsch machen. »Vielleicht auch nicht«, schob er nach. »Je nachdem, wie viel Zeit mir bleibt.«
Mit einem Klirren stellte Hilde ihre Kaffeetasse auf den Essteller, als Zeichen dafür, dass sie gesättigt war, und wechselte das Thema: »Weißt du, was ich heute erlebt habe?«
Wesselings Gedanken wanderten von Senger zu den beiden toten Männern. Bei dem neuen, alten Fall handelte es sich um André Ziskoven. Er war Anfang vierzig, wohnte in Olef und war von Beruf Hausmeister. Er hatte sich gerade ein Haus gebaut, als er arbeitslos wurde, er hinterließ eine Frau und drei Kinder. Alexander Linden, Ende zwanzig, Speditionskaufmann, war ledig gewesen, hatte aber eine Freundin, sie wollten demnächst heiraten, wie seine Eltern versicherten. Er hatte ebenfalls seine Arbeit verloren. Kein guter Start ins Leben.
Wesseling hatte beide Familien besucht. Sie wussten nichts von dem, was die beiden Männer in ihrer freien Zeit getrieben hatten. Der Tod sei für sie aus heiterem Himmel gekommen.
Außer der Unfallstelle, der Arbeitslosigkeit, und – wie Wesseling vermutete – der Todesart hatte man noch keine weiteren Gemeinsamkeiten feststellen können. Man wartete noch auf mögliche Erkenntnisse nach Exhumierung und Obduktion. Aber wenn alles zusammenpasste, hoffentlich nicht, betete Wesseling, dann begann die Kleinarbeit. Es musste andere Berührungspunkte zwischen den beiden Opfern geben. Irgendwo überschnitten sich ihre Lebensläufe. Manchmal lagen diese Fixpunkte sehr weit zurück. Und manchmal waren sie so klein, dass man sie übersehen konnte. Man musste eben die Augen weit aufmachen.
Ehemalige Kollegen, Verwandte, Freunde und Nachbarn würden dann von Mitarbeitern der Bonner Kriminalkommission befragt werden müssen. Bei Mord reichte man die Polizeiarbeit von Schleiden nach Euskirchen weiter und von dort nach Bonn. Die Kriminalkommissare Korb und Stelter waren wieder im Einsatz, wie Wesseling gehört hatte. Das war ihm lieb.
»Bernd!«, hieß es vorwurfsvoll.
Wesseling besann sich. Der Kaffeetisch war wie durch ein Wunder abgeräumt. Was war aus dem Bienenstich geworden? Er versuchte nachzuschmecken und legte eine Hand prüfend auf den Bauch. Hatte er ihn etwa gegessen? Hilde stand neben ihm, eine Hand an der Hüfte, die andere griff ins Haar, das sie neuerdings sehr kurz trug. Wesseling hatte sie kennengelernt, da lagen ihr die Haare auf den Hüften so wie jetzt ihre Hand. Ach!
»Er hat deine Frisur sehr gut hinbekommen«, steuerte Wesseling sicherheitshalber bei.
»Wer?«
»Dein Friseur!«
»Davon habe ich nicht gesprochen!«
»Trotzdem ist es so.«
»Findest du?« Sie drehte den Kopf hin und her wie eine Marionette.
»Aber ja. Es sieht sehr hübsch aus.«
Sie lächelte besänftigt. »In der Bücherei«, begann sie, vermutlich bereits zum zweiten Mal.
»Oh, du warst in der Bücherei? Was hast du dir geliehen?«
Aus der Ferne hörte Wesseling sie von einem Buch und dann von einem Erlebnis in der Stadtbücherei reden. Sie schien eine alte Freundin getroffen zu haben, die sie zwanzig Jahre oder länger nicht gesehen hatte. Und was aus dieser Frau geworden war! Wenn man Hilde Glauben schenken konnte, war sie nun doppelt so dick! Hilde ließ die Dinge manchmal drastischer erscheinen als sie waren. Die Ärmste! Und sie war geschieden! Und hatte jetzt wohl Probleme mit der Einsamkeit, da half ihr das Essen.
Wesseling sah seine Hilde nachdenklich an. Was machte Herr Schmidt jetzt wohl die ganze Zeit ohne sie? Er stellte ihn sich klein und hager vor, das dünne, rotblonde Haar mit einem akkuraten Seitenscheitel geteilt, mit wasserblauen Augen, die immer leicht gerötet waren, und spitzen Schuhen. In welchen Osten er sie wohl mitgenommen hätte?
3. Kapitel
Insgesamt knapp acht Flugstunden von Aachen entfernt, in Abu Dhabi Stadt, fühlte sich Karim bin Zayed Al-Nahyan wieder einmal als der Ärmste unter der brennenden Sonne der Vereinigten Arabischen Emirate.
»Du hast es mir versprochen«, warf er seinem Leibwächter Sharaf Jaziri fast täglich vor.
»Ja, Ja. Ich tue, was ich kann. Aber Geduld musst du dennoch haben, Geduld, der Tag ist nicht mehr fern. Du bist bald hektisch wie ein echter Europäer.«
Dabei war Karim nur ein halber. Er hatte die helle Haut seiner deutschen Mutter geerbt und sogar ihre meerblauen Augen. Er war schmaler und größer geraten als seine vielen Brüder. Allein seine schwarzen glatten Haare, die er bis zum spitzen Kinn trug, und die edle Hakennase verrieten seine hohe arabische Herkunft. Er war das einzige Kind, das Basmah, eine der Lieblingsfrauen des inzwischen verstorbenen Emirs Sheikh Zayed bin Sultan Al-Nahyan, zur Welt gebracht hatte.
Sheikh Zayed hatte während seiner Herrschaft in unermesslichem Überfluss gelebt und eine üppige, leider künstlich angelegte Vegetation in und um Abu Dhabi Stadt herum geschaffen. Scharen von Gärtnern beschäftigten sich mit seinen Parkanlagen und Alleen, um den Traum des Herrschers und aller Emiraties widerzuspiegeln: ein Leben in üppiger Vegetation.
Auch Karim träumte diesen Traum. Aber er wollte sich nicht damit begnügen, ein Grünflächen-Fan zu sein und jeder Palme einen Wasserschlauch zu verpassen. Er wollte mehr. Er wollte echte, wahre, wilde Flora. Basmah hatte diese Saat gesät.
Sie war anders gewesen als die anderen Frauen des Emirs, nicht nur schön und blass, fast durchsichtig, sondern auch blaublütig und klug. Den größten Teil ihres Lebens hatte sie in verschiedenen Ländern Europas verbracht. Ihr Vater war ein hoher Diplomat. Basmah sprach mehrere Sprachen. Sie hörte auf den Namen Katherina, ehe Sheikh Zayed sie in seinen Palast holte und Basmah nannte.
Ihrem kleinen Sohn Karim hatte sie viel von ihrem früheren Leben erzählt und damit einen Teil ihres Heimwehs gestillt. Zuerst die Märchen, Sagen und Fabeln, später berichtete sie ihm von der Realität, den Wäldern und Wiesen, den Seen, Flüssen und Bächen, dem Regen und den schier undenkbaren Phänomenen Kälte, Frost, Eis und Schnee. Für Karim wurde so Europa mit den Jahren eine Art Gelobtes Land, wo nicht gerade Milch und Honig, aber wenigstens Wasser reichlich floss. Wasser, das einfach aus dem Himmel kam, aus Stein oder Erde hervorsprudelte und sich zu Flüssen und Seen versammelte. Süßes Wasser, wie Basmah es nannte.
Unfassbar für ihn, der in einem Land aufgewachsen war, das zwar zu einem großen Teil am Meer gelegen und grundwasserreich war, aber auch zu 97,1 Prozent aus reiner Wüste bestand und wo nur durch riesige Meerwasserentsalzungsanlagen der Bedarf zu sichern war. Unvorstellbar für ihn, der nichts als künstlich angelegte Landschaften kannte, Wolkenkratzer aus Glas, Stahl und Beton, flirrende, vierspurige Highways, glatt wie Seide, so weit das Auge reichte, eingerahmt von Oleanderhecken zum Schutz gegen die peitschenden Sandstürme, die von den umliegenden Wüsten kamen. Eine harmlos klingende Durchschnittstemperatur von zweiunddreißig Grad bedeutete nichts anderes als unerträgliche fünfzig Grad im Sommer und milde zwanzig Grad im Winter. Ein mörderisches Klima. Ein mörderisches Leben.
Kein Wunder, dass sein Herz höher schlug, als seine Mutter ihm Fotografien von Europa zeigte. Wasserfälle und Seen, blau und grün zugleich. Und angeblich süß. Echte schwarze Wälder, echte Wiesen und Blumen. Rauschende Flüsse und plätschernde Bäche, Quellen. Diese Bilder wollten ihm nicht mehr aus dem Kopf.
Aber eine Reise kam nicht in Frage. Sheikh Zayed gestattete es nicht. Basmah durfte das Land nicht verlassen. Zu sehr fürchtete er wohl, sie könne nicht zurückkehren. Das Heimweh! Und Karim durfte keinen Tag ohne Basmah sein.
Dann musste er es doch. Für den Rest seines Lebens. Über der Oase von Liwa stürzte die Maschine ab. Da war Karim erst zehn Jahre alt und weinte sich nach seiner Mutter die Augen aus. Auch Sheikh Zayed sollte sich nie wieder von diesem Schicksalsschlag erholen. Eine Reise blieb tabu. Davon wollte der trauernde Emir nichts hören.
Als er am 2. November des Jahres 2004, mitten im Ramadan, nach langer Krankheit verstarb, versanken das Herrschergeschlecht Al-Nahyan und das gesamte Land in tiefer Trauer, denn er war ein gütiger, großzügiger Emir gewesen. Die Bevölkerung lebte im Wohlstand, es gab so gut wie keine Kriminalität.
Sein ältester Sohn Farouq, der schon seit einiger Zeit den Vater vertrat, übernahm nun die Amtsgeschäfte, wurde zum neuen Emir gewählt und gab sich alle Mühe, seinen Vater würdig zu ersetzen und die Kontinuität im Lande zu wahren. Aber das Charisma seines Vaters hatte er nicht. Bei Weitem nicht. Dessen Wimpernschlag allein gereicht hatte, dass sich die Leute vor ihm in den Staub warfen.
Trotz der guten diplomatischen Beziehungen zu Europa setzte Sheikh Farouq die Tradition fort und dachte nicht daran, seinem kleinen Bruder Karim eine Reise nach Europa zu gestatten.
»Die einzige Reise, die ich dir gestatte, ist die hadj«, sagte Farouq jedes Mal, wenn er Karim zu Gesicht bekam. Dieser Satz wurde zum geflügelten Wort im Palast des Emirs und Karim das Opfer des Spottes seiner vielen Brüder.
»Ich will nicht nach Mekka, ich will nach Europa.«
»Denke nicht einmal daran!« Farouq spuckte die Wörter aus, als seien sie vergiftet.
»Warum sollte ich nicht?«, fragte Karim dann trotzig zurück, warf seinen Kopf herum, dass die weiße ghutra nur so flog.
»Weil ich es nicht erlaube, ich habe unserem Vater versprochen, auf dich zu achten.«
»Dann tu es auch! Wenn ich nicht nach Europa kann, bringe ich mich um«, drohte Karim und strich sich mit der Handkante die Kehle entlang.
»Dazu fehlt dir der Mut.«
Karim schwieg. Sein Bruder hatte recht. Mut war nicht seine größte Stärke. Sonst wäre er längst nicht mehr hier. Was hielt ihn noch in Abu Dhabi? Er war jetzt fünfundzwanzig Jahre alt, verlassen von Vater und Mutter und ungeliebt von seinen Brüdern. Er hatte niemanden außer Sharaf.
Sharaf Jaziri war sein Diener, Leibwächter, Berater, Fahrer und Freund seit Kindertagen. Ihm allein vertraute er blind, ihm allein konnte er von seinen Wünschen und Sehnsüchten erzählen. Niemals lachte Sharaf ihn aus, so wie es seine Brüder taten. Nein, Sharaf fühlte wie er.
Auch Sharaf entstammte, allerdings um viele Ecken und nur mütterlicherseits, dem Herrschergeschlecht Al-Nahyan. Er hatte Sprachen studiert, sprach fließend englisch, französisch und deutsch, und hatte dann die Militärlaufbahn eingeschlagen. Danach war er in den Sicherheitsdienst gegangen, hatte eine Kampfausbildung genossen und war schließlich Teil eines Personenschutzes im Palast des Emirs geworden. Sharaf war ein kräftiger, untersetzter Mann mit einer Hakennase und Augen schwarz wie Eierbriketts. Er trug einen eckigen, akkurat gestutzten Bart. Durch seinen ehrenwerten Namen gewann er das Vertrauen des Emirs, sodass er von ihm einen wichtigen, lebenslangen Auftrag bekam, auf den er stolz sein konnte. Sein Auftrag war Karim.
Karim hatte auf Wunsch seines Vaters ein Studium der Betriebswirtschaft an der Universität von Al-Ain absolviert und war Geschäftsmann geworden und hatte seit zwei Jahren eine gute Position in der Al-Saman-Group. Sein Vater hatte diese Geschäftsverbindung noch geknüpft. Karim war nicht der erste seiner Söhne, den er in der Al-Saman-Group untergebracht hatte. Aber Karim war der Einzige, dem es an Ehrgeiz fehlte. Stets wirkte er ein wenig scheu und gedankenverloren, als habe er sich auf diese Welt nur verirrt und sei in Wirklichkeit woanders zu Hause. Und so war es auch. Er war zu Hause in seinen Träumen.
Die blitzblank geschniegelte Geschäftswelt war nicht seine Welt. Da saß er nun, Tag ein, Tag aus, im vierundzwanzigsten Stockwerk eines gläsernen Wolkenkratzers, hatte alles, was sich ein junger Mann wünschen konnte: ein großzügiges, eigenes Büro, einen Sekretär, eine Sekretärin, eine anspruchsvolle Aufgabe. Und was tat er? Er genoss es nicht. Bekümmert sah er in den erbarmungslos blauen Himmel, auf das flirrende Meer, die rote Wüste und die anderen Hochhäuser um ihn herum, in deren getönten Scheiben sich die Sonne verfärbte, und dachte an Europa. Der Ruf des Muezzin aus der nahen, weißen Moschee erreichte ihn nur von fern. Allahu akhbar …
Wenn er der Größte ist, warum steht er mir dann nicht bei, fragte sich Karim jeden Tag aufs Neue. Wann tauchte sein oberster Chef endlich noch einmal bei ihm auf? Das wünscht sich nicht jeder Angestellter auf der Welt, aber Karim saß nur aus einem einzigen Grund jeden Tag in seinem Büro, nämlich in der Hoffnung, endlich seinem obersten Chef, Salem Ebrahim Al-Saman, noch einmal zu begegnen. Erst ein einziges Mal, an seinem ersten Arbeitstag, war er ihm begegnet. Salem Ebrahim Al-Saman war ein älterer, kleiner, drahtiger Herr. Freundlich aber distanziert. Und an jenem Tag war keine Gelegenheit gewesen, auf Deutschland zu sprechen zu kommen. Und auf Salem zuzugehen, das entsprach nicht Karims Fähigkeit, dazu war er viel zu schüchtern.
»Heute wieder nicht«, berichtete er Sharaf jeden Abend unermüdlich.
»Warte, mein Herr«, sagte Sharaf dann jedes Mal. »Der Tag ist nicht mehr fern.«
Viel zu oft sah Karim auf seine Rolex, viel zu langsam verstrich die Zeit bis zum Feierabend, wenn der Tag, der hinter ihm lag, an Bedeutung verlor, als hätte es ihn nicht gegeben.
In seinen Privaträumen warf er den dunklen Geschäftsanzug aus feiner Seide auf sein Bett und tauschte ihn gegen die weiße, knöchellange dishdasha, bedeckte den Kopf mit der kunstvoll gehäkelten tagiyah, warf die weiße ghutra darüber und befestigte das Kunstwerk mit dem schwarzen igal. So fühlte er sich immer noch am wohlsten. Die schwarzen Business-Schuhe flogen in die Ecke und wurden durch Ledersandalen ersetzt.
Während seine Brüder sich in ihrer Freizeit mit Vorliebe oberflächlichen Vergnügungen wie dem Wüstenrennen, Sand-Skifahren, Golfen oder Kamelrennen widmeten, aus schierem Übermut sich manchmal sogar in die Niederungen des Fußballs begaben, galt Karims große Liebe allein der Falknerei, einem traditionellen Ritual, dem sich heutzutage fast nur noch die Älteren der Reichen verschrieben haben.
Seit sein Vater ihm den ersten Falken zu seinem fünften Geburtstag geschenkt hatte, Radji, einen weißen Ger aus einer norddeutschen Zucht, konnte er sich ein Leben ohne Falken nicht mehr vorstellen. Auf Radji folgte Malik, auf Malik Amir.
Karim griff zu Falknertasche, Federspiel und Geschüh, zog den Falknerhandschuh über die linke Hand und trat ans Fenster zu Amir, der dort die ganze Zeit fast bewegungslos auf seinem Block gestanden hatte. Als Karim ihm die lederne Haube vom Kopf zog, die mit einem Federbusch und bunten Perlenschnüren verziert war, schüttelte Amir sich und kommentierte die Störung mit einem kehligen Schrei.
»Genug geschlafen.« Karim kraulte ihm zärtlich Brust und Kopf, band ihn vom Block los, nahm die beiden Lederriemen zwischen Daumen und Zeigefinger und ließ Amir auf seine Hand steigen.
Am Bein trug er eine Kenn-Nummer, am Schwanz einen Mini-Peilsender für das GPS-System und in der Brust einen Mikrochip. So waren alle Falken in den Emiraten ausgestattet, aber Amir hatte noch ein besonderes Kennzeichen, das ihn einmalig und unverwechselbar machte: einen kleinen, ovalen, braunen Fleck über dem rechten Nasenloch.
Amir war drei Jahre alt, also im besten Alter, und natürlich ein weißer Ger. Weiß war vor allem der kräftige Brustkorb, die Flügel weiß-grau gestromt. Gers sind die Könige unter den Falken, die größten, schnellsten und stärksten ihrer Gattung.
An seinen freien Tagen ging Karim mit ihm im Leeren Viertel, der Wüste Ar-Rub al-Khali, auf Jagd. Da viele Beutetiere vom Aussterben bedroht waren, jagte man mit Attrappen. Seit Kurzem gab es aber dort auch eine speziell ausgewiesene Jagdzone, in der Tiere ausgesetzt wurden, die extra für die Jagd gezüchtet worden waren. Aber für den Feierabend war der Weg nach Ar-Rub al-Khali zu weit, da hatten sie anderes vor.
Amir trappelte unruhig auf dem Handschuh hin und her.
»Gleich geht es los.«
Wenig später stieß Sharaf Jaziri im Khaki-Anzug und mit weißer ghutra zu ihnen, und gemeinsam machten sie sich mit dem Jeep auf den Weg nach Dubai. Sharaf saß am Steuer, Karim immer hinten rechts, Amir auf seiner Hand. Es ging vorbei an einer Kamelherde, die in Reih und Glied durch die Wüste zog, an Dornenbüschen, Distelsträuchern und den Lehmmauern halb begrabener Ruinenstädte, Überbleibsel alter Karawansereien, aus denen schwarze, schreiende Vögel aufschreckten. Der rote Sand war durchzogen von Reifenspuren. Die Sonne hing über der Gebirgskette am Horizont. Eine Wolke aus Staub zogen sie hinter sich her.
Sobald sie an ihrem Ziel angekommen waren, dem Avian Reproduction Research Center (ARRC), der größten Falkenaufzuchtstelle der Emirate, einem Gelände, das durch Stacheldrahtrollen und Wachhunde gesichert war, hatte Karim sein anderes Leben vergessen. Auch wenn Amir nicht von hier stammte, verging fast kein Tag, an dem er nicht im ARRC den Falknern bei der Aufzucht der Jungvögel, der Pflege der kranken oder der Abrichtung der gefangenen Greifvögel über die Schulter sah. Karim half und beriet, wenn er gebeten wurde. Anschließend jagte er mit Amir ein wenig in der Wüstengegend um Nad Al Shiba. Für die Öffentlichkeit war das gesamte Gelände unzugänglich. Aber natürlich hatte ein Sohn des Herrschergeschlechtes jederzeit Zutritt. Solche kleinen Privilegien waren Karim der einzige Trost.
Im ARRC sprach man oft von Europa und besonders von Deutschland und dort besonders von einer weltbekannten Greifvogelstation in einem kleinen Ort mit dem seltsamen Namen Hellenthal, von dem keiner so genau wusste, wo er lag und wie man ihn aussprechen sollte. Von deutschen Tierärzten und Falknern hatte man im ARRC damals noch viel lernen können. Deswegen war die Greifvogelstation auch 1976 gekauft worden. Und zwar von keinem Geringeren als Karims Chef, Salem Ebrahim Al-Saman. Und letztlich war das der Grund für Karims verhasste Bürotätigkeit.