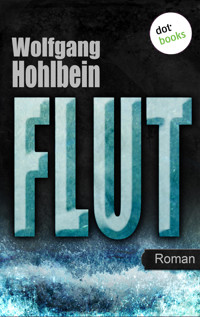7,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Was im Schatten lauert: Der Kult-Thriller „Azrael. Die Wiederkehr“ von Wolfgang Hohlbein jetzt als eBook bei dotbooks. Ein Alptraum ohne Erwachen: In Berlin bringen sich mehr und mehr Menschen auf bestialische Weise um. Nur der Schriftzug AZRAEL an den Fundorten der Toten schafft eine Verbindung zwischen den mysteriösen Fällen. Die Polizei ist nicht bereit zu glauben, was als Gerücht bald die Runde macht: Der Todesengel selbst geht um und hinterlässt sein Zeichen. Für den Polizisten Bremer hingegen bricht nun die Stunde der Wahrheit an. Was er hoffte, für immer vernichtet zu haben, drängt mit aller Macht zurück in sein Leben … Jetzt als eBook kaufen und das Mystery-Kultbuch genießen: „Azrael. Die Wiederkehr“ von Bestsellerautor Wolfgang Hohlbein. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 718
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein Alptraum ohne Erwachen: In Berlin bringen sich mehr und mehr Menschen auf bestialische Weise um. Nur der Schriftzug AZRAEL an den Fundorten der Toten schafft eine Verbindung zwischen den mysteriösen Fällen. Die Polizei ist nicht bereit zu glauben, was als Gerücht bald die Runde macht: Der Todesengel selbst geht um und hinterlässt sein Zeichen. Für den Polizisten Bremer hingegen bricht nun die Stunde der Wahrheit an. Was er hoffte, für immer vernichtet zu haben, drängt mit aller Macht zurück in sein Leben …
Über die Autoren:
Wolfgang Hohlbein, 1953 in Weimar geboren, ist Deutschlands erfolgreichster Fantasy-Autor. Der Durchbruch gelang ihm 1983 mit dem preisgekrönten Jugendbuch MÄRCHENMOND. Inzwischen hat er 150 Bestseller mit einer Gesamtauflage von über 44 Millionen Büchern verfasst. 2012 erhielt er den internationalen Literaturpreis NUX.
Wolfgang Hohlbein im Internet: www.hohlbein.de
Bei dotbooks veröffentlichte Wolfgang Hohlbein die Romane FLUCH – SCHIFF DES GRAUENS, DAS NETZ und IM NETZ DER SPINNEN, die ELEMENTIS-Trilogie mit den Einzelbänden FLUT, FEUER UND STURM sowie die große ENWOR-Saga.
***
Neuausgabe Juni 2016
Copyright © der Originalausgabe 2002 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2016 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Tanja Winkler, Weichs unter Verwendung von © estockiausdel
E-Book-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95824-660-7
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Azrael. Die Wiederkehr an:[email protected]
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
http://blog.dotbooks.de/
Wolfgang Hohlbein
Azrael
Die Wiederkehr
Mystery-Thriller
dotbooks.
Kapitel 1
Der erste Hieb war ins Leere gegangen, aber der nächste hatte seine linke Schulter getroffen und bis auf den Knochen hinab zerfleischt.
Wenigstens nahm er das an.
Er hatte bisher nicht den Mut aufgebracht, einen Blick auf seine Schulter zu werfen, um sich von der Schwere seiner Verletzung zu überzeugen, aber sein linker Arm hing so nutzlos wie ein Stück totes Holz an seiner Seite, und seine Jacke war naß und schwer von Blut. Obwohl der Regen immer heftiger strömte und er längst bis auf die Haut durchnäßt war, spürte er, wie ein zähflüssiges, warmes Rinnsal an seinem Arm hinablief und sich über der Handwurzel teilte, um an den Fingern entlang zu Boden zu tropfen. Hätte es nicht geregnet, hätte er eine gewundene Spur aus unterschiedlich großen Tropfen und Pfützen hinterlassen, die die Stationen seiner Flucht markierten. Er wußte nicht einmal mehr genau, wie viele. Sein unheimlicher Verfolger hatte ihn drei- oder auch viermal gestellt, aber es war ihm jedesmal gelungen, ihn noch einmal abzuschütteln.
Die Frage war nur: Wie oft noch? Trotz der Schmerzen, der atemabschnürenden Furcht und der immer stärker werdenden Erschöpfung war er noch nicht so sehr in Panik, daß sein logisches Denken vollends ausgeschaltet gewesen wäre. Der Angreifer hatte ihn mindestens einmal ganz bewußt entkommen lassen; wahrscheinlich sogar jedes Mal. Er spielte mit ihm.
Und Rosen hatte nicht vor, dieses Spiel zu verlieren.
Seine Chancen standen nicht einmal schlecht. Sicher, er war verletzt, er wußte nicht, mit wem er es zu tun hatte, und er befand sich in einer Gegend der Stadt, in der er sich überhaupt nicht auskannte. Aber er war zäh. Die Verletzung war zwar schmerzhaft, aber wahrscheinlich nicht tödlich, und er hatte noch nicht einmal angefangen, sich ernsthaft zur Wehr zu setzen.
Der Regen ließ für einen Moment nach; nicht vollkommen, und bestimmt auch nicht auf Dauer. Es war nur ein kurzes Atemholen, dem ein vermutlich noch intensiverer Guß folgen würde – aber für Rosen stellte diese Ruhepause eine neue, noch größere Gefahr dar. So quälend der Eisregen sein mochte, war er bisher doch sein einziger Verbündeter gewesen. Das seidige, leise Rauschen hatte das Geräusch seiner Schritte ebenso zuverlässig verschluckt wie die silbernen Schleier seine Gestalt. Nichts, was weiter als sechs oder sieben Meter entfernt war, war in den niederstürzenden Wassermassen noch zu erkennen. So wenig, wie er seinen Verfolger sehen konnte, konnte dieser ihn im Auge behalten. Und die wenigen Straßenlaternen, die in unregelmäßigen Abständen brannten, machten es eher schlimmer: Statt die Dunkelheit zu vertreiben, verwandelten sie den Regen vollends in einen dicht gewobenen Vorhang aus Quecksilberfäden. Wenn der Regen jetzt nachließ – oder gar ganz aufhörte –, dann war er seinem Verfolger wie auf dem Präsentierteller ausgeliefert.
Rosen nahm all seine Kraft zusammen, um abermals seine Schritte zu beschleunigen. Er wußte, daß es jetzt auf jede Sekunde ankam. Und auch darauf, seine Taktik zu ändern: Er rannte jetzt nicht mehr nur stur geradeaus, sondern in einem geschwungenen Zickzack, mit dem er den Straßenlaternen und ihrem verräterischen Licht auswich, das plötzlich zu einer Gefahr zu werden drohte. Sich auf sein Glück zu verlassen, bedeutete nicht, seinen Verstand auszuschalten oder die grundlegendsten Vorsichtsmaßnahmen zu vergessen.
Seine Schritte erzeugten jetzt, da das Geräusch des Regens nicht mehr jeden anderen Laut übertönte, ein hörbares Platschen in den flachen Pfützen, die die Straße wie Millionen asymmetrischer Spiegelscherben bedeckten. Das Wasser war eisig und drang bei jedem Schritt schmerzhaft in seine Schuhe ein. Für zwei, drei Augenblicke versuchte er, diesen Pfützen auszuweichen, gab es aber praktisch sofort wieder auf; es war lächerlich, sich wie ein Kind zu bewegen, das Hinkelkästchen spielte – und außerdem nicht schnell genug. Der Regen ließ weiter nach. Es war jetzt nicht mehr annähernd so dunkel wie noch vor Augenblicken. Wenn sein Verfolger ihn überhaupt jemals aus den Augen verloren hatte, dann würde er ihn in spätestens fünf bis zehn Sekunden wieder sehen, wenn er auf dieser Straße blieb.
Wenn er wenigstens gewußt hätte, wo er war!
Die Situation kam Rosen mit einem Male vollkommen grotesk vor, wenn auch kein bißchen komisch: Er befand sich in einer der größten Städte des Landes, einer Metropole mit mehreren Millionen Einwohnern, aber die Straßen, über die er sich bewegte, waren nicht nur menschenleer, sondern schienen niemals Leben beherbergt zu haben. Abgesehen von den wenigen noch funktionierenden Straßenlaternen, die aussahen, als stammten sie noch aus dem vergangenen Jahrhundert, brannte nirgendwo Licht. Vor ihm erstreckte sich eine scheinbar endlose, aber auch real sicher noch zwei Kilometer lange Straße, die von heruntergekommenen braunen und grauen Backsteingebäuden flankiert wurde. Es gab sehr viele Mauern ohne Fenster, und sehr wenige Fenster, in denen noch Glas war. Offensichtlich befand er sich in einem aufgegebenen Industriegebiet; einem jener Viertel der Stadt, in denen das Versprechen auf eine neue Freiheit und den damit verbundenen Wohlstand nicht eingelöst worden war.
Hinter ihm polterte etwas. Rosen drehte im Laufen den Kopf und stieß einen leisen, abgehackten Schrei aus, als die plötzliche Bewegung einen rasenden Schmerz durch seine Schulter jagte. Für einen Moment glaubte er eine Bewegung zu erkennen: Ein mächtiges, gleitendes Fließen und Wogen inmitten der Dunkelheit, als verberge sich etwas darin, das noch dunkler war als die vollkommene Schwärze, die die Straße hinter ihm erfüllte.
Im ersten Moment schrieb er diesen Eindruck dem Zustand zu, in dem er sich befand: Er war vollkommen erschöpft, halb verrückt vor Angst und fror wie noch nie zuvor im Leben. Und er hatte eine Menge Blut verloren. Vielleicht begann man zu halluzinieren, wenn man genug Blut verloren hatte.
Dann begriff er, daß es keine Halluzination war. Hinter ihm herrschte tatsächlich vollkommene Dunkelheit.
Und das war unmöglich. Er war noch vor Sekunden dem Licht der Laternen ausgewichen.
Noch während er diesen Gedanken dachte, erlosch eine weitere Laterne hinter ihm. Die Dunkelheit folgte ihm. Vielleicht war sie sein eigentlicher Feind. Nicht das, was sich darin verbarg.
Mit nach hinten gedrehtem Kopf zu rennen, ist nicht besonders vorteilhaft. Rosen kam aus dem Tritt, versuchte mit einer ungeschickt hastigen Bewegung sein Gleichgewicht wiederzufinden und machte es dadurch nur noch schlimmer. Er fiel der Länge nach hin und beging einen zweiten, größeren Fehler, indem er beide Arme nach vorne riß, um dem erwarteten Aufprall die schlimmste Wucht zu nehmen. Seine verletzte Schulter protestierte mit einem wütenden Schmerz gegen die plötzliche Bewegung.
Im nächsten Sekundenbruchteil verlor er fast das Bewußtsein. Der Schmerz war unvorstellbar: Er explodierte zuerst in seinen Handgelenken, raste in schnellen, sich oszillierend aufbauenden Wellen durch seine Arme, riß seine Ellbogengelenke in Stücke und verwandelte seine linke Schulter in einen durchgehenden Nuklearreaktor. Es war so schlimm, daß er nicht einmal mehr schreien konnte.
Mehr durch ein Wunder als durch die Kraft seines Willens gelang es ihm, bei Bewußtsein zu bleiben. Er konnte immer noch nicht schreien, aber erst jetzt registrierte er, daß er auch nicht mehr atmen konnte. Er lag mit dem Gesicht nach unten in einer Pfütze, und sein Mund und seine Nase hatten sich mit brackigem, nach Benzin schmeckendem Wasser gefüllt.
Seine Kraft reichte nicht, sich sofort wieder zu erheben. Würgend stemmte er sich auf die Knie hoch – diesmal war er klug genug, seinen linken Arm nicht zu belasten – spuckte Wasser und Schleim aus und rang verzweifelt nach Luft.
Der Schmerz in seiner Schulter verebbte nur ganz allmählich, und er konnte spüren, daß die Wunde nun sehr viel heftiger blutete. Stöhnend schloß er die Augen, wartete darauf, daß die Dunkelheit hinter seinen Lidern aufhörte, sich wie wild im Kreis zu drehen, und versuchte sich gleichzeitig weiter aufzurichten. Sein Verfolger war noch immer hinter ihm. Wenn er ihn hier erwischte, mitten auf der Straße und in seinem momentanen Zustand, dann war es vorbei. Er hatte nicht einmal mehr die Kraft, sich zu wehren.
Rosen öffnete die Augen, und sein Herz setzte für eine Sekunde aus.
Sein Gesicht spiegelte sich verzerrt und in tausend Streifen zerbrochen in der Pfütze, in der er vor Augenblicken noch fast ertrunken wäre. Darüber hätte der Himmel sichtbar sein müssen.
Aber das war er nicht.
Der Verfolger hatte ihn eingeholt. Er stand unmittelbar hinter ihm. Seine Gestalt ragte als riesiger, grotesk verzerrter Schatten über ihm empor, viel zu groß für den eines Menschen und auf unheimliche Weise verdreht und mißgestaltet, wie etwas, das vielleicht ein Mensch hatte werden wollen, es aber nicht geschafft hatte, sondern in einer früheren, unfertigen Entwicklungsphase steckengeblieben war.
Rosen fuhr mit einem Schrei herum, sprang auf die Füße und stolperte zurück, riß die unverletzte Hand vor das Gesicht und erstarrte zum zweiten Mal innerhalb weniger Sekunden.
Er war allein.
Hinter ihm war niemand.
Die Dunkelheit war ihm weiter gefolgt. Auch die beiden Lampen, an denen er gerade vorbeigelaufen war, waren jetzt erloschen, und er war nun sicherer denn je, daß sich etwas in dieser Finsternis bewegte, etwas Riesiges, Groteskes, das da in der Schwärze stand und ihn anstarrte. Es hätte ihn erledigen können. Er hatte mit Sicherheit zehn oder mehr Sekunden hilflos dagelegen, mehr als genug Zeit für dieses unfaßbare Wesen, ihn einzuholen und zu Ende zu bringen, was es begonnen hatte, aber es stand einfach nur da und starrte ihn an, wie ein schwarzer Dämon, der sich von seiner Furcht nährte.
Rosen begriff plötzlich die neue, vielleicht noch viel größere Gefahr, die er diesmal selbst heraufbeschwor: Indem er den schwarzen Umriß in der Dunkelheit Es nannte, verlieh er ihm eine Macht, die ihm nicht zustand. Es war kein Es, sondern ein Er. Irgendein Mistkerl, der gekommen war, um eine alte Rechnung zu begleichen – oder weil ihn jemand dafür bezahlte. Vielleicht nicht einmal das. Vielleicht war es einfach nur ein Verrückter, und er hatte das Pech gehabt, ihm im falschen Moment über den Weg zu laufen.
Der Schatten bewegte sich. Er machte nicht wirklich einen Schritt, sondern schien auf ihn … zuzugleiten, wie ein körperloser Schemen, der ein winziges Stück über dem Boden schwebte, statt ihn zu berühren, und im gleichen Moment begann auch die Laterne unmittelbar neben Rosen zu erlöschen. Sie ging nicht einfach aus. Ihr Licht wurde blasser. Rosen konnte sehen, wie sich der warme gelbe Schein lautlos zurückzog, als fliehe er vor der Dunkelheit, die im Gefolge der unheimlichen Gestalt kam.
Eingebildet oder nicht, der Anblick war so entsetzlich, daß Rosen mit einem Schrei herumfuhr und davonstürzte.
Seine Schulter reagierte mit einer neuen, wütenden Schmerzattacke auf die plötzliche Bewegung, aber er achtete gar nicht darauf. Hinter ihm kam die Dunkelheit näher, schnell und lautlos, und die Pfützen, an denen er vorbeirannte, waren voller verzerrter schwarzer Schatten.
Trotz der Gefahr, ein zweites Mal zu stürzen, sah er sich noch einmal nach dem unheimlichen Verfolger um. Die Schwärze raste heran, nicht ganz, aber doch fast so schnell wie er, und inmitten dieser Düsternis bewegte sich etwas Riesiges, Formloses, etwas, das eher zu flattern als zu laufen schien, und dessen bloße Anwesenheit Licht und Geräusche in eine Dimension der Dunkelheit verbannte, so als verlören die Gesetze der Welt ihre Gültigkeit dort, wo der Unheimliche entlangglitt.
Rosen begriff, daß er in Gefahr war, erneut zu stolpern, und wandte sich hastig wieder nach vorne. Das Ende der Straße war immer noch unendlich weit entfernt, und auch dahinter lag nichts als weitere Dunkelheit. Das hell erleuchtete, pulsierende Herz der Stadt schien unendlich weit entfernt; Lichtjahre, wie es ihm vorkam. Er hatte keine Chance, es zu erreichen. Und selbst wenn – was, wenn das unheimliche Ding ihm auch dorthin folgte, einfach alles Licht und jedes Leben auslöschte, bis er in einem Universum aus Schwärze und Leblosigkeit gefangen war?
Rosen rief sich in Gedanken ein zweites Mal zur Ordnung, und obwohl er selbst kaum damit gerechnet hatte, gelang es ihm tatsächlich, die Panik noch einmal niederzukämpfen. Seine Lage war auch so schon schlimm genug, ohne daß er seinem Verfolger übernatürliche Kräfte zusprach. Der Schmerz in seiner Schulter war zu einem hämmernden Pochen im Rhythmus seiner Schritte geworden, und der Blutverlust begann nun spürbar an seinen Kräften zu zehren. Selbst wenn er vor Entkräftung nicht einfach zusammenbrach, würde er das Tempo nicht mehr lange durchhalten. Er brauchte ein Versteck. Wenn der Kerl ihn einholte, war er tot. Er war nicht in der Verfassung, sich gegen einen auch nur halbwegs ernst gemeinten Angriff zu verteidigen.
Sein Blick irrte über die Häuser vor ihm. Auf der linken Seite erhoben sich nur gleichförmige, rotbraune Ziegelsteinmauern. Die wenigen Fenster, die er sah, waren vernagelt oder auf andere Weise verschlossen. Der Anblick auf der rechten Seite unterschied sich kaum von dem auf der linken, aber in dreißig oder auch vierzig Meter Entfernung entdeckte er ein rostiges Tor aus Wellblech, das einen Spalt offenstand. Er wußte nicht, was dahinter lag, aber alles war besser als diese unendliche, deckungslose Straße, auf der ihn die Dunkelheit verfolgte.
Rosen mobilisierte noch einmal alle Kraft seines geschundenen Körpers, steuerte eines der Gebäude auf der linken Straßenseite an und änderte seinen Kurs dann abrupt um fast neunzig Grad nach rechts. In einem letzten, verzweifelten Spurt raste er auf das Tor zu. Er wagte es nicht, hinter sich zu blicken – wie er sich selbst einredete aus Angst, möglicherweise gerade dadurch den einen entscheidenden Sekundenbruchteil zu verlieren, der zwischen Tod und Rettung lag, in Wahrheit aber wohl eher, weil er den Anblick der flatternden Dunkelheit nicht mehr ertrug, denn sie weckte eine uralte Furcht in ihm, die alle Barrieren aus Logik und Willenskraft einfach mit sich fortriß.
Er hatte sich getäuscht. Das Tor stand zwar eine Handbreit offen, war aber mit einer massiven Kette und einem Vorhängeschloß von der Größe einer Untertasse gesichert. Er rannte trotzdem weiter, so schnell er konnte, spielte eine halbe Sekunde lang mit dem Gedanken, über das Tor hinwegzuklettern und entschied sich dann dagegen. Mit seiner verletzten Schulter hatte er keine Chance, dieses Kunststück zu schaffen, ganz abgesehen davon, daß ihm vermutlich nicht einmal genug Zeit dafür blieb. Die Dunkelheit war hinter ihm. Nah. So entsetzlich nah.
Rosen setzte alles auf eine Karte, drehte sich im letzten Moment zur Seite und rammte die unverletzte Schulter mit der ganzen Kraft seines Anlaufs gegen das Tor.
Die linke Hälfte seines Körpers explodierte einfach. Der Schmerz war nicht einmal so furchtbar, wie er erwartet hatte, aber er spürte, wie nunmehr auch noch der letzte Rest von Kraft aus seiner Schulter und dem Arm wich. Das Tor dröhnte wie ein riesiger, falsch gestimmter Gong. Rosen wurde zurückgeschleudert und fand nur durch Glück sein Gleichgewicht wieder, und ein winziger, verbliebener Rest seines Selbsterhaltungstriebes ließ ihn noch einmal nach vorne und auf das Tor zutaumeln.
Sowohl die Kette als auch das Schloß hatten dem Anprall standgehalten, aber die schiere Wucht des Stoßes hatte das morsche Tor halb aus den Angeln gerissen. Der Spalt zwischen den beiden Hälften war deutlich breiter geworden. Vielleicht breit genug, um sich hindurchzuquetschen.
Das Ergebnis entsprach ganz seinen Erwartungen. Seine Schulter verwandelte sich in reinen Schmerz. Das rostige Metall zerriß seine Kleidung und fügte ihm eine Anzahl neuer, tiefer Schnitt- und Schürfwunden zu, und sein Arm und die linke Hüfte weigerten sich jetzt einfach, seinen Befehlen weiter zu gehorchen. Verzweifelt griff er mit der rechten Hand zu, stemmte den Fuß gegen den Boden und schob und zerrte zugleich mit aller Kraft. Rostiges Eisen biß wie mit glühenden Zähnen in seine Schulter. Er brüllte vor Schmerz. Er konnte kaum noch sehen. Alles war rot und schwarz, und der Geschmack in seinem Mund war eine Mischung aus Erbrochenem und Blut. Trotzdem kämpfte er mit der absoluten Kraft schierer Todesangst weiter.
Mit einem Ruck kam er frei. Fetzen seiner Kleidung blieben an den beiden Torhälften zurück, und diesmal versuchte er erst gar nicht, seinen Sturz aufzufangen, drehte sich aber instinktiv auf die rechte Seite, so daß er zwar erneut gequält aufschrie, wenigstens aber nicht wieder an den Rand einer Bewußtlosigkeit schlitterte. Wimmernd stemmte er sich auf eine Hand und beide Knie hoch, schrie abermals, als sich eine Glasscherbe tief in seine Handfläche bohrte und kroch ein paar Schritte vom Tor fort.
Keine Sekunde zu früh.
Das Licht auf der anderen Seite des Tores erlosch. Etwas traf die beiden Flügel aus verrostetem Wellblech und schleuderte sie davon wie zerfetztes Papier, und etwas Riesiges, Schwarzes raste durch die gewaltsam geschaffene Öffnung herein, streifte Rosen beinahe flüchtig und schmetterte ihn erneut zu Boden. Er hatte einen blitzartigen Eindruck von gigantischen Schwingen aus geronnener Dunkelheit und Klauen aus rasiermesserscharfem Stahl. Dann knallte er mit dem Hinterkopf so wuchtig gegen den Boden, daß er nun tatsächlich das Bewußtsein verlor.
Wenn auch wahrscheinlich nur für eine oder zwei Sekunden.
Als er die Augen wieder öffnete, stand der Gigant über ihm.
Es war kein Mensch.
Es war zu groß. Seine Schultern waren zu breit. Sie hörten nicht dort auf, wo sie es sollten. Sie wuchsen weiter zu einem Paar gigantischer, schwarzer Flügel aus gehämmertem Stahl. Seine Hände waren grauenerregende gebogene Klauen mit zu vielen Fingern. Und wo das Gesicht sein sollte, war nur wogende Schwärze. Es war das Ding, das er in der Pfütze gesehen hatte.
Kein Er.
Es.
Rosen wimmerte vor Angst und kroch rücklings von der furchtbaren Erscheinung weg.
Zu langsam.
Der schwarze Koloß folgte ihm, lautlos, ein Stück der Nacht, das zu gräßlichem Leben erwacht war. Eine der furchtbaren Krallen hob sich.
Zu leicht, wisperte eine lautlose Stimme hinter seiner Stirn. Nicht genug.
Die Klaue senkte sich wieder. Der schwarze Engel zog sich auf die gleiche, lautlose Weise wieder zurück, auf die er herangekommen war.
Er schlug erst zu, als sich Rosen in die Höhe stemmte und davonlaufen wollte.
Seine Kralle traf Rosens Rücken und riß ihn von den Schulterblättern bis zur Hüfte hinab auf.
Rosen kreischte in schierer Agonie, torkelte hilflos zwei Schritte nach vorne und prallte gegen etwas Hartes, etwas mit Spitzen und scharfen, reißenden Kanten. Er fiel, sprang wieder hoch und taumelte weiter. Sein Rücken war eine einzige, blutende Wunde. Er konnte die Quellen der einzelnen Schmerzen nicht mehr lokalisieren. Er hatte auch nicht mehr die Kraft zu schreien, sondern brachte nur noch eine Mischung aus Wimmern und Schluchzen zustande, während er haltlos weitertaumelte. Der schwarze Engel war hinter ihm, riesig, kalt, tödlich. Er konnte regelrecht spüren, wie sich die mörderischen Klauen zu einem weiteren, vielleicht dem letzten Hieb hoben.
Nicht genug.
Der Hieb hätte seinen Schädel zertrümmern können, aber er streifte seinen Hinterkopf nur. Trotzdem riß er Rosens Skalp bis auf den Knochen auf, zerfetzte seinen Nacken und ritzte die Halsarterie an der rechten Seite. Nicht tief genug, um ihn auf der Stelle zu töten, zu leicht, aber weit genug, um einen neuen Ausgang zu erschaffen, aus dem das Leben warm und klebrig aus ihm herausströmte.
Er fiel nicht, sondern taumelte blind weiter. Trotz allem registrierte er, daß er sich auf einer Art Schrottplatz zu befinden schien, vielleicht auch nur auf einem mit Unrat und Schrott übersäten Fabrikhof. Auf dem Boden schimmerten Glasscherben und scharfkantiges Metall. Links von ihm war etwas Großes, Glänzendes, vielleicht eine Wand aus Glas, vielleicht auch ein Block aus massivem Metall. Der Todesengel war noch immer hinter ihm. Gigantische Schwingen wie geschliffener Stahl durchschnitten die Luft zu leicht und berührten fast sanft seine Oberschenkel zu leicht und öffneten sein Fleisch zu einem weiteren Paar blutiger Lippen.
Rosen schrie. In seinen Beinen war jetzt keine Kraft mehr. Nirgends in seinem Körper war noch Platz für irgendein anderes Gefühl als Pein oder Angst.
Er fiel, prallte gegen etwas Hartes und zugleich Nachgiebiges und krallte sich instinktiv fest. Dünne, rote Linien aus Schmerz schnitten in seine Hände zu leicht, und nur ein kleiner Teil von ihm war noch klar genug und zu logischem Denken fähig. Dieser winzige Teil jedoch empfand nichts anderes als Erstaunen. Er hätte nicht mehr am Leben sein dürfen. Jede einzelne der grauenhaften Verletzungen, die ihm der schwarze Titan zugefügt hatte, hätte ihn töten müssen. Und wenn schon nicht das, so doch der Blutverlust. Der Schrottplatz schwamm in einem Meer aus dampfendem Rot. Trotzdem lebte er noch, vielleicht nur, weil er in diesem Moment dem Tod so nahe war wie niemals zuvor, und weil er plötzlich mit unerschütterlicher Sicherheit wußte, was auf der anderen Seite auf ihn wartete. Der Tod war keine Erlösung. Er war nur das Tor in eine andere, unvorstellbare Welt, ein Universum voller endloser Qual und immerwährender Furcht.
Zu leicht.
Der nächste Hieb traf ihn nicht mit der reißenden Kante, sondern mit der ganzen Breite der eisernen Schwinge. Rosen wurde mit furchtbarer Gewalt in die Höhe und nach vorne geschleudert, spürte, wie mindestens sechs oder sieben Rückenwirbel splitterten und seine Hüfte brach und fühlte zugleich ein geometrisches Muster aus neuem, blendendweißem Schmerz auf Gesicht und Händen. Er schrie, schluckte sein eigenes Blut und erstickte beinahe daran. Trotzdem begriff er, daß er gegen einen Maschendrahtzaun geschleudert worden war, einen Zaun aus glühendem, rasiermesserscharfem Draht, der sein Gesicht und seine Hände zerfetzte und dem Wort unerträglich eine neue, nie gekannte Dimension verlieh.
Seine Muskeln versagten ihm endgültig den Dienst. Hilflos sackte er am Zaun entlang zu Boden, klammerte sich mit blutigen, verheerten Fingern in den reißenden Stahl und war nicht mehr in der Lage, seinen Griff wieder zu lösen. Sein Körper wurde mit einem so brutalen Ruck herumgerissen, daß er sich die Schulter auskugelte, aber er hatte nicht mehr die Kraft für mehr als ein gequältes Wimmern. Es spielte zu leicht keine Rolle mehr.
Der Dunkle Engel stand über ihm. Seine eisernen Klauen glitzerten.
Zu leicht.
Diesmal zielte er auf Rosens Augen.
Kapitel 2
Es war noch immer das Haus der Pein. Der Mann, der diesen Namen ersonnen hatte, lebte schon lange nicht mehr, genau wie die meisten anderen, die in diesen Mauern gearbeitet und gelitten hatten, und obwohl er diese Bezeichnung nur für sich allein gewählt und mit keinem anderen Menschen darüber geredet hatte, war dieser Name irgendwie geblieben; als hätte er in den uralten Mauern Substanz gewonnen, die sich hinter weißer Tünche und modernem Kunststoff verbargen. Vielleicht war es aber auch genau anders herum: Vielleicht war dieses ganze Gebäude nur entstanden, um seinem Namen einen Körper zu verleihen.
Für Bremer jedenfalls war es so.
Er verknüpfte mit diesem Gebäude – vor allem mit dem, was darin geschehen war – nichts anderes als unangenehme Erinnerungen. Er hatte sich, lange nachdem alles vorbei war, über dieses Haus erkundigt und herausgefunden, daß seine Geschichte über Jahrhunderte hinweg tatsächlich eine Geschichte des Leides und der Pein gewesen war. Die Mauern des ehemaligen Klosters hatten mehr Schreie der Verzweiflung gehört und Tränen des Kummers gesehen als jedes andere von Menschenhand geschaffene Gebäude dieser Stadt, und in seinen Katakomben und Gewölben war mehr Blut vergossen worden als auf so manchem Schlachtfeld. Nichts von alledem war in böser Absicht geschehen. Die Menschen, die in diesem Gebäude gelebt und gewirkt hatten, hatten stets in bestem Willen gehandelt, und doch schien es, als ob dieser Ort alles verdrehte, Licht zu Dunkelheit und Gutes zu Schlechtem werden ließ. Es war ein böser Ort.
Und Bremer war hier geboren.
Zum zweiten Mal, um genau zu sein. Der Tag seiner ersten Geburt lag mittlerweile gute fünfzig Jahre zurück, aber sein zweites, neues Leben hatte hier begonnen, nicht nur in diesem Gebäude, sondern tatsächlich in dem Zimmer, in dem er sich jetzt befand, möglicherweise sogar auf der lederbezogenen Liege, auf der er lag. Er hatte nie danach gefragt. Als sie ihn hereingebracht hatten, war er tot gewesen. Als er die Klinik drei Monate später wieder verließ, da …
»Sie können sich jetzt wieder anziehen, Herr Bremer.« Dr. Mecklenburgs Stimme riß Bremer in die beruhigende Wirklichkeit des Untersuchungszimmers zurück. Er brauchte eine halbe Sekunde, um zu begreifen, daß die Worte ihm galten, und die zweite Hälfte, um ihren Sinn zu erfassen und darauf zu reagieren. Dann hob er – entschieden zu hastig – die Hände, fummelte die vier oberen Knöpfe seines Hemdes zu und stopfte den Rest unordentlich in die Hose, während er bereits den Gürtel schloß und von der Kante der Ledercouch glitt; alles in einer einzigen, kompliziert ineinander übergehenden Bewegung.
Mecklenburg schüttelte den Kopf. »Zirkusreif«, sagte er spöttisch. »Irre ich mich, oder haben Sie es ziemlich eilig, von hier zu verschwinden?«
Und ob, dachte Bremer. Ich hätte gar nicht erst kommen sollen. Laut sagte er: »Nein. Ich hasse es nur, Zeit zu verschwenden.«
»Ein Besuch bei einem Arzt ist niemals Zeitverschwendung«, belehrte ihn Mecklenburg – allerdings nur, um praktisch in der gleichen Sekunde schon den Kopf zu schütteln und seine eigene Behauptung zu relativieren: »Obwohl ich gestehen muß, daß das in Ihrem Fall vielleicht nicht ganz zutrifft. Für einen Mann Ihres Alters sind Sie in einer geradezu unverschämt guten Verfassung. Hat man Ihnen das eigentlich schon einmal gesagt?«
»Mehrmals.« Bremer griff nach seiner Jacke. »Es gibt da einen gewissen Arzt, der es mir alle drei Monate wieder versichert.« Er seufzte. »Im Ernst: Wie lange wollen wir dieses Theater noch treiben? Wir verschwenden nicht nur meine Zeit, sondern auch Ihre. Haben Sie nichts Besseres zu tun, als einen vollkommen gesunden Mann zu untersuchen?«
»Kein Arzt auf der Welt hat etwas Besseres zu tun, als einen Urenkel von Lazarus zu untersuchen und sein Geheimnis zu ergründen«, antwortete Mecklenburg. »Ich bekomme den Nobelpreis, wenn ich erklären kann, wieso Sie noch leben. Glauben Sie etwa, diese Chance lasse ich mir entgehen?« Er grinste, lehnte sich nachlässig gegen die Schreibtischkante und sah mit beinahe wissenschaftlichem Interesse zu, wie Bremer seinen üblichen Kampf mit dem Krawattenknoten aufnahm und wie gewohnt verlor.
»Was machen die Alpträume?« fragte er nach einer Weile.
Bremer zog eine Grimasse und riß den Schlips mit einem Ruck herunter, um ihn in die Jackentasche zu stopfen, verlor endgültig die Geduld und warf ihn auf die Liege hinter sich. »Danke der Nachfrage«, sagte er. »Sie entwickeln sich prächtig.«
Mecklenburg grinste weiter, aber das spöttische Funkeln in seinen Augen war nicht mehr da. »Sie sollten vielleicht doch mit meinem Kollegen reden«, sagte er. »Ich kann ihn anrufen. Es macht keine Mühe. Ich vereinbare gerne einen Termin für Sie.«
»Wenn ich einen Gehirnklempner brauche, sage ich Ihnen Bescheid«, antwortete Bremer. Die Worte klangen sogar in seinen eigenen Ohren schärfer, als sie es sollten. Einen Sekundenbruchteil lang überlegte er, sie mit einer entsprechenden Bemerkung ein wenig zu mildern, tat es aber dann doch nicht. Sie hatten dieses Gespräch schon so oft geführt, daß selbst Mecklenburg mit seiner berufsmäßigen Sturheit eigentlich begriffen haben sollte, daß er nicht mit einem Psychologen reden wollte. Er hatte Alpträume – und? Nach dem, was er durchgemacht hatte, hatte er jedes verdammte Recht dazu!
Mecklenburg sah ihn eine Sekunde lang enttäuscht an, dann zuckte er mit den Schultern und schwang sich mit einer übertrieben heftigen Bewegung von der Schreibtischkante. »Ganz wie Sie meinen«, sagte er. »Sollten Sie es sich anders überlegen, meine Nummer haben Sie ja. Wir sehen uns dann in drei Monaten.«
Soviel zu der Frage, wie lange diese Zeitverschwendung noch andauern sollte. Bremer sparte sich die Energie, noch einmal darauf einzugehen, sondern verabschiedete sich mit einem knappen Nicken von Mecklenburg und verließ den Untersuchungsraum. Nach zwei Schritten blieb er wieder stehen, versenkte die rechte Hand in die Tasche und machte ein ärgerliches Gesicht, noch bevor er sie leer wieder herauszog. Er hatte seine Krawatte auf der Liege vergessen. Nicht, daß ihm viel daran lag. Bremer haßte Krawatten. Aber sie gehörte nun einmal dazu, und das Ding hatte fast hundert Mark gekostet; für das Gehalt eines kleinen Polizeibeamten entschieden zu viel, um mit reinem Achselzucken darauf zu verzichten. Resignierend drehte er sich um und ging noch einmal zurück.
Er trat ein, ohne anzuklopfen. Mecklenburg hatte seinen Platz auf der Tischkante aufgegeben und saß hinter seinem Schreibtisch und telefonierte. Als Bremer eintrat, ließ er den Hörer erschrocken sinken und deckte die Muschel automatisch mit der linken Hand ab. Der Ausdruck auf seinem Gesicht war fast entsetzt.
Bremer zuckte die Achseln, kniff die Lippen zur Karikatur eines entschuldigenden Lächelns zusammen und deutete auf den zusammengeknüllten Schlips, der auf der Couch lag. In der ersten Sekunde begriff Mecklenburg sichtlich gar nicht, was er meinte, dann nickte er auffordernd, und Bremer durchquerte mit schnellen Schritten das Zimmer, raffte die Krawatte an sich und stopfte sie unordentlich in die Tasche. Ohne ein weiteres Wort wandte er sich wieder um und ging. Im Vorbeigehen streifte sein Blick die Akte, die vor dem Arzt auf dem Tisch lag. Sie war zugeklappt, aber Bremer konnte seinen eigenen Namen deutlich auf dem Deckblatt lesen. Nein, Mecklenburg hatte ganz eindeutig nicht vor, ihn in absehbarer Zeit aus seiner Patientenkartei zu streichen.
Wie üblich, durchquerte er den kurzen Gang und die dahinter liegende große Halle mit so schnellen Schritten, daß er gerannt wäre, hätte er sein Tempo auch nur noch um eine Winzigkeit gesteigert. Die kühle Sachlichkeit des Behandlungszimmers hatte ihm für einen kurzen Moment Schutz geboten, einen Halt, an den er sich klammem konnte, um nicht wieder in den bodenlosen Abgrund zu stürzen, der sich hinter der Fassade aus scheinbarer Normalität und dezentem Luxus verbarg, mit dem die Privatklinik ihre Besucher empfing. Aber dieser Schutz würde nicht ewig halten. Nicht einmal besonders lange. Obwohl er wahrscheinlich besser als jeder andere wußte, daß von diesem Gebäude keine Gefahr mehr ausging, waren die Gespenster der Vergangenheit hier noch höchst lebendig.
Und das vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes.
Hinter dem an einen Hoteltresen erinnernden Empfang hielten sich im Moment drei junge Frauen auf. Wie der größte Teil des Personals hier trugen sie keine Kittel oder irgendeine andere Art von Krankenhausuniform, sondern schmucke Kostüme, die entweder eine Menge über ihre Gehälter verrieten, oder vermuten ließen, daß die Klinik ihrem Personal ein großzügiges Kleidergeld zahlte, und selbstverständlich waren alle drei jung und äußerst attraktiv; Bremer war sicher, daß das Personal hier mindestens ebenso nach seinem Aussehen wie nach seinen fachlichen Qualifikationen ausgesucht wurde.
Eine der drei jungen Frauen kannte er.
Sie hatte sich das Haar gefärbt und zu einem modischen Kurzhaarschnitt frisieren lassen, und sie war ein wenig älter geworden – nein, nicht älter: erwachsener. Bremer erkannte sie trotzdem sofort und ohne den leisesten Zweifel wieder. Es war nicht nur eine zufällige Ähnlichkeit. Die junge Frau …
… hob in diesem Moment den Kopf und sah so direkt in seine Richtung, als hätte sie seinen Blick gespürt oder seine Gedanken gelesen, und für den zeitlosen Augenblick eines Gedankens sah sie ihm direkt in die Augen. Aus Ähnlichkeit wurde Identität, begleitet von einem Gefühl ungläubigen Entsetzens, denn das, was er sah, war vollkommen unmöglich. Dann blinzelte er, und die Vision zerplatzte; er blickte in ein immer noch attraktives, aber vollkommen fremdes Gesicht.
Jemand rempelte ihn an. Bremer machte einen hastigen Schritt zur Seite, holte Luft zu einer ärgerlichen Bemerkung und machte sich gerade noch im letzten Moment klar, daß es seine Schuld gewesen war. Schließlich hatte er mitten in seinem Sturmschritt angehalten. Statt also eine seiner gefürchteten sarkastischen Bemerkungen anzubringen, murmelte er ganz im Gegenteil eine Entschuldigung und ging weiter, ohne sich auch nur umzudrehen. Einen Augenblick später verließ er die Klinik und rannte beinahe die Treppe hinunter.
Es regnete immer noch leicht, so daß er einen Vorwand hatte, die hundert Meter zum Parkplatz nun endgültig im Laufschritt zurückzulegen. Der Regen war nicht sehr heftig, aber eiskalt; zu kalt für die Jahreszeit. Seine Finger waren klamm und zitterten, als er den Schlüssel aus der Tasche zog; er brauchte Sekunden, um ihn ins Schloß zu fummeln, und noch einmal endlos, um die Tür aufzubekommen und sich hinter das Lenkrad fallen zu lassen.
Wenigstens redete er sich ein, daß es die Kälte war, die seine Hände zittern ließ.
Er hatte sich dieses Déjà-vu nicht nur eingebildet. Was andererseits natürlich nicht stimmte. Die junge Frau, deren Gesicht er zu sehen geglaubt hatte, war vor fünf Jahren gestorben, und im Gegensatz zu ihm war sie nicht von den Toten wieder auferstanden. Es war eine Halluzination gewesen, ein böser Streich, den ihm sein Unterbewußtsein gespielt hatte, mehr nicht. Mehr nicht. Aber sie war so unglaublich realistisch gewesen.
So, wie Halluzinationen nun einmal waren?
Bremer schenkte seinem eigenen Konterfei im Innenspiegel ein schiefes Grinsen. Sein Gesicht war naß und sehr bleich. Natürlich war es eine Halluzination, ausgelöst durch die Klinik und die größtenteils unangenehmen Erinnerungen, die er mit diesem Ort verband. Was ihn erschreckte, das war auch gar nicht der Zwischenfall selbst. Vielmehr die Intensität, mit der er darauf reagiert hatte.
Er schüttelte den Kopf, zog mit der linken Hand die Tür zu und schob mit der anderen den Zündschlüssel ins Schloß. Der Motor sprang wie üblich erst beim dritten oder vierten Versuch an, aber diesmal gestattete Bremer es sich ganz bewußt, sich darüber zu ärgern. Der Wagen war kein Jahr alt, aber sobald der Wetterbericht auch nur Regen ankündigte, hatte er Startschwierigkeiten. Er war mit dieser verdammten Karre schon ein halbes Dutzend Mal in der Werkstatt gewesen, ohne daß sie den Fehler gefunden hatten. Nicht zum ersten Mal fragte er sich, warum er sich diese Unverschämtheit eigentlich gefallen ließ.
Der Trick mit der Ablenkung funktionierte. Als der Motor schließlich ansprang und stotternd auf Touren kam, ärgerte er sich zwar immer noch, aber die irrationale Furcht, die sich für einen Moment in seinen Gedanken ausgebreitet hatte, war wie fortgeblasen. Es lag einzig und allein an diesem verdammten Monstrum von Haus, in dem es zwar so wenig spukte wie in irgendeinem anderen Gebäude auf der Welt, mit dem er aber zu viele unangenehme Erinnerungen verband. So simpel war die Erklärung.
Bremer balancierte vorsichtig mit Kupplung und Gaspedal, damit der Motor nicht sofort wieder ausging – er wußte aus leidvoller Erfahrung, daß er danach für mindestens zwanzig Minuten gar nicht mehr anspringen würde – und nahm sich zum ungefähr zwanzigsten Mal vor, bei der nächsten Gelegenheit in die Werkstatt zu fahren und diesmal Tacheles mit den Burschen zu reden. »Die tun was«, knurrte er. »Freunde, ihr werdet euch wundern, was ich tue, wenn ihr diesen Schrotthaufen nicht bald hinkriegt!«
Der Motor stotterte zur Antwort und lief ein wenig ruhiger, wenn auch noch immer nicht so rund, daß Bremer es wagte, schon loszufahren. Mit einem ärgerlichen Kopfschütteln ließ er sich im Fahrersitz zurücksinken. Auf ein paar Augenblicke mehr oder weniger kam es jetzt auch nicht mehr an. Ganz im Gegenteil – vielleicht sollte er die wasserscheue Elektronik als seine Verbündete betrachten, statt sich über sie zu ärgern. Im Büro wartete nur ein Schreibtisch voller langweiliger Arbeit auf ihn. Manchmal fragte er sich, warum er sich um alles in der Welt das eigentlich noch antat. Nötig hatte er es weiß Gott nicht.
Sein Blick fiel auf das Display des Handys, das sich automatisch eingeschaltet hatte, als er den Schlüssel herumdrehte. Das Gerät zeigte die Kleinigkeit von zehn Anrufen in Abwesenheit auf – vermutlich mehr; so viel Bremer wußte, war zehn die maximale Anzahl von Nummern, die der Apparat speichern konnte. Bremer zerbrach sich ein paar Sekunden lang vergeblich den Kopf, welche Tasten er nun in welcher Reihenfolge drücken mußte, um die Nummern der Anrufer auf dem Display erscheinen zu lassen, und gab es dann auf. Der Verkäufer, der ihm das Ding aufgeschwatzt hatte, hatte ihm versichert, daß die Bedienung kinderleicht wäre. Er hatte beim Einbau nur vergessen, das passende Kind mitzuliefern.
Die Anzeige im Display erlosch und machte dem Wort Anruf Platz, eine halbe Sekunde, bevor das Ding klingelte. Bremer drückte die Sprechtaste und sagte: »Ja?«
»Bremer?« Nördlingers Stimme war verzerrt und so laut, daß Bremer hastig nach dem Lautstärkeregler griff und ihn herunterdrehte.
»Ja«, antwortete er. »Oder wer sonst sollte sich unter meiner Nummer melden?« Aus irgendeinem Grund hatte er stets Hemmungen, sich am Autotelefon mit seinem Namen zu melden; eine kleine Marotte, die Nördlinger eigentlich akzeptieren sollte.
Er tat es nicht. »Dann melden Sie sich gefälligst mit Ihrem Namen«, knurrte er. »Ich versuche seit einer Stunde, Sie zu erreichen. Wo zum Teufel waren Sie?«
»Beim Arzt«, antwortete Bremer. Er schluckte alles, was ihm sonst noch auf der Zunge lag, herunter. Es war eine Menge. Nördlinger konnte ihn weder leiden, noch machte er einen Hehl daraus, und er würde den Teufel tun und dem Kerl auch noch Munition liefern. »Die übliche Routineuntersuchung.«
»Mit dem üblichen Ergebnis, nehme ich an«, sagte Nördlinger. »Dann fühlen Sie sich doch jetzt bestimmt in der Lage, Ihre Arbeit wiederaufzunehmen. Fahren Sie zur Baldowstraße. Sie sehen dann schon, wo. Und wenn Sie das nächstemal zum Arzt oder sonstwohin gehen, dann nehmen Sie Ihr Handy gefälligst mit. Deswegen heißen die Dinger Handys. Weil man sie in die Hand nehmen kann. Nicht, damit man sie im Wagen liegen läßt.«
»In der Klinik sind sie verboten, soviel ich weiß«, antwortete Bremer. »Baldowstraße, sagten Sie?« Er versuchte sich zu erinnern, wo die Baldowstraße lag. Er war nicht ganz sicher, glaubte aber, daß es irgendwo im Ostteil war. Ganz eindeutig nicht ihr Revier.
»Soll ich Ihnen einen Stadtplan faxen?« fauchte Nördlinger. »Es geht um einen alten Freund von Ihnen. Sie werden schon sehen. Und jetzt beeilen Sie sich bitte. Die Kollegen warten schon.«
Bremer schaltete ab, ohne sich mit irgendeiner Höflichkeitsfloskel aufzuhalten, schnitt dem Handy eine Grimasse und schaltete gleichzeitig Licht und Scheibenwischer ein. Der Motor lief jetzt sauber und rund. Er konnte es wagen, loszufahren.
Als er den Mondeo vom Parkplatz lenkte, glitt ein Schatten wie von etwas Riesigem, Geflügeltem über den regennassen Asphalt.
Bremer weigerte sich, hinzusehen.
Er fädelte den Wagen in den fließenden Verkehr ein, fuhr mit zu schnellen achtzig Stundenkilometern stadteinwärts und lenkte sich mit der Frage ab, welchen Sonderauftrag Nördlinger heute wieder für ihn haben mochte. Kriminalrat Nördlinger war äußerst einfallsreich darin, unangenehme Beschäftigungen für diejenigen seiner Mitarbeiter zu finden, die er nicht leiden konnte; eine illustre Auswahl, auf deren Liste der Name Bremer zweifellos ganz oben stand. Seit Nördlinger seinen Dienst angetreten hatte (großer Gott, war das wirklich erst ein Jahr her? Bremer kam es vor wie zehn) hatte er keinen Zweifel daran aufkommen lassen, daß er erst zufrieden sein würde, wenn Bremer die großzügige Vorruhestandsvereinbarung annahm, die man ihm angeboten hatte – oder einen Fehler beging, der es ihm ermöglichte, ihn zu feuern. Beides war nicht sehr wahrscheinlich. Bremer fühlte sich mit noch nicht einmal fünfzig Jahren entschieden zu jung, um in Rente zu gehen und den Rest seiner Tage mit Zeitunglesen und der Pflege seiner Kakteenzucht zu fristen, und er war in seinem Job einfach zu gut, als daß ihm ein Fehler unterlaufen würde, der schwerwiegend genug war, ihm das Genick zu brechen.
Außerdem war es ein unfairer Kampf. Nördlinger war trotz allem ein sehr fähiger Mann – wäre er das nicht, dann säße er schon lange nicht mehr auf dem Stuhl, auf dem er saß –, aber er war auch ein Mann mit einem unerschütterlichen Glauben an Autorität und Regeln. Bremer hingegen war bis zu einer gewissen – sehr hoch angesetzten – Grenze Persona non grata, und als solcher mußte er einem Mann wie Nördlinger ein Dorn im Auge sein. Es war nicht etwa so, daß Bremer die Tatsache, praktisch unangreifbar zu sein, jemals ausgenutzt hätte. Aber die bloße Möglichkeit, daß er es konnte, war wohl schon mehr, als Nördlinger ertrug.
Er brauchte sehr viel länger als die veranschlagte halbe Stunde, um sein Fahrtziel zu erreichen. Trotz der noch frühen Stunde erstickte die Innenstadt schon fast im Verkehr. Das Gebiet rings um das neue Regierungsviertel war eine einzige Baustelle, und das würde sie Bremers Meinung nach auch noch mindestens fünf oder sechs Jahre lang bleiben, allen vollmundigen Versprechungen der Politiker zum Trotz. Erst, als er in den Ostteil (den alten Ostteil, verbesserte er sich in Gedanken. Daran würde er sich wohl nie gewöhnen) kam, wurde es ein wenig besser. Um das Maß vollzumachen, verfuhr er sich auf dem letzten Stück auch noch, so daß er nach dem Weg fragen mußte und es beinahe elf war, ehe er den Wagen – nachdem er den dritten Passanten nach dem Weg gefragt hatte – endlich um die letzte Biegung lenkte und sah, was Nördlinger gemeint hatte. Das Handy hatte in dieser Zeit dreimal geklingelt und hätte es wohl noch öfter getan, hätte er es nicht irgendwann kurzerhand ausgeschaltet. Ein Hoch auf die Technik.
Die Straße war heruntergekommen und mußte früher, noch zu DDR-Zeiten, so etwas wie ein bescheidenes Industriegebiet gewesen sein. Jetzt standen die meisten Gebäude leer und waren dem Verfall anheim gegeben. An einem normalen Tag traf man hier zusammengenommen vermutlich nicht einmal ein Dutzend Menschen.
Jetzt sah Bremer auf Anhieb gut die doppelte Anzahl von Autos; die – obligate – Menge von Neugierigen versuchte er erst gar nicht zu schätzen. Er hatte es schon vor Jahren aufgegeben, sich über Gaffer zu ärgern, die prinzipiell aus dem Nichts aufzutauchen pflegten und immer neue und erstaunlichere Ideen entwickelten, um Polizei, Feuerwehr und Notärzte an ihrer Arbeit zu hindern.
Er lenkte den Ford in scharfem Tempo auf die Menschenansammlung am Ende der Straße zu, brachte ihn im buchstäblich letzten Moment mit quietschenden Bremsen zum Stehen und quittierte die zornigen Blicke, die ihn trafen, mit einem schadenfrohen Grinsen. Ein weiterer Minuspunkt in seiner Personalakte, falls sich jemand seine Nummer merkte und ihn meldete. Es war ihm gleich. Mit etwas mehr als der notwendigen sanften Gewalt bahnte er sich einen Weg durch den Auflauf. Er kassierte und verteilte eine Anzahl derber Rippenstöße, Tritte gegen die Waden und auf die Zehen, aber der Saldo fiel eindeutig zu seinen Gunsten aus.
Der Grund des Menschenauflaufs befand sich nahezu am Ende der Straße und bestand aus zwei quer gestellten Streifenwagen und einem RTW der Berufsfeuerwehr. Dahinter erhob sich ein rostzerfressenes Wellblechtor, das ganz so aussah, als würde es nur noch von guten Wünschen und verkrustetem Staub vor dem Umfallen bewahrt. Ein leicht genervt wirkender Streifenpolizist hielt davor Wache, ließ ihn aber problemlos passieren, noch bevor er seinen Dienstausweis zücken mußte. Entweder kannte der Mann ihn, oder Nördlinger hatte sein Kommen ausführlich genug angekündigt. Bremer quetschte sich durch den schmalen Spalt zwischen den beiden Torflügeln. Beiläufig registrierte er das eingetrocknete Blut, das an dem Metall klebte.
Dahinter lag etwas, das Bremer auf den ersten Blick an eine Mischung aus einem Schrottplatz und einem aufgegebenen Fabrikhof erinnerte: Zerlegte Maschinen, Kisten, Metallschrott, halb ausgeschlachtete Autowracks, zerbrochenes Mobiliar und ganz ordinärer Müll bildeten ein einziges, ausuferndes Chaos. Ein halbes Dutzend Beamter stand tatenlos herum, und ein weiteres halbes Dutzend war mit Dingen beschäftigt, deren Sinn sich nur dem Eingeweihten offenbarte. Bremer wußte sofort, daß er sich am Schauplatz eines Verbrechens befand. Die Kollegen von der Spurensicherung waren damit beschäftigt, jeden rostigen Nagel zu katalogisieren und jeden Stein umzudrehen. Der Hof wurde an drei Seiten von schäbigen Gebäuden mit vernagelten Fenstern und Türen flankiert, nur direkt gegenüber des Tores gab es einen engen, mit einem Maschendraht verschlossenen Durchgang. Unmittelbar davor lag ein schmaler, mit einer schwarzen Plastikplane zugedeckter Körper. Ein Toter. Nördlinger hätte ihn nicht herbestellt, wenn es kein Toter wäre.
Bremer stockte zum ersten Mal, seit er aus dem Wagen gestiegen war, für einen kurzen Moment im Schritt, als er Nördlinger sah. Das war wirklich ungewöhnlich. Kriminalrat Nördlinger besuchte niemals einen Tatort, es sei denn in Begleitung eines Staatsanwalts oder eines Fernsehteams. Von beidem war weit und breit nichts zu sehen.
»Das hat lange gedauert«, sagte Nördlinger, ohne sich mit einer Begrüßung aufzuhalten. »Hatten Sie Mühe, die Adresse zu finden?«
Bremer verzog die Lippen zu etwas, das Nördlinger für ein Grinsen halten konnte, wenn ihm danach war, und zündete sich eine Zigarette an. Er hatte gar keine Lust auf eine Zigarette, aber Nördlinger war der militanteste Nichtraucher, der ihm jemals begegnet war, und das allein war Grund genug. »Was ist passiert?«
Nördlinger maß die Zigarette zwischen seinen Lippen mit einem angeekelten Blick, dann deutete er ein Achselzucken an und ließ die Bewegung in ein auf den zugedeckten Leichnam deutendes Nicken übergehen. Bremer trat an ihm vorbei, ging in die Hocke und streckte die Hand nach der Plastikfolie aus, und Nördlinger sagte: »Ich hoffe doch, Sie haben nicht zu ausgiebig gefrühstückt.«
Es war albern. Bremer verfluchte sich im stillen dafür, aber er zögerte tatsächlich einen Moment, die Plane zurückzuziehen. Als er es dann doch tat, geschah es zu schnell und mit viel zuviel Kraft.
Der Anblick war nicht so schlimm, wie er nach Nördlingers Worten erwartet hatte, aber schlimm genug. Bremer erstarrte für eine oder zwei Sekunden.
»Rosen«, sagte Nördlinger. »Ich hatte auch ein paar Schwierigkeiten, ihn wiederzuerkennen, aber er ist es.« Er atmete hörbar ein, zu tief und zu lange, als brauche er zusätzlichen Sauerstoff, um eine Übelkeit zu unterdrücken, und ließ sich dann neben Bremer in die Hocke sinken. Seine Kniegelenke knackten wie dünne, zerbrechende Äste. »Sehen Sie sich seine Hände an.«
Bremer zog die Plane noch ein Stück weiter zurück. Er sah sofort, was Nördlinger meinte. Rosens Gesicht bot einen erschreckenden Anblick, aber seine Hände sahen noch viel schlimmer aus. Fast alle seine Fingernägel waren abgebrochen und blutig gesplittert. Mindestens zwei Finger mußten gebrochen sein, wahrscheinlich mehr, und seine Handflächen wiesen ein geometrisches Muster sich kreuzender Schnitte auf, die bis auf die Knochen hinab reichten.
Das Muster in Rosens Händen paßte zu dem Maschendrahtzaun, vor dem man ihn gefunden hatte. Bremer brauchte nur eine Sekunde, um die dazugehörigen Blutspuren auf dem Draht zu finden.
»Was ist … mit seinen Augen passiert?« fragte Bremer mühsam. Unter seiner Zunge begann sich bittere Galle zu sammeln. Er schluckte sie hinunter, warf die Zigarette neben sich auf den Boden und trat sie mit dem Absatz aus, ohne noch einmal daran gezogen zu haben.
»So, wie es aussieht, hat er sie sich ausgekratzt«, sagte Nördlinger. Bremer starrte ihn an, und Nördlinger nickte zwei- oder dreimal hintereinander, um seine Behauptung zu unterstreichen. »Wir müssen natürlich das endgültige Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung abwarten, aber bisher deutet nichts auf Fremdeinwirkung hin.«
»Sie meinen, er hat sich das alles … selbst angetan?«
»Er – oder jemand, der keinerlei Spuren hinterlassen hat.« Nördlinger erhob sich ebenfalls, wobei seine Gelenke erneut und noch lauter knackten, beugte sich dann aber noch einmal vor und schlug die Plane wieder über Rosens Gesicht. Es nutzte nicht viel. Bremers Magen revoltierte noch immer. »Jedenfalls keine, die wir gefunden haben.«
Oder wenigstens keine, die noch da wären, fügte Bremer in Gedanken hinzu. Er sprach es nicht laut aus. Es wäre nicht fair, und es wäre vor allem nicht wahr. Nördlingers Anruf lag fast eine Stunde zurück, und wahrscheinlich hatte die Spurensicherung den Hof schon abgesucht, lange bevor Nördlinger überhaupt eingetroffen war. Es gehörte zwar nicht viel dazu, dachte er spöttisch, aber selbst die Berliner Polizei war besser als ihr Ruf. Wenn Nördlinger sagte, daß keine Spuren da waren, dann waren keine Spuren da.
»Vielleicht hat man ihn woanders umgebracht und die Leiche dann hierhergeschafft.«
»Ja. Vielleicht. Und dann ist der Tote aufgestanden und hat mit solcher Kraft am Draht gerüttelt, daß er sich die Hände daran aufgeschnitten hat.« Nördlinger schüttelte den Kopf. »Bevor oder nachdem er sich die Augen aus dem Kopf gerissen hat, was meinen Sie? Er ist hier gestorben. Die Frage ist nur, wie. Und warum.«
»Vielleicht, weil es doch so etwas wie eine höhere Gerechtigkeit gibt«, murmelte Bremer. Er hatte nicht vorgehabt, so laut zu sprechen, daß Nördlinger es hörte, aber Nördlinger hatte es gehört, und als Reaktion verfinsterte sich sein Gesichtsausdruck noch mehr.
»Sparen Sie sich solche Sprüche bitte, Herr Bremer«, sagte er steif. »Vor allem, wenn jemand in der Nähe ist, der sie falsch verstehen könnte.«
»Ist denn jemand in der Nähe?« Die Frage war überflüssig. Die örtlichen Gegebenheiten waren ausnahmsweise einmal auf ihrer Seite. Die Mauern und das Wellblechtor hielten nicht nur zuverlässig die Gaffer fern, sondern ihnen – bisher jedenfalls – auch die Presse vom Hals. Sehr lange würde das wahrscheinlich nicht mehr so bleiben. Nördlinger würdigte ihn nicht einmal einer Antwort.
Bremer kratzte all seinen Mut zusammen, ließ sich noch einmal in die Hocke sinken und zog mit spitzen Fingern die Plane vom Gesicht des Toten. Diesmal war er auf den Anblick vorbereitet. Sein Magen rebellierte zwar noch immer, versuchte aber wenigstens nicht mehr, aus seinem Hals herauszuspringen. Er hatte schon Tote gesehen, die schlimmer zugerichtet waren.
»Keine schöne Art, zu sterben«, sagte Nördlinger leise.
Bremer zuckte die Schultern. »Ein paar von seinen Opfern sahen schlimmer aus.«
Nördlinger schenkte ihm einen verwirrten Blick, beließ es aber bei einem Achselzucken. Vermutlich verstand er nicht einmal, was Bremer meinte. Auf den ersten Blick bot Rosens Gesicht einen Anblick, das an Grauen kaum noch zu übertreffen war. Es waren nicht einmal die fehlenden Augen. Jemand hatte seine Lider geschlossen, aber das machte es beinahe noch schlimmer. Die Augäpfel dahinter waren nicht mehr da. Wo sich die Haut über sanfte Rundungen spannen sollte, waren eingesunkene Löcher. Rosens Wangen und Kinn waren von tiefen Kratzern und Rissen zerfurcht, die zum Teil bis auf den Knochen hinabreichten. Er mußte unvorstellbar gelitten haben, bevor sein Herz endlich ausgesetzt hatte. Keines seiner Opfer war so zugerichtet gewesen. Bremer hatte sie alle gesehen.
Trotzdem war ihr Anblick schlimmer gewesen. Es war der Ausdruck auf den Gesichtern der Kinder. Keines seiner Opfer hatte auch nur annähernd solche Qualen erlitten, wie sie Rosen ausgestanden haben mußte. Verglichen damit hatte er seinen Opfern ein gnädiges, schnelles Ende bereitet. Wovon Bremer gesprochen hatte, war jedoch nicht der Ausdruck körperlicher Qual. Es war das Entsetzen. Die vollkommene, hilflose Fassungslosigkeit, das unbeschreibliche Gefühl, ausgeliefert zu sein, und diese eine, niemals beantwortete Frage, die er in ihrer aller Augen gelesen hatte: Warum ich?
Er schüttelte den Gedanken ab. »Wann ist es passiert?«
»Irgendwann zwischen Mitternacht und drei«, antwortete Nördlinger. »Soweit man das bisher sagen kann. Der Nachtwächter hat ihn heute morgen gegen sechs gefunden.«
Bremer sah auf die Uhr. Es war fast Mittag. Er fragte sich, warum man den Toten noch nicht weggebracht hatte, stellte die Frage aber nicht laut. Nördlinger würde seine Gründe haben. Und wenn nicht, dann ging es ihn nichts an. »Und was habe ich damit zu tun?«
»Sie machen mir Spaß«, sagte Nördlinger. »Wenn ich richtig gezählt habe, ist das Nummer vier auf Ihrer Liste.«
Bremer sah auf. »Vier?«
»Halbach, Belozky, Lachmann – und jetzt Rosen.« Nördlinger hielt die gleiche Anzahl Finger in die Höhe und schüttelte den Kopf. »Keine schlechte Bilanz, in vier Monaten.«
»Was soll das heißen?« Bremers Stimme war jetzt eine Spur schärfer, aber Nördlinger zeigte sich vollkommen unbeeindruckt. Nach einer oder zwei Sekunden gönnte er Bremer sogar eines seiner seltenen Lächeln.
»Gar nichts«, sagte er. »Ich zähle nur zwei und zwei zusammen – bevor es jemand anderes tut. Glauben Sie denn wirklich, ich wäre der einzige, der da gewisse Zusammenhänge erkennt?«
»Das einzige, was ich erkenne, ist ein toter Kindermörder.« Bremer stand auf. »Vielleicht hat er in einem klaren Moment ja begriffen, was er für ein Ungeheuer ist, und sich aus lauter Entsetzen darüber selbst umgebracht.«
Nördlinger wiederholte sein Kopf schütteln, trat an Bremers Seite und versuchte mit der Schuhspitze die Plane wieder über Rosens Gesicht zu schieben. Ohne Erfolg. »Verstehen Sie mich doch nicht falsch, Bremer«, sagte er. »Mein Mitleid mit diesem Kerl hält sich genauso wie Ihres in Grenzen. Und das gilt für die drei anderen genauso. Aber ich habe heute morgen schon eine Menge unangenehmer Fragen beantworten müssen, und ich fürchte, ich werde noch sehr viel mehr davon hören, bis ich heute abend nach Hause gehe. Ich hatte gehofft, daß Sie ein paar Antworten für mich haben.«
Die Ungeheuerlichkeit, die sich hinter diesen Worten verbarg, kam Bremer erst nach ein paar Sekunden wirklich zu Bewußtsein. Zu seiner eigenen Überraschung wurde er aber nicht einmal wütend. Nicht wirklich. Was Nördlinger gerade angedeutet hatte, war so bizarr, daß er für einen Moment… gar nichts empfand.
»Ich habe für die Zeit zwischen Mitternacht und drei kein Alibi, wenn Sie das meinen«, sagte er spröde. »Möchten Sie meinen Dienstausweis und meine Waffe?«
»Seien Sie nicht albern«, antwortete Nördlinger. »Niemand verdächtigt Sie, oder wirft Ihnen irgend etwas vor. Als Halbach starb, waren Sie nicht einmal in der Stadt, nicht wahr? Ich sage das nur, weil es da gewisse … Parallelen gibt.«
»Sie sind alle drei tot, das stimmt«, sagte Bremer feindselig. »Und?«
Nördlinger zuckte ungerührt mit den Schultern. »Wenn sie mir aufgefallen sind, könnten sie auch anderen auffallen.«
»Ich …«
»Ich erwarte Sie in zwei Stunden in meinem Büro«, fuhr Nördlinger fort, noch immer ruhig, jetzt aber in verändertem, dienstlicherem Tonfall, der einen Befehl aus ihnen machte und die Diskussion gleichzeitig beendete.
»Soll ich eine Zahnbürste mitbringen?«
Nördlinger verdrehte die Augen. »Bremer – tun Sie mir und vor allem sich selbst einen Gefallen und strapazieren Sie meine Geduld nicht noch mehr. Ich erwarte ein paar konstruktive Vorschläge von Ihnen, keine dummen Sprüche. In zwei Stunden.«
Er ging. Bremer starrte ihm wütend nach. Nördlinger hatte es wieder einmal geschafft, ihn aus der Ruhe zu bringen. Das gelang ihm beinahe jedesmal. Sie gingen sich aus dem Weg, so gut es ging, aber immer war das nun einmal nicht möglich, und wenn es überhaupt etwas gab, das Kriminalrat Nördlingers Pedanterie noch übertraf, dann war es seine Fähigkeit, seinen Gesprächspartner mit ein paar gezielten Bemerkungen auf die Palme zu bringen.
Vor allem, wenn dieser Gesprächspartner Bremer hieß.
Vielleicht, überlegte er, war er ja nur deshalb so wütend, weil er immer wieder darauf hereinfiel. Dabei wäre es gar nicht nötig gewesen. Er war ziemlich sicher, daß er Nördlinger gewachsen war, wenn es ihm nur einmal gelang, Ruhe zu bewahren. In zwei Stunden, wenn sie sich wiedersahen, würde er sich einfach zusammenreißen. Und sei es nur, um Nördlinger nicht zwei Triumphe an einem Tag zu gönnen. Einer war genug. Mehr als genug, wenn man es genau nahm.
Bremer verspürte ein unangenehmes Kratzen im Hals. Er unterdrückte ein Husten und kramte in seinem Mantel nach einem Taschentuch, als sich ein Kribbeln in der Nase hinzugesellte. Er fand keines, hob im letzten Moment den Handrücken unter die Nase und nieste so kräftig, daß seine Trommelfelle knackten.
»Hier … bitte.«
Jemand hielt ihm ein offenes Päckchen Tempo hin. Bremer putzte sich ausgiebig die Nase, nickte dankbar und räusperte sich mehrmals hintereinander und übertrieben, damit das Kratzen in seinem Hals aufhörte. Es half allerdings nicht viel. Offensichtlich hatte er sich irgendwo eine Erkältung eingefangen.
Erst dann drehte er sich zu dem Mann herum, der ihm das Taschentuch gegeben hatte. Er erwartete, einen seiner Kollegen zu sehen, vielleicht jemanden von der Spurensicherung, oder auch einen uniformierten Beamten. Statt dessen blickte er in das Gesicht eines vielleicht dreißigjährigen, dunkelhaarigen Mannes, der einen für die Witterung viel zu dünnen schwarzen Sommeranzug trug, dazu ein ebenfalls schwarzes Hemd – und einen weißen Priesterkragen.
»Danke«, sagte er überrascht. »Was … was tun Sie hier?«
»Nehmen Sie ruhig das ganze Päckchen«, sagte der andere lächelnd. »Sie hören sich an, als könnten Sie es gebrauchen.«
Bremer griff fast automatisch zu und steckte die Taschentücher ein. Gleichzeitig sah er sich verwirrt um. Er hatte sich zwar in den letzten Minuten intensiv mit Nördlinger beschäftigt, aber er war auch vollkommen sicher, ganz bestimmt keinen Geistlichen gesehen zu haben, als er vorhin gekommen war.
»Was tun Sie hier?« wiederholte er. »Wer sind Sie?«
»Mein Name ist Thomas«, antwortete der andere. »Vater Thomas – aber vergessen Sie den Vater ruhig. Niemand nennt mich so. Ist er das? Sie gestatten doch.«
Er deutete auf Rosens Leichnam und ließ sich daneben auf ein Knie herabsinken, ohne Bremers Antwort abzuwarten. Während er mit der rechten Hand ein winziges Silberkreuz an einer Kette unter dem Hemd hervorzog, entfernte er mit der anderen die schwarze Plane von Rosens Gesicht. Auf seinen Zügen zeigte sich nicht die geringste Reaktion, als sein Blick in Rosens zerstörtes Gesicht fiel. Er tat alles so schnell und mit einer solchen Selbstverständlichkeit, daß Bremer nicht einmal auf die Idee kam, ihn davon abzuhalten, sondern die kniende Gestalt vor sich nur mit einer Mischung aus Überraschung und Staunen anstarrte. Es dauerte Sekunden, bis er seine Fassung wiederfand.
»Bitte … entschuldigen Sie«, sagte er. Keine Reaktion. »Thomas?«
Er sprach den Vater tatsächlich nicht aus, wenn auch weniger, weil Thomas es ihm angeboten hatte. Er wäre sich albern dabei vorgekommen, einen Mann Vater zu nennen, der jung genug war, um sein Sohn zu sein. Und den er vielleicht in der nächsten Minute verhaften mußte.
Es vergingen noch einmal Sekunden, bevor Thomas reagierte. Er hatte die Augen geschlossen und Zeige- und Mittelfinger der linken Hand auf die Stirn des Toten gelegt. Seine Lippen bewegten sich lautlos. Nachdem er sein stummes Gebet zu Ende gesprochen hatte, hob er das kleine Kreuz an die Lippen, küßte es flüchtig und verbarg es dann wieder unter seinem Hemd. Erst dann stand er auf und wandte sich wieder zu Bremer um.
»Bitte verzeihen Sie«, sagte er, »aber …«
Bremer unterbrach ihn. »Was suchen Sie hier?« fragte er, in ganz bewußt nicht mehr allzu freundlichem Ton. »Wer hat Sie hier hereingelassen?«
»Ihr Kollege am Tor war so freundlich, mich einzulassen«, antwortete Thomas. Bremer wandte den Kopf und warf dem Mann einen ärgerlichen Blick zu, aber Thomas schüttelte rasch den Kopf und zog seine Aufmerksamkeit mit einer entsprechenden Geste wieder auf sich.
»Nehmen Sie es ihm nicht übel«, sagte er lächelnd. »Ich weiß, daß er es wahrscheinlich nicht gedurft hätte. Aber nicht jeder kann sich der Autorität eines Priesterkragens widersetzen.«
»Da haben Sie verdammt recht«, sagte Bremer. »Er hätte Sie nicht hereinlassen dürfen. Wir sind hier am Tatort eines Verbrechens. Kannten Sie den Toten?«
Thomas verneinte. »Ich bin nur zufällig vorbeigekommen. Als ich hörte, was geschehen war, habe ich Ihren Kollegen gebeten, mich einzulassen. Bitte, bereiten Sie ihm deswegen keine Schwierigkeiten. Es wäre mir unangenehm.«
»Wieso?« fragte Bremer. »Warum wollten Sie hier herein?«
»Um dem Toten die Sakramente zu geben«, antwortete Thomas.
»Die Sakramente?« Bremer legte den Kopf schräg. »Um ehrlich zu sein, habe ich mit der Kirche nicht viel am Hut. Aber trotzdem … erteilt man die Sterbesakramente nicht eigentlich, bevor jemand stirbt?«
»Wenn die Zeit dafür reicht, ja«, sagte Thomas. »Leider kommen wir nicht immer rechtzeitig.«
»Das stimmt«, antwortete Bremer. »In diesem Fall kommen Sie ungefähr vierzig Jahre zu spät.«
Thomas’ Blick nach zu schließen, verstand er nicht, was Bremer damit meinte – und wie auch? Bremer machte jedenfalls keinen Versuch, seine Worte irgendwie zu erklären, sondern fuhr mit einer unwilligen Geste zum Tor hin fort: »Ich muß Sie bitten, jetzt wieder zu gehen. Die Spurensicherung ist noch nicht fertig. Sie behindern uns bei unserer Arbeit.«
»Gleich.« Thomas drehte sich wieder zu dem Toten herum. »Ich möchte nur noch …«
Bremer ergriff ihn am Arm. »Nein, Vater«, sagte er betont. »Jetzt. Es sei denn, Sie könnten mir vielleicht irgend etwas über den Toten erzählen, was ich noch nicht weiß.«
»Ich möchte Sie wirklich nicht behindern«, sagte Thomas. Er lächelte noch immer, und aus irgendeinem Grund wußte Bremer einfach, daß es ein echtes Lächeln war, kein berufsmäßig aufgesetztes. »Es ist auch nicht meine Aufgabe. Ich bin nur für das Seelenheil dieses Mannes verantwortlich.«
»Machen Sie sich darum keine Sorgen«, sagte Bremer. »Es sei denn, Sie glauben wirklich an ein Leben nach dem Tod.«
»Ich wäre nicht hier, wenn ich das nicht täte, Herr Bremer«, antwortete Thomas ernst. »Sie tun es doch auch.«
Und ob, dachte Bremer. Ich könnte dir eine Menge darüber erzählen, mein Freund. Ich bin nur nicht sicher, ob es dir gefallen würde.