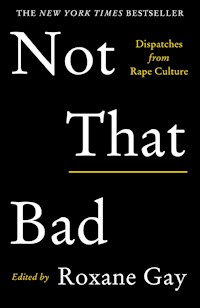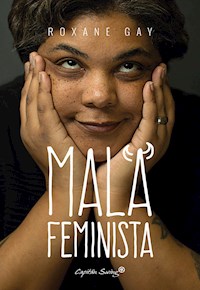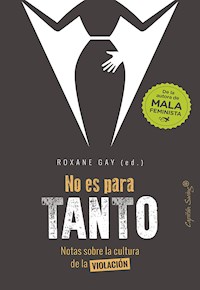9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Leider liebt sie Rapmusik, das Frauenbild: grauenvoll. Leider liest sie sehr gerne Fashion-Magazine, das Frauenbild: ebenfalls erschreckend. Und ihre Lieblingsfarbe ist leider: pink. In einer Zeit, in der Barack Obama sich als Feminist bezeichnet und sogar Modeimperien den Schriftzug in großer Zahl auf T-Shirts drucken, wahrscheinlich keine gute Idee. Feminismus ist chic geworden und angekommen in der Popkultur. Aber was kann guter Feminismus heute wirklich sein? In ihrem hochgelobten Essayband sprengt Roxane Gay das ideologische Korsett eines guten und starren Feminismus und erklärt sich selbst ironisch zum Bad Feminist – stimmgewaltig, bestechend klug und fern jeder Ideologie unterzieht sie unsere Gegenwart einer kritischen Analyse und zeigt, wie man alles auf einmal sein kann: eine der bedeutendsten Feministinnen der Gegenwart und dabei definitiv nicht perfekt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 509
Ähnliche
Zum Buch
Feminismus ist schick geworden und angekommen in der Popkultur. Aber was kann guter Feminismus heute wirklich sein? In ihrem hochgelobten Essayband sprengt Roxane Gay das ideologische Korsett eines guten und starren Feminismus und bezeichnet sich selbst ironisch als bad feminist – stimmgewaltig, bestechend klug und fern jeder Ideologie unterzieht sie unsere Gegenwart einer kritischen Analyse und zeigt, wie man alles auf einmal sein kann: eine der bedeutendsten Feministinnen der Gegenwart und dabei definitiv nicht perfekt.
Zur Autorin
ROXANE GAY, geboren 1974, ist Autorin, Professorin für Literatur und eine der wichtigsten gesellschaftspolitischen und literarischen Stimmen ihrer Zeit. Mit ihrem großen Essay »Hunger«, ebenfalls bei btb erschienen, war sie genau wie mit »Bad Feminist« wochenlang auf der New-York-Times-Bestsellerliste und wurde von der Kritik hochgelobt. Sie schreibt u. a. für die New York Times und den Guardian, sie ist Mitautorin des Marvel-Comics World of Wakanda, Vorlage für den Actionfilm Black Panther (2018), dem dritterfolgreichsten Film aller Zeiten in den USA. Roxane Gay ist Gewinnerin des PEN Center USA Freedom to Write Awards. Sie lebt in Indiana und Los Angeles.
ROXANE GAY BEI BTB
Hunger. Die Geschichte meines Körpers
Essays
Aus dem amerikanischen Englischvon Anne Spielmann
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel »Bad Feminist« bei Harper Perennial, New York.
Copyright © der Originalausgabe 2014 by Roxane Gay
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2019 by btb Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Semper Smile München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
mr · Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-22755-5V003www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Inhalt
Einleitung: Feminismus (m.): Plural
[ICH]
Fühl mich. Sieh mich. Hör mich.
Fragwürdige Privilegien
Typisch Anfänger
To scrabble: tasten, scharren, wie wahnsinnig herumwühlen
[GENDER & SEXUALITÄT]
Wie man mit einer anderen Frau befreundet ist
Girls, Girls, Girls
Ich war einmal Miss America
Performance, Show, Reality
Nicht hier, um Freunde zu finden
Wie wir alle verlieren
Die Sehnsucht nach Katharsis: abnehmen und zunehmen und ein Buch von Diana Spechler
Die glatten Oberflächen des Idylls
Das achtlose Sprechen über sexuelle Gewalt
Wonach wir hungern
Die Illusion von Sicherheit, die Sicherheit von Illusion
Das Spektakel der kaputten Männer
Das Märchen von drei Comingout-Geschichten
Jenseits männlicher Maßstäbe
Manche Witze sind lustiger als andere
Liebe junge Ladys, die ihr Chris Brown so sehr liebt, dass ihr euch von ihm schlagen lassen würdet
Blurred Lines, verwischte Grenzen
Das Problem mit dem Märchenprinzen, oder Er, der uns erniedrigt
[RACE & ENTERTAINMENT]
Wie tröstlich es ist, Hühnchen zu braten, und andere fragwürdige Erinnerungen aus dem Mississippi der 60er-Jahre: Anmerkungen zu The Help
Wie ich Django überlebte
Wie erzählen wir weiter?
Die Moral von Tyler Perry
Der letzte Tag im Leben eines jungen Schwarzen Mannes
Wenn weniger mehr ist
[POLITIK, GENDER & RACE]
Die Politik der Respektabilität
Was Twitter kann und Journalismus nicht
Die veräußerlichen Rechte von Frauen
Warten auf einen Helden
Profiling ist nicht Profiling
Unser aller Rassismus
Tragödie. Appell. Mitgefühl. Antwort
[ZURÜCK ZU MIR]
Bad Feminist: Take One
Bad Feminist: Take Two
Dank
EinleitungFeminismus (m.): Plural
Die Welt verändert sich so schnell, dass wir kaum noch mitkommen. Sie ist kompliziert und wird komplizierter, das verwirrt und lässt uns oft fassungslos zurück. Das kulturelle Klima verändert sich, besonders für Frauen, wie Freiheit einschränkende Regelungen zu Abtreibung und Verhütung, anhaltende Rape Culture und falsche, Schaden verursachende Darstellungen von Frauen in Musik, Film und Literatur zeigen.
Wir sehen uns einem Fernsehkomiker gegenüber, der seine Fans auffordert, sich an wildfremde Frauen ranzumachen und ihren Bauch zu streicheln, weil es so lustig ist, persönliche Grenzen zu ignorieren. Wir hören jeden Tag jede Menge Songs, in denen die Herabsetzung von Frauen gefeiert wird, und diese Musik ist verdammt eingängig, weshalb ich mich oft beim Mitsingen eines mich selbst erniedrigenden Textes erwische. Sänger wie Robin Thicke wissen: »We want it«. Rapper wie Jay-Z verwenden das Wort »bitch« als eine Art Satzzeichen. Die meisten Filme erzählen Geschichten von Männern, als wären Geschichten von Männern die einzigen Geschichten, auf die es ankommt. Wenn Frauen darin vorkommen, dann als Sidekick, zum Zweck des romantischen Zwischenspiels, als Nebenrolle. Selten stehen Frauen im Zentrum der Aufmerksamkeit. Selten kann man sagen, dass es unsere Geschichten sind, auf die es wirklich ankommt.
Wie können wir auf diese Dinge aufmerksam machen? Wie schaffen wir es, wirklich Gehör zu finden? Wie finden wir die Sprache, die nötig ist, um über die Ungleichheit und die kleinen und großen Ungerechtigkeiten zu sprechen, denen Frauen ausgesetzt sind? Je älter ich geworden bin, desto besser hat mir der Feminismus geholfen, diese Fragen zu beantworten, wenigstens zum Teil.
Der Feminismus ist nicht perfekt, aber er vermag es im besten Fall immer noch, uns durch die sich verändernde kulturelle Landschaft zu steuern. Der Feminismus hat mir auf jeden Fall dabei geholfen, meine eigene Stimme zu finden. Der Feminismus hat die Überzeugung in mir gestärkt, dass meine Stimme zählt, selbst in unserer heutigen Welt, in der so viele Stimmen danach verlangen, gehört zu werden.
Wie können wir die Fehler und Schwächen des Feminismus mit all dem Guten, das er bewirkt, versöhnen? Der Feminismus ist deshalb nicht perfekt, weil er eine Bewegung von Menschen ist und Menschen nun einmal unvollkommen sind und Fehler machen. Aus allen möglichen Gründen neigen wir dazu, aus dem Feminismus ein unerreichbares Ideal zu machen, eine Bewegung, die alle unsere Wünsche erfüllen muss und immer nur das Richtige tut. Wenn der Feminismus unsere Erwartungen nicht erfüllt, glauben wir, dass das am Feminismus liegt, statt an den mangelhaften Wesen, die im Namen der Bewegung handeln.
Das Problem mit Bewegungen ist, dass sie meistens nur mit denjenigen ihrer Repräsentanten und Repräsentantinnen in Verbindung gebracht werden, die am sichtbarsten sind, die Leute mit den größten Plattformen und den lautesten und provokantesten Stimmen. Aber der Feminismus ist nicht das oder nur zum Teil das, was in den Medien gerade als coolster neuer feministischer Trend gefeiert wird.
In letzter Zeit hat der Feminismus darunter gelitten, dass es Frauen gab, die ihn zu einem Bestandteil ihres persönlichen Markenzeichens machten. Wenn diese Leitfiguren das sagen, was wir von ihnen hören wollen, stellen wir sie auf den feministischen Sockel, und wenn sie etwas tun, was wir nicht mögen, zerren wir sie wieder herunter und sagen dann, der Feminismus ist schuld, weil unsere feministischen Ikonen uns enttäuscht haben. Wir vergessen den Unterschied zwischen Feminismus und professionellen Feministinnen.
Ich nehme ganz offen die Bezeichnung bad feminist, schlechte Feministin, für mich in Anspruch. Und zwar deshalb, weil ich ein unvollkommenes menschliches Wesen bin. In feministischer Geschichtsschreibung bin ich nicht besonders bewandert. Ebenso wenig kenne ich alle feministischen Schlüsseltexte so gut, wie ich sie gerne kennen würde. Ich habe gewisse … Interessen und persönliche Eigenschaften und Meinungen, die mit dem feministischen Mainstream vielleicht nicht übereinstimmen, und dennoch bin ich Feministin. Ich kann gar nicht sagen, wie befreiend es gewesen ist, das zu akzeptieren.
Ich nehme die Bezeichnung bad feminist in Anspruch, weil ich ein Mensch bin. Ich bin chaotisch. Ich versuche nicht, ein gutes Beispiel für andere zu sein. Ich versuche nicht zu sagen, ich hätte auf alles eine Antwort. Ich versuche nicht zu sagen, mit mir würde alles stimmen. Ich versuche nur das nach außen zu tragen, woran ich glaube. Ich versuche, etwas Gutes zu tun in dieser Welt, versuche, mit meinem Schreiben Aufmerksamkeit zu erregen und dabei ich selbst zu bleiben: eine Frau, die Pink liebt und es manchmal mag, einfach auszuflippen, und die manchmal wild zu Musik tanzt, von der sie weiß – ja, sie weiß es! –, dass sie schrecklich über Frauen spricht, und die sich manchmal dumm stellt, wenn ein Handwerker da ist, weil es einfach leichter ist zuzulassen, dass er sich als Macho fühlt, als den weiblichen Moralapostel zu spielen.
Ich bin eine schlechte Feministin, weil ich nicht auf einen feministischen Sockel gestellt werden will. Von Menschen, die man auf Sockel stellt, wird erwartet, dass sie etwas darstellen, und zwar perfekt. Und wenn sie es versauen, stürzt man sie. Ich versaue es regelmäßig. Betrachten Sie mich also als bereits gestürzt.
Als ich jünger war, distanzierte ich mich mit alarmierender Regelmäßigkeit vom Feminismus. Ich verstehe, warum Frauen sich noch immer so vehement dagegen wehren, als Feministinnen bezeichnet zu werden. Ich habe mich früher distanziert, weil sich die Bezeichnung Feministin für mich wie eine Beleidigung anfühlte. Tatsächlich war es meistens auch so gemeint. In einer Situation dachte ich mal: Aber ich hab doch gar nichts gegen Blowjobs! Ich hatte die fixe Idee, dass sich Feministinsein mit sexueller Offenheit nicht vertragen. Ich hatte jede Menge fixer Ideen, als ich jünger war.
Ich distanzierte mich vom Feminismus, weil ich keine Vorstellung von der Bewegung hatte. Wenn man mich als Feministin bezeichnete, hörte ich: »Du bist ein zorniges, Sex und Männer hassendes weibliches Opfer.« Diese Karikatur haben Menschen aus Feministinnen gemacht, die den Feminismus am meisten fürchten. Die, die am meisten zu verlieren haben, wenn der Feminismus Erfolg hat, diffamieren die feministische Bewegung und verdrehen ihre Ziele. Jedes Mal, wenn ich mich daran erinnere, wie ich früher auf den Feminismus hinabgeschaut habe, schäme ich mich für meine Ignoranz. Ich schäme mich für meine Angst, denn der Grund für meine Missbilligung und Distanzierung war zum größten Teil die Angst, ausgegrenzt und missachtet zu werden, als Spielverderberin betrachtet und vom Mainstream nicht akzeptiert zu werden.
Ich werde wütend, wenn Frauen auf den Feminismus herabschauen und nicht wollen, dass man sie als Feministinnen bezeichnet, obwohl sie sagen, sie unterstützen alle Verbesserungen, die wir dem Feminismus verdanken, denn ich sehe eine Trennung, die nicht sein muss. Ich werde wütend, aber ich verstehe und hoffe, dass wir eines Tages in einer Kultur leben werden, in der wir es nicht nötig haben, uns vom Feminismus zu distanzieren, in der die Bezeichnung Feministin nicht die Angst hervorruft, allein zu bleiben, zu anders zu sein und zu viel zu wollen.
Ich versuche, meinen Feminismus einfach zu halten. Ich weiß, Feminismus ist komplex und vielfältig und nicht perfekt. Ich weiß, Feminismus wird und kann nicht alles in Ordnung bringen. Ich trete ein für die Chancengleichheit von Frauen und Männern. Ich trete dafür ein, dass Frauen die Freiheit haben zu verhüten und abzutreiben, und dass sie uneingeschränkten Zugang zu bezahlbarer medizinischer Versorgung haben. Ich trete dafür ein, dass Frauen für gleiche Arbeit den gleichen Lohn wie Männer bekommen. Feminismus ist ein Angebot, und wenn eine Frau keine Feministin sein will, ist das ihr Recht, aber es liegt dennoch in meiner Verantwortung, für ihre Rechte zu kämpfen. Ich bin davon überzeugt, dass Feminismus grundsätzlich dafür kämpfen muss, dass Frauen Entscheidungen frei treffen können, auch wenn ich selbst mit ihren Entscheidungen nicht übereinstimme. Ich glaube, dass Frauen nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern überall auf der Welt Gleichheit und Freiheit verdienen, aber ich weiß auch, dass ich nicht dazu befugt bin, Frauen aus anderen Kulturen zu sagen, wie diese Gleichheit und diese Freiheit aussehen sollen.
Als ich um die zwanzig war, missbilligte ich den Feminismus, weil ich befürchtete, dass er mir nicht erlauben würde, die chaotische Frau zu sein, die ich nun einmal war. Aber dann erfuhr ich mehr darüber. Ich lernte, den einfachen Feminismus von dem einzigartigen, idealen, heiligen Feminismus und den einzigartigen, idealen, heiligen Feministinnen zu unterscheiden – dem einzig wahren Feminismus, der über allen Frauen thront. Es war leicht, sich den Feminismus zu eigen zu machen, als ich erkannte, dass er für die Gleichheit der Geschlechter in allen Bereichen eintritt, während er sich gleichzeitig um Intersektionalität bemüht, das heißt, alle anderen Faktoren zu berücksichtigen versucht, die Einfluss darauf haben, wer wir sind und wie wir uns in der Welt bewegen. Feminismus hat mich Frieden finden lassen. Feminismus hat mir Orientierung für mein Schreiben und Lesen und für mein Leben gegeben. Natürlich folge ich seinen Prinzipien nicht immer, aber ich weiß auch, es ist okay, dass ich meinem besten feministischen Selbst nicht immer gerecht werde.
Frauen of Color, queere Frauen und Transgender-Frauen müssen im feministischen Projekt besser verankert werden. Frauen aus diesen Gruppen sind vom Ideal-Feminismus beschämenderweise immer wieder vernachlässigt worden. Das ist eine harte, schmerzliche Wahrheit. Deshalb kommt es immer wieder dazu, dass zwischen der Bewegung und diesen Gruppen von Frauen eine künstliche Distanz hergestellt wird. Glauben Sie mir, das verstehe ich. Jahrelang war ich selbst der Meinung, dass Feminismus mir als Schwarze und sich manchmal als queer identifizierende Frau nichts sagen könne, weil Feminismus sehr oft für die Verbesserung des Lebens heterosexueller weißer Frauen eintritt – zum Nachteil aller anderen.
Aber ein Unrecht hebt das andere nicht auf. Die Versäumnisse des Feminismus bedeuten nicht, dass wir ihn komplett aufgeben sollten. Menschen tun ständig schreckliche Dinge, aber das heißt nicht, dass wir unser Menschsein einfach abstreifen können. Wir missbilligen die schrecklichen Dinge. Wir sollten die Versäumnisse des Feminismus kritisieren, ohne die vielen Erfolge zurückzuweisen und zu verleugnen, dass wir schon weit gekommen sind.
Wir müssen nicht alle an den gleichen Feminismus glauben. Feminismus kann pluralistisch sein, solange wir die verschiedenen Feminismen respektieren, die wir mit uns herumtragen, solange wir die heilige Einheit fahren lassen und einfach versuchen, die Brüche zwischen uns möglichst klein zu halten.
Feminismus wird erfolgreicher sein, wenn wir uns gemeinsam für seine Ziele einsetzen, aber es gibt auch Erfolge, die durch persönliches Verhalten entstehen. Ich habe von vielen jungen Frauen gehört, dass sie sich mit den bekannten Feministinnen nicht identifizieren können. Das ist sicherlich entmutigend. Aber ich sage, lasst uns die Feministinnen werden (oder es wenigstens versuchen), die wir in dieser Welt gern sehen würden.
Wenn man niemanden finden kann, dem man folgen will, muss man selbst als ein Beispiel vorangehen. In dieser Sammlung von Essays versuche ich auf meine eigene kleine, unvollständige Art voranzugehen. Ich erhebe meine Stimme als bad feminist, als schlechte Feministin. Ich beziehe Stellung als schlechte Feministin. Ich gebe Einblicke in unsere Kultur und unser Konsumverhalten. Die Essays in dieser Sammlung untersuchen auch die Darstellung von Race im zeitgenössischen Kino, die Grenzen der »Diversität«, und wie unbefriedigend Neuerungen sein können, weil sie selten genügen. Ich fordere andere Maßstäbe, um die Qualität von Texten zu beurteilen, und schaue mir die HBO-Serie Girls und die Shades-of-Grey-Trilogie genauer an. Diese Essays sind politisch, und sie sind persönlich. Sie sind, wie der Feminismus, unvollkommen, aber authentisch. Ich bin ganz einfach eine Frau, die versucht, mit der Welt, in der wir leben, zurechtzukommen. Ich erhebe meine Stimme, weil ich zeigen will, dass wir auf vielfältige Weise Räume schaffen können, um mehr zu wollen und Besseres zu tun.
[ICH]
Fühl mich. Sieh mich. Hör mich.
Datingseiten für ein Nischenpublikum sind interessant. Es gibt JDate oder Christian Mingle oder Black People Meet und jede Menge anderer Seiten, die eigens dafür gemacht sind, um Leute, die sich irgendwie ähnlich sind, zusammenzubringen. Wenn man bestimmte Kriterien eingibt, kann man Menschen finden, die aussehen wie man selbst oder dem gleichen Glauben anhängen oder die gern in Plüschkostümen Sex haben. In der Welt des Internets ist niemand allein mit den eigenen Vorlieben. Wenn man diese Nischen-Datingseiten besucht, kann man hoffen, es mit einer begrenzten Anzahl von Nutzern zu tun zu haben. Man kann hoffen, dass in Sachen Liebe online eine Lingua franca alles möglich macht.
Ich denke ständig über Beziehungen und Einsamkeit und Gemeinschaft und Zugehörigkeit nach, und ich denke viel, vielleicht zu viel, darüber nach, wie mein Schreiben von den Überschneidungen und Durchdringungen dieser Themen erzählt. So viele von uns strecken die Hand aus und hoffen, dass irgendjemand da draußen sie ergreift und uns daran erinnert, dass wir nicht so alleine sind, wie wir befürchten.
Ich erzähle einige Geschichten immer und immer wieder, weil mich bestimmte Erfahrungen tief berührt haben. Manchmal hoffe ich, dass ich durch das wiederholte Erzählen dieser Geschichten besser verstehe, wie die Welt funktioniert.
Ich habe es noch nicht oft mit Onlinedating versucht, und außerdem habe ich mich eigentlich noch nie mit jemandem verabredet, mit dem ich viel gemein hatte. Ich denke, daran ist mein Sternzeichen schuld. Im Lauf der Zeit finde ich natürlich immer Gemeinsamkeiten in einer Beziehung, aber die Menschen, die ich date, sind meistens wirklich anders als ich. Eine Freundin sagte kürzlich, ich würde mich ja nur mit weißen Jungs treffen und das sei … Ich weiß nicht genau, was. Sie lebt in einer Stadt und glaubt, es gebe überall auf der Welt die kulturelle Vielfalt, an die sie sich gewöhnt hat. Im Gegenzug sagte ich, dass ich mich auf dem College regelmäßig mit einem chinesischen Jungen getroffen hätte. Ich sagte, dass ich mich mit den Männern treffe, die mich einladen. Wenn mich ein Brotha einladen würde und ich ihn mag, würde ich sehr gern mit ihm ausgehen. Aber die wollen nichts von mir, außer, sie sind über siebzig, und ein Date mit einem Greis interessiert mich nicht. Außerdem habe ich offenbar ein Faible für Libertäre. Ich kriege wirklich nie genug von ihnen und von ihrem radikalen Bedürfnis nach Freiheit von Tyrannei und Steuern. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es wäre, viele Gemeinsamkeiten mit einer Person zu haben, die ich date, wie sich die weiteren Treffen dann gestalten würden. Das soll nicht heißen, dass ich mit jemandem besonders viel gemeinsam habe, nur weil die Person auch Schwarz ist oder auch demokratisch oder auch schreiben würde. Ich weiß nicht, ob es überhaupt jemanden auf der Welt gibt, mit dem ich vieles gemeinsam habe, vor allem nicht im Sinne dieser Webseiten, wo man ein paar Charakterzüge und Vorlieben eingibt und dann irgendwie irgendjemanden mit ähnlichen Eigenschaften erwischt. Das habe ich noch nie versucht, und das finde ich gar nicht schlecht. Ich mag es, mit einer Person zusammen zu sein, die unendlich interessant ist, weil wir so verschieden sind. Wenn man den Wunsch hat, zu einer Gruppe von Menschen oder zu einem einzigen Individuum zu gehören, geht es nicht darum, einfach ein Spiegelbild seiner selbst zu finden.
Black Entertainment Television schaue ich relativ selten, weil Lifetime Movie Network und Kabelfernsehen mir lieber sind. Außerdem ist das schlechte Programm bei BET wirklich außergewöhnlich schlecht, und wenn ich bedenke, dass ich mir zwei ganze Folgen von Amsale Girls angeschaut habe, kann ich sagen, dass meine Toleranz gegenüber schlechten Filmen wirklich groß ist. Es ist furchtbar, dass Schwarze Menschen eine so kleine Rolle im Qualitätsfernsehen spielen und dass sie außerhalb von BET so selten auftauchen. Dagegen gibt es so unfassbar viel Raum für Weiße, abgesehen von den von Shonda Rhimes produzierten Serien (Grey’s Anatomy, Private Practice, Scandal), deren Cast reflektierter mit Themen wie Race, Gender und, etwas weniger, Sexualität umgeht. Davon abgesehen sehen sich Schwarze Menschen – eigentlich alle Menschen of Color – fast ausschließlich in der Rolle des Anwalts oder der Anwältin oder der als schicke Freundin oder exotischer Freund dargestellt, und, natürlich, wie in The Help. Sogar beim Schauen einer Serie wie Lena Dunhams Girls, die verspricht, etwas Neues, nie da Gewesenes zu zeigen, und die Geschichte vierer Freundinnen Mitte zwanzig erzählt, die mitten in Brooklyn, New York wohnen, ist man gezwungen, das immer Gleiche zu sehen – die völlige Ignoranz und das Ausblenden racespezifischer Kontexte.
Die BET-Sitcom Girlfriends hingegen ist anders und wird absolut unterschätzt. Es dauerte eine Weile, bis ich die Serie zu schätzen lernte, aber dann merkte ich, dass sie etwas Wichtiges zeigt und sie viel mehr Anerkennung verdient, als ich ihr habe zukommen lassen, auch wenn die Leute darin mir äußerlich ähnlich sehen, und ich das manchmal sehr gerne anschaue. Braune Haut ist schön; und ich mag es, verschiedene Geschichten zu verfolgen. Das Problem ist, dass ich in der Serie Leute sehe, die zwar aussehen wie ich, aber damit hört es mit den Ähnlichkeiten schon auf. Teilweise deshalb, weil ich schon Ende dreißig bin. Nach den Maßstäben der Serie bin ich uralt. So sehr ich mit der Popkultur verbunden bin, gibt es doch immer wieder Dinge, von denen ich keine Ahnung habe, und da helfen weder Geografie noch die Dinge, die ich durch mein Schreiben und meine Lehre weiß. Als ich diesen Essay zu schreiben begann, gab es, vom gleichen Sender produziert, eine Realityshow namens Toya. Sie tauchte schon ein paarmal in den Vorschlägen auf, die mir angezeigt wurden, aber ich habe sie mir nie angeschaut. Diesmal sah ich sie mir an, und ich begriff nicht das Geringste. Ich googelte die Hauptdarstellerin und erfuhr, dass sie die Exfrau von Lil Wayne ist, aber das war’s. Ich glaube, sie ist nicht einmal eine Backgroundsängerin oder so etwas, sie ist einfach berühmt für gar nichts.
Ich sah mir also Toya an, und mir war wirklich überhaupt nichts von dem, was sie war oder tat, nahe, das Einzige war vielleicht, dass ich vermute, dass ihre Familie ihr wichtig ist, und auch mir ist meine Familie wichtig. Aber ganz sicher bin ich mir bei ihr nicht, denn meistens reden die Leute in der Show einfach über langweilige Dinge. Irgendwann datet Toya jemanden namens Memphitz (sie sind inzwischen verheiratet), der ständig irgendwelche Diamantringe betrachtet. Ist er Rapper? Wovon leben diese Leute? Lil Waynes Unterhaltszahlungen können unmöglich so hoch sein. Ich wünschte, der Sender würde mehr tun, um das ganze Spektrum Schwarzer Erfahrungen darzustellen. Wenn man diese Serien schaut, hat man den Eindruck, dass Schwarze Menschen nur als Profisportler oder -musiker Erfolg haben können oder weil sie jemanden heiraten/mit ihm ins Bett gehen/ein Kind bekommen, der Sportler oder Musiker ist.
Zur Abwechslung würde ich gern mal Beispiele erfolgreicher Schwarzer Menschen sehen, die in anderen Berufen tätig sind. In vielen Fernsehserien zeigen weiße Protagonisten ihren Zuschauern ein weites Spektrum von Antworten auf die Frage »Was ich werden will, wenn ich groß bin«. Es gibt ein paar Ausnahmen, klar. Zum Beispiel Lawrence Fishburne in CSI oder Blair Underwood, der einen Anwalt in L.A.Law spielt oder die Serien von Shonda Rhimes. Wahrscheinlich steckt aber sonst die Idee dahinter, dass eine nichtweiße Anwältin oder Ärztin oder Schriftstellerin oder – mein Gott, natürlich – eine Jazzmusikerin oder ein Lehrer oder Professor oder Postbeamter oder eine Kellnerin aus Mangel an tatsächlichen Berufsmöglichkeiten für Jugendliche weniger interessant wären. Und trotzdem. Irgendwann müssen wir aufhören, jedem Schwarzen Kind in diesem Land die Vorstellung zu vermitteln, dass er oder sie nur einen Ball oder ein Mikrofon in der Hand zu halten bräuchte, um im Leben etwas zu erreichen. Bill Cosby ist heute aus anderen Gründen nicht mehr zumutbar, aber diesen Kampf hat er zeit seines Lebens geführt. BET frustriert mich einfach, weil es einem so schmerzhaft vor Augen führt, dass man gleichzeitig etwas gemeinsam haben kann, obwohl man gar nichts gemeinsam hat. Ich mag Unterschiede, aber manchmal würde ich gerne einen kleinen Teil von mir selbst in anderen aufblitzen sehen.
An der Uni war ich Beraterin in der Schwarzen Studentenvereinigung. Es gab eine zu vernachlässigende Zahl Schwarzer Lehrender (man konnte sie an einer Hand abzählen), und sie alle waren entweder überarbeitet, oder sie hatten Burn-out, oder sie interessierten sich nicht im Geringsten für ihren Job. Nach vier Jahren verstand ich das. Je älter ich werde, desto mehr Dinge verstehe ich. Beraterin in einer Schwarzen Studentenorganisation zu sein ist anstrengend und herzzerreißend, eine undankbare Aufgabe. Nach einer Weile zerstört es jegliche Zuversicht, die man irgendwann hatte. Einmal kam eine neue Professorin, und ich fragte sie, warum sie nicht mit den Schwarzen Studierenden arbeitete. Sie sagte: »Das ist nicht meine Aufgabe.« Und sie sagte: »Ich kann sie doch sowieso nicht erreichen.« Ich hasse es, wenn Leute sagen, etwas sei nicht ihr Job oder etwas sei unmöglich. Klar, wir alle sagen das manchmal, aber es gibt Leute, die wirklich glauben, sie müssten nicht mehr tun als das, was in ihrer Jobbeschreibung steht und sie müssten nicht wenigstens versuchen, diejenigen zu erreichen, die scheinbar nicht zu erreichen sind.
Meine Arbeitsmoral habe ich von meinem nimmermüden Vater. Wenn es darum geht, jungen Schwarzen Studierenden zu zeigen, dass es gute Lehrende gibt, die aussehen wie sie selbst, wenn es darum geht, sie zu betreuen und zu unterstützen, glaube ich, dass jeder (unabhängig von seiner ethnischen Zugehörigkeit) diese Aufgabe hat, und wenn man das als Schwarze Professorin und als Schwarzer Lehrer nicht als seine Aufgabe ansieht, sollte man Selbstkritik üben und dann noch einmal Selbstkritik üben, bis man es begreift.
Als ich in der Studentenvereinigung arbeitete, respektierten mich die Schwarzen Studierenden wahrscheinlich, aber sie mochten mich nicht besonders. Ich weiß. Ich bin gewöhnungsbedürftig. Die meisten bezeichneten mich als »bourgeois«. Viele sagten, meine Haut sei nicht schwarz genug, und sie lachten, wenn mich das ärgerte. Sie störten sich daran, wie ich bestimmte Slangwörter ausspreche. Es gibt Wörter, die ich eher singe als spreche. Sie sagten oft »Sag noch mal ›holla‹«, was ich tat, weil es eins meiner Lieblingsworte ist, auch wenn ich es nach ihren Regeln vielleicht nicht richtig aussprach. Oder zum Beispiel das Wort »gangsta«, für das sie mich immer wieder aufzogen. Das machte mir nichts aus. Es machte mir aber etwas aus, dass sie glaubten, ich würde zu viel von ihnen erwarten, weil dieses »zu viel« bedeutete, überhaupt etwas zu erwarten.
Ja, ich war eine anstrengende Zicke, und gelegentlich war ich wahrscheinlich ziemlich unverschämt. Ich bestand auf sehr gute Leistungen. Das habe ich von meiner Mutter. Meine Erwartungen waren von der Art, dass ich von den leitenden Leuten verlangte, dass sie bei wichtigen Meetings auftauchten, und dass leitende und gewöhnliche Mitglieder zu den Vollversammlungen erschienen, und zwar fünf Minuten vor dem angesetzten Termin, weil das pünktlich ist; ich verlangte, dass Studierende, die zugesagt hatten, etwas zu tun, ihr Wort hielten; ich verlangte, dass sie Hausaufgaben machten und um Hilfe baten, wenn sie welche brauchten; ich verlangte, dass sie eine 3 oder eine 4 nicht als gute Noten betrachteten und ihr Studium ernst nahmen; ich verlangte, dass sie nicht überall Verschwörungen witterten und dass nicht jeder Prof, der etwas tat, was ihnen nicht gefiel, ein Rassist war.
Wie ich bald merkte, wussten viele dieser jungen Leute gar nicht, was es heißt zu studieren. Wenn wir in akademischen Kreisen oder in intellektuellen Kreisen über soziale Probleme sprechen, geht es meist um Privilegien und darum, dass wir alle Privilegien haben und uns dessen bewusst sein müssen. Ich wusste immer, dass ich privilegiert bin, aber als ich mit diesen Studierenden arbeitete, die größtenteils aus der City von Detroit stammten, merkte ich erst, wie sehr. Wenn jemand zu mir sagt, ich sei mir meines privilegierten Status nicht bewusst, denke ich, er oder sie soll gefälligst die Klappe halten. Du glaubst, ich wüsste das nicht? Ich weiß es besser als jede andere. Die Behauptung, ich hätte mich mit dem Status quo abgefunden, weil er mich eigentlich nicht betrifft, ist abscheulich.
Diese jungen Leute konnten nicht lesen, also besorgte ich ihnen Wörterbücher, und weil sie zu schüchtern waren, um ihre Lese- und Schreibunfähigkeit öffentlich anzusprechen, fingen sie mich irgendwo auf dem Campus oder im Gang vor meinem Büro ab und flüsterten: »Ich brauche Hilfe beim Lesen.« Es war mir noch nie zuvor in den Sinn gekommen, dass es möglich ist, dass ein Kind in diesem Land erzogen wird und es aufs College schafft, ohne auf College-Level lesen zu können. Ich sollte mich dafür schämen, dass ich von den empörenden Unterschieden in der Kindererziehung hierzulande nichts wusste. Ja, ich sollte mich dafür schämen. An der Uni lernte ich außerhalb der Unterrichtsräume viel mehr als bei akademischen Debatten über theoretische Konzepte. Ich erfuhr, wie unwissend ich bin. Ich arbeite immer noch daran, das zu ändern.
In Einzelgesprächen kam ich mit den Studierenden besser aus. Sie waren viel offener. Ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte. Wie bringt man jemandem bei zu lesen? Regelmäßig konsultierte ich Dr. Google. Ich kaufte ein Buch mit simplen Grammatikübungen. Manchmal lasen wir einfach Wort für Wort die Texte, die sie als Hausaufgaben bekommen hatten, und wenn sie ein Wort nicht kannten, ließ ich sie es aufschreiben und nachschlagen, weil meine Mutter es mir so beigebracht hatte. Ich hatte eine Mutter, die nachmittags nach der Schule zu Hause war und die sich Tag für Tag, Jahr um Jahr mit mir hinsetzte und lernte, bis ich auf die Highschool ging, sie spornte mich an und verlangte gute Leistungen. Es gab Dinge in meinem Leben, die meine Mutter nicht verstehen konnte, aber was Erziehung und Bildung betraf, war sie großartig.
Gelegentlich hasste ich es, dass ich so viel zu Hause zu tun hatte. Meine amerikanischen Klassenkameraden und -kameradinnen mussten das alles nicht tun. Ich verstand nicht, warum meine Mom, eigentlich meine beiden Eltern, so darauf erpicht waren, dass wir lernten, unseren Verstand zu gebrauchen. Es gab jede Menge Druck bei uns. Jede Menge. Ich war als Kind ziemlich gestresst, und es gab Druck, den ich mir selbst machte, und Druck von außen. Mir gefiel es, die Beste zu sein und meine Eltern stolz zu machen. Mir gefiel das Gefühl, Kontrolle über Dinge zu haben, und ich hatte diese Kontrolle, weil ich gut in der Schule war, während es andere Teile meines Lebens gab, in denen ich gar nichts unter Kontrolle hatte. Man erwartete von mir, dass ich Einsen mit nach Hause brachte. Eins minus war keine Option, und ich hielt mich daran. Das ist die typische Immigrantenkind-Story, überhaupt nicht interessant. Als ich mit den Jugendlichen auf dem College arbeitete, verstand ich, warum meine Eltern uns zeigten, dass wir dreimal härter arbeiten mussten als weiße Kinder, um die Hälfte der Belohnung zu kriegen. Sie vermittelten uns das ohne Bitterkeit. Sie beschützten uns.
Am Ende unserer gemeinsamen Stunden sagten die Studierenden, mit denen ich arbeitete, meist: »Sagen Sie niemandem, dass ich bei Ihnen war.« Es war ihnen nicht so sehr peinlich, Hilfe bekommen zu haben. Es war ihnen peinlich, dabei gesehen zu werden, dass sie sich für ihre Bildung anstrengten, dass sie die Sache ernst nahmen. Manchmal erzählten sie mir etwas aus ihrem Leben. Viele der jungen Leute, mit denen ich arbeitete, hatten Eltern, die sie nicht so auf die Welt vorbereiten wollten oder konnten, wie es meine Eltern taten. Sie waren oft die ältesten Geschwister und die Ersten, die es aufs College schafften. Ein Junge hatte acht Brüder und Schwestern. Ein Mädchen sechs. Es gab viele abwesende Väter und viele Mütter oder Väter oder Cousins oder Tanten oder Geschwister im Gefängnis. Es gab Alkoholismus, Drogensucht und Missbrauch. Es gab Eltern, die es nicht gern sahen, dass ihre Kinder aufs College gingen, und versuchten, sie davon abzuhalten. Es gab Studierende, die ihre Stipendien oder ihr von der Bank geliehenes Geld nach Hause schickten, um ihre Familien zu unterstützen, und das Semester über ohne Lehrbücher und ohne ausreichendes Essen auskommen mussten, weil zu Hause so viele hungrige Mäuler zu stopfen waren. Sicherlich gab es Studierende mit großartigen Eltern oder Elternteilen, mit hilfsbereiten und wohlwollenden Familien, die nichts von Armut wussten und gut vorbereitet waren auf das College und die neuen Anforderungen, die auf die Jugendlichen warteten. Doch sie waren die Ausnahme. Ich denke oft über die Gefahr der »einen, einzigen Geschichte« nach, wie sie sie Chimamanda Adichie in ihrem TED-Vortrag genannt hat, aber manchmal gibt es tatsächlich nur eine einzige Geschichte, und sie zerreißt mir das Herz.
Am Ende meines letzten College-Jahres war ich wegen all der anderen Dinge, die sich in meinem Privatleben ereigneten, völlig erschöpft. Ich konnte nichts mehr geben. Viel zu oft zeigten sich die Studierenden gleichgültig, und ich war es schließlich auch. Ich bin nicht stolz darauf, aber das, womit ich mich auseinandersetzen musste, war groß. Das sage ich mir selbst. Die Studierenden kamen nicht zu den angesetzten Meetings. Sie ließen die Dinge schleifen, setzten sich für nichts ein und bauten Mist, und ich hatte keine Kraft mehr, um wütend zu sein und zu schreien und anzuspornen und Mut zuzusprechen und sie dazu zu bringen, es besser machen zu wollen. Wenn sie nach vier Jahren nichts gelernt hatten, hatte ich versagt, und ich konnte wenig tun, um das wiedergutzumachen. Natürlich waren sie nicht anders als alle Studierenden an einem College oder einer Universität, aber es war frustrierend. Als das letzte Semester zu Ende ging, war ich erleichtert. Ich würde sie vermissen, weil sie mir, wohlgemerkt, viel Freude machten – intelligent, witzig, charmant, lieb und verrückt, wie sie waren. Und doch brauchte ich eine Pause, eine sehr, sehr lange Pause.
Die Frau, die mir diese Arbeit am College vermittelte, hatte zwanzig Jahre lang mit Schwarzen Studierenden gearbeitet. Als sie in Rente ging, war sie so erschöpft, dass sie nicht über sie reden konnte, ohne von ihrer Frustration überwältigt zu werden – über ihren Unwillen, sich zu verändern, das Unrecht, das ihnen immer wieder zugefügt wurde, ihren fehlenden Glauben daran, dass es anders und besser gehen könnte, die jämmerlich unzureichenden Bemühungen der Verwaltung, etwas zu verändern, all das. Ich verstand auch ihre Erschöpfung. Ich brauchte vier Jahre dazu, aber dann war es mir klar. Und trotzdem. Es gab ein Neujahrsbankett, bei dem die Studierenden mich überraschten. Sie schenkten mir eine Plakette und hielten eine wunderschöne Rede, in der sie sagten, ich sei der Inbegriff von Anstand und Integrität. Sie dankten mir dafür, dass ich erkannte, wie überaus begabt und kraftvoll sie sind. Sie sagten, ich stünde für sie ein, auch wenn sie Fehler machten, und dass ich zur Familie gehöre, was unsere Beziehung sehr gut beschrieb: bedingungslos und kompliziert. Sie sagten eine Menge anderer ungeheuer schmeichelhafter Dinge. Sie hätten nichts davon zu sagen brauchen. Ich verließ das College mit dem Gefühl, sie erreicht zu haben. Ganz gewiss hatten sie mich erreicht und mir das Gefühl gegeben, ein Teil von etwas zu sein, obwohl es ja meine Aufgabe war, ihnen das Gefühl zu geben, ein Teil von etwas zu sein.
Als Mitglied des Lehrkörpers an meinem jetzigen College habe ich die Organisation der Schwarzen Studierenden bis heute noch nicht kontaktiert, weil mir die Kraft dazu noch fehlt. Ich fühle mich schuldig, weil ich mir so lange damit Zeit lasse. Ich fühle mich verantwortlich. Ich fühle mich schwach und dumm.
Im ersten Jahr hatte ich einen Schwarzen Studenten in meiner Klasse, der das Gefühl hatte, wegen seiner Hautfarbe von mir schikaniert zu werden. Man hat mir gesagt, dass Schwarze Lehrende öfter vor diesem Problem stehen. Ich habe diesen jungen Mann nicht schikaniert. Erstens, weil ich für solche Spielchen keine Zeit habe. Und zweitens, weil ich von all meinen Studenten und Studentinnen Leistung verlange, ohne Ausnahme. Er hatte vorher einen sehr guten Notendurchschnitt und konnte einfach nicht glauben, dass ich ihm nicht ständig Einsen gab. Er konnte nicht glauben, dass ich ihn nicht schon dafür lobte, dass er mit guten Noten zu mir kam. Und ich konnte diese Arroganz nicht glauben. Ich hatte das Gefühl, er wollte mich mit seiner Besonderheit, mit seiner Erstklassigkeit beeindrucken und mich dazu bringen, dass ich ihn aufgrund seiner vergangenen Leistungen beurteilte, statt aufgrund dessen, was er in meinem Unterricht tat. Einmal sagte er mir: »Ich bin nicht wie die anderen Scheißschwarzen auf dem Campus.« Ich entgegnete, er solle sich gefälligst um eine andere Haltung und eine andere Sprache bemühen. Wir hatten einige recht heftige Debatten. Eine davon war so heftig, dass mein mir bis dahin unbekannter Chef hinter einem Pfeiler versteckt am Tor stehen blieb und lauschte, weil er fürchtete, dass dieser junge Mann gewalttätig werden könnte. Ich selbst fürchtete, dass er gewalttätig werden könnte. Ich brauchte ein ganzes Semester, um das Problem zu erkennen, das ihn umtrieb. Am Ende wurde mir klar, dass er sich unbedingt von denjenigen unterscheiden wollte, die nicht genug wissen, um das College zu schaffen, oder denen es egal ist, ob sie es schaffen oder nicht. Seine Art, das zu tun, seine Besonderheit zu beweisen, war, dass er ständig von seinem hervorragenden Notendurchschnitt sprach. Er bestand alle Prüfungen, und ich weiß nicht, wo er jetzt ist, aber ich hoffe, dass er seine trotzige Antihaltung zum (angeblich von Weißen bestimmten) akademischen Verhaltenskodex nicht sein Leben lang beibehält.
Ich arbeite hart. Ich arbeite in gewissen Fällen auch ohne Geld für meine Arbeit zu bekommen. Ich versuche, etwas zu leisten, wenn ich Leistungen zugesagt habe. Ich versuche, meinen Job gut zu machen. Ich versuche, mich weiterzuentwickeln, dafür verausgabe ich mich. Ich arbeite an der Uni, und ich arbeite zu Hause. Ich nehme die Bewertungen ernst, die ich bekomme, und versuche, meine Schwachpunkte beim Unterrichten auszugleichen, um besser zu werden. Ich sitze mit meinen Kollegen zusammen und denke: Bitte mögt mich. Bitte mögt mich. Bitte mögt mich. Bitterespektiert mich. Hasst mich wenigstens nicht. Die Leute verstehen mich oft falsch, missverstehen meine Motivation. Ständig gibt es Druck, und er macht mir zu schaffen. Ich behaupte, ein Workaholic zu sein, und vielleicht bin ich das auch, aber vielleicht versuche ich einfach, wie dieser Student, allen zu zeigen, dass ich anders und besonders bin.
Als ich noch selbst Studentin war, hörte ich einmal eine Kommilitonin über mich reden. Sie wusste nicht, dass ich sie hören konnte. Sie stand mit anderen zusammen und sagte, ich wäre da, damit die Quote stimmt. Ich ging in mein Zimmer und versuchte, mich auf dem Weg zusammenzureißen. Ich wollte nicht vor aller Augen heulen. Aber kaum hatte ich die Tür hinter mir geschlossen, fing ich an zu schluchzen, denn genau das war meine größte Angst: dass ich nicht gut genug war und dass das jeder wusste. Vom Verstand her wusste ich, dass das absurd war, aber als ich hörte, wie dieses Mädchen und vielleicht andere mich sahen, verletzte es mich tief. Es gab niemanden, mit dem ich darüber reden konnte, weil ich in diesem Studienprogramm die einzige nichtweiße Studierende war. Es gab niemanden, der mich verstehen würde. Natürlich hatte ich Freunde und Freundinnen, gute Freundinnen, die Mitgefühl hätten, aber sie erlebten nicht dasselbe, und ich konnte nie sicher sein, dass sie nicht dasselbe von mir dachten wie das Mädchen.
Ich machte keine Witze mehr darüber, wie faul ich sei. Ich verdreifachte die Zahl der Projekte, für die ich arbeitete. Ich war die meiste Zeit sehr gut. Nur ein paarmal erreichte ich meine Ziele nicht. Ich sorgte dafür, dass ich gute Noten bekam. Ich sorgte dafür, dass meine fachübergreifenden Prüfungen gediegen ausfielen. Ich schrieb Konferenzbeiträge, die angenommen wurden. Ich veröffentlichte. Ich entwarf ein überehrgeiziges Forschungsprojekt für meine Dissertation, bei dem mir selbst schwindlig wurde. Egal, was ich tat, ich hörte eine Frau, irgendeine Frau, die weit weniger geleistet hatte als ich, zu einem Kreis von Mitstudierenden sagen, ich sei diejenige, die es nicht verdiene, zu unserem Studienprogramm zu gehören. Diese Mitstudierenden übrigens dachten nicht daran, mich zu verteidigen. Sie sagten nicht, dass sie das anders sähen. Und das tat auch weh. Ihre Worte hielten mich nächtelang wach. Ich kann sie immer noch hören, diese Worte, ihre hohe Stimme, und wie überzeugt sie von ihrer Meinung war. Bei der Arbeit frage ich mich ständig: Glauben diese Leute, ich bin nur wegen derQuote hier? Ich frage mich: Verdiene ich es, hier zu sein? Ich frage mich: Arbeite ich genug? Ich habe einen Doktortitel, den ich verdammt noch mal verdient habe, und ich frage mich ständig, ob ich gut genug sei. Das ist absurd, irrational und anstrengend. Nein, es ist deprimierend.
Ich weiß, das alles ist vielleicht verrückt, aber für mich ist es ein Teil der Wahrheit.
Ich schreibe immer noch, um endlich irgendwo anzukommen, wo ich hinpasse und hingehöre, aber ich finde auch Menschen, die zu mir gehören, an den unerwartetsten Orten – Kalifornien, Chicago, Upper Michigan und anderswo, manchmal an Orten, die auf keiner Karte verzeichnet sind. Schreiben überbrückt viele Unterschiede. Auch Güte überbrückt Unterschiede, oder die gemeinsame Liebe zu OneTree Hill oder Lost oder zu wunderbaren Büchern oder schlechten Filmen. Es gibt Momente, in denen ich mir wünschte, das Finden von Gleichgesinnten könnte so leicht sein wie das Eintippen von ein paar persönlichen Eigenschaften auf einer Webseite, worauf ein Algorithmus mir dann zeigt, wo ich hingehöre. Und dann wird mir klar, dass es das ist, was das Internet und soziale Netzwerke für mich getan haben – ich habe viele Gleichgesinnte gefunden.
Aber vielleicht möchte ich gar nicht, dass der Algorithmus das für mich tut.
Ein Algorithmus ist eine Methode zur Problemlösung nach einer begrenzten Zahl von Schritten. Ein Algorithmus führt zur Lösung eines Problems, das zu komplex ist, als dass der menschliche Verstand es lösen könnte.
Das ist es nicht, wonach ich suche. John Louis von Neumann sagte: »Wenn Leute nicht glauben, dass Mathematik einfach ist, dann nur deshalb, weil sie nicht verstehen, wie kompliziert das Leben ist.« Die Mathematik mag einfach sein, doch die komplexen Probleme von Race und Kultur sind oft nicht zu entwirren. Man kann sie in einem einzigen Essay oder Buch oder Film nicht klären.
Ich werde über die Schnittpunkte dieser Probleme weiterhin nachdenken und schreiben, als Schriftstellerin und Lehrende, als Schwarze Frau und als bad feminist – als schlechte Feministin –, bis ich nicht länger das Gefühl habe, die Verwirklichung meiner Wünsche wäre unmöglich. Ich will nicht länger glauben, diese Probleme seien zu komplex für uns.
Fragwürdige Privilegien
Als ich klein war, flog ich mit meinen Eltern und der ganzen Familie in den Ferien nach Haiti. Für meine Eltern war es eine Heimkehr. Für meine Brüder und mich war es ein Abenteuer, manchmal eine lästige Sache und immer eine wertvolle Lektion über Privilegien und die Gnade eines amerikanischen Passes. Bevor ich Haiti besuchte, hatte ich keine Ahnung, was Armut wirklich ist, und welchen Unterschied es gibt zwischen relativer und absoluter Armut. Nackte Armut zu sehen war etwas, was mich tief berührte.
Bis heute erinnere ich mich an meinen ersten Besuch und wie bei jeder Kreuzung unser Auto von schweißüberströmten Männern und Frauen umringt wurde, die ihre dünnen Arme ausstreckten und auf ein paar Gourdes oder amerikanische Dollars hofften. Ich sah die riesigen Slums, die Hütten, in denen ganze Familien hausten, den in den Straßen aufgehäuften Müll, aber auch die herrlichen Strände und die jungen Männer in Uniform, die uns Coca-Cola in Glasflaschen brachten und aus Palmwedeln Hüte und Boote für uns machten. Für ein Kind war es schwierig zu begreifen, dass es diesen Kontrast gab zwischen der unentrinnbaren Armut und dem obszönen Luxus auf der anderen Seite, und dann die Vereinigten Staaten, nur ca. 1200 Kilometer entfernt, mit all den prächtigen Städten und den gepflegten Autobahnen, dem fließenden Wasser und dem gut ausgebauten Stromnetz. Erst viele, viele Jahre später wurde mir klar, dass ich das Wissen um Privilegien schon in einer Zeit erworben hatte, als ich noch gar nicht in der Lage war, darüber nachzudenken.
Ein Privileg ist ein Recht oder eine Freiheit, und es funktioniert wie eine besondere Vergünstigung, ein Vorteil, ein Monopol. Es gibt das Race-Privileg, das Gender-(und Gender-Identitäts-)Privileg, das Privileg der Heterosexualität, das ökonomische Privileg, das gesundheitlich bedingte Privileg, das Privileg der Bildung, der Religion und so weiter und so fort. An einem gewissen Punkt kann man nicht anders, als sich dem Privileg zu ergeben, das man hat. Fast jeder, besonders in den hochentwickelten Ländern, hat irgendetwas, was jemand anders nicht hat, irgendetwas, was sich jemand anders sehnlichst wünscht.
Das Problem ist, dass die Kulturkritiker schon so oft und so inhaltsleer über Privilegien geredet haben, dass die Bedeutung des Wortes nicht mehr ganz klar und zu einem Hintergrundrauschen geworden ist und man kaum noch hinhört, wenn es auftaucht.
Es war äußerst schwierig für mich, mein Privileg anzuerkennen und zu akzeptieren. Und es ist mir noch immer nicht ganz gelungen. Ich bin eine Frau, ich bin nicht weiß, und ich bin das Kind von Einwanderern, aber ich wuchs auch in einem Haushalt der Mittelschicht, später der oberen Mittelschicht, auf. Meine Eltern erzogen meine Geschwister und mich in einer strengen, aber liebevollen Umgebung. Sie sind bis heute glücklich verheiratet, daher hatte ich nie etwas mit Scheidung oder schwer erträglichen Ehestreitigkeiten zu tun. Ich ging auf Eliteschulen. Ich hatte genug Geld, um meinen Master und meinen Doktor zu machen. Ich bekam sofort eine gute Stelle am College. Meine Rechnungen sind bezahlt. Ich habe Zeit und Geld genug, um auch mal leichtsinnig sein zu können. Ich habe eine Agentin, und es gibt Bücher von mir. Wenn ich etwas veröffentliche, werde ich wahrgenommen. Mein Leben ist alles andere als vollkommen, aber es ist irgendwie beschämend für mich, dass ich akzeptieren muss, ein privilegierter Mensch zu sein.
Es ist aber genauso schwierig für mich zu erkennen, inwiefern ich nicht privilegiert bin und meine Privilegien mich nicht auf magische Weise vor einer Welt voller Verletzungen beschützt haben. In meinen dunkleren Zeiten weiß ich nicht, was schrecklicher ist – Schwarz zu sein oder eine Frau zu sein. Ich bin froh, dass ich beides bin, aber die Welt kommt mir immer wieder dazwischen. Es gibt jede Menge ärgerlicher Besserwisser, die mich daran erinnern, wo mein Platz in der Welt ist: irgendwelche Leute, die mir auf dem Unigelände den Parkplatz streitig machen, weil sie sich einfach nicht vorstellen können, dass ich ein Mitglied des Lehrkörpers bin; die beharrlichen Bemühungen von Gesetzgebern, die den weiblichen Körper mit Ge- und Verboten belegen; Belästigungen auf der Straße; Fremde, die meine Haare berühren wollen.
Mit der Zuerkennung von Privilegien ist meist gemeint, dass Privilegierte es leichter haben als andere, und diejenigen, die so bezeichnet werden, ärgert dieses Etikett natürlich, weil das Leben für fast jeden Menschen hart ist. Weiße Männer zum Beispiel. Sie neigen dazu, unverzüglich in die Abwehrhaltung zu gehen (und manchmal kann man das durchaus verstehen). Sie sagen: »Es ist nicht meine Schuld, dass ich als weißer Mann geboren wurde«, oder: »Ich bin doch auch [irgendetwas, was das Privileg konterkariert]«, statt einfach zu akzeptieren, dass sie in dieser einen Hinsicht tatsächlich einen Vorteil haben, der anderen fehlt. Ein Privileg in einer oder in mehreren Domänen zu haben heißt ja nicht, dass man generell privilegiert lebt. Zu akzeptieren, dass man ein Privileg oder mehrere Privilegien hat, ist nicht leicht, aber eigentlich wäre das schon der wesentliche Schritt. Ich erinnere mich selbst regelmäßig daran, dass die Anerkennung meines Privilegs nicht bedeutet, dass ich leugne, wie oft ich marginalisiert wurde und immer noch werde und wie sehr ich darunter gelitten habe.
Wenn man sein Privileg oder seine Privilegien einmal anerkannt hat, muss man gar nichts weiter tun. Man muss sich nicht dafür entschuldigen. Man muss das Ausmaß dieser Privilegien verstehen und die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, und man muss sich dessen bewusst sein, dass es Menschen gibt, die anders sind als man selbst und die die Welt in einer Weise erfahren, über die man selbst vielleicht nie etwas erfährt. Dass diese Menschen Dinge erleiden, über die man nie etwas erfahren kann. Aber man könnte sein Privileg auch zum allgemeinen Guten nutzen, könnte versuchen, die Chancen für alle zu verbessern, für soziale Gerechtigkeit zu arbeiten, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, wie die Nichtprivilegierten in unserer Welt ausgebeutet und entrechtet werden. Wir haben gesehen, was die Anhäufung von Privilegien bewirken kann, und die Folgen sind beschämend.
Wenn man über Privilegien spricht, beginnen manche Leute ein sehr albernes und gefährliches Spiel zu spielen, in dem verschiedene demografische Eigenschaften durcheinandergeworfen und neu zusammengesetzt werden, um den Gewinner im Privilegienspiel zu ermitteln. Wer würde im Kampf der Privilegien gewinnen, der queere weiße Mann oder die queere asiatische Frau? Wer würde gewinnen, der weiße Mann aus der Arbeiterklasse oder die reiche mexikanische Frau mit Behinderung? Wir könnten das Privilegienspiel tagelang spielen und nie einen Gewinner ermitteln, denn es bringt nur den Spielenden Spaß und ist letzten Endes nichts als mentale Masturbation.
Es gibt zu viele Leute, die als selbst ernannte Privilegienpolizisten in Auditorien und Vortragssälen unterwegs sind. Sie erinnern die Menschen an ihre Privilegien, egal, ob diese Menschen ihre Privilegien leugnen oder nicht. Besonders im Internet lauert das Privilegiengespenst überall. Wenn jemand über irgendeine Erfahrung schreibt, gibt es immer jemand anders, der mit zitterndem Finger darauf hinweist, dass der Schreibende in vieler Hinsicht privilegiert sei. Wie kann es jemand wagen, von einer persönlichen Erfahrung zu sprechen, ohne Rechenschaft über alle möglichen Privilegien beziehungsweise deren Fehlen abzulegen? Wir würden in einer Welt des Schweigens leben, wenn die Einzigen, die über Erfahrung oder über kulturelle Unterschiede schreiben oder sprechen dürften, diejenigen wären, die in keiner Hinsicht privilegiert sind.
Wer andere anklagt, im Besitz von Privilegien zu sein, will selbst gehört und gesehen werden. Dieses Bedürfnis ist intensiv und oft verzweifelt, und es entspringt den vielen früheren und immer noch andauernden Versuchen, marginalisierte Gruppen zum Schweigen zu verdammen und unsichtbar zu machen. Müssen wir unser Bedürfnis, gehört und gesehen zu werden, befriedigen, indem wir andere daran hindern, sich Gehör und Aufmerksamkeit zu verschaffen? Negiert der Besitz von Privilegien automatisch alles, was ein privilegierter Redner uns und der Welt zu sagen hat? Sollen wir zum Beispiel alles ignorieren, was weiße Männer zu sagen haben?
Wir brauchen einen Ort, an dem wir als Beobachtende und Erkennende über Privilegien diskutieren können, statt als Anklagende. Wir müssen in der Lage sein zu argumentieren, ohne uns vor der Drohung des Privilegs zu fürchten. Wir müssen aufhören, die Olympischen Spiele der Privilegien und der Unterdrückung zu spielen, weil das zu nichts führt. Wir müssen andere, wirkungsvollere Arten finden, miteinander zu sprechen, ohne die Unterschiede zu verwischen. Wir sollten fähig sein zu sagen: »Das ist meine Wahrheit«, und diese Wahrheit sollte im Raum stehen, ohne dass hundert empörte Stimmen über sie herfallen und den Eindruck erwecken, dass multiple Wahrheiten nicht koexistieren können. Denn gibt es nicht einen Punkt, an dem Privilegien mit der Sache nichts zu tun haben?
Privilegien sind relativ und kontextuell. Nur wenige Menschen in der entwickelten Welt, und besonders in den Vereinigten Staaten, haben überhaupt kein Privileg. Unter denjenigen von uns, die zur intellektuellen Community gehören, gibt es unendlich viele Privilegien. Wir haben Zeit für uns und die Möglichkeit, regelmäßig das Internet zu konsultieren. Wir haben die Freiheit, unsere Meinung zu sagen, ohne Bestrafung oder Rache fürchten zu müssen. Wir haben Smartphones und Tablets und Laptops. Wenn Sie diesen Essay lesen, sind Sie schon privilegiert. Es mag schwer zu akzeptieren sein, ich weiß, aber wenn Sie Ihre privilegierte Situation nicht erkennen, haben Sie noch eine Menge Arbeit vor sich: Sie sollten endlich damit anfangen.
Typisch Anfänger
Ich gehe zur Schule und dann ans College, schreibe ein paar Prüfungen und ziehe schließlich in eine sehr kleine Stadt, um die herum nur Kornfelder sind. Ich lasse jemanden hinter mir. Ich sage mir, ich habe so hart gearbeitet, ich kann mich nicht für einen Mann entscheiden statt für eine Karriere. Ich möchte mich für den Mann entscheiden statt für die Karriere. Ich miete eine Wohnung, die schönste Wohnung, die ich als Erwachsene je hatte. Ich habe eine Gästetoilette. Nicht dass ich Leben retten würde, aber ich versuche, keine zu zerstören.
Das ist ein Traum, sagen alle – ein guter Job mit der Aussicht auf eine richtig gute Karriere. Ich habe ein Büro, das ich nicht mit zwei oder vier Leuten teilen muss. Mein Name steht eingraviert auf dem Türschild. Mein Name ist korrekt geschrieben. Ich habe einen eigenen Drucker. Dieser Luxus kann nicht überbewertet werden. Ich drucke irgendein Dokument aus; ich seufze glücklich, als das Blatt herausgleitet, warm. Ich habe ein Telefon und eine eigene Nummer, und wenn Leute diese Nummer wählen, wollen sie oft mich sprechen. Es gibt eine Menge Regalbretter, aber ich habe meine Bücher lieber zu Hause. In jedem Film über Professoren, den ich je gesehen habe, stehen Bücher im Regal. Schnell packe ich meine drei Kisten aus, Zeug aus dem College – viel Ramsch, Bücher, die ich sicher nie wieder aufschlagen werde –, aber jetzt bin ich Professorin. Ich muss Bücher in meinem Büroregal stehen haben. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz.
Ich hänge ein Whiteboard an meine Tür. Aus alter Gewohnheit. Alle paar Wochen stelle ich eine neue Frage. Was ist dein Lieblingsfilm? (Pretty Woman) Was ist dein Lieblingsmusical? (West Side Story) Was wünschst du dir zu Weihnachten? (Inneren Frieden.) Neu ist dazugekommen: Was ist dein Lieblingscocktail? Beste Antwort: »Der, zu dem ich eingeladen werde.«
Die Sekretärin erklärt mir das Wichtigste: Wo ist der Briefkasten, wo finde ich Bürozubehör, den Code für den Kopierer. Ich vergesse ihn Woche für Woche. Sie ist verbindlich, geduldig, freundlich, aber wenn man sie verärgert, kann man sich auf was gefasst machen. Ich gelobe, sie niemals zu verärgern.
Die Orientierungswoche beginnt nervtötend mit einer Studentin, die akustische Gitarre spielt. Ein bedrohliches Mitsummen aus vielen unmusikalischen Kehlen erfüllt den Raum. Die Gitarristin hat Schwierigkeiten, die Töne zu treffen. Die meisten im Publikum zucken immer wieder merklich zusammen. Ich verstecke mich in der letzten Reihe. In den nächsten beiden Tagen sammle ich Wissen an, das ich nie mehr nutzen werde – vor allem in Mathe.
Ich werde drei Klassen unterrichten, zwei davon haben Stoff zu lernen, den ich nie zuvor unterrichtet habe. Es stellt sich heraus, dass Leute einem glauben, wenn man einfach behauptet, etwas zu können.
Zehn Minuten vor meiner ersten Unterrichtsstunde renne ich zur Toilette und übergebe mich. Ich habe Angst, in der Öffentlichkeit zu reden, was das Unterrichten nicht erleichtert.
Als ich das Klassenzimmer betrete, starren die Studierenden mich an, als wäre ich jetzt der Chef. Sie warten darauf, dass ich etwas sage. Ich starre zurück und warte, dass sie etwas tun. Es ist ein wortloser Machtkampf. Schließlich sage ich ihnen, was sie tun sollen, und sie tun es. Mir wird klar, dass ich tatsächlich der Chef bin. Wir werden mit Legos spielen. Ein paar Minuten lang verblüffe ich sie, weil ich Spielzeug mitgebracht habe.
Wenn man drei Klassen unterrichtet, braucht man ein gutes Gedächtnis, um sich all die Namen zu merken. Oft verschwimmen die Gesichter. Es dauert fast drei Wochen, bis ich Ashley A. und Ashley M. auseinanderhalten kann, und Matt und Matt und Mark und Mark und so weiter. Ich nehme Zuflucht zum ausgestreckten Zeigefinger. Ich orientiere mich an den Farben. Sie im grünen Shirt. Sie mit der orangefarbenen Mütze.
Ich bekomme mein erstes Gehalt. Es kommt einmal im Monat, was eine Art von Haushaltsführung erzwingt, zu der ich nicht fähig bin. Ungefähr ab dem dreiundzwanzigsten wird das Leben ungemütlich. Ich habe so lange studiert, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass die monatliche Überweisung vier Stellen hat plus etwas nach dem Komma. Dann sehe ich, wie viel ein Mann bekommt. Verdammte Typen.
Die Studierenden können nichts mit mir anfangen. Ich trage Jeans und Sneakers. Ich habe Tattoos auf den Armen. Ich bin groß. Ich bin nicht zierlich. Ich bin das Kind von Einwanderern. Viele meiner Studierenden hatten noch nie eine Schwarze Professorin. Da kann ich ihnen leider nicht helfen. Ich bin die einzige Schwarze Professorin in meinem Department. Das wird sich wahrscheinlich mein Leben lang nicht ändern, egal, wo ich unterrichte. Ich bin daran gewöhnt. Ich wünschte, es wäre anders. Es scheint eine stillschweigende Übereinkunft darüber zu geben, wie viele akademische Stellen nichtweiße Profs bekommen dürfen. Ich habe es satt, die Einzige zu sein.
Wenn ich als Studentin gezwungen war, den endlosen langweiligen Tiraden eines Professors oder einer Professorin zuzuhören, dachte ich immer: So werde ich nie sein. Eines Tages halte ich eine Vorlesung und merke plötzlich, dass ich genau dieselbe bin. Ich beobachte die Studierenden; die meisten machen sich Notizen und starren mich mit jenem lähmend-leeren Blick an, der bedeutet: Ich wünschte, ich wäre woanders. Ich denke: Ich wünschte, ich wäre woanders. Ich rede immer schneller, um unserem gemeinsamen Elend zu entkommen. Meine Sätze verlieren den Zusammenhang. Ihr leerer Blick verfolgt mich den ganzen Tag und noch länger.
Ich halte die Verbindung zu meiner engsten Freundin aus dem College aufrecht. Unser Job macht uns beiden Spaß, aber die Lernkurve ist steil. Es gibt kein flaches Ende. Ständig fallen uns Metaphern ein, die sich ums Ertrinken drehen. In langen Gesprächen stellen wir uns die Frage, ob wir wirklich richtige moderne Frauen sein wollen. Wir müssen so viele Noten geben. Und die Vorstellung, an einem sonnigen Vormittag zu putzen und zu kochen, kommt einem überaus anziehend vor, wenn man einen Stapel Semesterarbeiten zu korrigieren hat.
Als ich den Gang hinuntergehe, höre ich eine junge Frau immer wieder sagen: »Frau Dr. Gay!«, und ich denke: Diese Frau Dr. Gay muss ziemlich unhöflich sein, dass sie das arme Mädchen einfach ignoriert. Ich drehe mich um und sage etwas, und erst dann fällt mir auf, dass das Mädchen mich meint.
Ich denke sorgenvoll darüber nach, dass einige meiner Studierenden keine Kleidungsstücke besitzen mit Reißverschlüssen oder Knöpfen oder anderen Mitteln des Verschließens und Festhaltens. Ich sehe jede Menge Wörter, einige schon verblasst, auf Hintern, unter BH-Trägern und schlecht sitzenden Hosen. Im Winter liegt draußen Schnee und Eis, und die jungen Männer kommen in Shorts und Flipflops in den Unterricht. Ich mache mir Sorgen um ihre Füße, ihre armen kleinen Zehen.
Helikoptereltern schreiben mir E-Mails, sie wollen Auskünfte über ihre Kinder. Wie geht es meinem Sohn? Kommt meine Tochterregelmäßig zum Unterricht? Ich rege sie dazu an, mit ihren Kindern direkt zu kommunizieren. Ich gebe ihnen höflich zu verstehen, dass es gesetzlich verboten ist, ihnen ohne das schriftliche Einverständnis ihrer Kinder solche Auskünfte zu geben. Das Kind ist selten einverstanden.
In der neuen Stadt gibt es nichts Neues, und ich kenne keine Menschenseele. Die Stadt ist ein flaches, verschrammtes Stück Land mit halb aufgegebenen Ladenzeilen. Und dann ist da das Getreide, sehr viel davon, überall, meilenweit. Die meisten meiner Kollegen und Kolleginnen leben achtzig Kilometer entfernt. Die meisten meiner Kollegen und Kolleginnen haben Familie. Ich fahre nach Norden, nach Chicago. Ich fahre nach Osten, nach Indianapolis. Ich fahre nach Süden, nach St. Louis. Ich fange an, regelmäßig Scrabble zu spielen, und gewinne mein erstes Turnier. In der letzten Runde treffe ich auf meinen Angstgegner, der sich über meinen Sieg so ärgert, dass er mir den Handschlag verweigert und wutschnaubend aus dem Raum stürmt. Das herrliche Gefühl dieses Sieges bleibt lange bestehen. Als ich ihn bei einem anderen Turnier wiedersehe, zeigt er auf mich und sagt: »Noch zwei Partien, dann bist du weg vom Fenster.« Er irrt sich.
Meine eigenen Eltern fragen: Wie geht es unserer Tochter? Ich verschweige ihnen das meiste.
Manchmal ertappe ich Studierende während des Unterrichts, wie sie unter dem Tisch auf ihre Handys starren. Offenbar halten sie sich für unsichtbar. Es ist so komisch wie beunruhigend. Manchmal sage ich unwillkürlich: »Doch, ich sehe Sie.« Bei anderen Gelegenheiten konfisziere ich ihre elektronischen Geräte.
Manchmal, wenn die Studierenden in Gruppen arbeiten, schaue ich verstohlen auf mein eigenes Telefon und halte mich für unsichtbar. Ich bin Teil des Problems.
Ich versuche, den Unterricht so zu gestalten, dass es Spaß macht, dass es mitreißend ist, dass experimentiert wird. Wir verfassen eine parlamentarische Debatte über soziale Fragen. Wir nutzen Twitter, um zu lernen, wie man Microcontent in sozialen Medien gestaltet. Wir spielen Quizshow, um zu lernen, wie man professionelle Berichte schreibt. College und Kindergarten sind nicht so verschieden, wie man denkt. Jeden Tag frage ich mich: Wie schaffe ich es, diese Leute sinnvoll zu beschäftigen, wie kann ich sie in fünfzig Minuten gleichzeitig bilden und unterhalten? Wie kriege ich sie dazu, mich nicht mit leeren Blicken anzustarren? Wie schaffe ich es, dass sie lernenwollen? Es ist anstrengend. Manchmal denke ich, die Antwort auf all diese Fragen ist: Ich kann es nicht.
Eine Seuche rafft alle Großmütter hinweg. In einer bestimmten Woche sterben die älteren Verwandten meiner Studierenden alarmierend häufig. Ich habe den Wunsch, die verbleibenden Großmütter zu warnen. Ich will, dass sie überleben. Die Entschuldigungen, die die Studierenden vorbringen, wenn sie schwänzen oder keine Hausaufgaben vorweisen können, amüsieren mich in ihrer Absurdität. Sie glauben, ich würde das wissen wollen. Sie glauben, ich bräuchte Erklärungen. Sie glauben, ich wüsste nicht, dass sie lügen. Manchmal sage ich einfach: »Ich weiß, dass Sie lügen. Besser, Sie sagen gar nichts.«
Ich versuche, nicht alt zu sein. Ich versuche, nicht zu denken: Als ich in eurem Alter war …, aber oft erinnere ich mich tatsächlich daran, wie es war, als ich in ihrem Alter war. Die Schule gefiel mir; ich lernte gern und arbeitete hart. Die meisten meiner Mitschülerinnen taten das nicht. Wir feierten nächtelang, aber wir tauchten immer rechtzeitig im Unterricht auf und taten, was wir tun mussten. Eine alarmierende Zahl meiner Studierenden scheint das College nicht besuchen zu wollen