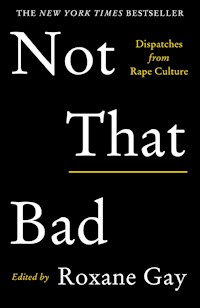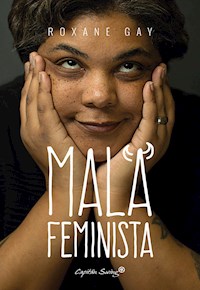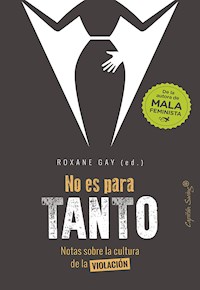10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Halb so schlimm darf nicht mehr gut genug sein! - 29 Essays und Geschichten über Vergewaltigung und sexuelle Belästigung - tief persönlich und schonungslos ehrlich.
»Alles daran war schrecklich, aber es war halb so schlimm.« 29 Beitragende schreiben über eine Welt, in der man als Betroffene*r von sexueller Gewalt und Aggression die Folgen oft allein ertragen muss und sich einredet, dass es ganz so schlimm nicht gewesen sein kann. Eine Welt, in der Überlebende von Missbrauch – falls sie sich doch trauen, ihre Stimme zu erheben – routinemäßig diskreditiert, verunglimpft, verleumdet, herablassend behandelt, verspottet, beschämt, beleidigt und schikaniert werden. Eine Welt, in der es normal zu sein scheint, in einer Rape Culture zu leben, Kindesmissbrauch zu dulden und auf der Straße belästigt zu werden. »Halb so schlimm« versammelt Essays, die sich oft sehr persönlich und immer unerschrocken ehrlich zeigen, die unsere Welt spiegeln, wie sie ist, und gleichzeitig endlich klarstellen wollen, dass halb so schlimm nicht mehr gut genug sein darf.
Ausgewählt von Kulturkritikerin und Bestsellerautorin Roxane Gay.
Mit Beiträgen von: Aubrey Hirsch, Jill Christman, Claire Schwartz, Lynn Melnick, Brandon Taylor, Emma Smith-Stevens, AJ McKenna, Lisa Mecham, Vanessa Mártir, Ally Sheedy, xTx, So mayer, Nora Salem, Lyz Lenz, Amy Jo Burns, V.L. Seek, Michelle Chen, Gabrielle Union, Liz Rosema, Anthony Frame, Samitha Mukhopadhyay, Miriam Zoila Pérez, Zoë Medeiros, Sharisse Tracey, Stacey May Fowles, Elisabeth Fairfield Stokes, Meredith Talusan, Nicole Boyce, Elissa Bassist
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
»Alles daran war schrecklich, aber es war halb so schlimm.« 29 Beitragende schreiben über eine Welt, in der man als Betroffene*r von sexueller Gewalt und Aggression die Folgen oft allein ertragen muss und sich einredet, dass es ganz so schlimm nicht gewesen sein kann. Eine Welt, in der Überlebende von Missbrauch – falls sie sich doch trauen, ihre Stimme zu erheben – routinemäßig diskreditiert, verunglimpft, verleumdet, herablassend behandelt, verspottet, beschämt, beleidigt und schikaniert werden. Eine Welt, in der es normal zu sein scheint, in einer Rape Culture zu leben, Kindesmissbrauch zu dulden und auf der Straße belästigt zu werden. »Halb so schlimm« versammelt Essays, die sich oft sehr persönlich und immer unerschrocken ehrlich zeigen, die unsere Welt spiegeln, wie sie ist, und gleichzeitig endlich klarstellen wollen, dass halb so schlimm nicht mehr gut genug sein darf.
Ausgewählt von Kulturkritikerin und Bestsellerautorin Roxane Gay.
Mit Beiträgen von:
Aubrey Hirsch, Jill Christman, Claire Schwartz, Lynn Melnick, Brandon Taylor, Emma Smith-Stevens, AJ McKenna, Lisa Mecham, Vanessa Mártir, Ally Sheedy, xTx, So Mayer, Nora Salem, Lyz Lenz, Amy Jo Burns, V. L. Sleek, Michelle Chen, Gabrielle Union, Liz Rosema, Anthony Frame, Samhita Mukhopadhyay, Miriam Zoila Pérez, Zoë Medeiros, Sharisse Tracey, Stacey May Fowles, Elisabeth Fairfield Stokes, Meredith Talusan, Nicole Boyce, Elissa Bassist
Halb so schlimm
29 Essays über Rape Culture
Herausgegeben von Roxane Gay
Aus dem amerikanischen Englisch von Cornelia Röser
Die englische Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel »Not that bad« bei Harper Perennial, einem Imprint von HarperCollins.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstausgabe September 2024
im btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © der Originalausgabe 2018 by Roxane Gay
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2024 im btb Verlag, München
Umschlaggestaltung: semper smile | München
nach einem Entwurf von © Robin Bilardello/Harper Collins
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
MSP · Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-25851-1V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/penguinbuecher
Für alle, die in der Rape Culture Narben davongetragen haben und trotzdem überleben
Inhalt
ROXANEGAY – Einleitung
AUBREYHIRSCH – Fragmente
JILLCHRISTMAN – Slaughterhouse Island
CLAIRESCHWARTZ – Und die Wahrheit ist: Ich habe keine Geschichte
LYNNMELNICK – Die glücklichste MILF in Brooklyn
BRANDONTAYLOR – Zuschauer
Meine Familie, mein Vergewaltiger und das Trauern im Internet
EMMASMITH-STEVENS – The Sun
AJMCKENNA – Dreiundsechzig Tage
LISAMECHAM – Nur die Einsamen
VANESSAMÁRTIR – Was ich mir sagte
ALLYSHEEDY – Stasis
xTx – Wie wir lernen, Mädchen zu sein
SOMAYER – Floccinaucinihilipilification
NORASALEM – Der Lebenszerstörer
LYZLENZ – Die wütenden Frauen
AMYJOBURNS – Brave Mädchen
V. L. SLEEK – Äußerster Widerstand
Das Recht und die lesbische Frau oder: Wie ich in einem Seminarraum saß und meine männlichen Kommilitonen über die Definition von Gewalt und Einvernehmlichkeit diskutierten
MICHELLECHEN – Körper gegen Grenzen
GABRIELLEUNION – Den Schandfleck entfernen
LIZROSEMA – What We Didn’t Say
ANTHONYFRAME – Ich habe Ja gesagt
SAMHITAMUKHOPADHYAY – Es besser wissen
MIRIAMZOILAPÉREZ – Nicht so laut
Stille Begegnungen mit der Rape Culture
ZOËMEDEIROS – Warum ich aufgehört habe
SHARISSETRACEY – Das perfekte Bild
STACEYMAYFOWLES – Endlich darüber hinwegkommen
ELISABETHFAIRFIELDSTOKES – Ernten, was die Rape Culture sät
Live von den Schlachtfeldern, auf denen man in Amerika zur Frau heranwächst
MEREDITHTALUSAN – Unsichtbare Lichtwellen
NICOLEBOYCE – Es nach Hause schaffen
Zwei Tage danach
ELISSABASSIST – Warum ich nicht Nein gesagt habe
Autor*innen
Danksagung
Literatur
ROXANE GAY Einleitung
Als ich zwölf war, wurde ich im Wald hinter meinem Wohnviertel von einer Gruppe Jungen mit den gefährlichen Absichten böser Männer vergewaltigt. Es war eine schreckliche Erfahrung, die mein Leben verändert hat. Vorher war ich naiv und behütet gewesen. Ich hatte geglaubt, Menschen wären von Natur aus gut, und die Sanftmütigen würden das Erdreich besitzen. Ich hatte Vertrauen und glaubte an Gott. Und dann tat ich es nicht mehr. Ich war gebrochen. Ich hatte mich verändert. Ich werde nie wissen, wer ich gewesen wäre, wenn ich nicht das Mädchen im Wald gewesen wäre.
Als ich älter wurde, lernte ich unzählige Frauen kennen, die alle Arten von Gewalt, Belästigung, sexueller Nötigung und Vergewaltigungen erlitten hatten. Ich hörte ihre Leidensgeschichten und dachte: Was ich durchgemacht habe, war schlimm, aber es könnte schlimmer sein. Die meisten meiner Narben sind verblasst. Ich habe gelernt, mit meinem Trauma zu leben. Das Mädchen, das ich früher war, haben diese Jungen getötet, aber sie haben mich nicht ganz getötet. Sie haben mir keine Pistole an den Kopf gehalten und kein Messer an die Kehle, und sie haben nicht gedroht, mich umzubringen. Ich habe überlebt. Ich habe gelernt, für mein Überleben dankbar zu sein, auch wenn Überleben nicht viel zu sein schien.
Vielleicht tröstete es mich, wenn ich mir sagte, was ich durchgemacht hatte, sei »halb so schlimm«. Indem ich mir erlaubte zu denken, dass eine Gruppenvergewaltigung »halb so schlimm« sei, konnte ich mein Trauma auf etwas Fassbares herunterbrechen, auf etwas, das ich mit mir herumtragen konnte, statt von seiner Größe vernichtet zu werden.
Aber auf lange Sicht schadete mir das Kleinreden meiner Erlebnisse mehr, als dass es mir half. Ich schuf einen unrealistischen Maßstab dafür, welche Behandlungsweisen in Beziehungen, Freundschaften und bei zufälligen Begegnungen akzeptabel waren. Oder besser: Hätte ich eine Messlatte dafür gehabt, wie ich es verdiente, behandelt zu werden, dann hätte diese Latte tief unter dem Erdboden gelegen. Wenn eine Gruppenvergewaltigung halb so schlimm war, dann war es noch viel weniger schlimm, wenn man gestoßen wurde oder von einer fremden Hand so fest am Arm gepackt, dass fünf Blutergüsse zurückblieben, oder wenn einem wegen eines großen Busens hinterhergepfiffen wird oder wenn mir jemand in die Hose griff und sagte, ich solle für die romantische Aufmerksamkeit dankbar sein, weil ich nicht gut genug wäre, und so weiter und so fort. Alles das war schrecklich, aber alles war halb so schlimm. Die Liste dessen, was ich mir gefallen ließ, nahm Ausmaße an, die ich irgendwann nicht mehr mit mir herumschleppen konnte.
Indem ich die Vorstellung des »halb so schlimm« verinnerlichte, wurde ich unheimlich hart gegen mich selbst, weil ich nicht schnell genug »darüber hinwegkam«, während die Jahre vergingen und ich immer noch so viel Schmerz und so viele Erinnerungen mit mir herumtrug.
Dass ich das »halb so schlimm« verinnerlichte, stumpfte mich ab gegenüber schlechten Erfahrungen, die weniger schlimm waren als die schlimmsten Geschichten, die ich gehört hatte. Jahrelang hatte ich völlig unrealistische Vorstellungen davon, unter welcher Art von Erfahrungen man leiden durfte, sodass nur noch sehr wenig übrig blieb. Meine Empathie bekam eine Art Hornhaut.
Ich weiß nicht, wann sich das änderte, wann mir allmählich bewusst wurde, dass alle Erfahrungen mit sexueller Gewalt tatsächlich schlimm sind. Es war nicht die eine große Erleuchtung. Irgendwann hatte ich mich endlich so weit mit meiner Vergangenheit versöhnt, dass ich erkennen konnte: Was ich durchgemacht hatte, war wirklich schlimm; die Erlebnisse von allen anderen waren wirklich schlimm. Irgendwann hatte ich endlich genug Menschen kennengelernt, hauptsächlich Frauen, die ihre schrecklichen Erlebnisse für halb so schlimm hielten, genau wie ich, obwohl sie eindeutig ganz schlimm waren. Ich beobachtete diese abgestumpfte Empathie an Menschen, die jedes Recht gehabt hätten, ihre Wunden offen zu zeigen, und ich fand den Anblick unerträglich.
Als mir die Idee für diese Anthologie kam, wollte ich eine Sammlung von Essays über Rape Culture zusammenstellen – ich dachte an ein paar Reportagen, ein paar persönliche Geschichten, Texte, die sich mit dem Begriff auseinandersetzen. Der Ausgangspunkt sollte die Frage sein, was es bedeutet, in einer Welt zu leben, in der das Wort »Rape Culture« existiert. Mich interessierte der Diskurs über Rape Culture, weil der Begriff oft benutzt wird, man sich aber nur selten damit befasst, was er eigentlich bedeutet. Was bedeutet es, in einer Kultur zu leben, in der es oft eher eine Frage des Wann und nicht des Ob zu sein scheint, dass eine Frau irgendeine Art von sexueller Gewalt erfährt? Was bedeutet es für Männer, sich in dieser Kultur zu bewegen, je nachdem, ob ihnen Rape Culture egal ist, ob sie sich bemühen, sie zu überwinden, oder selbst einen signifikanten oder geringfügigen Teil dazu beitragen?
Die vorliegende Anthologie ist ganz anders geworden, als ich anfänglich beabsichtigt hatte. Als ich die ersten Beiträge erhielt, war ich verblüfft, wie viele persönliche Erfahrungen darunter waren. Da gab es unzählige Geschichten von Personen aus dem gesamten Genderspektrum, die darüber berichteten, wie sie auf die eine oder andere Art sexuelle Gewalt erfahren hatten oder durch enge Beziehungen zu Menschen, die sexuelle Gewalt erfahren hatten, in Mitleidenschaft gezogen wurden. Mir wurde bewusst, dass ich meinen ursprünglichen Plan für diese Anthologie aufgeben musste, um Raum für das zu schaffen, was dieses Buch offenbar unbedingt werden musste: ein Ort, an dem Menschen ihren Erfahrungen eine Stimme geben können, ein Ort, an dem Menschen mitteilen können, wie schlimm es wirklich ist, ein Ort, an dem Menschen zeigen können, in welcher Form die Rape Culture sie geprägt hat.
Durch diese Texte, so hoffe ich, wird sich in dieser tief gespaltenen Kultur etwas verändern. Immer mehr Menschen wird inzwischen bewusst, wie schlimm es wirklich ist. Harvey Weinstein ist in Ungnade gefallen, nachdem eine Reihe von Frauen ihn als Sexualstraftäter benannt haben. Seine Verbrechen wurden offengelegt. Seine Opfer sind, zumindest in einem gewissen Ausmaß, zu ihrem Recht gekommen. Frauen und Männer melden sich zu Wort und nennen Menschen im Verlagswesen, im Journalismus, in der Techbranche beim Namen, die sexuelle Belästigungen oder Schlimmeres begehen. Frauen und Männer sagen: »So schlimm ist es wirklich.« Endlich gibt es für Sexualstraftäter Konsequenzen. Mächtige Männer verlieren ihre Jobs und haben weniger oft die Gelegenheit, Schwächere auszubeuten.
Ich hoffe, dass aus dieser Situation eine Bewegung entstehen wird, und ich hoffe, dass die folgenden Essays einen wichtigen Beitrag dazu leisten. Die hier versammelten Stimmen sind wichtige Stimmen, die Gehör verdienen.
AUBREY HIRSCH Fragmente
Er sagt: »Du solltest damit lieber nicht so herumwedeln.«
Du bist mit deinem Freund James im Speisesaal auf dem Campus und hast gerade eine rostrote Antibabypille aus der Öffnung der blauen Gummihülle gedrückt.
Du sagst: »Das hab ich nicht. Ich nehme sie nur.«
Er sagt: »Du solltest sie in deinem Zimmer nehmen. Allein. Privat.«
»Ich muss sie zum Essen einnehmen«, sagst du, »sonst kriege ich davon Magenschmerzen.« So ist das schon, seit du mit fünfzehn angefangen hast, sie zu nehmen. Jahre bevor du überhaupt Sex hattest, und selbst wenn du mit einem Mann schläfst, hast du solche Angst vor einer ungewollten Schwangerschaft, dass du erst verheiratet sein willst, bevor du ihn in dir kommen lässt.
Du nimmst die Pille, weil deine Periode eine furchtbare Bestie ist. Die Hormone galoppieren durch deinen Körper, du wachst mitten in der Nacht auf und krümmst dich. Dein Magen krampft sich zusammen, deine Eingeweide rebellieren. Die Pille hilft dagegen. Auch wenn du es nicht magst, dass du sie jeden Tag nehmen musst. Schon vom Geruch der blauen Gummihülle wird dir ein bisschen übel, wenn du sie pflichtbewusst jeden Nachmittag zur selben Zeit aus dem Portemonnaie nimmst, um die Bestie in dir im Zaum zu halten.
Er sagt: »Trotzdem sollten das nicht alle sehen. Du willst doch nicht, dass irgendein Typ das mitkriegt und denkt, er kann es mit dir treiben, ohne dass es Konsequenzen hat.«
Du legst dir die Pille auf die Zunge und steckst die Packung wieder in die Tasche. James beobachtet dich, wie du das Wasserglas an die Lippen setzt. Du schluckst. Schwer.
Wenn Rape Culture eine Flagge hätte, wäre das so ein Titteninspektor-T-Shirt.
Wenn Rape Culture eine eigene Küche hätte, wäre das der ganze Scheiß, den man so schlucken muss.
Wenn Rape Culture ein Stadtzentrum hätte, würde es dort nach AXE-Bodyspray riechen und nach dem Parfum, das sie auf Tampons tun, damit die Scheide nach Weichspüler riecht.
Wenn Rape Culture eine Landessprache hätte, wären es Herrenwitze und eine peinliche Lachkonserve. Rape Culture spricht alle Sprachen.
Wenn Rape Culture einen Nationalsport hätte, es wäre … na ja … irgendwas mit Eiern.
Auf der Party trinkst du zu viel, weil du auf dem College bist und weil du immer zu viel trinkst. Die Party ist eine Party wie alle anderen, mit Bier-Pong und basslastiger Musik. Alle trinken Bier mit viel Schaum aus roten Einwegplastikbechern. Bestimmt gibt es irgendwo sogar Schwarzlicht.
Daniel weiß, dass du kein Bier trinkst, deshalb hat er dir eine Flasche billigen Wodka mitgebracht, und du trinkst ihn gemischt mit noch billigerem Orangensaft.
Eine Zeit lang lässt du dich treiben, sprichst mal hier, mal dort mit einem Grüppchen. In der Küche packt ein Junge, ein Baseballspieler, seinen Schwanz aus, um allen zu zeigen, wie groß er ist. Er ist wirklich sehr groß.
Das Letzte, woran du dich erinnerst, ist, dass du dich aufs Sofa legst. Nur kurz die Augen zumachen, denkst du. Nur eine Minute.
Als du aufwachst, liegst du in einem Bett oben im Schlafzimmer, wo du vorher noch nie warst. Daniel liegt neben dir. Du bist angezogen, nur die Schuhe fehlen.
»Hey«, sagst du und drückst die Handflächen gegen die Schläfen. Wenn du fest genug drückst, hört vielleicht das Hämmern auf.
»Du bist eingeschlafen«, sagt er, noch bevor du fragen kannst. »Ich habe dich hochgetragen.«
Du sagst: »Getragen?«
»Ja. Ich wollte dich nicht bei den ganzen Typen da unten auf dem Sofa liegen lassen, bewusstlos, wie Freiwild oder so.«
»Hast du mir die Schuhe ausgezogen?«
»Ja. Damit du schlafen konntest.«
Dein Mund ist trocken. Alles ist verschwommen. Du reibst dir die Augen und holst Luft, um dich bei Daniel zu bedanken, da sagt er: »Ich hab dir auch die Kontaktlinsen rausgenommen.«
Du weißt nicht, wohin sie verschwunden ist, aber ganz plötzlich ist deine Dankbarkeit weg.
Solche Geschichten sind keine Erzählung wert. Sie haben keinen Spannungsbogen, keinen dramatischen Höhepunkt. Eigentlich geht es um nichts. Man stellt sich vor, wie sich die Zuhörerin vorbeugt. »Und was ist dann passiert?« Und du musst sagen: »Nichts. Das ist schon die ganze Geschichte.« »Oh«, sagt sie dann mit schmalen Lippen.
Das sind kleine Ausschnitte von Dingen, die passiert sind, oder von Dingen, über die du nachdenkst. Sie sind nicht sehr spannend, und das weißt du. Es gibt keine echte Bedrohung. Und es gibt keine Auflösung.
Trotzdem wirst du sie nicht los. Du denkst noch darüber nach, nachdem es vorbei ist. Manchmal noch lange danach. Daher weißt du, dass sie in irgendeiner Weise wichtig sind. Deshalb kannst du dich noch daran erinnern, wie es auf dieser Party gerochen hat, während der Geruch vom Eau de Cologne deines Großvaters schon seit Jahren aus deiner Erinnerung verblasst ist.
Wenn du Kreatives Schreiben unterrichtest, begegnen dir irgendwann Texte mit Vergewaltigungsgeschichten.
Die erste Geschichte ist mit voller Absicht eine Vergewaltigungsgeschichte. Ein Student reicht sie in deinem Schreibkurs als Belletristik-Hausaufgabe ein. Darin trifft der Held seine zierliche brünette Englischdozentin allein in einer Kirche. Er zieht eine mit vierundzwanzig Karat vergoldete Pistole mit Perlmuttgriff, hält sie ihr an den Kopf, beugt sie über die Lehne einer Kirchenbank und vergewaltigt sie. Als er fertig ist, fährt er im Cabrio davon und hinterlässt eine Tasche voll Geld auf dem Polizeirevier, um der Strafe zu entgehen.
Die zierliche brünette Englischdozentin bist du selbst. Du bist erst zweiundzwanzig, gerade mal ein paar Jahre älter als dieser Student, der jetzt in deinem Büro sitzt, die Mütze tief ins Gesicht gezogen. Du bist zu schüchtern, um ihn wegen dieses gefährlichen misogynen Drecks zu ermahnen. Was ist, wenn du dich irrst? Was ist, wenn er sich bei deinem Vorgesetzten beschwert? Was ist, wenn er dir in der Unterrichtsbewertung eine schlechte Punktzahl gibt? Stattdessen kritisierst du die Geschichte, was nicht schwer ist: Es ist eine miserable Geschichte. »Der Held ist unsympathisch, und das Ende ist lächerlich.« Das sagst du dem Studenten, der neben dir sitzt und grinst. »Und schau hier«, sagst du, »eine falsche Zeitform, und da, ein Kommafehler.«
In der zweiten Vergewaltigungsgeschichte lernt der Held ein Mädchen auf einer Party kennen. Sie ist schön und betrunken, ihre Augen sind glasig, und sie kann kaum noch sprechen. Als sie nicht mehr gehen kann, trägt der Held, der selbst keinen Tropfen getrunken hat, sie nach draußen an den Strand. Er zieht ihr die Kleider aus und schläft mit ihr, wobei sie leise Stöhngeräusche von sich gibt. Dann zieht er sie wieder an und legt sich neben sie in den Sand.
»Der Ton ist ein bisschen verwirrend«, sagst du dem Studenten, als er in deine Sprechstunde kommt. »Es scheint beinahe romantisch zu sein. Sollen wir den Kerl sympathisch finden, obwohl er das Mädchen vergewaltigt?«
Der Student sieht betroffen und überrascht aus. »Er vergewaltigt sie doch nicht. Sie schlafen miteinander.«
Du zeigst sämtliche Belege dafür auf, dass er sie tatsächlich vergewaltigt. Sie ist offensichtlich sehr betrunken. Sie kann nicht mal mehr ohne Hilfe gehen. Sie wird nie selbst aktiv, sondern liegt nur da, während es passiert.
Der Student unterbricht dich: »Die Geschichte basiert praktisch auf dem ersten Mal zwischen mir und meiner Freundin.«
Dir war nicht in den Sinn gekommen, dass er eine Vergewaltigungsgeschichte geschrieben haben könnte, ohne sich dessen bewusst zu sein.
»Ich kann nur sagen«, erwiderst du, »dass viele Menschen das als Vergewaltigung lesen werden.«
»Aber das ist es nicht«, sagt er kleinlaut. Es klingt jetzt eher, als wolle er sich selbst überzeugen. »Das war es nicht.«
Die dritte Geschichte begegnet dir in einem Kurs für autobiografisches Schreiben. Die Erzählerin ist auf einer Party sehr betrunken. Sie küsst einen Typen, und von einem anderen wird sie geküsst. Sie flüchtet vor ihm und läuft einem Bekannten in die Arme, den sie in dem Dunst von billigem Bier kaum wiedererkennt. Er ist aggressiv und schiebt sein Glied in sie, während sie zu stammeln versucht: »Halt, warte.«
Du beginnst den Kurs damit, dass du die Studierenden bittest, den Text kurz zusammenzufassen. Jemand meldet sich: »Er handelt von einem Mädchen, das auf eine Party geht, sich betrinkt und mit einem ganzen Haufen Kerle rummacht.«
Interessant. »Möchte jemand etwas hinzufügen oder hat eine andere Interpretation?« Die Studierenden schütteln den Kopf. »Also«, sagst du. »Im ersten Teil geht’s ums Rummachen, denke ich. Im zweiten vielleicht um ein Missverständnis. Aber den letzten Abschnitt verstehe ich ziemlich eindeutig als Übergriff.«
Alle Studierenden senken den Blick und lesen den letzten Abschnitt noch einmal. Manche legen den Kopf schief, als wollten sie sagen: Hmmm. Das Wort »Vergewaltigung« kommt in dem Text nicht vor, aber da steht »nicht richtig«, da steht »total besoffen« und »übel« und »schwindelig« und »kotzen«. Da steht »ignoriert«. Wie kann es sein, dass sie das nicht gesehen haben? Wie kann es sein, dass ihre Dozentin ihnen sagen muss, was Einvernehmlichkeit ist?
Nach den Regeln des Workshops darf sich die Autorin des Texts nicht äußern, aber du beobachtest, wie sie sich stumm Notizen macht. Hat sie es gewusst?, fragst du dich. Weiß sie es jetzt?
Du erkennst das Spannungsfeld zwischen »Ich bin ein Körper« und »Ich habe einen Körper«, aber du bist nicht fähig, es aufzulösen. »Haben« impliziert, dass der Körper nur etwas ist, das man besitzt, das man verlieren oder wegwerfen kann. Es impliziert, dass man ohne ihn auskommen könnte. Vielleicht impliziert es auch, dass jemand anderes den eigenen Körper besitzen kann, dass er dann nicht mehr einem selbst gehört. Dass er jemand anderem gehören würde.
Das scheint nicht ganz in Ordnung.
Aber »bin« scheint auch nicht richtig zu sein. Ein Körper zu »sein«, legt nahe, dass man nur ein Körper ist. Dass man Fleisch und ein bisschen Blut ist. Harte Knochen und biegsame Knorpel. Ein Geflecht von Adern und Haut. Aber ist das alles?
Du stehst vor dem Spiegel an deiner Kleiderschranktür und machst eine Bestandsaufnahme. Da sind deine Knie, zwei davon. Zwei Ellbogen. Ein Kinn. Ein Oberkörper mit milchschweren Brüsten. Füße. Hände. Knöchel. Zwei Ohrläppchen. Zehn Zehennägel. Ein paar pfenniggroße blaue Flecke. Tausende und Abertausende Haare.
Dann sind da Dinge, die du nicht sehen kannst, von denen du aber weißt, dass sie da sind. Zwei Lungenflügel. Eine Leber. Das Rückgrat, ein Wirbel über dem anderen. Dein Herz, das du mal im Ultraschall gesehen hast. Dein Uterus, den du viermal gesehen hast, aber nie in leerem Zustand. Nerven. Kugelgelenke. Die komplizierten Windungen deines Gehirns.
Die Liste ist lang, aber so lang auch wieder nicht. Bei ihrem Anblick fragt man sich: Ist denn nicht mehr an mir als das?
Manchmal sagt man zu dir, ein Glück, dass du Söhne hast, weil die sich mit dem ganzen Scheiß nicht befassen müssen.
Es ist richtig, dass deine Kinder, da sie beide Jungen sind, privilegiert sein werden, aber die Vorstellung, dass sie sich »nicht mit Rape Culture befassen müssen«, lässt dich erschaudern. Du willst sehr wohl, dass sie sich mit Rape Culture »befassen«, so wie man sich mit einem Kakerlakenproblem »befasst«.
Manchmal überlegst du, was du ihnen sagen wirst, und zu deiner Überraschung weißt du es nicht. Es sind die Worte, die dir fehlen, nicht die Inhalte. Die Inhalte sind da.
Auch wenn du noch nicht ganz sicher bist, was du sagen wirst, möchtest du, dass sie die folgenden Dinge wissen:
Es ist nicht okay, das Mädchen zu schlagen, das ihr mögt. Und es ist nicht okay, das Mädchen zu schlagen, das ihr liebt.
In dieser Welt wird Frauen erzählt, sie sollen immer höflich nicken, egal, was sie im Inneren empfinden. Nehmt ein höfliches Nicken nie als Antwort. Wartet, bis sie es sagt: »Ja!«
Nicht jeder und jede kriegt Sex, wenn er oder sie es möchte. Nicht jeder und jede bekommt Liebe, wenn er oder sie es möchte. Das gilt für Männer genauso wie für Frauen. Eine Beziehung ist nicht die Belohnung dafür, dass man ein netter Kerl ist, auch wenn es die Kinofilme noch so oft erzählen.
Für Verhütung seid auch ihr verantwortlich.
Beleidigt eine Frau nie mit einem Ausdruck, den ihr nicht auch für Männer benutzen würdet. Sagt »Dummkopf« oder »Rindvieh« oder »Arsch«. Sagt nicht »Schlampe« oder »Nutte« oder »Flittchen«. Wenn ihr »Arsch« sagt, kritisiert ihr ihre Einparkfähigkeiten, wenn ihr »Schlampe« sagt, kritisiert ihr ihr Geschlecht.
Jetzt kommen ein paar Sätze, die ihr kennen solltet. Übt sie vor dem Spiegel, bis sie euch so leicht über die Lippen gehen wie Songtexte, die ihr auswendig könnt. »Möchtest du das?« »Das ist nicht lustig, Alter.« »Fühlt sich das gut an?« »Ich mag dich, aber ich glaube, wir sind beide ein bisschen betrunken. Lass es uns ein andermal machen.«
Deine Cousine schreibt dir aus heiterem Himmel eine Nachricht. »Die haben mich voll gefickt bei der Bank.«
»Oh Gott«, antwortest du. »Bist du okay?« Deine Gedanken rasen. Du überlegst, in welchem Krankenhaus sie wohl ist, ob sie den Täter anzeigen wird, warum sie sich bei dir meldet und was du überhaupt tun kannst, um diese Katastrophe ein kleines bisschen zu lindern.
Der blinkende Kreis auf deinem Handy, das Zeichen, dass sie tippt. Dann treten Worte an seine Stelle, auf die du dich nur mühsam konzentrieren kannst: »Ja! Ich hab meinen Scheck auf das falsche Konto eingezahlt und deshalb meine Kreditkarte überzogen. Ich muss 175 Dollar Gebühren zahlen!«
Du wartest auf den Kreis, aber der erscheint nicht. Nach einer Weile wird dir klar, dass das schon alles war. Mit »Die haben mich gefickt« meinte sie »Ich musste Überziehungsgebühren zahlen«.
Eine Zeit lang starrst du auf deine Tastatur, auf die Buchstaben und Ausrufezeichen und die starrgesichtigen Emojis, dann legst du das Handy weg. Dir fällt einfach nichts dazu ein.
Jordana hat eine neuartige Anti-Vergewaltigungs-Unterwäsche entwickelt. Wenn sie eine Charge von fünftausend Stück bestellt, kann sie die für 2,25 Dollar produzieren lassen und für 4 Dollar das Stück verkaufen. Wenn sie zehntausend Stück bestellt, kann sie sie für 1,90 Dollar das Stück produzieren lassen und für 3,50 Dollar verkaufen. In Anbetracht dieser Zahlen und selbst wenn man Importzölle außer Acht lässt, wie will sie die Vergewaltiger dazu bringen, sie zu tragen?
Marc macht täglich um 18:25 Uhr Feierabend. Mit einer konstanten Geschwindigkeit von 9,6 km/h läuft er elf Blocks nach Norden, drei Blocks nach Westen und einen Block nach Süden, um zu seiner Wohnung zu kommen. Sein Heimweg führt ihn an dem Diner vorbei, in dem Gina arbeitet. Wenn sie die Nachmittagsschicht hat, macht sie Feierabend, kurz bevor Marc vorbeiläuft. Sie läuft elf Blocks nach Norden mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 8,8 km/h. Es ist Winter und wird früh dunkel. Wie viel Abstand sollte Marc hinter Gina halten, damit sie keine Angst haben muss, dass er sie überfallen will?
Carla überarbeitet ihr Online-Dating-Profil. Als sie »Cheerleaderin« hinzufügt, steigen ihre Nachrichtenanfragen um 11 Prozent. Als sie ihre Figur statt mit »durchschnittlich« als »dünn« beschreibt, steigen die Nachrichtenanfragen um 42 Prozent. Als sie »Feminismus« als Interesse angibt, gehen die Anfragen um 86 Prozent zurück, und die Anzahl der Vergewaltigungsdrohungen, die sie erhält, verdreifacht sich. Angenommen, sie hat im Schnitt drei Dates pro Monat, wie viele Stunden muss sie mit einem beliebigen Mann verbringen, bis sie sich sicher genug fühlt, ihm ihre Privatadresse zu geben?
In Montana wird ein Kind vergewaltigt. Der Vergewaltiger ist einunddreißig, das Kind fünfzehn. Das Schutzalter ist sechzehn. Auf Unzucht mit Minderjährigen stehen in Montana zwei bis hundert Jahre Bundesgefängnis und eine Geldstrafe von bis zu 50 000 Dollar. Wenn aber der Vergewaltiger nur zu dreißig Tagen Gefängnis verurteilt wird, um wie viel älter als ihr wirkliches Alter muss sich das Mädchen verhalten haben, als sie ihn verführt hat?
Du hast eine neue Masche: Wenn dir ein Mann auf der Straße etwas hinterherruft, rufst du zurück. Du hast es satt, so zu tun, als würdest du diese Männer nicht hören. Du hast es satt, den Blick beschämt auf den Gehweg zu richten. Du hast es satt, das hinzunehmen, als wäre es eine Art Steuer, die du für das Privileg bezahlen musst, dich als Frau in der Öffentlichkeit zu bewegen.
Vielleicht ist es dumm, aber du denkst, du könntest diesen Männern erklären, was du empfindest, und sie würden dir zuhören.
Du trägst deinen Entschluss wie eine Rüstung, und es dauert nicht lange, bis sich eine Gelegenheit bietet, deinen Plan in die Tat umzusetzen. Du kommst aus dem Supermarkt, in jeder Hand eine Tüte Lebensmittel, als ein Mann hinter dir sagt: »Hey, hey, hey! Was für eine Schönheit!«
Du bleibst stehen, und er geht an dir vorbei. Jetzt oder nie.
Du sagst: »Kann ich einen Moment mit Ihnen sprechen?«
Er bleibt in etwa einem Meter Entfernung stehen und dreht sich zu dir um.
»Warum haben Sie das gerade zu mir gesagt?«
Anstatt zu antworten, probiert er es noch mal mit seinem Spruch: »Hey, schönes Mädchen.«
»Darf ich Ihnen etwas sagen?«
Er antwortet nicht, aber er geht auch nicht weg. Er wirkt verwirrt, wie wenn man im Aufzug die Taste für eine bestimmte Etage drückt, aber die Türen nicht zugehen und man einfach weiterdrückt. Warum hältst du nicht den Mund? Das hat er nicht erwartet.
Du sagst: »Ich fühle mich nicht geschmeichelt, wenn Sie so etwas zu mir sagen. Ehrlich gesagt bin ich nicht mal wütend. Ich habe Angst. Wussten Sie das?«
»Warum? Warum hast du Angst? Angst vor mir?«
»Ja«, sagst du. »Wenn Männer wie Sie mir auf der Straße hinterherrufen, habe ich Angst, dass sie mir etwas tun wollen.«
»Oh, ich bin dir unheimlich. Das willst du mir sagen?« Jetzt kommt er in Bewegung. Er macht einen großen Schritt auf dich zu, und, verdammt, du zuckst zurück.
Du sagst: »Ja.« Du versuchst, das Wort hart wie Stahl klingen zu lassen, doch es zerknittert schon in deiner Kehle wie Alufolie. Du gehst zu deinem Auto.
Er folgt dir und ruft: »Jetzt mache ich dir Angst, ja? Jetzt hast du Angst vor mir!«
Er hat recht. Er macht dir Angst. Du hast Angst. Aber da ist auch noch etwas anderes, etwas Neues. Bis gerade hast du wirklich geglaubt, diese Männer wüssten womöglich nicht, was ihre Sprüche bei Frauen auslösen. Du hast gedacht, sie versuchten vielleicht, nett zu sein. Aber jetzt kennst du die Wahrheit – sie wissen, dass es dir Angst macht. Und es gefällt ihnen.
Die Angst ist immer noch da, ja, aber jetzt ist da auch Wut. So viel Wut, dass sie einen Teil der Angst besiegt. Wenn du das nächste Mal einem Mann Kontra gibst, der dir hinterherruft, ist es schon leichter. Und das Mal danach ist es noch leichter.
Jetzt gehen dir die Worte leicht über die Lippen. Du hast sie so lange im Kopf und auf der Zunge gewälzt, dass sie glatt wie Glas sind. »Warum sagen Sie so etwas zu mir?« »Das ist übergriffig.« »Es ist verletzend, so mit Frauen zu sprechen.« »Sie sollten so etwas nicht mehr sagen.«
Der Lohn, den du für diese Mühen erhältst, ist klein, aber er bedeutet dir viel. Es ist die Verblüffung auf dem Gesicht des Mannes. Manchmal murmelt er sogar ein dünnes »Entschuldigung«, bevor er sich eilig davonmacht. Er will kein Gespräch. Dass er dir hinterherruft, soll nicht dazu dienen, mit dir in Kontakt zu kommen, er testet nur etwas aus. Er muss seine Macht spüren wie ein Totem in der Hosentasche. Er will sich vergewissern, dass sie noch da ist.
Beim nächsten Mal, sagst du dir nach vollbrachter Tat, wird dieser Mann nicht gedankenlos einer Frau hinterherrufen. Beim nächsten Mal wird er sie kommen sehen, wird den Mund öffnen, um etwas zu sagen, und für einen Moment, für einen vollkommenen Augenblick, wird er Angst vor ihr haben.
JILL CHRISTMAN Slaughterhouse Island
Die Schwierigkeit, diese Geschichte zu erzählen, liegt darin, dass es mir sogar dreißig Jahre später noch schwerfällt, die hartnäckigen Überreste der Scham abzulegen, und das, obwohl ich – zweifelsfrei – weiß, wo die Schuld liegt. Ich kratze die letzten klebrigen Reste mit dem Daumennagel ab.
Ja, ich habe einige Dummheiten gemacht. Wie wir alle. Aber heute weiß ich, dass wir ein Recht darauf haben, Kinder zu sein, die ihre tief sitzenden Unsicherheiten hinter Eitelkeit verstecken. Wir tragen bauchfreie Tops und enge Jeans mit Spitzengürtel und dazu hochhackige Stiefel. Wir betrachten uns zehnmal in dem großen Spiegel im Wohnheimzimmer und recken den Hals, um zu sehen, wie fett unser dürrer kleiner Hintern von hinten aussieht, wir kippen sogar zuckrig süße Drinks und schlucken harmlos aussehende Pillen, von denen wir hoffen, dass wir uns davon besser fühlen oder schneller tanzen oder hübscher aussehen oder einfach nur vergessen. Wir wollen, dass zur Abwechslung mal irgendetwas einfach ist. Wir treffen jede Entscheidung auf einer alltäglichen Skala zwischen Voraussicht und purer Selbstsabotage.
Und trotzdem verdienen wir es nicht, vergewaltigt zu werden. Niemals.
Wie konnte es sich überhaupt so tief in unseren Köpfen verankern, die Schuld bei den Opfern zu suchen? Dreh es doch mal um, sage ich mir, mit dem Daumennagel kratzend. Stell es dir umgekehrt vor.Was hätte Kurt tun müssen, damit ich geglaubt hätte, ich hätte das Recht, ihn zu vergewaltigen?
Es gibt keine Antwort auf diese Frage.
Ich will die Zeit zurückdrehen. Ich will in dieses italienische Restaurant in Eugene, Oregon, gehen, wo mein achtzehnjähriges Ich sein erstes, unbehagliches Date mit Kurt hat. Ich will die Hand der jungen Frau nehmen und sie bitten, mit mir auf die Toilette zu kommen. Statt zuzulassen, dass sie die vier Bissen Pasta in Sahnesauce wieder auskotzt, die sie zu Abend gegessen hat – und ich weiß, dass sie an nichts anderes denken kann, während sie Kurts spitze Zähne im Kerzenlicht blitzen sieht –, will ich sie in die entgegengesetzte Richtung zum Ausgang ziehen.
Wir würden das Restaurant zusammen verlassen, ich würde sie ins Wohnheim zurückbringen, und wir würden uns unterhalten. Irgendwie würde ich sie vor dem bewahren, was uns als Nächstes passieren wird, obwohl ich weiß, Süße, dass es nicht deine Schuld ist. Nichts davon ist deine Schuld. Hörst du mich?
Nicht. Deine. Schuld.
Aber von hier aus der Zukunft kann ich bloß zusehen.
»Du fährst einen Porsche«, sagte ich – mit kaum hörbarem e, wie Borscht, nur ohne das t am Ende. Ich ließ mich in die weichen Ledersitze von Kurts elegantem silbernem Auto sinken und hoffte, dass meine Freund*innen im zweiten Stock des Erstsemesterwohnheims uns hinter den Vorhängen beobachteten. Er beugte sich zu mir. Sein Atem roch zu stark nach Pfefferminz, das bereits schütter werdende Haar glänzte in der Frühlingssonne vor Gel, und er ließ die Hand vom Schalthebel auf mein Bein rutschen. Ich glaube, er wollte sexy aussehen, aber es wirkte nur irre.
»Por-schäh«, sagte er. »Menschen, die keinen Por-schäh haben, sagen Porsche. Leute, die Por-schähs fahren, sagen Porschäh.«
Ich zog mein Knie einen Millimeter zur Seite, ein minimaler Einwand, und sagte: »Na ja, ich habe ja keinen Porsche, also nenne ich ihn lieber Porsche.«
»Du bist ja jetzt mit mir zusammen«, sagte er, die Lippen zu einem Lächeln verzogen. »Jetzt kannst du dieses Auto Por-schäh nennen.«
Ich hatte noch nie vorher ein solches Date gehabt – wie ich mir ein echtes College-Date vorstellte, bei dem Kurt alles öffnete, zurechtrückte, festhielt oder übernahm, was es zu öffnen, zurechtzurücken, festzuhalten oder zu übernehmen gab: die Tür des Por-schäh, meinen Stuhl am Tisch, mich am Arm, als mir ein anderer Mann zu nahe kam, und natürlich die Rechnung. Wir gingen in ein schickes italienisches Restaurant mit weißen Leinentischtüchern, Kerzen und gedämpftem Licht, wo wir uns darüber unterhielten, wie viel Zeit wir im Fitnessstudio am Rande des Campus verbrachten: ich, die in den Aerobic-Kursen alle Kalorien verbrannte, die ich in schwachen Momenten zu mir genommen hatte, und er, der in der Testosteronbrühe des großen Fitnessraums riesige Eisenscheiben hochstemmte und runterknallen ließ.
Wir waren beide zu stark gebräunt. Damals bekam man in den überheizten Kabinen im Einkaufszentrum nahe dem Campus zehnmal Solarium für 20 Dollar. Ich war im ersten Jahr am Honors College, las Darwin und Shakespeare und Austen, war schwer beeindruckt von Mary Shelleys Frankenstein, von Theorien über sexuelle Auslese und den Ursprung des Universums. Kurt studierte Wirtschaft und drehte im letzten Jahr eine Ehrenrunde – ich hörte den Ausdruck zum ersten Mal, kam aber schnell dahinter, dass diese »Ehre« nichts Positives war.
Da wir sonst nicht viele Gesprächsthemen hatten, redeten wir übers Solarium. Ich erzählte, dass ich unter dem Gerät immer einschlief, wenn der summende blaue Uterus mir eine Atempause vom grauen Winter in Eugene schenkte – obwohl ich sicher bin, dass ich an dem Abend nicht »Uterus« gesagt habe –, und Kurts Zähne schimmerten im Kerzenlicht wie in einem Horrorfilm.
Nach dem Essen brachte Kurt mich in ein Apartment, das nicht so aussah, als würde dort jemand wohnen. Er gab mir etwas zu trinken und führte mich durch das Wohnzimmer, in dem eine schwarze Ledercouch und ein gläserner Couchtisch standen, ins Schlafzimmer. Dort schloss er die Tür und zeigte mir seine Hanteln, an der Wand aufgereiht wie Schuhe, dann schob er mich zum Schreibtisch. Ich weiß noch, dass er die Hände ständig auf meinem Körper hatte, und noch bevor er den Spiegel und die Rasierklinge aus der Schreibtischschublade holte, dachte ich: Das ist nicht gut.
Kurt holte ein gefaltetes Papierbriefchen aus der Manteltasche – Junkie-Origami – und kippte zwei schneeweiße Häufchen auf das Glas. Ich sah zu, wie er teilte und schabte. Von dem Geräusch zuckte ich leicht zusammen, eine Gabel auf Porzellan, Fingernägel auf der Tafel, ein Alarmsignal, das ich ignorieren würde. Ich spürte bis in die tiefsten Fasern meines Körpers, dass ich verschwinden sollte, aber dies war ein Abend der ersten Male meines Collegelebens: erstes Date im Restaurant, erste Porschefahrt, erste Line. Kurt rollte einen frischen Geldschein aus seinem Portemonnaie zusammen und zeigte mir, was ich tun musste.
Es brannte. Und dann? Nicht viel. Das Koks bewirkte nicht mehr als das Gefühl, dass meine Augen weit aufgerissen waren. Ich sollte übergenau wahrnehmen, was danach geschah.
Was ebenfalls fast nichts war. Er küsste mich und zog mich dabei aufs Bett. Er war der schlechteste Küsser der Welt, seine bohrende Zunge kam mir vor wie eine Nacktschnecke, die in meinen Hals kriechen wollte. Ich war abgestoßen, wurde aber (wie ich heute weiß) vom Koks gerettet: Er kriegte keinen hoch. Er rieb sich an mir. Durch den dünnen Anzugstoff seiner Kakihose spürte ich ihn weich wie ein Milchbrötchen an meinem Oberschenkel.
Aus den Lautsprechern sang George Michael. Statt sich weiter dieser, wie er wohl aus Erfahrung wusste, vergeblichen Liebesmüh zu widmen, sprang Kurt vom Bett auf, als hätte er das alles so geplant, und drehte die Stereoanlage auf. I will be your father figure. Als ich ihn eine halbe Stunde später bat, mich ins Wohnheim zurückzufahren, tat er das ohne große Widerrede. Im Por-schäh.
Offenbar hatte Kurt sich besser amüsiert als ich, denn am nächsten Tag rief er an, um zu fragen, ob ich mit ihm zum Shasta-See fahren wolle. Dort veranstalteten die Studentenverbindungen der Universität von Oregon jedes Jahr zum Memorial Day eine traditionelle Feier: mindestens hundert gemietete Hausboote, darauf jeweils acht Pärchen und reichlich Bier, das aus kleinen Fässern strömte. Rote Plastikbecher schaukelten auf dem Wasser wie Bojen.
Man stelle sich vor: Alkohol und Drogen. Schlafmangel und jugendlicher Leichtsinn. Die Hitze, die Dehydrierung und das Essen, zubereitet von den Halbstarken, die diesen Albtraum veranstalteten. Man stelle sich vor: Niemand auf dem ganzen Boot hatte an Sonnencreme gedacht. Die Untiefen brennender, unerfüllter Leidenschaft – und dann die gefährlichen Untiefen des Wassers.
Man stelle sich außerdem vor: Ich hatte bereits geplant, mit einem Freund aus meinem Wohnheim dort hinzugehen, mit einem Jungen namens Jeff, der im letzten Herbst einer Verbindung beigetreten war. Jeff reichte mir gerade mal bis zur Nase, wenn er sich streckte, aber er war klug und brachte mich zum Lachen, also hatte ich zugesagt, als er fast beiläufig vorgeschlagen hatte, mich zum Shasta mitzunehmen.
Aber eine richtige Einladung von einem richtigen Date mit einem richtigen Auto und einem richtigen Apartment und richtigen Möbeln schien mir genau der richtige Statuskick zu sein, um vom Vollstipendiums-Hippiemädchen mit Beatles-Postern und Batiktüchern an den Wänden ihres Wohnheimzimmers aufzusteigen zur … zur was eigentlich?
Was wollte ich sein? Ein Teil des Systems, das meine liberalen Künstlereltern immer abgelehnt hatten? Wollte ich gesehen werden? Akzeptiert? Begehrt?
Ich mochte Kurt nicht mal. Er stand für alles, dem ich in dieser Welt zu misstrauen gelernt hatte: privilegierte Vorortschnösel, die glaubten, mit genug Geld könnten sie alles haben, einschließlich mir.
Also tat ich zuerst das Richtige: Ich lehnte Kurts Einladung ab. Aber meine beste Freundin D. hatte kein Date für den Trip auf dem See, und ich hatte das Gefühl, sie im Stich zu lassen. Außerdem wollte ich mich als Nicht-Zugehörige – eine Studentin vom Honors College, was für ein Freak – nicht allein mit Jeff in das Meer aus griechischen Buchstaben stürzen. Als sich Kurts Verbindungskumpel also bereit erklärte, D. mitzunehmen, wenn ich mit Kurt hinging, willigte ich ein.
Und dann brach die Hölle los.
Als ich Jeff sagte, dass ich nicht mit ihm, sondern mit Kurt zu dem Fest gehen würde, flippte der völlig aus. Sein Zimmer lag direkt unter meinem, und er spielte die ganze Nacht wütende Musik und lehnte sich aus dem Fenster, um zu brüllen, ich wäre eine Schlampe, eine Nutte, eine Scheißfotze. Andere Jungs aus dem Wohnheim stimmten in Jeffs gerechten Zorn ein, schmissen Sachen auf den Boden, hämmerten gegen meine Tür und zischten durch den Türspalt.
Ich wurde daraufhin nicht ebenfalls wütend, sondern fühlte mich furchtbar und schuldig und hockte zusammengekauert in meinem Zimmer, während sich die gesamte männliche Besatzung meines Wohnheims mit der klaren Botschaft erhob: Ich hatte ihnen gehört, und ich hatte dem Rudel den Rücken gekehrt, mich mit einem wilden Streuner eingelassen und damit die Unantastbarkeit des gesamten gottverdammten Wohnheim-Genpools gefährdet. Die ganze Nacht inhalierte ich ihre Wut und weinte so heftig und so lange und blöderweise ohne die Kontaktlinsen rauszunehmen, dass ich am Morgen einen Notfalltermin beim Augenarzt brauchte. Ich hatte auf beiden Seiten Verletzungen der Hornhaut, auf einer so schwer, dass ich eine Augenklappe tragen musste.
Ich war eine Piratenbraut, die die Demütigung überlebt hatte, wenn auch nur knapp. Und jetzt gab es kein Zurück mehr: Ich würde als Piratin zum Shasta gehen, und zwar mit Kurt.
Das Boot hatte noch nicht mal abgelegt, als klar wurde, dass D.s Begleitung kein tolles Date war – die beiden redeten nicht mal miteinander –, aber ihr war das egal. Sie hätte genauso gut auf einem anderen Boot sein können, so high war sie von den Drogen, vom Jack Daniel’s und den Augen ihres neuen Freundes, mit dem sie sich vor einer tragbaren Stereoanlage wiegte, wo sie eine alte Eagles-Kassette immer wieder zurückspulte. »Desperado« wurde ihr Song. Als Kurt und seine Meute betrunkener Verbindungsbrüder, die in jeder Hinsicht gut durch waren, unser Boot an Slaughterhouse Island mitten im Shasta-See festmachten, waren nicht nur die Untiefen gefährlich.
In meinem magentafarbenen Bikini fühlte ich mich auf dem Oberdeck allein und in der Falle. Die Verbindungsbrüder versahen alle Mädchen auf dem Boot mit Spitznamen für das Wochenende, und meiner lautete Klappergestell. Kurt beugte sich über mich.
Ich wusste, dass es zu spät war, um abzuhauen. Und irgendwie wusste ich auch, was passieren würde.
Ich weiß nicht, wie viele Hausboote an diesem Abend an unserer Seite der Insel festmachten – mindestens ein Dutzend. Nachdem die Sonne untergegangen war, wurden Feuer entzündet, die Musik aufgedreht, Stimmen erhoben sich zu einem chaotischen Lärm. Den ganzen Tag über hatte ich das Koks abgelehnt – der Abend in Kurts Apartment hatte mir gereicht –, aber als die Party in vollem Gange war, zog Kurt ein Tütchen aus der Tasche und hielt mir auf seiner großen Handfläche etwas hin. Braune Pilze, die aussahen wie Schrumpfköpfe auf winzigen Hälsen. Ich nahm ein paar, kaute die harten, trockenen Stängel und spülte sie mit einem großen Schluck von seinem Bier herunter.
Als die Pilze anfingen zu wirken, zog ich mich von Kurt und der Horde betrunkener Verbindungsstudenten zurück und kletterte den kahlen Hügel hinauf, an dem sich die dunklen, schwankenden Umrisse menschlicher Körper um die Flammen scharten, zwängte mich kurz vor der Kuppe durch dichtes Gestrüpp und suchte Schutz unter etwas, das mir zu dem Zeitpunkt eine wundervoll großherzige Bergkiefer zu sein schien.
Von meinem Fluchtpunkt aus beobachtete ich die rot lodernden Lagerfeuer, ein postapokalyptisches Höllenszenario. Die angedockten Hausboote trieben auf dem Wasser wie Krokodile. Ich war gut versteckt und konnte sehen, wie Kurt am Ufer entlang von einem Boot zum nächsten ging und mich suchte, meinen Namen rief. »Wo ist sie?«, brüllte er. »Wo ist sie, verdammte Scheiße? Mit wem ist sie zusammen? Mit wem habt ihr sie gesehen?«
Ich war mit niemandem zusammen, ich war allein da oben auf dem Hügel, und ich wusste, wenn ich herunterkäme, würde er mich kriegen. Also blieb ich unter dem Baum sitzen: zwei Uhr, drei Uhr, vier Uhr. Die Wirkung der Pilze ließ nach, und ich wurde müde – ich war müde und fror. Als ich endlich nichts mehr von Kurt sah, schleppte ich mich zurück aufs Boot.
Mein Gedanke war: Wenn ich im Bett liege, wenn er mich im Bett liegend und schlafend findet, wird er mich vielleicht schlafen lassen. Ich werde bis morgen früh schlafen, wenn das Boot wieder im Hafen anlegt, und dann bin ich in Sicherheit. Doch als er mich fand, war ich nicht in Sicherheit.
Sie wecken einen auf, um einen zu vergewaltigen.
Als das Boot am nächsten Morgen am Hafen festmachte, ging Kurt in die Stadt und kam mit einer Papiertüte von Dunkin’ Donuts zurück – Donuts mit Cremefüllung, Geleefüllung, Puderzucker und ohne alles, mindestens zwei Dutzend – und sagte zu mir: »Hier, Jill, nimm du dir zuerst.«
Sechs Stunden vorher hatte er mir ein Kissen in den Mund gestopft, um meine Schreie zu dämpfen, und jetzt hatte er die Nerven, mir eine verschissene Tüte Donuts anzubieten.
Ich überlegte, ob ich mich heftiger hätte wehren können – ich hatte ihm nicht das Ohrläppchen abgebissen und es ihm ins Gesicht gespuckt, ich hatte ihm nicht mit aller Kraft meines mageren achtzehnjährigen Körpers das Knie in die Eier gerammt, ich war nicht aufgesprungen und hatte ihm mit dem Absatz gezielt gegen die Kniescheibe getreten. Ich hatte gefleht und geweint und schließlich um Hilfe geschrien, aber ich habe ihm nichts getan, weil ich nicht sterben wollte.
Ich erinnere mich an das Kissen auf meinem Gesicht und daran, wie ich, als ich nicht mehr genug Luft zum Schreien hatte, dachte: Atme, atme, atme.
Im hellen Licht der Morgensonne sah Kurt abstoßend aus. Die Tüte Donuts baumelte zwischen uns in der Luft und mit ihr der Gestank von heißem Zucker und schalem Bier und Kotze überall. Seine Augen sahen nichts, rein gar nichts, und ich stellte mir vor, wie ich sie ihm auskratze.
»Nein danke«, sagte ich und wandte mich ab. »Ich esse keine Donuts.«
Nach unserer Rückkehr aus Kalifornien rief Kurt mich immer wieder auf dem Telefon im Wohnheimflur an. Ich habe nicht gesagt: »Du Arschloch! Du hast mich vergewaltigt. Glaubst du ernsthaft, ich würde mit dir ausgehen?!«
Stattdessen sagte ich: »Ich hab zu tun« und »Ich kann nicht«, und: »Ich muss arbeiten/eine Hausarbeit schreiben/Mathe üben.«
Ich nannte das, was am Wochenende auf dem Boot passiert war, nicht Vergewaltigung.
Und dann, einen Monat nach Shasta, ließ ich mich auf ein Treffen mit Kurt ein.
Ich hatte ein Flugticket von Portland nach Savannah, Georgia, und ich musste irgendwie zum Flughafen kommen. Kurt wollte mich fahren. Was konnte dabei schon Schlimmes passieren?, dachte ich. Ein paar nette Jungs vom Honors College – echte Freunde – brachten mich bis Portland und boten mir mindestens zehnmal an, mich von der Buchhandlung, in der wir die Zeit totschlugen, zum Flughafen zu begleiten. Sie wussten nicht, was Kurt mir angetan hatte, aber sie wussten, dass ich ihn nicht mochte.
Warum ließ ich mich von Kurt abholen? Auf diese Frage habe ich bis heute keine Antwort.
»Jill! Wie schön, dich zu sehen«, sagte er, als er am Bordstein anhielt, wo ich mit meinem Koffer stand. »Ich hab dich vermisst. Du mich auch?« Er wollte mich küssen, doch ich drehte den Kopf weg. Er öffnete den winzigen Kofferraum, stopfte meinen Koffer hinein und führte mich dann, die Hand auf meiner Taille, zur Beifahrerseite des röhrenden Wagens.
Kaum saß ich drin, fiel mir etwas auf, das vom Rückspiegel baumelte. Etwas, das mir bekannt vorkam.
»Hey«, sagte ich. »Das ist meiner.«
»Ja.« Kurt strich mit einem Finger über das Band aus weißer Spitze, das er an die Halterung des Rückspiegels gebunden hatte. »Dein Gürtel. Ich wollte etwas haben, das mich an dich erinnert.«
Ich wollte Kurts Trophäe herunterreißen, aber er hielt meine Hand fest und drückte sie grinsend.
»Wer’s findet, darf’s behalten.«
Als der Porsche anfuhr, überkam mich eine Woge aus Angst und Hass.
Kurt nahm die falsche Straße stadtauswärts. »Wo fährst du hin?«, fragte ich.
»Ich hab was bei meinen Eltern vergessen«, sagte er. »Wir halten auf dem Weg zum Flughafen nur kurz da an.«
»Aber das liegt nicht auf dem Weg zum Flughafen.« Ich wusste, dass Kurts Eltern in einem Vorort wohnten.
»Schon gut«, sagte er grinsend. »Du hast noch reichlich Zeit.«
Vor dem Haus wollte ich im Wagen warten, aber er meinte, ich solle mit reinkommen und seine Eltern kennenlernen. Die waren natürlich nicht zu Hause, und irgendwie landeten wir in Kurts Zimmer. Er schloss die Tür.
»Was hast du vor?«, fragte ich. »Ich muss los!«
Kurt brachte sein Gesicht ganz dicht vor meines, von seinem Aftershave, dem Pfefferminzgeruch, von allem an ihm wurde mir übel. Wir bewegten uns wie in einer Art Tanz, in dem ich immer weiter zurückwich, bis ich gegen die Bettkante stieß. Kurt lächelte.
Er legte die Hände auf meine Schultern und stieß mich nach hinten. Ich landete flach auf dem Rücken, und er fiel mit seinem ganzen Körper auf mich.
Nicht schon wieder. Nein. Neinneinneinnein. Das würde nicht noch einmal passieren.
Dann hörten wir ein Geräusch, jemand kam zur Tür herein.
Kurt sprang von mir herunter, streckte mir die Hand hin und half mir auf. Ich stand unter Schock. Ich sagte nichts. Ich hatte keine Worte mehr.
Kurt lachte. »Was hast du gedacht, was ich vorhatte, Jill? Dich vergewaltigen?«
Auf seine eigene, schreckliche Art hatte Kurt seine Tat beim Namen genannt, bevor ich es tun konnte, und trotzdem habe ich nie Anzeige erstattet. Ich habe nicht einmal gesagt: »Du hast mich vergewaltigt.« Ich habe nichts getan. Ich bin am Flughafen aus diesem Scheißauto ausgestiegen und habe ihn nie wiedergesehen.
In der Koje am Shasta-See hatte Kurt mir ein Kissen aufs Gesicht gedrückt, damit mich niemand schreien hörte, aber jetzt frage ich mich: Wer hätte mich denn gehört? Und wenn mich jemand gehört hätte, auf diesem Boot vor einer mir unbekannten Insel, die bis heute nach einem Fleischmarkt und Schlachthaus benannt ist, wer hätte etwas unternommen? Wer hätte mir geholfen? Mit fast dreißig Jahren Abstand, einem durch Mutterschaft verletzlichen Herzen und dem erbitterten Wunsch, meine Kinder zu beschützen, frage ich mich: Wie viele andere Frauen wurden in dieser Nacht auf Slaughterhouse Island vergewaltigt?
Ich habe das sichere Gefühl, dass ich nicht die Einzige war.
Im Sommer nach der Vergewaltigung hatte ich innerhalb von drei Monaten Sex mit mehr Männern als in den ganzen Jahren davor und danach zusammen. Meine unausgesprochene Logik lautete: Wenn ich meinen Körper immer wieder hergebe, kann ich mir selbst beweisen, dass Sex meine Entscheidung ist – obwohl ich, und das scheint mir jetzt von Bedeutung, die Wahl immer den Männern überlassen habe. Bis ich neunzehn wurde, ist mir nie in den Sinn gekommen, dass ich selbst die Wahl treffen könnte. Du nicht, du nicht, du nicht. Ja, okay, du.
An dem Morgen, als ich diesen Text schrieb, ging ich an mein Bücherregal und zog ein Taschenbuch mit rotem Rücken heraus. I Never Called It Rape. Das Cover sieht aus, als wäre ein Teil des Buchs abgerissen, und in meinem Exemplar sind die Ränder der Seiten vergilbt. Das Buch der Journalistin Robin Warshaw, erschienen 1998, genau in dem Jahr, in dem ich mit Kurt nach Shasta fuhr, enthält die Ergebnisse der von der Ms. Foundation und dem National Institute for Mental Health finanzierten Umfrage von Mary Kross. Es war die erste landesweite Studie über sexuelle Übergriffe auf dem Campus überhaupt, und die statistischen Ergebnisse waren erschütternd: 25 Prozent der Frauen am College wurden Opfer von Vergewaltigungen oder versuchten Vergewaltigungen. 84 Prozent dieser Opfer kannten die Täter. Nur 27 Prozent der vergewaltigten Frauen bezeichneten sich selbst als Vergewaltigungsopfer.
Ich habe das Buch in meinem letzten Collegejahr für den Kurs »Selbstverteidigung von innen« gekauft. Ach du Scheiße, dachte ich damals. Warum hat mir das niemand früher gesagt?
Hier, auf den Seiten von I Never Called It Rape, kann ich mit meinem Ich aus der Collegezeit ins Gespräch kommen: Das Mädchen, das ich damals war, hat mit lila Tinte hineingeschrieben, wenn auch nicht viel, und sich die wichtigsten Stellen mit Sternchen markiert. Eine von vier befragten Frauen hatte Erfahrungen gemacht, die der rechtlichen Definition von Vergewaltigung oder versuchter Vergewaltigung entsprechen, und weiter: … das Durchschnittsalter bei einer Vergewaltigung (sowohl bei Tätern als auch bei Opfern) war 18 ½ Jahre, und weiter: … [die Frauen] schämten sich für die genauen Umstände der Vergewaltigung (mit einem Mann eine Bar verlassen, Drogen nehmen etc.) und hatten das Gefühl, man würde ihnen die Schuld an den Vorfällen geben, oder dachten, man würde ihnen nicht glauben, weil die betreffenden Männer sozial höhergestellt waren, und weiter: … kurz gesagt nahmen viele Männer das, was passiert war, nicht als Vergewaltigung wahr.
»Die Frage ist nicht«, sagte unsere Selbstverteidigungslehrerin eines Nachmittags in der Sporthalle, als wir im Schneidersitz auf Matten um sie herumsaßen, »›Was wird er von mir denken?‹ – wenn ich nicht auf seine Frage antworte, wenn ich unhöflich bin, wenn ich nicht mit ihm mitgehen will –, sondern: ›Was denke ich von ihm