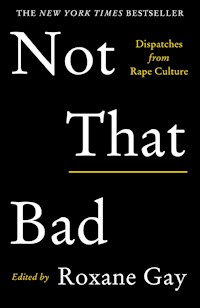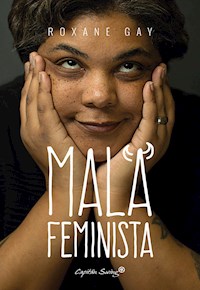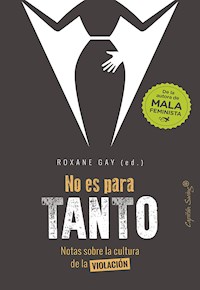10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kurze, herbe Stories der New-York-Times-Bestsellerautorin: Ein aufregendes und radikal neues Kapitel in der haitianisch-amerikanischen Literatur.
Voll emotionaler Wucht und in feinfühliger Sprache ergründen diese Stories die Komplexität haitianischer Identität. Sie erzählen von Erschütterndem und Schönem, von Humor und Härte, von Illusion und Realität.
Ein Ehepaar, das mit dem Schiff in die USA entkommen will, bereitet sich darauf vor, Haiti für immer zu verlassen. Eine junge Frau umgarnt mithilfe eines Voodoo-Liebestranks einen Klassenkameraden aus Kindertagen. Eine Mutter nimmt einen Soldaten als Untermieter in ihrem Haus und in ihrem Bett auf. Und eine Frau wird auf der Flucht vor einem schrecklichen Massaker schwanger mit einer Tochter, die ihr Leben lang den Geruch von Blut in der Nase tragen soll.
»Mein Wissen über meine Familiengeschichte ist lückenhaft. Wir sind die Hüterinnen von Geheimnissen. Wir sind selbst ein Geheimnis.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Zum Buch
Ein Ehepaar, das mit dem Schiff in die USA entkommen will, bereitet sich darauf vor, Haiti für immer zu verlassen. Eine junge Frau umgarnt mithilfe eines Voodoo-Liebestranks einen Klassenkameraden aus Kindertagen. Eine Mutter nimmt einen Soldaten als Untermieter in ihrem Haus und in ihrem Bett auf. Und eine Frau wird auf der Flucht vor einem schrecklichen Massaker schwanger mit einer Tochter, die ihr Leben lang den Geruch von Blut in der Nase tragen soll.
New-York-Times Bestsellerautorin Roxane Gay ergründet in diesen Stories die Komplexität haitianischer Identität. Sie erzählt von Erschütterndem und Schönem, von Humor und Härte, von Illusion und Realität.
Zur AUTOR:IN
ROXANEGAY, geboren 1974, ist Autorin, Professorin für Literatur und eine der wichtigsten gesellschaftspolitischen und literarischen Stimmen ihrer Zeit. Sie schreibt u. a. für die »New York Times« und den »Guardian«, sie ist Mitautorin des Marvel-Comics »World of Wakanda«, Vorlage für den hochgelobten Actionfilm »Black Panther« (2018). Roxane Gay ist Gewinnerin des PEN Center USA Freedom to Write Award. Sie lebt in Indiana und Los Angeles.
Zur ÜBERSETZER:IN
EVABONNÉ übersetzt Literatur aus dem Englischen, u. a. von Rachel Cusk, Anne Enright, Michael Cunningham und Abdulrazak Gurnah. Sie wurde mit dem Heinrich Maria Ledig-Rowohlt-Preis ausgezeichnet.
ROXANE GAY
VON GEISTERNUND SCHATTEN
Aus dem amerikanischen Englischvon Eva Bonné
Die Originalausgabe erschien erstmals 2011 unter dem Titel »Ayiti« bei Artistically Declined Press, USA. Die Originalausgabe der vorliegenden Ausgabe erschien 2018 unter selbigem Titel bei Grove Atlantic, New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstausgabe Januar 2024
btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © der Originalausgabe 2011, 2018 Roxane Gay
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2024
btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Umschlaggestaltung: semper smile | München nach einem Entwurf von © Grove USA unter Verwendung eines Fotos von © Offset/Lyn Hui Ong
MSP · Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-25852-8V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/penguinbuecher
Für meine Mutter und meinen Vater
Inhalt
Motherfucker
Der Akzent meines Vaters
Voodookind
Da ist kein »E« in Zombi, was bedeutet, dass es kein Du und kein Wir geben kann
Zucker
Billig, schnell, macht satt
Wie Wasser oder Licht
Lacrimosa
Je heftiger sie kommen
Alles ist relativ
Gracias Nicaragua y Lo Sentimos
Wir fressen keinen Dreck
Was man über haitianische Frauen wissen sollte
Von Geistern und Schatten
Ein kühler, trockener Ort
Danksagung
Motherfucker
Gérard denkt täglich über die vielen Gründe nach, aus denen er Amerika hasst. Diese beinhalten, beschränken sich aber nicht auf: die Menschen; das Wetter, insbesondere die Kälte; dass man für alles ein Auto braucht; dass man jeden Tag zur Schule gehen muss. Gérard ist vierzehn. Er hasst alles Mögliche.
Am ersten Tag an der neuen Schule soll Gérard sich der Klasse vorstellen. Er steht auf, sagt seinen Namen, setzt sich schnell wieder hin und starrt auf sein Pult, das er jetzt schon hasst. »Was für ein interessanter Akzent«, flötet die Lehrerin. »Woher kommst du denn?« Er hebt den Kopf. Er ist gereizt. »Haiti«, sagt er. Die Lehrerin lächelt breit. »Sag mal was auf Französisch.« Gérard gehorcht: »Je te déteste.« Die Lehrerin klatscht aufgeregt in die Hände. Sie spricht kein Französisch.
Die Information verbreitet sich rasch, und schon bald hat Gérard in der Schule einen Spitznamen. Die anderen nennen ihn HBO. Erst Wochen später versteht er, wofür die Abkürzung steht.
Gérard wohnt mit seinen Eltern in einer Dreizimmerwohnung. Er teilt sich ein Zimmer mit seiner Schwester und seinem Cousin Edy. Sie haben kein Kabelfernsehen, aber Edy, der schon ein paar Monate länger in den Staaten ist als Gérard, lügt ihn an und sagt, HBO stünde für Home Box Office, einen Privatsender mit Bruce-Willis-Filmen. Gérard hasst die Tatsache, dass sie kein Kabelfernsehen haben, aber er liebt Bruce Willis. Er ist stolz auf seinen neuen Spitznamen. Wenn die Jungs in der Schule ihn HBO nennen, antwortet er: »Yippie-ka-yay.«
Gérards Vater duscht nicht jeden Tag, weil er sich an Sanitäranlagen in geschlossenen Räumen erst noch gewöhnen muss. Stattdessen begnügt er sich jeden Morgen mit einer Katzenwäsche über dem Waschbecken und spart sich den Luxus einer Dusche fürs Wochenende auf. Manchmal sitzt Gérard auf dem Wannenrand, beobachtet seinen Vater und denkt an zu Hause. Er kennt das Ritual auswendig: Sein Vater spritzt sich Wasser unter die Achseln, seift sie ein, spült den Schaum ab und reibt sich dann mit einem feuchten Waschlappen über Brust, Nacken und Ohren. Dann schickt er Gérard hinaus, um sich zwischen den Beinen zu waschen. Das Ritual endet damit, dass er sich das Gesicht abtrocknet und die Zähne putzt. Danach geht er zur Arbeit. Zu Hause war er Journalist, in den Staaten schneidet er acht Stunden täglich Wurstwaren an der Frischetheke eines Delis und gibt vor, nur gebrochen Englisch zu sprechen.
Im zweiten Monat an der neuen Schule findet Gérard eine Tüte mit billigen Parfums in seinem Spind. Jemand hat in dicken Großbuchstaben »für HBO« daraufgeschrieben. Ein seltsames Geschenk, denkt Gérard. Obwohl sie einen widerlichen Geruch verströmt, nimmt er die Tüte mit nach Hause und zeigt sie seinem Cousin. Edy verdreht die Augen, zieht aber trotzdem ein Fläschchen heraus. Seine Freundin wird sich darüber freuen. »Diese Motherfucker«, sagt er, weil er im Gegensatz zu Gérard schon ein paar Schimpfwörter kennt. Er erklärt Gérard, was HBO wirklich bedeutet. Gérard ballt die Hände zu Fäusten. Er denkt an die Motherfucker, mit denen er zur Schule geht, und wie sehr er sie hasst. Am nächsten Morgen übergießt er sich mit so viel Parfum, dass seinen Mitschülern die Augen tränen.
Wenn sie ihn HBO nennen, schmückt er das Yippie-ka-yay mit einem kleinen Zusatz aus.
Der Akzent meines Vaters
Er weiß, dass man ihn hören kann. Er ist schwer, noch schwerer sogar als der meiner Mutter. Mein Vater lebt seit fast dreißig Jahren in Amerika, aber seine Stimme klingt nach Port-au-Prince, nach überfüllten Straßen und gellenden Autohupen; sie riecht nach Grillfleisch, geröstetem Mais und einer drückenden, reglosen Hitze.
In seiner Stimme hören wir ihn auf Kokospalmen klettern. Er klammert sich barfuß und mit sandigen Schenkeln an den Stamm und schlägt die Nüsse mit einer stumpfen Machete ab. Wir hören ihn zu Kompa tanzen, er wiegt sich hin und her und hat sich eine Hand an den Bauch gelegt, während die andere über seinem Kopf schwebt. Wir hören alles über Toussaint L’Ouverture und Henri Christophe und den Stolz, der erste freie Schwarze zu sein. Wir hören seine Verbitterung, wenn er im Fernsehen Nachrichten aus der Heimat sieht oder mit den Zurückgebliebenen telefoniert.
Wenn meine Brüder und ich ihn nachäffen, lächelt er geduldig: vor jedem Vokal ein »H«, kein Plural bekommt ein »S«.
»Ihr macht euch über mich lustig, aber ihr versteht mich ohne Probleme, oder?«, fragt er. Wir nicken. Wir bitten ihn, »American Airlines« zu sagen. Wenn er uns den Gefallen tut, kriegen wir keine Luft mehr vor Lachen.
Viele Jahre lang hatten wir gar nicht bemerkt, dass unsere Eltern mit Akzent sprachen und ihre Stimmen für feindselige amerikanische Ohren anders klangen. Wir hingegen hörten nichts als Heimat.
Aber dann kam uns die Welt dazwischen. Wie immer.
Voodookind
Meine College-Mitbewohnerin hat erfahren, dass ich Haitianerin bin, und weil sich das Internet in den Händen von Schwachköpfen befindet, glaubt sie seither, ich praktiziere Voodoo. Ich unternehme nichts, um ihre Befürchtungen zu zerstreuen, obwohl ich Katholikin bin und mein gesamtes Voodoo-Wissen aus einem Film mit Lisa Bonet stammt, über den sich Bill Cosby angeblich furchtbar aufgeregt hat (als hätte er das Recht, sich über irgendetwas oder irgendwen aufzuregen).
Nachts singe ich leise Beschwörungen und zünde Kerzen an. Tagsüber trage ich Rot und Weiß, bemale mir das Gesicht und tanze wie eine Besessene. Ich lasse eine kleine Stoffpuppe auf meinem Schreibtisch liegen. In der Puppe, die meiner Mitbewohnerin ähnlich sieht, stecken viele strategisch platzierte Nadeln. Ich liebe es, sie zu verarschen. Sie hat mir das größere Zimmer mit den besseren Möbeln überlassen, und in der Mensa bietet sie mir nach dem Essen an, mein Tablett in die Spülküche mitzunehmen.
Manchmal fahren wir mit dem Bus nach Manhattan und gehen shoppen, anschließend tanzen und trinken wir und reißen verdorbene New Yorker Jungs auf. Ich bin der Lieblingsdämon meiner Mitbewohnerin.
Als wir einmal die Grand Central Station verlassen, kommt eine dicke, ältere Frau auf mich zu, packt mich beim Arm und verbeugt sich hektisch.
Meine Mutter hat mir immer eingeschärft, dass man vor Verrückten am besten langsam zurückweicht; und die Verrückten sind überall. Als meine Mutter in die Staaten kam, wohnte sie im schlimmsten Viertel der Bronx, jenem Teil, der bis zur Unkenntlichkeit abgebrannt ist. Sie hat sich bis heute nicht davon erholt.
Dort, vor der Grand Central Station, krallte meine Mitbewohnerin ihre Finger in meinen Arm, bis ich blutete. Als wäre ich mit der Lage weniger überfordert als sie.
Im Zurückweichen merkte ich, dass die Fremde in Kreol auf mich einredete. Ich kannte sie, obwohl ich sie nie gesehen hatte. »Ki sa ou vle?«, fragte ich, und sie erklärte mir, ich sei eine berühmte Mambo-Priesterin. Es sei ihr eine große Ehre, mir hier in Amerika zu begegnen. Sie nahm mich bei den Handgelenken, küsste meine Handflächen und drückte sie sich an die Wangen. Ich glaube, sie wollte meinen Segen. Ich war mit den Gedanken bei den unanständigen New Yorker Jungs, die meine Mitbewohnerin und ich später kennenlernen würden.
Da ist kein »E« in Zombi, was bedeutet, dass es kein Du und kein Wir geben kann
[EIN HANDBUCH]
[Was Amerikaner nicht über Zombis wissen:]
Sie sind nicht tot, sondern nur dem Tod sehr nah, was nicht dasselbe ist.
Sie sind echt.
Sie essen kein Menschenfleisch.
Sie vertragen kein Salz.
Sie wanken nicht mit steif vorgereckten Armen durch die Gegend.
Man kann sie retten.
[Wie das Wort Zombi ausgesprochen wird:]
Saahhnnnn-Bi. Man sollte es am Gaumen spüren.
Man sollte es zügig aussprechen.
Das »M« ist stumm. Gewissermaßen.
[Wie man einen Zombi macht:]
Zunächst einmal braucht man einen Grund. Einen sehr guten.
Man braucht einen Kugelfisch und ein wenig Blut und Haare des ausgewählten Kandidaten.
Anleitung: Töten Sie den Kugelfisch. Seien Sie dabei nicht zimperlich. Extrahieren Sie das Gift (Überlegen Sie sich was). Anschließend lassen Sie es trocknen. Zerstoßen Sie Blut und Haare zu Ihrem persönlichen Coup de Poudre (eine fähige Apothekerin kann Ihnen dabei helfen). Pusten Sie den Puder ins Gesicht des Kandidaten. Warten Sie ab.
[EINE LIEBESGESCHICHTE]
Micheline Bérnard war schon seit Ewigkeiten in Lionel Desormeaux verliebt. Ihre Eltern waren befreundet gewesen, jedoch hatte sich der joviale Umgang nie so recht auf die Kinder übertragen. Micheline und Lionel hatten zusammen die Grund- und dann die Sekundarschule besucht und sich ihr Leben lang gekannt. Wenn Lionel Micheline sah, überkam ihn ein Gefühl vager Vertrautheit. Wenn Micheline Lionel sah, überkam sie ein Gefühl absoluter Gewissheit, den Mann ihrer Träume vor sich zu haben. In Wahrheit waren alle in Lionel Desormeaux verliebt. Er war groß, hatte braune Haut, hohe Wangenknochen und volle Lippen. Wenn er nach einem langen Tag am Meer aus dem Salzwasser stieg, glitzerte sein muskulöser Körper. Micheline saß in einer der Strandhütten und war unsichtbar. Sie leckte sich die Lippen, stierte und dachte bei sich: Sieh mich an, Lionel! Aber er tat es nie.
Lionels Gang war lässig. Er bewegte sich langsam, aber zielgerichtet, und wenn er vorbeiging, schworen manche Leute, sie hätten ein dumpfes Trommeln gehört. Seine Mutter, die ihren einzigen Sohn über alles liebte, sagte ihm immer: »Lionel, du bist der Sohn von L’Ouverture.« Er glaubte ihr. Er glaubte alles, was seine Mutter ihm erzählte. Zu seinen Freunden sagte er: »Mein Vater hat unser Volk befreit. Ich bin sein wichtigster Sohn.«
In Port-au-Prince gab es zu viele Frauen. Micheline wusste, dass es um Lionels Aufmerksamkeit einen harten Wettkampf gab. Sie war zierlich und attraktiv. Das Haar frisierte sie sich zu einem adretten Knoten, nur am Wochenende trug sie es offen. Wenn sie vorüberging, riefen die Männer: »Quelle belle paire de jambes«, was für schöne Beine, und Micheline genoss den Nervenkitzel von so viel Aufmerksamkeit. Freitagabends traf sie sich meistens mit ihren Freundinnen im Oasis, einem beliebten Nachtklub am Rand des Bel-Air-Slums. Sie trank fruchtige Cocktails, rauchte französische Zigaretten und trug einen Rock, der genau die richtige Länge Bein zeigte. Lionel war ständig von einem Mob aus Bewunderinnen umgeben. Er trug eine gebügelte Leinenhose und ein dunkles T-Shirt, das seine definierten Oberarme perfekt zur Geltung brachte, fläzte sich auf ein Sofa mitten im Raum und ließ sich Cola-Rum spendieren. Am Ende des Abends wählte er eine Frau aus, lud sie zu sich nach Hause ein, nahm sie gründlich ran und wünschte ihr am nächsten Morgen alles Gute. Der steinerne Pfad zu seiner Haustür war von salzigen Tränen und getragenen Slips der Frauen gesäumt, die Lionel erst versext und dann verstoßen hatte.
An ihrem Geburtstag beschloss Micheline, am Abend diejenige zu sein, die mit Lionel nach Hause ging. Sie schlüpfte in ein buntes, schulterfreies Kleid und tupfte sich Parfum überall dorthin, wo sie Lionels Lippen spüren wollte. Ihre High Heels waren so hoch, dass ihr Bruder sie auf dem Weg in den Nachtklub stützen musste. Als Lionel erschien und Hof hielt, sorgte Micheline dafür, dichter neben ihm zu sitzen als jede andere. Sie lächelte viel, krümmte ganz leicht die Schultern und beugte sich vor, damit er einen möglichst guten Blick auf ihre üppige Oberweite hatte. Als der Abend endete, nickte Lionel in ihre Richtung und sagte: »Meine liebe Micheline, heute Nacht sollst du die Zuneigung des wichtigsten Sohnes von L’Ouverture zu spüren bekommen.«
Im Bett verliebte Micheline sich heftiger in Lionel, als sie es sich hätte vorstellen können. Er kniete zwischen ihren Schenkeln und massierte ganz sanft ihre Knie. Er strahlte sie an, und ein heller Lichtspeer fiel auf ihren Körper. Micheline streckte die Hände nach Lionel aus, berührte seine Haut und spürte ein Kribbeln. Als er in sie eindrang, zog ihr Herz sich so schmerzlich zusammen, dass sie fürchtete, sie müsse sterben. Er flüsterte ihr ins Ohr, und sein Atem war so heiß, dass sie Brandblasen davon bekam. Er sagte: »Alles auf dieser Insel ist mein. Du bist mein.« Micheline stöhnte: »Ich bin dein Sieg.« Er sagte: »Ja, heute Nacht bist du das.« Während er sie fickte, hörte Micheline das Wummern einer dumpfen Trommel.
Am nächsten Morgen begleitete Lionel sie nach Hause und gab ihr einen keuschen Kuss auf die Wange. Als er gehen wollte, ergriff Micheline seine Hand, drückte den Daumen auf seine Knöchel und sagte: »Heute Abend komme ich zu dir.« Lionel legte ihr einen Finger auf die Lippen und schüttelte den Kopf. »Nein, meine Liebe, wir hatten unsere Nacht.«
Lange Zeit schaffte Micheline es nicht, aus dem Bett aufzustehen. Sie musste immerzu an Lionels Berührungen denken, an seine Worte, und wie ihr Inneres sich an ihn geschmiegt hatte. Ihre Eltern riefen einen Arzt, dann einen Priester und am Ende eine Mambo. Letztere allerdings erst nach langem Zögern, schließlich waren sie gute Katholiken. Doch sie konnten den Anblick ihrer jüngsten Tochter, die reglos im Bett lag und weder sprach noch aß, nicht mehr ertragen. Die Mambo setzte sich an die Bettkante und schnalzte mit der Zunge. Sie befühlte Michelines schlaffes Handgelenk und fragte: »Die Liebe?«, und Micheline nickte. Die Mambo scheuchte die Eltern hinaus. Sie gingen freiwillig, denn sie waren überglücklich darüber, dass ihr Kind sich endlich rührte. Die alte Mambo beugte sich so tief hinunter, dass Micheline ihre trockenen Lippen am Ohr spüren konnte.
Als die Mambo gegangen war, nahm Micheline ein Bad und betupfte sich überall dort mit Parfum, wo sie Lionels Lippen spüren wollte. Sie ging ins Oasis, wo Lionel in der Mitte des Raumes saß und ein hellhäutiges, junges Ding auf den Knien hielt. Micheline stieß das Mädchen beiseite und nahm ihren Platz ein. Sie sagte: »Wir hatten unsere Nacht, aber wir haben eine zweite verdient«, und da erinnerte Lionel sich an ihr köstliches Stöhnen, an ihre drallen Oberschenkel, und wie sie den heldenhaften Eroberer in ihm gesehen hatte, der er tatsächlich war.