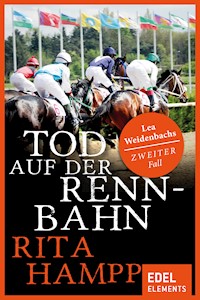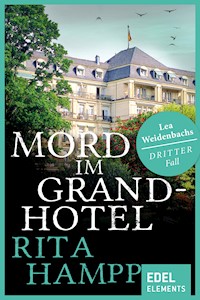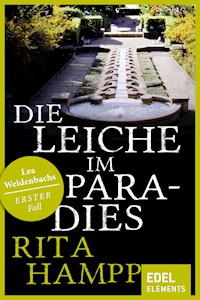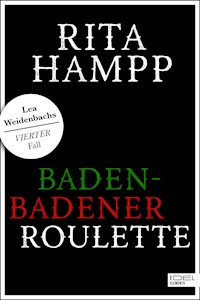
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Gottlieb & Weidenbach
- Sprache: Deutsch
Ein maskierter Räuber versetzt Baden-Badens reiche Witwen in Angst und Schrecken. Als sein letztes Opfer einen qualvollen Tod stirbt, nimmt die Kripo unter Maximilian Gottlieb die Ermittlungen auf. Während er den Enkel der Toten verdächtigt, geht die Reporterin Lea Weidenbach anderen Spuren nach. Eine davon führt zum einst legendären Goldtisch der Spielbank Baden-Baden, eine andere zu russischen Investoren. Leas eigenwillige Ermittlungen kommen Kriminalhauptkommissar Gottlieb gewaltig in die Quere. Da geschieht ein zweiter Mord.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Kurzbeschreibung:
Ein maskierter Räuber versetzt Baden-Badens reiche Witwen in Angst und Schrecken. Als sein letztes Opfer einen qualvollen Tod stirbt, nimmt die Kripo unter Maximilian Gottlieb die Ermittlungen auf. Während er den Enkel der Toten verdächtigt, geht die Reporterin Lea Weidenbach anderen Spuren nach. Eine davon führt zum einst legendären Goldtisch der Spielbank Baden-Baden, eine andere zu russischen Investoren. Leas eigenwillige Ermittlungen kommen Kriminalhauptkommissar Gottlieb gewaltig in die Quere. Da geschieht ein zweiter Mord.
Rita Hampp
Baden-Badener Roulette
Lea Weidenbachs vierter Fall
Edel Elements
Edel Elements
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2019 Edel Germany GmbHNeumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2011 by Rita Hampp
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Cover: Anke Koopmann, Designomicon, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-315-1
www.instagram.com
www.facebook.com
www.edelelements.de
Im Herbst des Vorjahres
»Rien ne va plus!«
Monoton, fast gelangweilt übertönt die Stimme des Croupiers das hölzerne Kreiseln der Kugel, das Getuschel, das ferne Gläserklirren und das Sausen in seinem Kopf, das immer lauter wird.
Rot! Rot, Rot, Rot!
Das Ziehen zwischen seinen Schulterblättern wird unerträglich, vor seinen Augen verschwimmt der Kessel, obwohl er ihn doch hypnotisieren will.
Rot! Rouge, Rouge, Rouge!
Noch einmal fliegt sein Blick zur Anzeigetafel.
21 – 3 – 18 – 32 – 7.
Alle rot. Fünfmal hintereinander. Das ist gsssut, nein, perfekt. Es riecht danach, dass sich die Serie fortsetzt. Sein Einsatz hat sich bereits versechzehnfacht. Zweimal noch, dann ist es genug.
Immer noch jagt die weiße Kugel am Kesselrand entlang. Zu viel Schwung? Das kann und darf nicht sein. Diesen Croupier hat er seit Tagen beobachtet. Er wirft die Kugel gleichmäßig wie ein Uhrwerk. Eigentlich hätte er sogar auf Große Serie setzen können, aber er will auf Nummer sicher gehen. Er braucht das Geld, sonst sitzt er auf der Straße. Überziehungskredit überzogen, Schulden, Mietrückstand, und heute Morgen im Briefkasten der amtliche Umschlag: Zwangsräumung, endgültig. Morgen. Wenn kein Wunder geschieht.
Hier könnte es geschehen, das Wunder. Rot muss kommen! MUSS!
Klackernd fängt die Kugel an zu tanzen und zu springen.
Er kann nicht mehr hinsehen. Um Gottes willen, was tut er da! Alles liegt auf diesem einen Feld. Hatte er sich nicht tausendmal geschworen, dass er diesen Fehler nie wieder begeht? Bei Schwarz wäre alles verloren.
Schweiß tropft ihm in den Hemdkragen, rinnt ihm in die Augen.
Seine Hände zittern, als er sie in Zeitlupe vors Gesicht hebt. Nicht hinsehen!
Das Klackern wird langsamer. Klackklackklack, klackklack, klack ...
Gleich wird es entschieden sein.
Er will die Ansage des Croupiers nicht hören. Weg hier, nur weg.
Sein Stuhl kippt nach hinten, so hastig steht er auf. Der Pulk Gaffer hinter ihm lässt ihn durch, raunt verwirrt. Sein Blick hebt sich zum gleißenden Licht des Kronleuchters, zum ersten Mal seit Stunden fühlt er den unterdrückten Hunger, Durst und quälenden Druck auf der Blase.
Rot! Rouge, Rouge, Rot!
Er kann nichts anderes mehr denken.
Mit einem letzten Klick und leisem Schnarren fällt die Kugel an ihren Platz.
Er hält sich die Ohren zu, legt die Hände dann wieder vors Gesicht, nur um die Anzeigetafel sogleich zwischen den gespreizten Fingern anzuvisieren.
Noch flackert die letzte Zahl, 7, rot.
Gleich muss die neue Zahl aufleuchten.
Sein Herz rast. Er wendet sich zum Tisch, wo der Croupier mit ungerührter Miene bereits die Auszahlungen abwickelt. Die Gaffer haben ihm wieder den Rücken zugewandt, ein paar schütteln den Kopf.
Langsam dreht sich sein Kopf zur Tafel, zur Leuchtschrift, zum Unentrinnbaren.
31.
Schwarz.
Alles aus.
Stille dröhnt in seinem Kopf. Der blaue Saal dreht sich, ihm werden die Knie weich.
Nicht auffallen. So tun, als sei nichts passiert. Lächeln. Die Schultern heben und die Handflächen nach oben drehen. Pech gehabt. Morgen ist ein neuer Tag, kommt ein neues Spiel.
Nur nicht zeigen, dass es kein Morgen, kein neues Spiel mehr geben kann.
Mit bebenden Fingern zerrt er die Krawatte auf, die seine Kehle wie ein Henkersstrick zuschnürt. Der oberste Hemdknopf springt dabei ab.
Der Saalchef hebt die Augenbrauen und tauscht einen kurzen Blick mit dem Croupier. Beide nicken fast unmerklich, dann kommt der Saalchef langsam auf ihn zu. Gleich wird er ihm höflich ein Taxi anbieten, etwas von »Pause einlegen«, »eine Weile fernbleiben« vorschlagen.
Das hat er erst letzte Woche drüben in Baden-Baden gehört. Deshalb hat er doch den Ort gewechselt, hat sein Glück im elsässischen Niederbronn versucht.
Mit einer Handbewegung bringt er den Saalchef zum Innehalten, stürzt an ihm vorbei, durch die Lobby, hinaus ins Freie, wo der Herbstwind sein durchgeschwitztes Hemd eiskalt an seinen Körper klatscht. Vier Straßen weiter, unter alten Kastanienbäumen, die bereits ihr Laub verlieren, wartet sein altersschwacher Peugeot. Das Benzin reicht wahrscheinlich nicht mehr nach Hause.
Nach Hause? Er hat kein Zuhause mehr, und das ist alles seine eigene Schuld.
Verdammt, nur kein Selbstmitleid jetzt. Der Verlust war doch gar nicht hoch. Streng genommen hat er nur den ersten Einsatz verloren, die zwanzig Euro, die er vorhin im kleinen Park vor den Eingangsstufen für seine Armbanduhr bekommen hat. Den ganzen Haufen Plastikjetons auf Rot hat eigentlich die Bank im Laufe des Spiels beigesteuert. Das ist gar nicht sein Geld gewesen. Es hätte seines sein können, ja, aber eingesetzt hat er nur die Uhr. Gar nicht so schlimm, abgesehen vom zerplatzten Traum vom Geld.
Trotzdem. Warum hat er nicht früher aufgehört? Warum hat er denselben Fehler gemacht wie gestern und vorgestern und letzte Woche? Wie dumm kann ein Mensch sein?
Gierig tastet er seine Taschen nach einer Zigarette ab, vergebens. Regen setzt ein, rinnt ihm über das Gesicht, läuft in den nass geschwitzten Hemdkragen. Er rennt das letzte Stück, stolpert, kann sich gerade noch abfangen, lässt sich auf den Fahrersitz fallen und schlägt aufs Lenkrad, so lange, bis die Handfläche brennt. Es hilft nichts, die Wut bleibt.
Mechanisch löst er die Krawatte und wirft sie auf den Beifahrersitz, öffnet die oberen Hemdknöpfe und tastet nach seinem Glücksbringer. Die Goldkette, an der dieser früher hing, ist längst einem billigen silberfarbenen Ersatz gewichen, aber der Anhänger, den er vor jahren einem abgebrannten Berufskollegen abgeluchst hat und von seinem Bruder hat umarbeiten lassen, der ist noch da. Obwohl er kein Glück bringt. Jedenfalls nicht immer. Aber man kann nie wissen. Vielleicht wendet sich das Blatt schon morgen.
Einen Augenblick überlässt er sich dieser Aussicht, dann kehrt die Realität mit dem klatschenden Regen, dem leeren Tank, dem bohrenden Hunger und dem trockenen Mund zurück, der sich wie Schmirgelpapier anfühlt. Seine Zunge klebt vor Durst am Gaumen.
Er weigert sich auszurechnen, wie lange er die Miete hätte bezahlen können, wenn er nur aufgehört hätte. Er hätte einfach den Stapel nehmen und zur Kasse gehen müssen. Fünfmal Rot hintereinander – das wäre eigentlich genug gewesen. Es hätte so einfach sein können.
Hätte.
Selbstvorwürfe helfen nicht. Es muss weitergehen. Aber wie? Marcel anrufen? Dem schuldet er noch die letzte Beute. Der würde ihm die Hölle heißmachen oder gleich einen neuen Coup vorschlagen. Aber er will das nicht mehr. Er hat es satt, alte Frauen schreien zu hören. Ihr Gebettel und ihre aufgerissenen Augen verfolgen ihn schon in den Schlaf.
Dann lieber die Nacht am Straßenrand verbringen.
Oder auf ein Wunder hoffen.
Wie spät mag es sein? Die Uhr am Armaturenbrett funktioniert schon lange nicht mehr, das Radio ist kaputt. Es ist stockdunkel, als sei es nach Mitternacht. Aber das kann nicht sein. Als er seine Uhr verkauft hat, dämmerte es gerade.
Egal. Was bedeutet das schon. Es gibt nur ein Ziel: weg vom Ort seiner Niederlage.
Die Straßenlaternen blenden, dann, außerorts, schluckt der nasse Asphalt das trübe Licht seiner verschmutzten Scheinwerfer. Die Wischerblätter rucken und quietschen, die Scheiben beschlagen von innen. Ein Wegweiser huscht vorbei.
Ist er richtig abgebogen? Angestrengt starrt er durch die Schlieren auf der Windschutzscheibe und versucht, etwas Bekanntes zu erhaschen. Aber da ist nichts, nur ein einsames Waldstück, durch das er schon viel zu lange fährt. Wäre dies der gewohnte Rückweg, hätte längst die nächste Abzweigung auftauchen müssen.
Was würde mehr Sprit verbrauchen: umkehren oder aufs Geratewohl weiterfahren und auf eine Abkürzung hoffen?
Wie eine schwarze Wand drängen sich die Bäume links und rechts der Strecke. Die Sicht wird immer schlechter. Er nimmt den Fuß vom Gas. Ein Wildunfall wäre das Letzte, was er jetzt gebrauchen könnte. Linkerhand taucht ein großes, hell erleuchtetes Einsiedler-Gehöft auf.
Achtung! Da vorn, am rechten Straßenrand! Da ist etwas. Es bewegt sich, zappelt. Ein Kitz? Nein, ein Hund. Und auf der anderen Straßenseite ... um Gottes willen! Bremsen, bremsen!
Schlitternd kommt der Wagen zum Stehen. Das war knapp.
Warum kniet die Frau dort am geöffneten Gartentor und streckt die Arme aus? Warum läuft sie nicht hinüber? Das ist offensichtlich ihr Hund, der sich im Straßengraben quält. Er scheint schwer verletzt zu sein. Wahrscheinlich hat ihn ein Autofahrer erfasst und ist geflüchtet.
Wenn das die Besitzerin ist, warum hilft sie dem Tier dann nicht?
Er kurbelt das Fenster herunter, und der Regen durchweicht ihm wie eine Schwalldusche die linke Anzugseite.
»Bennie, Bennie!«, hört er die Frau schreien. Sie windet sich wie unter Qualen, scheint aber äußerlich unverletzt zu sein. »Benniiiie!«
Was ist los mit ihr? Kann sie nicht laufen? Hat sie innere Verletzungen?
Ohne sich um den Regen zu kümmern, springt er aus dem Auto und rennt zu ihr.
Sie sieht ihm entgegen wie ein Reh in der Falle. Als er sie erreicht, schnellt sie hoch und umklammert ihn mit erstaunlich kräftigem Griff.
»Ich kann nicht! Ich kann da nicht hin. Helfen Sie ihm. Holen Sie ihn mir. Mein armer Bennie!«
Sie zittert, ist vollkommen durchnässt. Vermutlich steht sie unter Schock. Warum kann sie die paar Schritte nicht selbst laufen?
Doch für Fragen ist keine Zeit. Das Jaulen des Hundes bringt ihn fast um den Verstand. Es erinnert ihn an den Tag kurz nach Mutters Tod, als Marcel und er ihren kleinen Nicki ins Tierheim bringen mussten, weil Großmutter Hunde angeblich nicht leiden konnte.
Bennie ist ein wuscheliger Mischling, dem jetzt das Fell an den Rippen klebt. Immer wieder versucht er, auf die Vorderfüße zu kommen, während seine Hinterläufe merkwürdig verdreht reglos auf dem nassen Gras liegen. Winselnd blickt er hoch. Zu schwach, um Abwehr oder Freude zu zeigen, lässt er sich hochnehmen, streicheln, über die Straße tragen und wieder absetzen.
»Bennie!«
»Ich fürchte, sein Rückgrat ist gebrochen«, hört er sich mit heiserer Stimme sagen.
Die Schreie der Frau werden lauter, je weiter sich das Leben aus dem zuckenden, blutenden Hundekörper zurückzieht. Sie legt sich neben das Tier in den Schlamm, vergräbt ihr Gesicht im nassen Fell, aus den Schreien wird ein Wimmern. Dann herrscht Stille.
Schweinwerferlicht nähert sich und streift das Hofensemble, das viel imposanter ist, als er zunächst vermutet hatte. Es besteht aus einem großen alten Fachwerkgebäude, das linkerhand der offenen Hoffläche steht, einem Garagentrakt rechts und einer riesigen Scheune an der Stirnseite, die, von den großen hellen Schaufenstern zu schließen, als Verkaufsraum benutzt wird. Neben dem Zaun sind Keramiken auf einem langen Brett aufgereiht, so wie in der Gegend sonst Obst und Kartoffeln am Straßenrand angeboten werden. »Sophies Keramikstudio« steht zweisprachig auf einem großen Schild.
Das Kreischen von Bremsen reißt ihn aus den Betrachtungen. Hupend überholt der heranpreschende Wagen sein gefährlich ungesichert abgestelltes Fahrzeug.
»Tut mit leid«, sagt er leise. »Ich muss dann wieder. Das Auto ...«
Die Frau umarmt weiter ihren Hund und sieht ihn an, als verstünde sie ihn nicht. Sie ist ungefähr in seinem Alter, trägt Jeans und ein zu großes kariertes Hemd, das klatschnass an ihrem kräftigen Körper klebt; die langen dunklen Haare hat sie zu einem dicken Zopf im Rücken geflochten. Die Traurigkeit in ihren Augen scheint sich bis in seine Seele zu bohren.
»Bitte helfen Sie mir«, fleht sie. »Helfen Sie mir, Bennie zu begraben. Lassen Sie mich nicht allein, nicht jetzt. Das ertrage ich nicht. Bleiben Sie bei mir, bitte!«
Sein Blick wandert von der schweren Goldkette an ihrem Hals über das gepflegte Grundstück, von den Töpferwaren in den erleuchteten Schaufenstern bis hin zum ordentlich aufgeschichteten Stapel Brennholz neben der herrschaftlichen Eingangstreppe und zu den Kübeln mit sorgfältig gestutzten Buchskugeln. Blätter wirbeln vom riesigen Walnussbaum in der unbefestigten Hofmitte, eine Windbö peitscht ihm den Regen waagerecht ins Gesicht.
»Leben Sie allein?«
Sie nickt ohne Argwohn. »Normalerweise macht mir die Einsamkeit nichts aus, im Gegenteil, sie hilft mir. Aber heute ...« Ihre Stimme bricht ab, als sei alles gesagt.
Hier ist es also, das Wunder, auf das er gehofft hat. Warum zögert er noch?
EINS
Montag, 6. Juli
Eine noch. Nur eine einzige. Die letzte. Aber welche?
Unschlüssig ließ Ingeborg Dahlmann ihre Finger über der Schale mit den Pralinen kreisen. Büffelmilch-Sahne-Likör, Weihrauch mit Rosmarin, Feige an Balsamico, Tomate-Marsala, Birne-Kardamom, Blaumohn-Rotwein oder Thymian-Limette? Wer um alles in der Welt kam nur auf so unwiderstehliche Ideen?
Süßholz-Lakritz! Nein, doch lieber Tonka-Bohne.
Genüsslich lehnte sie sich in ihrem geblümten Sofa zurück, legte sich das Stück auf die Zunge, schloss die Augen und blendete das hauchfeine Kratzen in der Diele und die schwüle Sommerhitze im Haus aus, um sich mit allen Sinnen diesem himmlischen Geschmack hinzugeben, der in ihrem Mund zu einer seidigen, buttrigen, süßen Sünde schmolz. Im Nachklang setzte ein schwach prickelndes Feuerwerk am Gaumen ein, das Ingeborg mit einem zufriedenen Brummen honorierte. Der Chocolatier hatte offenbar noch eine Spur Brausepulver oder wer weiß was für eine Essenz, vielleicht aus dieser merkwürdigen, neumodischen Molekularküche, beigemischtgöttlich. Gleich morgen würde sie ihn anrufen und ein weiteres Pfund seiner Gewürzpralinen bestellen.
Doch jetzt sollte sie endlich den Blutdruck messen, die Herztablette einnehmen und einen kurzen Mittagsschlaf halten, wenn der sich überhaupt noch lohnte. Thorben würde gleich kommen, ihr Enkel, ihr Ein und Alles. Hoffentlich hatte die Standpauke vom letzten Mal genutzt, und er kam pünktlich.
Zehntausend brauchte er heute, und sie hatte den Umschlag schon bereitgelegt. Er würde ohnehin alles erben, warum sollte er dann nicht jetzt schon etwas bekommen?
Ihre Freundin Marie-Luise sah das völlig anders. Erst gestern hatten sie sich am Telefon gestritten, weil sie so unterschiedliche Auffassungen hatten. Marie-Luise war manchmal entsetzlich kompromisslos »alte Schule«, sie lehnte jede Maßlosigkeit ab, sowohl im privaten Bereich als auch im geschäftlichen. »Der Junge hat schon genug bekommen, der muss sich erst einmal beweisen«, hatte Marie-Luise sie beschworen, bis ihr die Ohren heiß geworden waren und sie deshalb mitten im Gespräch den Hörer aufgelegt hatte. Sie konnte sich gut ausmalen, dass Marie-Luise das »unerhört« und »ungebührlich« gefunden hatte, aber das war ihr egal. Später, wenn Thorben ihr eine seiner netten, lustigen Geschichten erzählt hatte, wofür er das Geld diesmal benötigte, würde sie ihre Freundin ausnahmsweise von sich aus anrufen und sich mit ihr aussöhnen.
Aber erst einmal das Blutdruckgerät aufbauen. Und die Vorhänge zuziehen. Seit Tagen schon waberte diese unerträglich feuchte Hitze von der Rheinebene bis hinauf zum Annaberg, dem Sonnenhügel Baden-Badens gleich unterhalb des Merkurberges. Auch in der Nacht kühlte es kaum ab, dabei war es erst Anfang Juli.
Ächzend und mit einer ungeschickten Armbewegung nach hinten versuchte Ingeborg, im Sitzen einen der dicken Vorhänge zu erhaschen. Es gelang ihr nicht. Mühsam rappelte sie sich hoch, hielt sich an der Sofalehne fest und fasste sich unwillkürlich an die schmerzende Hüfte. Gleich morgen früh würde sie Natascha bitten, alle Läden und Vorhänge vorzuziehen und so die Hitze auszusperren.
Das Telefon begann zu läuten, und Ingeborg verfluchte sich wieder einmal innerlich, dass sie noch kein schnurloses Gerät hatte, sondern sich nun in den Flur schleppen musste. Der Apparat hatte nicht einmal einen Anrufbeantworter – Thorben hatte ihn schon einmal als Antiquität versteigern wollen –, aber der Fernsprecher war nur ein wenig unbequem, sonst jedoch völlig in Ordnung. So etwas gab man nicht einfach weg, das wäre unvernünftig, einfach das Geld zum Fenster hinausgeworfen.
Ingeborg hielt die Luft an, als der Schmerz wie gewohnt wie ein glühendes Messer an ihrem Hüftknochen vorbei direkt bis ins Schmerzzentrum in ihrem Kopf schoss, während sie an Tisch und Sessel Halt suchte und sich in Zeitlupe dem Telefon näherte, das beharrlich weiterschrillte. Jeder in ihrem Bekanntenkreis wusste, dass sie nicht gut zu Fuß war, also würde das Klingeln noch eine Weile weitergehen.
»Ja doch, gleich«, murmelte sie und streckte schon den Arm zum Hörer aus.
Da war dieses Kratzen wieder zu hören, lauter als vorhin und näher. Erschrocken drehte sie sich um und erstarrte. Dann begann sie zu schreien.
***
Marie-Luise Campenhausen stand vor dem Eingang der Stadtklinik und betrachtete ihr Handy mit einer Mischung aus leisem Ärger und Verwunderung. Warum nahm Ingeborg nicht ab? Sie war zu Hause, das wusste sie. Thorben hatte sich angesagt, da verließ sie nie das Haus. Wahrscheinlich schmollte sie noch wegen ihres dummen Streits gestern. Wie konnte ein Mensch nur so nachtragend sein! Dabei hatte sie es nur gut gemeint. Sie mochte Thorben und vertraute ihm, aber trotzdem musste der Junge endlich lernen, so finanziell für sich selbst zu sorgen, wie er es für andere auch tat.
Seufzend steckte Marie-Luise ihr Handy ein und winkte Joseph zu, der ermattet im Schatten auf einer Bank wartete. Sie kannte Joseph von Termühlen nun schon seit vier Jahren, und stets war er ihr gerade in Krisensituationen ein ergebener Freund gewesen. Auch heute hatte er auf sein Mittagsritual verzichtet und sie ohne Murren in die Klinik gefahren, in die ihre Putzfrau nach einem bösen Sturz von der Leiter in ihrer Wohnung eingeliefert worden war.
»Komplizierter Bruch. Sie wird die nächsten zwei, drei Wochen hierbleiben müssen«, berichtete sie ihm, als sie neben ihm auf dem warmen Holz Platz nahm. Diskret holte sie ein Taschentuch aus der Handtasche und tupfte sich die Schläfen ab. »Und auch danach ist vorerst nicht mit ihrer Hilfe zu rechnen. Darüber muss ich Ingeborg informieren.«
Wieder griff Marie-Luise zu ihrem kleinen Apparat, tippte die Kurzwahl und hielt sich mehr als eine Minute lang den Hörer ans Ohr.
»Warum nimmt sie nicht ab? Ich will ihr doch nur sagen, was mit Natascha passiert ist, damit sie morgen früh nicht vergebens auf sie wartet.«
»Vielleicht hält sie an einem schattigen Plätzchen im Garten ein Nickerchen und hört das Telefon nicht.«
In Josephs Stimme schwang solch eine Sehnsucht mit, dass Marie-Luise ihm schmunzelnd die Hand auf den Arm legte. »Mein Lieber, fahr du doch bitte heim. Du hast mir schon genug geholfen.«
»Das kommt nicht in Frage«, protestierte Joseph, doch sein weißer Schnauzbart zitterte verdächtig, als würde er nur mit Mühe ein Gähnen unterdrücken.
»Ich warte nur noch, bis Nataschas Mann ein paar Sachen vorbeibringt. Das bin ich ihr schuldig. Hätte ich sie nicht gebeten, die Gardinen zu waschen, wäre sie niemals auf die Leiter gestiegen. Nataschas Mann ist Taxifahrer, er fährt mich bestimmt heim, das wird überhaupt kein Problem sein. Und wer weiß, vielleicht erreiche ich Ingeborg, und sie lädt mich zu sich zu einem Kaffee ein. Dazu möchtest du mich bestimmt nicht begleiten.«
Das genügte, um ihn zu überzeugen.
***
Die Hand, die sich brutal auf ihre Lippen presste, war glatt und roch nach Plastik. Der Fremde vor ihr trug eine welke Gummimaske, die wohl Wladimir Putin darstellen sollte und in einer anderen Situation eher lächerlich gewirkt hätte. Aber hier gab es nichts zu lachen. Das hier war tödlicher Ernst. Ingeborg bog ihren Kopf zurück, doch der Eindringling stieß sie im gleichen Augenblick rückwärts an die Wand. Ihre Zähne schlugen bei dem Aufprall aufeinander, ihr Kopf begann zu dröhnen.
Entsetzen kroch in ihr hoch, gelangte in ihr Herz, das augenblicklich bockte und ausschlug. Sie spürte, wie es schwächer wurde.
Die Notfalltropfen!
Ingeborg hatte das Gefühl, ihre Augen würden aus den Höhlen quellen, als sie versuchte, den Mann mit Blicken zum Couchtisch zu dirigieren, auf dem neben der Konfektschale ihre Notfallmedizin stand.
»Nicht schreien«, flüsterte der Fremde.
Sie bemühte sich, den Kopf zu schütteln, und streckte mit einem wimmernden Laut das Kinn in Richtung Wohnzimmer.
»Wenn du schreist, erschieß ich dich«, raunte es in ihrem Ohr, und sie deutete heftiges Nicken an.
Der Griff lockerte sich, und im gleichen Moment sah Ingeborg in die Mündung einer Waffe. Eine Pistole, Sig Sauer P 225, neun Millimeter, Magazin mit acht Patronen, plus eine im Lauf, dachte sie automatisch. Ihr lieber Eugen war Waffennarr gewesen und hatte sie bis zu seinem Tod mit allen langweiligen Einzelheiten jeder Waffengattung genervt.
Zuletzt hatte er sich immer öfter ohne jeden Grund bedroht gefühlt und mit Pistolen oder Revolvern aus seiner Sammlung herumgefuchtelt, bis sie selbst es mit der Angst zu tun bekommen hatte und heimlich alle Munition im Vorratsschrank hinter den Nudeln verwahrt hatte. Die Waffe vor ihrer Nase stammte jedoch nicht aus Eugens Arsenal, so viel war sicher.
»Sofa«, kommandierte der Fremde, und Ingeborg humpelte, so schnell es ihr möglich war, auf ihre Medikamente zu, als sie auch schon einen Stoß in den Rücken erhielt und bäuchlings auf die Polster fiel. Ehe sie sich wehren konnte, hatte der Mann sie an den Knöcheln gepackt, drückte sie zusammen und setzte sich auf sie. Ihr wurde schwarz vor Augen, während sie hörte, dass etwas riss. Dann wurde etwas um ihre Füße gewickelt, und sie konnte sie nicht mehr rühren.
»Arme auf den Rücken«, befahl der Mann barsch.
Das konnte dem so passen. Sie würde sich nicht so einfach fesseln lassen. Sollte er doch versuchen, sie umzudrehen! Zum ersten Mal war Ingeborg froh über ihr stattliches Gewicht. Sie würde es ihm nicht leicht machen, oh nein, sie nicht!
Und da begann das Telefon wieder zu klingeln.
***
Panik greift nach ihm. Dieser Koloss macht Schwierigkeiten, und das hasst er. Er wird die Arme dieser Tonne nicht ohne Weiteres fesseln können, und jeden Augenblick kann sie wieder anfangen zu schreien wie vorhin. Schon da wäre er am liebsten davongelaufen. Er kann das nicht mehr. Soll Marcel doch künftig die Drecksarbeit machen.
Das Telefon nervt gewaltig, hoffentlich springt der Anrufbeantworter bald an.
Warum rührt sich die blöde Alte nicht? Was ist mit ihr? Gibt es etwa Komplikationen? Eigentlich müsste man mit so etwas rechnen, so gut kann Marcel gar nicht alles im Vorfeld auskundschaften.
Immer noch bimmelt das Telefon.
Und da! Die Türklingel.
Die Frau unter ihm hebt den Kopf. Gleich wird sie wieder schreien. Schnell hält er ihr mit der linken Hand den Mund zu, und sie sackt zusammen und zischt durch die Nase wie ein Luftballon, in den eine Nadel gestochen wurde.
Die Klingel, schon wieder.
Verdammt, das läuft gewaltig aus dem Ruder!
***
Die Klingel, Gott sei Dank! Das war Thorben, bestimmt. Über eine Stunde vor der vereinbarten Zeit. Typisch. Aber diesmal war ihr seine Unpünktlichkeit willkommen. Er würde bestimmt Alarm schlagen, wenn sie nicht öffnete, auch wenn sie ihm mehr als einmal verboten hatte, sich in ihre Angelegenheiten einzumischen. Er würde spüren, dass hier etwas nicht stimmte. Wie gut, dass sie nicht auf Marie-Luise gehört hatte. Gleich war der Alptraum vorbei, und dieser Bandit würde festgenommen werden. Sie musste nur noch ein paar Sekunden durchhalten.
Die Hand an ihrem Mund wurde weggezogen, doch bevor sie schreien konnte, drückte der Mann ihr mit dem Ellbogen den Kopf in die Kissen. Sie konnte sich nicht rühren, denn immer noch saß er auf ihren Beinen. Wieder hörte sie das Reißen des Klebebands und vergrub ihre Hände noch tiefer unter ihrem Bauch. Vielleicht sollte sie so tun, als sei sie ohnmächtig geworden. Vielleicht würde ihm dann alles zu kompliziert, und er würde flüchten. Herrje, niemals hätte sie es für möglich gehalten, dass sie einmal in ihrem eigenen Haus überfallen werden könnte.
Thorben – oder wer immer es war – hämmerte an die Tür. Nun mach schon! Schlag Alarm. Ruf Hilfe herbei. Dies ist keine Erziehungsmaßnahme. Ich öffne nicht, weil ich in Gefahr bin! Lass deine alte Oma nicht im Stich!
Doch nichts geschah. Ganz still wurde es, nur der schnelle Atem des Fremden an ihrem Ohr war zu hören. Dann schien auch er die Luft anzuhalten.
Entsetzt musste sie mit anhören, wie draußen Thorbens Porsche aufheulte, den sie ihm zum fünfunddreißigsten Geburtstag geschenkt hatte. Üblicherweise war es ein Hochgenuss, den satten Klang des Sportwagens zu hören, nur jetzt war das Geräusch so unwillkommen wie dieser Halunke hier, denn ... ja, in der Tat! Es schien sich zu entfernen! Das durfte doch nicht wahr sein!
Ingeborgs Herz machte sich erneut bemerkbar, es zitterte und flatterte. Höchste Zeit für die Medizin. Außerdem bekam sie allmählich keine Luft mehr in dem Kissen. Mit aller Macht versuchte sie, den Kopf zu heben, was den Gegendruck des Ellbogens noch verstärkte. Hilfe, Hilfe!
Sie musste ruhig bleiben. Dieser Überfall war eigentlich nicht viel anders als das, was sie ganz zum Schluss hatte durchmachen müssen, als Eugen immer öfter nachts mit der Pistole in ihr Schlafzimmer eingedrungen war, weil er dachte, sie sei der Feind. Nie hatte sie sicher sein können, ob er zuvor nicht doch die Munition gefunden hatte. Sie hatte es überlebt, und so würde sie auch diese Situation überstehen.
Wenn nur das Herz mitmachte! Der schwere, glühende Ring um ihre Brust wurde von Minute zu Minute enger und lähmte bereits den linken Arm. Sie wusste, was das zu bedeuten hatte, ihr Arzt hatte ihr etwas Derartiges prophezeit, aber sie konnte sich nicht verständlich machen. Verzweifelt versuchte sie, mit Röcheln und Brummen die Aufmerksamkeit des Maskierten zu erregen, doch der Mann reagierte nicht.
Immer noch saß er bewegungslos auf ihr, dann atmete er tief aus, als sich das Röhren des Porsches bergabwärts verlor.
Plötzlich ließ der Druck auf ihren Kopf und ihren Rücken nach, aber bevor sie reagieren konnte, hatte er sie an Oberarm und Oberschenkel gepackt und rollte sie in Richtung Sofalehne auf den Rücken.
Geistesgegenwärtig ließ sie ihre Arme hochschnellen, bekam mit der rechten Hand seine Halskette zu fassen und zerrte mit Leibeskräften an ihr, bis sie mit einem Ruck nachgab. Gleichzeitig packte sie mit der linken Hand die wenigen Haare der Maske, zog daran und war selbst überrascht, wie leicht das ging. Der Mann griff grob nach ihren Händen, riss die Maske wieder an sich, doch es war zu spät.
Vollkommen perplex starrte sie in sein Gesicht und japste nach Luft, während sie vor Schreck die Kette neben das Sofa auf den dicken Teppich fallen ließ.
»Sie kenn ich doch!«, rief sie und begann, sich gegen seine Spinnenhände zur Wehr zu setzen, die immer brutaler nach ihr packten. Mit aller Kraft versuchte sie, ihm das Gesicht zu zerkratzen, aber sie hatte keine Chance gegen ihn. Er setzte sich wieder auf ihre Beine und nahm ihre vor Erschöpfung zitternden Hände in einen Schraubstockgriff.
»Ich gebe Ihnen Geld«, keuchte sie. »Viel Geld. Der Umschlag ... neben dem Telefon ... nehmen Sie ihn.«
Ein zufriedenes Lächeln huschte über sein Gesicht, das sich gleich darauf wieder verfinsterte.
»Und der Safe? Und der Schmuck?«, bellte er.
Da schlug die Türklingel erneut an, ganz kurz nur, schüchtern, anders als eben bei Thorben.
Der Mann erstarrte, dann tastete er hinter sich und drückte ihr mit einer schnellen Bewegung ein Stück rotes Klebeband auf die Lippen, das er offenbar vorhin präpariert hatte. Bevor sie es wegreißen konnte, hatte er ihre Arme gepackt und über ihren Kopf gedrückt. Er stand auf und rollte sie mit einem Ruck zu sich, sodass sie fast von der Couch fiel. Dann zog er ihre Arme nach hinten auf den Rücken und wickelte etwas um ihre Handgelenke, bis sie sich nicht mehr bewegen konnte.
Das Telefon begann erneut zu klingeln, gleichzeitig rief eine fremde männliche Stimme draußen etwas. Wenig später klopfte es an die Terrassentür, jemand hämmerte immer heftiger, warf sich offenbar dagegen.
Ingeborg nahm das Geschehen nur noch verschwommen wahr. Es war doch nicht möglich, dass es zwei Täter an ein und demselben Tag ausgerechnet auf sie abgesehen hatten!
Mit einem Knurren ließ der Mann mit der Maske von ihr ab. Sie hörte ihn zum Telefontischchen eilen, den Umschlag aufreißen, einen leisen Pfiff ausstoßen, während auf der anderen Seite des Hauses jemand etwas rief und erneut gegen die Terrassentür trat, bis es so klang, als würde der Holzrahmen splittern . Dann wurde es still, drinnen wie draußen. Als würden sich die beiden gegenseitig belauern.
Da war dieses merkwürdige Kratzen wieder, das sie schon vorher gehört hatte, dann entfernte sich der Mann mit quietschenden Gummisohlen in Richtung Diele; im nächsten Moment fiel die Haustür ins Schloss.
Im Garten war noch einmal ein undeutliches »Hallo?« zu hören, dann kehrte auch dort Ruhe ein.
Nur ihr Herz kam nicht mehr zur Ruhe, sondern krampfte sich zusammen, setzte aus und hielt inne.
ZWEI
Mittwoch, 8. Juli
Grübelnd saß Lea Weidenbach vor ihrem Bildschirm und versuchte, den Geräuschpegel der Redaktion auszublenden. Normalerweise gelang ihr das ohne Probleme, aber heute war es anders; sie war nervös und deshalb überempfindlich.
Ihr Schreibtisch war übersät mit Papieren und Notizzetteln, die Sensation zum Greifen nah – und doch war sie meilenweit davon entfernt, sie veröffentlichen zu dürfen, und das wurmte sie. Schließlich war es ihre Aufgabe als Reporterin des Badischen Morgens, jemanden aufzutreiben, der ihr wenigstens eine kleine offizielle Bestätigung lieferte, damit sie die Story aus dem Tümpel der Gerüchteküche reißen konnte. Aber sie fand niemanden, und es sah so aus, als würde sie für heute auf ihren geheimen Informationen sitzen bleiben und nur hoffen können, dass kein anderer Journalist in der Stadt von der Sache Wind bekam und vielleicht mehr Glück hatte als sie oder die Sensation ungeprüft veröffentlichte.
Und was für eine Sensation das war: Eine Handvoll Russen plante im Geheimen, für etliche Millionen Euro ein neues Museum in Baden-Baden zu bauen und darin Ikonen auszustellen, deren Wert den des Gebäudes um ein Vielfaches übersteigen würde. Das war an sich ein schönes Vorhaben. Was die Sache so heiß machte, waren zwei Dinge: Sie planten den Neubau ausgerechnet auf der Klosterwiese, also mitten in der allen Baden-Badenern heiligen Lichtentaler Allee, und sie knüpften an ihren Plan die Bedingung, im Gegenzug für sich und ihre weitverzweigten Familien unbegrenzte Aufenthaltsgenehmigungen zu erhalten – und zwar unter sehr großzügiger Auslegung der gesetzlichen Bestimmungen.
Es gab offenbar bereits Pläne, Voranfragen, Vorgespräche, Vortreffen, aber alles war top secret, auch sie hatte erst heute Morgen davon erfahren. Niemand, erst recht nicht ihre Informanten, wollte und konnte offiziell dazu Stellung nehmen. Angeblich drohten die Investoren, ihr Vorhaben im drögen Rastatt zu verwirklichen oder – schlimmer noch – den Bau direkt neben den Autobahnzubringer zu setzen, aber auf die Gemarkung der ohnehin schon viel zu reichen Nachbarstadt Sinzheim, sollte auch nur das Geringste an die Öffentlichkeit gelangen.
Lea betrachtete die Archivmeldungen über ein ähnliches Projekt, ein gigantisches Oldtimermuseum, das unter fast gleichen Vorzeichen vor einigen Jahren geplant worden und dann geplatzt war, weil die Investoren die Voraussetzungen nicht erfüllen konnten. Tatsächlich war es nach dem Gesetz möglich, eine unter Bürgern der ehemaligen Sowjetunion begehrte, dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten, wenn man nachweisen konnte, dass man pro Person mindestens eine viertel Million Euro investieren, mindestens fünf Arbeitsplätze schaffen sowie als Geschäftsführer dauerhaft vor Ort leben werde.
Wenn sie wenigstens herausbekommen könnte, wer die Interessenten waren. Vielleicht fand sich unter ihnen einer, der redete.
Lea schloss das Suchprogramm im Computer und stöhnte leise. Heute fühlte sie sich tatsächlich wie sechsundvierzig, ach, noch älter: antriebslos, ausgepowert, depressiv. Das lag bestimmt daran, dass sie wegen einer dummen kleinen Knöchelverletzung seit Wochen keine ordentliche Joggingrunde mehr gedreht hatte. Aber Sonntag, Sonntag würde sie wieder anfangen. Und das sogar mit ...
Wo hatte sie nur ihre Gedanken! Verdrossen schob sie den Stapel Papiere zusammen und überlegte angestrengt, wen sie noch anrufen könnte. Hoffentlich blieb die Sache wirklich geheim. Es wäre ihr persönlicher Alptraum, würde ihr jemand von der Konkurrenz zuvorkommen und die Story auch ohne die erforderlichen Absicherungen veröffentlichen.
Natürlich könnte auch sie die Bombe ins Blaue hochgehen lassen, aber es ging gegen ihre Ehre, unsaubere journalistische Arbeit abzuliefern.
Das Telefon riss sie aus ihren Überlegungen, und erneut entschlüpfte ihr ein leiser ungeduldiger Laut. Der Blick auf das Display verriet ihr, dass dies kein Anruf war, auf den sie sehnlichst wartete, im Gegenteil: Die Mobilnummer von Marie-Luise Campenhausen, ihrer Vermieterin und Vertrauten, leuchtete auf. Seit sie sich vor zwei Jahren endlich ein Handy zugelegt hatte, war die liebenswerte achtundsiebzigjährige Dame von der Telefonitis befallen, die sie sogar dann und wann ihre geheiligte Etikette vergessen und sie hemmungslos anrufen ließ, wann und wo immer ihr etwas spanisch vorkam in Baden-Baden. Sie spielte gern Hilfsdetektivin, was auch an der riesigen Menge an Krimis lag, die sie unablässig verschlang. In der Vergangenheit hatten sie deshalb schon einige Male ein hervorragendes inoffizielles Ermittlerteam abgegeben. Jetzt allerdings nervte sie.
»Verzeihen Sie bitte, ich glaube, ich rufe Sie in letzter Zeit zu oft an, Kindchen«, entschuldigte sie sich nach hastiger Begrüßung, »und ich habe lange gezögert, ob ich Sie in der Redaktion stören darf. Aber ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Es geht um meine Freundin Ingeborg ...«
Lea verdrehte die Augen. »Das ist die, die Sie gestern und vorgestern nicht erreichen konnten, nicht wahr?«
»Sie hat sich immer noch nicht gemeldet, nicht einmal gestern, als ihre Putzfrau nicht kam. Durch meine Schuld übrigens ...«
»Ich weiß, der Beinbruch.« Die Geschichte hatte sich Lea schon mehrfach anhören müssen. Allmählich wurde selbst eine noch so flotte Frau Campenhausen alt, daran war nichts zu rütteln.
»Genau. Ich habe Ihren Rat befolgt und Joseph gestern Abend noch gebeten, mich zu ihr zu fahren. Wir haben geklingelt, aber es hat niemand aufgemacht. Es kann sich also um keine simple Telefonstörung handeln, wie es in Baden-Baden ja leider zur Tagesordnung gehört.«
»Vielleicht macht sie einen spontanen Kurzurlaub.«
»Nicht Ingeborg. Sie verlässt fast nie das Haus.«
»Haben Sie es bei den Nachbarn versucht?«
»Das ist es ja gerade. Die Villa links ist verwaist, und der andere Nachbar hat nichts außer einem Falschparker bemerkt.«
»Tja, also dann, Frau Campenhausen ...«
»Und Thorben, ihren Enkel, kann ich seit heute auch nicht mehr erreichen.«
Lea lehnte sich mit leiser Ungeduld in ihrem Stuhl zurück. »Sie befürchten also, dass ihr etwas zugestoßen ist. Warum informieren Sie nicht die Polizei?«
»Oh, Sie kennen Ingeborg nicht. Sie würde nie mehr ein Wort mit mir wechseln, wenn es falscher Alarm wäre. Es könnte durchaus sein, dass sie nicht ans Telefon geht, weil sie immer noch eingeschnappt ist. Vielleicht hält sie gerade ein Schläfchen oder liegt in der Wanne, und die Polizisten schlagen die Haustür ein und stürmen mit gezückter Waffe das Haus ...«
Lea musste lachen. »Jetzt geht Ihre kriminelle Phantasie aber mit Ihnen durch.«
»Meinen Sie nicht, Sie könnten den netten Herrn Gottlieb ganz privat um Hilfe bitten? Sie sind ja gut mit ihm bekannt.«
Lea lächelte. Gut bekannt war untertrieben. Max und sie waren seit zwei Jahren ein Paar, aber nur heimlich. Lediglich Frau Campenhausen wusste Bescheid, niemand in der Redaktion oder auf seiner Dienststelle durfte etwas davon wissen. Polizei und Presse – das passte nicht zusammen, das gab jede Menge beruflicher Schwierigkeiten.
Sie angelte ihr privates Handy aus dem Rucksack, drückte ein paar Tasten, bis sein Foto hochlud, das sie vor Kurzem im Elsass aufgenommen hatte: Sein gepflegter gestutzter Vollbart und die kurzen Haare waren inzwischen silbergrau geworden, seine karamellbraunen sanften Augen hinter der runden Hornbrille blitzten freundlich, und sein verlegenes Lächeln verriet, dass er sich nicht gern ablichten ließ. Aber sie hatte nicht widerstehen können, diese Aufnahme zu machen, denn es war ein himmlischer Abend gewesen. Ihr wurde warm, als sie das Bild betrachtete, dann aber drehte sie sich schuldbewusst um und vergewisserte sich, dass kein Kollege ihr über die Schulter sah. Schnell ließ sie das Handy wieder zurückgleiten.
»Sie wollen jetzt aber nicht, dass der Leiter der Mordkommission für Sie ganz privat über einen Zaun klettert, ein fremdes Grundstück betritt, ein Fenster einschlägt, in ein Haus eindringt, in dem die Besitzerin vielleicht gerade seelenruhig vor dem zu laut aufgedrehten Fernseher sitzt und einen Herzanfall erleidet, wenn sie ihn sieht?«
»Oh, wie dumm von mir. So weit hatte ich gar nicht gedacht. Das geht natürlich nicht. Aber wissen Sie was? Ich als Ingeborgs Freundin sollte das tun. Ja, genau, ich nehme gleich den Bus. Auf Wiederhören, ich melde mich dann später noch einmal.«
»Nein, Frau Campenhausen, so war das nicht gemeint. – Frau Campenhausen?«
Aufgelegt.
Halb belustigt, halb besorgt betrachtete Lea den Apparat. Frau Campenhausen war alles zuzutrauen. Was, wenn es in der Villa ihrer Freundin wirklich einen Notfall gab? In den letzten Monaten waren im Stadtgebiet mehrere wohlhabende Witwen überfallen worden. Ob sie Max vielleicht doch informieren sollte? Aber sie wusste ja nur den Vornamen dieser Freundin, und Frau Campenhausen, so stellte sie fest, als sie die Nummer zurückrufen wollte, hatte soeben ihr Handy vom Netz genommen und war »leider vorübergehend nicht erreichbar«.
***
Wolkenlockerer Biskuit, cremige Sahne, süße Früchte bestäubt mit einem Hauch von Puderzucker – das war, das war ...
»Diese Erdbeerrolle ist genau das Richtige für Ihren Einstand, Frau äh ...«, nuschelte Kriminalhauptkommissar Maximilian Gottlieb verzückt. »Selbst gebacken?«
Die neue Schreibkraft, die bisher im Raubdezernat gearbeitet hatte, nickte strahlend. »Mein Name ist übrigens ganz leicht zu merken:. Lydia Riebe. Riebe – das reimt sich auf Liebe. Da passen wir doch prima zusammen, gell, Herr Gottlieb?«
Gottlieb gab sich Mühe, sich nicht zu verschlucken. Natürlich kannte er ihren Namen, er wusste nahezu alles über sie: Vierunddreißig, geschieden, Dienstvermerk wegen Unpünktlichkeit, aber offenbar extrem effizient, wenn er der Kollegin Katz glauben konnte, und tierlieb. Ständig trieb sie sich bei der Hundestaffel herum, schäkerte mit den Kollegen, sorgte aber auch für deren vierbeinige Gefährten.
Wie aufs Stichwort war irgendwo in einem Büro oder auf dem Gang ein Fiepen zu hören, dann ein hastiges Bellen und ein leiser Fluch.
»Was ...?«
»Oh, das ist meine Ella. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, dass ich sie heute mitgebracht habe. Ich will nach Dienstschluss zu meiner Cousine ins Elsass fahren und ihr den Hund bringen. Ihr eigener ist im Herbst überfahren worden, und sie hätte so gern wieder einen. Und ich kann mich ja nur schlecht um die Kleine kümmern, wenn ich hier in der Mordkommission arbeite. Meine Vorgängerin hat mich schon unterrichtet, dass die Dienste recht unregelmäßig sein können.«
Gottlieb schnaubte. Wie viele Mordfälle hatte es denn in den letzten Jahren gegeben? Vier oder fünf. Da von unregelmäßigem Dienst zu sprechen, grenzte an Verleumdung.
Allmählich füllte sich der Aufenthaltsraum, neben den Kollegen von der kriminaltechnischen Abteilung kamen nun auch Hanno Appelt, sein pingelig-bürokratischer Stellvertreter mit nass nach vorn gekämmtem dünnen Haar und breiter Streifenkrawatte, die blondierte, dauergewellte, mütterliche, blitzgescheite Sonja Schöller mit dem sechsten Sinn, die seit einem Jahr dessen Verlobte war, und der junge, drahtige Lukas Decker, der keine Augen für die rosa-weiße Versuchung hatte, sondern mit seinem Lauf-Computer spielte und ihnen gleich mit seinen neuesten Marathonzeiten auf die Nerven gehen würde.
Alle scharten sich um die Neue, die für Gottliebs Geschmack gar nicht wie jemand aussah, der mit allen Sinnen gut und gern backte. Dazu war sie zu dünn, und ihre Fingernägel waren zu lang und zu rot, ihre Glitzerjeans zu eng, ihre Ohrringe zu auffallend und die Absätze ihrer giftgrünen Pumps zu hoch. »Streichhölzchen« würde als Spitzname für sie passen, fand er, denn auf ihrem extrem zierlichen Körper saß ein überproportional großer Kopf mit feuerroten Locken und einem kreisrunden, pfiffigen Gesicht.
Geduldig ließ sie gerade Lukas Deckers Rekorde über sich ergehen und fragte fachkundig nach, als sei sie selbst ambitionierte Läuferin. Wenn das mal gut ging.
Vorsichtig zog Gottlieb seinen Bauch ein. Lea joggte auch regelmäßig und wollte ihn nächsten Sonntag zu einer halbwegs versteckten Strecke mitnehmen, wo er quasi inkognito seine ersten Laufversuche machen sollte.
»Ausrede zwecklos«, hatte sie ihm lachend angedroht. »Ich werde Rücksicht auf deine fehlende Kondition und deine siebenundfünfzig Jahre nehmen, und wir werden nur kurze Stücke laufen und dann wieder bequem gehen. Das wird dir Spaß machen.«
Na ja. Spaß sah anders aus. Weiß und rosa zum Beispiel, wie das zweite Stück Kuchen auf seinem Teller.
Ein schauriges Jaulen schreckte alle aus ihren Gesprächen.
»Wo ist der Hund eigentlich?«, erkundigte sich Gottlieb eher beiläufig.
»In Ihrem Büro. Das war am nächsten, sorry.«
Streichhölzchen wurde zum Glühwürmchen und sprintete los, und Gottlieb legte wortlos seine erste Trainingseinheit ein.
Zu spät.
Ella saß wie ein schwarzes Häufchen Unglück mitten auf dem schönen Teppich vor seinem Schreibtisch und winselte schuldbewusst, während sich das Bächlein unter ihr immer weiter ausbreitete.
***
Marie-Luise hielt die Hand an die Krempe ihres leichten Strohhütchens und spähte durch das hohe Eisentor. Die gelbe, verspielte Villa mit den Sprossenfenstern und weißen Klappläden, Türmchen und Anbauten, der geschwungenen hochherrschaftlichen Auffahrt und dem riesigen Garten stammte aus dem Jahr 1927 und war Ingeborgs Elternhaus gewesen, in der die Familie auch den Krieg über gelebt hatte. 1952 war Ingeborg kurz nach ihrer etwas überstürzten Heirat mit Eugen Dahlmann nach Wiesbaden umgesiedelt, aber nach dem Tod ihrer Eltern wieder zurückgekehrt, weil sie sehr an dem Anwesen hing.
Marie-Luise konnte das nur zu gut verstehen. Alte Einfamilienhäuser hatten einen unverwechselbaren Charme, und manchmal haderte sie mit sich, weil sie sich entschlossen hatte, in ihrem großen Mietshaus in der Quettigstraße zu wohnen, obwohl es zwei Villen in der Stadt gab, die ihr Willi noch zu seinen Lebzeiten als Altersvorsorge gekauft hatte. Aber sie konnte eigentlich zufrieden sein: Die Räume in ihrer Wohnung waren großzügig geschnitten, und es waren immer Mieter in Reichweite, die ein Auge auf sie hatten, wie zum Beispiel die nette Lea Weidenbach.
Ingeborg hingegen hatte niemanden, nur Natascha, die dienstags kam, hin und wieder einen Gärtner und gelegentlich die Fußpflegerin, einen Nachbarn, dem sie aus gutem Grund aus dem Weg ging, und natürlich Thorben, der sie aber nur besuchte, wenn er Geld brauchte. Noch nie hatte Marie-Luise ihre Freundin über weitere Kontakte reden hören, und das war eigentlich verständlich, denn es war manchmal wirklich etwas mühsam mit ihr. Sie schnappte leicht ein, wusste alles besser und hatte in letzter Zeit oft einen quälenden Pessimismus an den Tag gelegt. Trotzdem. Sie waren Freundinnen seit der Schulzeit. Da gehörte es sich, gegenseitig nach dem Rechten zu sehen, wenn der Verdacht bestand, dass eine von ihnen Hilfe brauchte.
Marie-Luise betätigte die Glocke ein zweites Mal und drückte vorsichtig gegen die Eisenstäbe, darauf bedacht, ihre weißen Häkelhandschuhe nicht zu ruinieren, die sich gerade bei großer Hitze angenehm bewährten. Sie hatte letzte Woche ein neues Paar kaufen wollen und erfahren müssen, dass sie aus der Mode gekommen waren und nicht mehr hergestellt wurden.
Nichts rührte sich.
So kam sie nicht weiter. So hatte sie gestern mit Joseph auch schon am Zaun gestanden. Sie warf einen schnellen Blick zum Nachbargrundstück links. Alles verrammelt, vor allem das hohe Einfahrtstor. Russen hatten das Anwesen vor drei Jahren für zwei Komma sechs Millionen gekauft – in bar, wie es hieß – und nutzten es lediglich ein, zwei Wochen im Jahr als Feriendomizil oder wenn sie eine aufwendige Zahnbehandlung oder eine Schönheitsoperation brauchten.
Blieb also der Nachbar zur Rechten. Er pflegte genau wie Joseph seit Jahrzehnten seine festen Rituale und war, wie sie von Ingeborg wusste, um diese Uhrzeit mit dem Hund unterwegs. Das Tor seiner Einfahrt fehlte; offenbar wurde es ausgetauscht, wie auch der Pflasterbelag ganz neu war. Eine bessere Gelegenheit gab es nicht.
Ein paar Schritte, schon war sie an seinem Haus vorbei und suchte sich ihren Weg zwischen einem alten Kirschlorbeer und einem mächtigen Eibenbusch in das mit Unkraut zugewucherte Grenzbeet, in dem sich offenbar Katzen einen Pfad gebahnt hatten. Sie fand die unscheinbare, verrostete niedrige Pforte im freistehenden Zaun sofort und war ganz stolz darauf, denn immerhin hatte Ingeborg ihr von der Existenz dieser Geheimtür berichtet, als sie siebzehn gewesen war. Ja, auf ihr Gedächtnis war immer noch Verlass, auch wenn Lea Weidenbach neuerdings manchmal ungeduldig Luft holte, wenn sie ihr etwas erzählen wollte. Was sie dann dermaßen verunsicherte, dass sie gleich noch einmal von vorn anfing, obwohl sie im selben Moment merkte, dass sie sich wiederholte und viel zu ausschweifend wurde. Ach, alt werden war kein Zuckerschlecken, wahrlich nicht.
Eigentlich hatte Marie-Luise befürchtet, die Pforte verschlossen vorzufinden und darüberklettern zu müssen, aber zu ihrer Überraschung schwang das Törchen ohne Widerstand auf, ja, es quietschte nicht einmal. Als hätte es jemand vor Kurzem geölt. Aber wer sollte das getan haben? Nein, nein, das war eben noch gute alte Wertarbeit.
Der Abstand zur Bepflanzung reichte, um das Törchen bequem zu öffnen und hindurchzuschlüpfen, dann musste sie sich auf Ingeborgs Seite an einer stacheligen Fichte und einem mächtigen Rhododendron vorbeischlängeln, und schon stand sie auf dem weitläufigen Rasen. Kein Liegestuhl, wie Joseph spekuliert hatte, keine Ingeborg im Schatten außerhalb der Hörweite von Klingel und Telefon. Still lag das Haus da, fast gespenstisch.
Eine Amsel setzte sich wie eine Wächterin auf den Dachfirst und stimmte ein Begrüßungs- oder Warnlied an. Hinten im Gebüsch raschelte etwas, dann hüpfte ein Eichhörnchen über das Gras und kletterte behände den schiefen Stamm eines vergreisten Birnbaums hinauf.
»Ingeborg? Hallo?«, versuchte es Marie-Luise ohne viel Hoffnung.
Schweigen.
Unschlüssig blieb sie stehen. Obwohl die Sonne schier unerträglich auf die Rückseite der Villa brannte, waren die Läden offen, die Fenster hingegen geschlossen. Im Wohnzimmer war der schwere Vorhang aufgezogen, trotzdem konnte man durch die dichte Gardine so gut wie nichts erkennen.
Bei näherem Betrachten war jedoch der Rahmen der Terrassentür, die zur Küche führte, gesplittert, und ein Sprossenfeld hatte einen Sprung.
»Ingeborg?«
Selbst die Vögel verstummten, ebenso der Rasenmäher irgendwo in der Ferne.
Marie-Luise klopfte gegen den kaputten Türrahmen, erst vorsichtig, dann heftiger, drückte dagegen, dann drehte sie sich um und gab der Tür ganz undamenhaft mit dem Hinterteil einen Schubs Mit einem hässlichen Knirschen gab die beschädigte Tür nach. Um Gottes willen, was hatte sie getan? Konnte sie dafür belangt werden?
Nun, wo die Tür schon fast von allein nachgegeben hatte, konnte sie sie auch vorsichtig noch etwas weiter aufdrücken.
»Ingeborg!«
Jetzt könnte sie wirklich langsam antworten. Doch im Haus war es totenstill, kein Radio, kein Fernseher, der als Entschuldigung für Ingeborgs plötzliche Taubheit herhalten konnte. Und wenn Frau Weidenbach recht hatte und Ingeborg einen Ausflug machte? Vielleicht mit Thorben? Dann würde es etwas schwierig werden, diese Situation hier zu erklären.
Marie-Luise brach der Schweiß aus, was sie nicht leiden konnte. Seufzend holte sie ein frisches Stofftaschentuch aus ihrer Kostümjacke und tupfte sich damit die Stirn ab. Sie hatte keine Ahnung, was sie tun sollte. Vielleicht doch besser gehen und abwarten? Vielleicht lag morgen schon eine Ansichtskarte in ihrem Briefkasten.
Und trotzdem. Das war doch alles sehr merkwürdig hier.
Sie ging langsam durch die Küche und sah sich aufmerksam um. Es roch muffelig, als gammele seit Tagen Biomüll unter der Spüle. Auf dem Herd stand eine Pfanne mit den vertrockneten Überresten von etwas, das nach Rührei oder Haferbrei aussah. Auf dem Küchentisch standen sechs Tablettenboxen, für jeden Tag eine. Ingeborg richtete sich jeden Sonntagabend ihre Wochenration, seit vielen Jahren schon. Darin war sie pingelig. Es fehlte nur der Montag.
Eine böse Ahnung ergriff Marie-Luise wie ein hungriges Tier und nagte in ihrem Magen. Sie sollte die Polizei rufen, jetzt, sofort! Dies hier war doch Beweis genug, dass etwas nicht stimmte.
Aber sie konnte nicht anders, sie wollte sich mit eigenen Augen überzeugen. Bebend schlich sie weiter in die Eingangshalle. Auch hier war alles ruhig, wenn es auch sehr unangenehm roch. Marie-Luise hielt sich das Taschentuch vor die Nase. Das einzig Auffallende war vielleicht, dass die opulente Ming-Vase auf der antiken Kommode fehlte. An deren Platz hatte Ingeborg eine moderne, grellbunte Keramik gestellt, die wie ein Gockel mit zu langem Hals und zu kurzen Beinen aussah.
»Na ja«, murmelte Marie-Luise abschätzig, während sie sich wie in Zeitlupe der Wohnzimmertür näherte und sich unwillkürlich das Taschentuch noch fester vors Gesicht presste. Es roch ganz abscheulich hier, um nicht zu sagen entsetzlich faulig.
»Ingeborg?«, versuchte sie es ein letztes Mal und erschrak über das ängstliche Piepsen in ihrer Stimme.
Sie musste allen Mut zusammennehmen. Noch ein Schritt. Als Erstes fiel ihr Blick auf den Tisch mit den Notfalltropfen und einer Konfektschale, dann ...
»Ingeborg! Um Himmels willen!«
Die Gestalt, und als etwas anderes konnte man das Wesen in Ingeborgs weitem rosa Sommerkleid nicht mehr bezeichnen, lag reglos auf der geblümten breiten Couch, bäuchlings, die Füße ebenso mit rotem Klebeband gefesselt wie ihre Hände, die auf dem Rücken zusammengebunden waren. Das Gesicht war seitwärts zum Couchtisch gewandt, auch auf dem Mund klebte ein roter Streifen, aber das war es nicht, was Marie-Luise schier den Verstand raubte.
Überall in dem Gesicht wimmelte es. Maden krabbelten aus den Augenhöhlen, den Nasenlöchern, den Ohrmuscheln. Die Gesichtszüge waren zur Unkenntlichkeit aufgedunsen, die Haut hatte ihre natürliche Farbe verloren und schimmerte grün-bräunlich.
Marie-Luise schloss die Augen und drehte sich würgend um, doch es war bereits zu spät: Dieses Bild hatte sich in ihr Gedächtnis eingebrannt, und sie wusste, dass sie es nie mehr im Leben loswerden würde.
In ihrer Brust entflammte ein tiefer Schmerz, der immer größer wurde und drohte, sie zu zerreißen.
Wie in Trance öffnete sie ihre Handtasche und suchte nach ihrem Beruhigungsmittel, dabei glitt ihr das Mobiltelefon in die Hand, und ohne nachzudenken, schaltete sie es ein und drückte auf Wahlwiederholung.
DREI
Normalerweise freute sich Maximilian Gottlieb, wenn er Lea sah, denn er liebte alles an ihr: ihre immer noch jugendlich sportliche Figur, die halblangen braunen Haare, die in der Sonne wie flüssiges Gold schimmerten, ihre klugen braunen Augen, ihren Humor, ihren beruflichen Eifer, ach ...
Meistens trafen sie sich in verschwiegenen Hotels oder abgelegenen Gasthäusern, bevorzugt im Elsass, oder sie besuchten sich heimlich, wenn es dunkel war, parkten ihre verräterischen Autos um mehrere Ecken entfernt, damit ihre von Natur aus neugierigen und findigen Kollegen ihnen nicht auf die Schliche kamen, und genossen dann die gemeinsame Zeit wie Kinder, die ihren strengen Eltern entwischt waren.
In letzter Zeit hatte sich allerdings auch ein Stück Bedauern eingeschlichen. Gottlieb sehnte sich immer öfter danach, bei Lea zu bleiben, Tag und Nacht, Woche für Woche, und endlich sein Glück mit ihr ganz offen kundzutun.
Jetzt jedoch empfand er den Anblick ihres rot-weißen Minis neben den Streifenwagen in dieser ruhigen Villengegend als absolut unpassend, denn er bedeutete nichts anderes, als dass sie mal wieder vor der Mordkommission, ja, womöglich vor den Kollegen der Schutzpolizei am Tatort gewesen war und Fotos gemacht hatte. Deren Veröffentlichung konnte er nicht mehr verhindern, genauso wenig wie den Ärger, den er sich damit bei seinen Vorgesetzten einhandelte. Bestimmt würde man ihn wieder einmal hochnotpeinlich nach seinem Verhältnis zu der Journalistin befragen und ihm nicht abnehmen, dass sie einfach gut in ihrem Job war und deshalb manchmal – ganz gegen seinen Willen und ohne sein Wissen oder Zutun – die Nase vorn hatte.
Diesmal jedoch war Lea entschieden zu weit gegangen, denn offenbar hatte sie auch noch ihre gelegentliche Hilfsdetektivin mitgeschleppt. Oder warum sonst stand die ihm nur allzu gut bekannte Marie-Luise Campenhausen hier mitten im mit Antiquitäten, alten Stichen und wertvollen Orientteppichen vollgestopften Wohnzimmer des Anwesens und gab – durch das vorgehaltene Taschentuch gedämpft – der Spurensicherung Anweisungen, während nahe dem Sofa, auf dem das aufgedunsene, gefesselte, von Maden nur so wimmelnde Opfer lag, ein Blitzlicht aufflammte?
Gottlieb bemühte sich, Lea zu ignorieren, die in ihren Jeans und dem engen weißen T-Shirt verdammt attraktiv aussah. Dankbar registrierte er, dass sie ihn betont unbeteiligt, wenn auch mit glühenden Wangen begrüßte und zur Leiche und zu möglichen Spuren gebührenden Abstand hielt. Sie war eben Profi. Trotzdem hatte sie hier nichts zu suchen, genauso wenig wie Frau Campenhausen, die mit einem der Uniformierten diskutierte, weil sie, wie aus ihren Gesten zu schließen war, offenbar die Treppe hinauf in den ersten Stock steigen wollte.
Er musste dem Treiben ein Ende machen.
»Alle Personen, die nicht zur Polizei gehören, verlassen auf der Stelle den Tatort«, rief er, während er gleichzeitig mit aufwallender Übelkeit kämpfen musste.
Stille kehrte ein, die nur durch ein bockiges »Aber ich muss da hinauf, das habe ich ihr versprochen« unterbrochen wurde, dann war auch Frau Campenhausen ruhig und zog sich mit Lea in die Eingangshalle zurück.
»Wieso sind die beiden Frauen hier?«, zischte er dem Streifenbeamten zu, der ihm am nächsten stand.
»Die alte Dame hat das Opfer aufgefunden und uns alarmiert, und die Presse war schon vor Ort, als wir ankamen. Wahrscheinlich ist sie ebenfalls von der Zeugin informiert worden.«
»Hm. Also, was haben wir?«
»Das Opfer ist eine gewisse Ingeborg Dahlmann, siebenundsiebzig, Witwe von Eugen Dahlmann ...« Der Beamte stockte vielsagend, was Gottlieb genauso wenig ausstehen konnte wie Hanno Appelts Eigenschaft, ständig rhetorische Fragen zu stellen.
»Und weiter?«
»Na, von dem Eugen Dahlmann ...«
»Jetzt bitte!«
»Hier liegen Sie immer richtig«, begann der Kollege unmotiviert und unmelodiös zu singen.
»Wie bitte?« Gottlieb sah ihn fassungslos an.
»Das Motto des Dahlmann’schen Hotelimperiums. Kam früher stündlich im Radio. Ich bin damit aufgewachsen wie Sie wahrscheinlich mit Clementines Wenn’s so sauber wie gekocht sein soll oder mit Damit Sie auch morgen noch kraftvoll zubeißen können«.
Gottlieb sah sich den Scherzkeks näher an. Ende zwanzig, zwei grüne Sterne auf der Schulter. Polizeimeister, kein Wunder: Wenn der so weitermachte, würde er in dreißig Jahren immer noch Polizeimeister sein. Im Innendienst.
»Könnten Sie bitte zur Sache kommen?«
Der Mann bekam rote Ohren und nahm Haltung an. »Der Anruf der Zeugin Campenhausen kam um fünfzehn Uhr null neun herein. Eintreffen am Tatort um fünfzehn Uhr fünfundzwanzig. Der Tunnel ist gesperrt, da war in dem Verkehrschaos kein Durchkommen. Die Zeugin hat uns ins Anwesen gelassen.«
Gottlieb entfuhr ein verärgerter Grunzlaut. Das würde also jede Menge verwischter Spuren bedeuten. Andererseits war Frau Campenhausen in Kriminalfällen bewandert und wusste aus ihrer Lieblingsliteratur, dass sie nichts anfassen durfte. Und diese grausigen altmodischen Häkeldinger, die sie an den Händen trug, hatten hoffentlich das Schlimmste verhindert.
Wie auf Bestellung mischte sich Kollege Endres von der Spurensicherung ein.
»Es gibt Spuren eines Aufbruchsversuchs, aber die Zeugin behauptet, die Terrassentür habe noch gehalten und erst durch ihr Zutun endgültig nachgegeben. Wenn dem so wäre, muss das Opfer den Mörder selbst hereingelassen haben. Oder wir haben es mit unserem alten Bekannten und seinem Phänomen des ungeklärten Zutritts zu tun.«
Gottlieb kam sich vor wie ein Analphabet, der auf einem Fass mit der Aufschrift Dynamit sitzt. Erst der pinkelnde Hund, dann der Scherzkeks mit den Werbesprüchen und nun noch diese Bemerkung, die andeutete, dass jeder im Raum wusste, wer der Täter war – nur er nicht. Noch so etwas, und er würde explodieren. Aber das passte nicht zum Leiter der Mordkommission. Also bemühte er sich um eine gelangweilte Miene.
»Schon gut. Ich würde das gern ausformuliert haben, fürs Protokoll des jungen Kollegen hier«, versuchte er, sein Gesicht zu wahren und grub in seinen Taschen nach einem scharfen Pfefferminzbonbon, um den Gestank aushalten zu können.
»Geht klar. Also: Alleinstehende, wohlhabende betagte Frau in freistehender Villa, bäuchlings und gefesselt auf der Couch, rotes Klebeband, kein Hinweis auf gewaltsames fremdes Eindringen, wenn die Zeugin tatsächlich für die Terrassentür verantwortlich ist. Es spricht also nicht alles, aber doch einiges für eine Tatbegehung durch unseren Gentleman-Räuber.«
»Ach du lieber Gott, der Gentleman-Räuber! Haben Sie das gehört, Frau Weidenbach?«, ertönte aus dem Flur die Stimme von Frau Campenhausen.
Was genug war, war genug.
»Würden Sie bitte die beiden Damen nach draußen begleiten? Haben Sie ihre Aussagen aufgenommen? Gut. Dann sollen sie sich morgen früh auf der Dienststelle einfinden, denn jetzt würden wir gern unsere Arbeit tun«, bollerte Gottlieb los.
Im Flur war ein kurzes Tuscheln und Zischeln zu hören, dann dauerte es nur noch einen kurzen Moment, bis draußen ein Wagen angelassen wurde und davonfuhr.
***
Seltsam nackt kommt er sich vor ohne seinen Glückbringer, nackt, verletzlich und nervös. Warum steht über den Überfall vor zwei Tagen nichts in der Zeitung? Ist das ein Trick? Ist man ihm wegen der verlorenen Kette bereits auf der Spur? Warum sieht ihn der Mann mit der gelben Krawatte am Ende des Tisches so merkwürdig an? Ist er ein verdeckter Ermittler? Wird er gleich aufstehen und ihn festnehmen?
Ruhig, ruhig. Keine Panik. Kein Aufsehen erregen. Die Croupiers arbeiten wie immer, niemand macht Zeichen, neigt den Kopf in seine Richtung. Auch die Saalchefs haben ihn zwar beim Eintreten flüchtig mit hochgezogener Augenbraue gemustert, sich dann aber nicht weiter um ihn geschert.
Konzentration.
Heute wird er nicht verlieren. Das ist doch schon Gesetz: Hat man genügend Geld in der Tasche, kommt noch mehr hinzu.
Also kann er etwas riskieren.
Fünf hellgelbe glatte Handschmeichler auf 30.
Das ist gerade mal ein Zehntel der Beute, die er vorhin in bunte Plastikstücke umgetauscht hat. Das Geld auf die Bank zu tragen hätte keinen Sinn ergeben. Was macht es denn für einen Unterschied, ob er achtundzwanzig- oder dreiundzwanzigtausend Euro Schulden hat? Hier hingegen hat er eine reelle Chance, das Geld sogar zu vermehren.
Marcels Anteil knistert noch in Scheinen in seiner Brusttasche. Die werden nicht angerührt. Diesmal bekommt sein Bruder das Geld, gleich heute Abend noch. Aber es wird das letzte Mal sein. Die Augen der alten Frau, die schier aus den Höhlen traten, haben ihn nun schon zwei Nächte verfolgt. Marcel hätte ihm sagen müssen, dass sie krank und gehbehindert war. Niemals hätte er sie genommen. Dann hätten sie eben noch ein oder zwei Wochen auf eine andere Gelegenheit gewartet. Es ist schon grauenhaft genug, gesunde Opfer fast zu Tode zu erschrecken. Sie können ja nicht wissen, dass die Pistole nicht geladen ist.
Die Kugel kreist. Er bleibt ruhig, zum ersten Mal seit langer Zeit. Geld zu Geld, sagt er sich noch einmal vor, es gibt nichts zu befürchten.
Und wenn er verliert, setzt er eben gleich wieder auf 30, was die Wahrscheinlichkeit, dass er gewinnt, erhöht. Das System ist kinderleicht. Man muss nur genügend Geld zur Verfügung haben.
»Faites vos jeux«, säuselt der Croupier und schiebt mit seinem Rechen Plastiktaler anderer Spieler auf die Felder.
»Orphelins à plein«, kräht eine blondierte Frau neben ihm und wirft dem Croupier einen Tausender hin, der in null Komma nichts in fünf große eckige Stücke umgesetzt und auf acht Zahlenkombinationen verteilt wird. Seine Zahl ist nicht dabei. Wenn seine 30 kommt, geht die Frau leer aus. So ist das eben im Spiel.
Der Kessel wird in Bewegung gesetzt.
»Rien ne va plus.«
Die Kugel scheuert am Kesselrand entlang, und es hört sich gut an. Siegesgewiss.
Wenn er gewinnt, hat er aus fünfhundert Euro achtzehntausend gemacht und wird sofort aufhören. Dann wird er im Internet versuchen, einen Anhänger zu ersteigern, der seinem verlorenen Glücksbringer ähnelt, ehe Sophie fragt, wo seine Kette abgeblieben sei. Er kann ihr ja schlecht erklären, dass und wo er sie verloren hat. Wenn die Polizei sie findet, wird man nach dem Besitzer fahnden, und zwar in jeder Zeitung, auch im Elsass. »Das Amulett des Gentleman-Räubers – wer erkennt es? Wo fehlt es?« Er kann die Überschrift schon vor sich sehen. Merde.