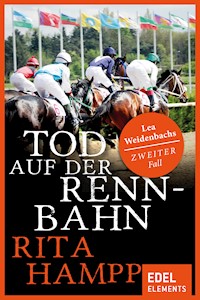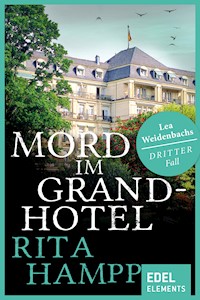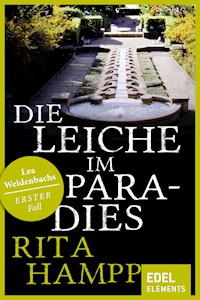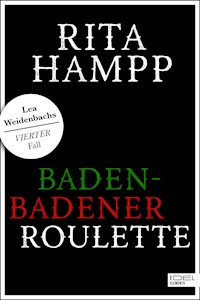4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Vergangenheit ist nie zu Ende Ebba hat gelernt, mit den schrecklichen Erinnerungen an ihre Kindheit zu leben. Sie und ihre Geschwister wurden vom Vater tyrannisiert – bis er bei einem Unfall ums Leben kam. Danach findet die Familie zum ersten Mal Frieden. Doch als Ebbas Bruder unter mysteriösen Umständen stirbt, holt sie die Vergangenheit ein. Sein Tod ist erst der Anfang. Bald passieren Dinge, die Ebba mit ihren tiefsten Ängsten konfrontieren. Sie ahnt: Die Dämonen der Kindheit sind noch längst nicht besiegt. Denn es scheint jemanden zu geben, der in die dunkelsten Winkel ihrer Seele blicken kann ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 604
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Kurzbeschreibung:
Die Vergangenheit ist nie zu Ende
Ebba hat gelernt, mit den schrecklichen Erinnerungen an ihre Kindheit zu leben. Sie und ihre Geschwister wurden vom Vater tyrannisiert – bis er bei einem Unfall ums Leben kam. Danach findet die Familie zum ersten Mal Frieden. Doch als Ebbas Bruder unter mysteriösen Umständen stirbt, holt sie die Vergangenheit ein. Sein Tod ist erst der Anfang. Bald passieren Dinge, die Ebba mit ihren tiefsten Ängsten konfrontieren. Sie ahnt: Die Dämonen der Kindheit sind noch längst nicht besiegt. Denn es scheint jemanden zu geben, der in die dunkelsten Winkel ihrer Seele blicken kann ...
Rita Hampp
Im Dunkel der Schuld
Psychothriller
Edel Elements
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2017 Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2013 by Rita Hampp
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Covergestaltung: Anke Koopmann, Designomicon, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-075-4
www.facebook.com/EdelElements/
www.edelelements.de/
INHALT
Prolog
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Siebenundzwanzig
Achtundzwanzig
Neunundzwanzig
Dreissig
Einunddreissig
Zweiunddreissig
Dreiunddreissig
Vierunddreissig
Fünfunddreissig
Sechsunddreissig
Siebenunddreissig
Achtunddreissig
Neununddreissig
Vierzig
Einundvierzig
Zweiundvierzig
Dreiundvierzig
Vierundvierzig
Fünfundvierzig
Sechsundvierzig
Danksagung
PROLOG
14. Juni 1982
Schwarz. Alles schwarz.
Wie in einem Loch. Oder im Bauch von einem Walfisch. Oder im Wald von Hänsel und Gretel, nein, noch viel, viel schlimmer. Die konnten wenigstens etwas sehen: Mond und Sterne am Himmel und Kieselsteine auf dem Weg. Aber hier, in der doofen Kiste, ist gar nichts. Hier ist es einfach nur schwarz. Rabenschwarz.
Das ist schrecklich unheimlich.
Vor allem, weil man nie weiß, wie lange es diesmal dauert.
Sie ist schon ganz lange mutig gewesen und hat nicht geheult und nicht gekratzt oder geklopft oder geschrien wie früher.
Sie hat zwischendurch sogar geschlafen. Jedenfalls hat sie von Schmetterlingen und Kirschen geträumt. Das war schön.
Aber jetzt ist sie aufgewacht und liegt immer noch hier. Ganz lange schon.
Bestimmt sitzen die anderen in der Küche und essen Abendbrot und haben sie vergessen.
Ob sie wohl ganz leise rufen soll? Nur wie beim Spiel »Mäuschen, mach mal piep«?
Lieber nicht.
Keinen Mucks! Sonst werden Georg und Rosie wieder bestraft.
Wo sind die eigentlich alle?
Sie presst ihr Ohr ganz fest ans Holz. So still!
Ob sie noch im Krankenhaus sind? Rosies Bein hat vorhin ganz komisch ausgesehen.
Wie bei ihrer Puppe, der sie mal aus Versehen das Bein rausgedreht hatte. Sie hatte es nicht mehr reinbekommen. Papa hatte ihr helfen müssen und hatte sie deswegen in die Truhe gesperrt.
Wie jetzt auch. Aber nicht so lange.
Niemand ruft nach ihr, niemand.
Georg traut sich bestimmt nicht, Papa zu bitten, sie rauszuholen. Das gibt sonst neue Strafzeiten.
Rosie weint bestimmt schon.
Sie würde auch gern weinen, aber das darf sie nicht. Und sie wird es auch nicht tun. Schon wegen Papa. Wenn sie nicht weint oder schreit, findet er nichts zum Schimpfen und Bestrafen.
Keinen Mucks darf sie machen, sonst wird alles noch schlimmer.
Nicht weinen! Und nicht schniefen, das schon gar nicht. Das darf sie nicht.
Warum hört sie nichts?
Schlafen alle schon?
Oder sitzt Papa neben der Truhe und wartet, dass sie ein Geräusch macht, wie beim letzten Mal? Dann klebt er ihr zur Strafe bestimmt wieder mit dem ekligen Leukoplast den Mund zu. Das kann sie gar nicht leiden, weil man keine Luft kriegt, wenn man aus Versehen heulen muss und dabei die Nase verstopft. Außerdem tut es ganz schrecklich weh, wenn er das Pflaster später wieder abzieht.
Eigentlich ist es das Schlimmste, dass man nie weiß, welche Strafe kommen wird. Vielleicht muss sie auch nur ohne Essen ins Bett, wenn sie jetzt ruft. Das wäre eigentlich nicht schlimm. Das Bett ist warm und weich, Georg und Rosie würden sie besuchen kommen, und zur Toilette könnte sie auch gehen.
Iih, genau! Ganz nötig muss sie. Dringend!
Aber sie darf hier nicht reinmachen.
Sie muss die Beine zusammenpressen und am besten noch mit der Hand dagegendrücken. Dann kann man das ein bisschen länger aushalten.
Bisher hat Papa sie immer rechtzeitig rausgeholt. Sie ist doch sein Liebling. Seine kleine Malerin.
Sie darf keine Angst haben. Es ist nur die Truhe, in der sie liegt. Da passen keine Ungeheuer oder ekligen Tiere rein. Das hat sie doch schon ganz oft festgestellt. Es ist nur eine Truhe. Aber sie ist so dunkel …
Auch wenn sie die Augen ganz weit aufmacht, kann sie nichts sehen.
Wenn sie die Hand vor die Augen hebt, kann sie sie nicht sehen.
Ganz schwarz ist es hier.
Wie in einem Grab.
Mist, jetzt läuft ihr die Nase, und sie muss schniefen. Leise, leise, wie ein Mäuschen!
Wenn niemand daran denkt, sie herauszuholen, dann bekommt sie auch nichts mehr zu essen und zu trinken. Ein Apfel würde ja reichen. Oder eine Kirsche, Rosie hat doch vorhin genügend Kirschen gepflückt.
Nächstes Mal muss sie sich unbedingt welche in die Taschen stopfen.
Und einen Nagel mitnehmen. Mit dem könnte man vielleicht ein Loch ins Holz bohren. Dann wäre es nicht mehr so dunkel hier drin.
Irgendwie ist das ungerecht, dass immer sie in die Truhe muss. Papa weiß doch, dass sie sich so fürchtet. Wenn er sie hinterher rausholt, weint er oft selbst, weil sie ihn dazu gebracht hat, so böse zu ihr zu sein.
Weinen tut man doch nicht mehr, wenn man groß ist. Sie hat jetzt auch damit aufgehört. Nach dem Sommer kommt sie in die Schule, und ein Schulkind heult nicht.
Und sie hat auch keine Angst mehr.
Nur ein klitzekleines bisschen, aber nicht viel.
Ob sie wohl flüstern darf? Ganz leise »Mama« rufen?
Aber Mama ist bestimmt noch in der Kirche beim Beten. Oder sie denkt, dass sie schon im Bett liegt.
Ganz leise klopfen? Vielleicht ist die Uhr kaputt, oder Papa schläft oder …
Oder pfeifen?
Vielleicht hilft es, wenn sie sich eine gute Fee herbeiruft? Manchmal klappt das.
»Mach den Deckel auf, liebe Fee«, würde sie sich wünschen. »Und mach Rosie gesund. Und mach, dass Mama mehr Zeit für uns hat. Und dass Papa nicht so böse auf uns ist. Und dass Georg nicht immer so viel weinen muss.«
»Hallo, Fee, bist du da?« Es klingt so dumpf. Da kriegt man ja noch mehr Angst.
Pssst. War da was? War das der Flügel der Fee?
Nein, schade.
Hoffentlich kommt bald jemand. Nie mehr wird sie sich erwischen lassen ohne die Taschen voller Obst oder wenigstens einem Stück Brot.
Wenn es hier nicht so bi-ba-butzemann-dunkel wäre, hätte sie bestimmt weniger Angst.
»Hallo«, versucht sie etwas lauter zu rufen. Nicht zu laut, aber vielleicht hört Georg sie und versucht ihr zu helfen. Niemand kriegt die Truhe auf; nur Papa hat den Schlüssel. Vielleicht schläft Papa bald ein, dann könnte Georg ihm den Schlüssel stibitzen. Ach, lieber nicht.
Er soll nicht wegen ihr bestraft werden. Rosie auch nicht. Rosie soll nicht wieder auf den Fenstersims im Dachzimmer klettern müssen, um ganz lange das Gleichgewicht zu halten, ohne runterzufallen oder zu weinen. Arme Rosie. Ganz weiß ist sie dann immer im Gesicht.
»Mama«, ruft sie etwas lauter. »Georg! Rosie!« Und dann sogar: »Papa?«
Niemand antwortet. Sie bekommt auch den Deckel nicht auf, obwohl sie ganz fest dagegendrückt.
»Hallo!« Jetzt schreit sie, so laut sie kann. »Hallo!«
Aber alles bleibt still, totenstill, und irgendwann - irgendwann kann sie einfach nicht mehr.
EINS
Montag, 25. Dezember 2006
Etwas Schweres lag auf ihrer Brust. Es hinderte sie daran, sich zu rühren, sich auf die Seite zu rollen, richtig zu atmen. Ebba schnappte nach Luft. Ein tiefes Brummen stülpte sich über ihren Kopf, verschloss ihre Ohren wie Watte, sperrte sie ein in ihre Urängste, lähmte sie.
Nichts hatte sie entgegenzusetzen, das Einzige, was ihr noch blieb, war so zu tun, als träume sie nur. Bloß nicht die Augen öffnen und wieder im Dunkeln liegen. Nicht schreien. Brav sein. Still sein!
Der Druck verlagerte sich von ihrer Brust auf ihren Hals, dann auf die Stirn, dann war er mit einem Mal fort. Jemand rüttelte sie leicht, und wenn sie sich anstrengte, konnte sie durch den dicken Wattemantel etwas hören.
»Ebba, Ebba!«
Sie traute sich nicht zu antworten, denn sonst würden die anderen noch schlimmer bestraft werden.
»Ebba!«
Das war nicht die Stimme ihres Vaters!
Verwirrt hob Ebba den Kopf und blinzelte. Schwarze Locken, azurblaue Augen, die sie besorgt musterten, dann ein zärtliches Lächeln – Gott sei Dank! Es war Jörg, Gino, wie sie ihn am liebsten nennen würde, weil sie nicht glauben konnte, dass er bei seinem Aussehen wirklich keine italienischen Vorfahren hatte.
»Wwas …«
»Schschscht«, machte er und legte die Hand auf ihren Mund, ganz sacht nur, aber es war zu viel. Augenblicklich kehrte die Panik zurück. Sie musste würgen. Sie unterdrückte den über Jahre im Kampfsport antrainierten Reflex, seine Hand mit einem geübten Hebelgriff zu fixieren und zu drehen, bis er vor Schmerzen stöhnen würde, stemmte sich aber kraftvoll gegen ihn, strampelte sich mit den Beinen frei und stieß dabei einen Schrei aus.
Er ließ sich auf den Rücken fallen und betrachtete sie verwundert. »Was war das denn?«
»Nie wieder – machen!« Mehr bekam sie nicht heraus, und sein Lächeln wich Ratlosigkeit.
»Was ist los? Wir hatten doch so eine wunderbare … «
Ebba setzte sich auf und versuchte sich zu beruhigen. Sie war in ihrer Wohnung, in Sicherheit. Niemand konnte ihr etwas antun oder sie irgendwo einsperren.
Ihr Blick wanderte vom integrierten offenen Badbereich mit der frei stehenden Wanne, neben der ihr Hayashi-Anzug mit dem braunen Gürtel am Haken hing, zur riesigen Fensterfront vor ihrem Bett, vor der sich ein grauer Morgen anschickte, das nasskalte Wetter der letzten Tage noch zu überbieten. Schneegriesel, Nieselregen, überfrierende Nässe – mal wieder Baden-Badener Weihnachtswetter wie aus dem Bilderbuch.
Was kümmerte es sie? Sie musste erst am Mittag los, und bis dahin würde sie …
»Alles in Ordnung?«
Sie nickte und ließ sich in die Kissen zurückfallen. Dann streckte sie die Arme nach ihm aus. Wenn sie sich zusammennahm und es gezielt zuließ, war es nicht schlimm, wenn er sich auf sie legte, im Gegenteil. Aber das Gewicht seines Arms auf ihrer Brust vorhin im Schlaf hätte ihr fast den Verstand geraubt.
Sie musste mit ihm reden, ihm Verhaltensregeln nennen. Aber sie hatte Angst davor, denn es waren viele, und vielleicht würde er deswegen die Beziehung abbrechen, die doch gerade erst begonnen hatte.
Sie spürte, wie sich ihre Brustwarzen aufstellten, als er ihr die schweißnasse Seidenjacke aufknöpfte, als seine warmen Fingerspitzen leicht wie eine Feder über ihre Kehle, die Halsbeuge, die Brüste strichen, sich den Weg hinab suchten, innehielten … Sie wünschte sich inständig, er möge weitermachen, keine Fragen stellen, sondern sie einfach weiter liebkosen. Lustvoll drehte sie den Kopf zur Seite und … Nein! Vorbei die prickelnde Versuchung, den Kopf auszuschalten, nur noch Gefühl zu sein.
Die Tür! Er hatte die Tür zwischen Schlaf- und Wohnzimmer geschlossen.
»Nein!«
»Ebba, beruhige dich.«
Aber sie wollte sich nicht beruhigen, denn schon schwoll das Brummen in ihrem Kopf an. Sie musste etwas tun, sofort! Keuchend wand sie sich aus der Umarmung, wankte zur Tür und stieß sie auf, dann blieb sie stehen, um die Weite des riesigen Penthouses, die Aussicht, die Luft zum Atmen zu spüren, zu schmecken und zu sehen.
Das Vibrieren in ihren Ohren wurde leiser, Jörgs Stimme verständlich. Eisig kalt fühlte sich nun der nasse Stoff auf ihrer Haut an. Sie schlang die Arme um sich, wie um noch einen winzigen Aufschub zu bekommen.
Nachdenklich heftete sie ihren Blick auf die Tür zum Schlafzimmer, die einzige, die sich noch im Apartment befand. Sie hatte sie eigentlich nur für ihre Gäste hängen lassen, damit diese ohne Hemmungen die sonst vor Blicken ungeschützte offene Toilette hinter dem Schlafbereich benutzen konnten. Wenn sie sich im riesigen Wohnraum aufhielt, konnte diese eine Tür auch vorübergehend einmal geschlossen sein. Eine Wohnungstür gab es ja auch. Aber wenn sie im Bett oder in der Badewanne lag, musste sie alles überblicken können. Alles musste offen sein, auch Vorhänge oder Rollläden an den Fenstern waren indiskutabel.
Er musste es erfahren. Wenigstens einen winzigen Teil. Sie musste es ihm endlich sagen, sonst würde es nie aufhören.
Vertraute sie sich ihm aber an, würde er keine Ruhe geben. Er würde wie bei ihrer ersten Begegnung wieder nachfragen, womöglich auf eigene Faust versuchen, die wahre Ursache herauszufinden. Das galt es unbedingt zu verhindern. Niemand durfte die Wahrheit erfahren, absolut keine Menschenseele. Niemals. Unter keinen Umständen. Das hatten sie sich geschworen in jener Nacht.
Sollte sie die Beziehung also lieber beenden wie die anderen zuvor? Schluss machen? O nein, nicht mit ihm. Alles stimmte diesmal.
Glucksendes Lachen kam aus seiner Richtung, und auch ohne zum Spiegel zu sehen, wusste sie, warum: Ihre Haare standen nach allen Seiten ab, wie immer, wenn sie sich aufregte. Automatisch hob sie die Hände und strich sich über den Kopf.
»Bitte«, begann sie und musste noch einmal ansetzen, weil sich ihre Kehle wie ein Reibeisen anfühlte. »Es ist mir todernst: Mach das bitte nie wieder, hörst du? Nie wieder!«
ZWEI
Nebelbänke hingen in der Rheinebene, tiefe Wolken schmiegten sich wie Hermelinmäntelchen um die mit Raureif überzuckerten Höhen des Schwarzwalds, an den Rändern der gefährlich glitzernden Autobahn lag Matsch, die Menschen in den überholenden oder überholten Autos sahen frustriert und gestresst aus.
Ebba war froh, früher losgefahren zu sein, obwohl es ihr schwergefallen war, sich von Jörg loszureißen. Knapp ein halbes Jahr kannten sie sich jetzt; er hatte zur Eröffnung ihrer Galerie eine große Fotoreportage in mehreren Kunst- und Freizeitmagazinen veröffentlicht, und sie waren danach in Kontakt geblieben, der sich stetig vertieft hatte.
Gestern war er zum ersten Mal über Nacht geblieben, und es hatte ihr überraschend gutgetan. Schade nur, dass der Morgen dann so schrill begonnen hatte.
Um eine ähnliche Situation künftig zu vermeiden, hatten sie noch vor dem Frühstück die Schlafzimmertür aus den Angeln gewuchtet und an die Wand gelehnt. Der Hausmeister würde sie nach den Feiertagen zu den anderen Türen in den Keller schaffen. Dann hatte er sie liebevoll in den Arm genommen und ihr ins Ohr geflüstert, sie brauche sich keine Sorgen zu machen, er werde ihr so viel Zeit lassen, wie sie benötige.
»Mit dieser Nacht sind wir zu einem Marathon angetreten, Liebes«, murmelte er in ihr Haar, und es tat gut, ihm zu glauben, auch wenn ihr alles viel zu schnell und unwirklich vorkam. Konnte Liebe wirklich unkompliziert sein? Gab es einen Pferdefuß, den sie übersehen hatte? Hätte sie überprüfen sollen, was er ihr über sich erzählt hatte? Aber warum sollte er sie anlügen? Er war früher Enthüllungsjournalist mit Leib und Seele gewesen, hatte darüber sträflich seine Familie vernachlässigt und sich nach der Scheidung auf freie Fotoreportagen für Lifestyle-Magazine konzentriert, und er liebte seine halbwüchsige Tochter Lisa, die jedes zweite Wochenende bei ihm verbrachte. Sie wusste, wo er wohnte, sie sah seine Arbeiten in diversen Hochglanzzeitschriften, sie kannte sein Auto, seine Telefonnummer und seit dieser Nacht auch das Muttermal auf seinem Rücken, das wie eine kleine Spinne aussah.
Ebba reihte sich in die Abbiegespur zur Stadtmitte ein und zwang sich, sich auf die Stunden zu konzentrieren, die vor ihr lagen. Hoffentlich ließ Mutter sie mit ihrer ewigen Beterei in Ruhe. Hoffentlich kam Rosie pünktlich. Hoffentlich stellte Georg mit seinem Ordnungsfimmel nicht wieder die ganze Wohnung auf den Kopf. Aber seine Maria kam ja mit, die mit unglaublicher Sanftmut all seine Schwächen und Zwänge ertrug.
Beim Einparken am menschenleeren Volkshauser Klosterplatz verkündeten mächtige Glockenschläge, dass es Mittag war. Ihre Mutter wartete bestimmt schon, damit sie zum nächsten Gottesdienst und danach nahtlos in ihren Betkreis kam. Beten war ihr Lebensinhalt, so lange Ebba zurückdenken konnte. Nie war ihre Mutter da gewesen, wenn sie sie gebraucht hatten, stattdessen hatte sie sich in der Kirche die Knie wundgescheuert. Nach dem Vorfall war sie nach Freiburg gezogen und hatte eine sehr ansehnliche kleine Drei-Zimmer-Dachwohnung mit Balkon und Münsterblick gefunden. Wenn sie nur das Beten abgelegt hätte, dem sich alles andere unterzuordnen hatte.
Prustend zerrte Ebba die Klappkiste mit den Vorräten vom Beifahrersitz und schleppte sie zum Eingang, klingelte und hievte, als die Tür aufging, ihre Last zum Aufzug. Prüfend überflog sie die Zutaten für das Festmenü, die sie mitgebracht hatte: die Bio-Gans, die sie schon gestern gefüllt hatte, dazu Blumenkohl, Wirsing und Rotkohl, als Vorspeise Rote-Bete-Carpaccio mit Ziegenfrischkäse und Feldsalat, als Nachtisch sizilianische Orangen. Seit ihrer Jugend kochte sie gern – erst, um zu überleben, dann jedoch hatte sich Leidenschaft entwickelt.
Die Lifttüren gingen auf. Ebba drückte den Knopf zur fünften Etage und schubste die Kiste in die Kabine, dann beobachtete sie, wie sich die Türen schlossen, bevor sie leichtfüßig die Treppen hinauflief.
Oben wartete ihre Mutter in Hut und elegantem Mantel. Neben ihr stand ein Korb mit einer abgedeckten Schüssel darin. Ohne Begrüßung tippte sie auf ihre Armbanduhr.
»Elisabetha, schade, dass du so spät bist. Ich muss los. Hier ist der Schlüssel. Tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann.«
Ebba gab ihrer Mutter einen Kuss auf die Wange. »Wann bist du zurück?«
»Vielleicht gegen sechs.«
»Mama! Kein Mensch kann sechs Stunden am Stück beten. Jetzt kommen wir doch nur einmal im Jahr …«
»Genau. Und für die restlichen 364 Tage hat Georg seine Maria, Rosie ihre Bücher, du die Galerie, und ich – ich habe eben meinen Betkreis. Das ist mein Leben. Wir sind dort eine große Familie. Ich kann sie nicht im Stich lassen. Niemand von ihnen hat noch Angehörige. Wir haben eine kleine Andacht geplant und anschließend eine Weihnachtsfeier.« Sie machte eine Kopfbewegung zum Korb. »Ich bin diesmal für den Nachtisch zuständig. Ich hätte euch auch eine Schüssel Mousse au Chocolat gemacht, aber das willst du ja nicht.«
»Die Gans ist um sechs Uhr fertig. Pünktlich.«
»Du weißt doch …«
»Ja. Für dich gibt es natürlich Gemüse. Drei Sorten.«
»Du bist ein Schatz. Ich kann nichts versprechen, aber vielleicht bin ich etwas früher da.«
Ebba glaubte ihr kein Wort, zwang sich jedoch ein Lächeln ab. Dann brachte sie die Vorräte in die zweckmäßig eingerichtete kleine Küche und öffnete alle Zimmertüren. Am Garderobenspiegel im Flur hielt sie inne, um ihre Frisur zu bändigen. Hoffnungslos. Als stünde sie unter Strom. Dabei ging es ihr doch wirklich gut nach dieser Nacht. Schnell noch ein wenig rosa Lippenstift; die Farbe passte gut zu den weißblonden kurzen Haaren. Sie war dennoch nicht zufrieden mit ihrem Aussehen. Zu klein, zu dünn, zu blass. Wer nicht wusste, dass sie neunundzwanzig war, hielt sie mit ihren zierlichen 1,62 Metern manchmal für einen Teenager. In der Tat würde sie leicht in Kinderkleidung passen.
Ebba schnitt ihrem Spiegelbild eine Grimasse und warf einen Blick ins Wohnzimmer. Der Tisch war nicht gedeckt, es gab keinen Weihnachtsschmuck wie bei ihr zu Hause auch nicht. Sie hatten nur einmal versucht, Weihnachten wie alle anderen zu feiern, und das war gründlich schiefgegangen. Das brauchte kein Mensch noch einmal. Aber Kerzen, schönes Geschirr, Servietten, Tafelsilber – das gehörte sich für einen Feiertag. Später. Maria würde ihr bestimmt dabei helfen und wieder beklagen, wie kahl diese Wohnung war. Kein Nippes, keine Bilder, keine Blumen, keine Kissen, keine Teppiche, keine Tischdecken, keine Fotos. Nur Kruzifixe über jeder Tür. Jedes Möbelhaus sah heimeliger aus. Dies hier war ganz offensichtlich eine Wohnung, die hauptsächlich zum Schlafen gebraucht wurde. Den Rest des Tages verbrachte Frieda Seidel in der Kirche.
Ebba ging zurück in die Küche und schaltete den Herd ein, konzentrierte sich ganz auf ihre Handgriffe. Wie üblich vergaß sie darüber die Zeit, und so schreckte sie hoch, als es klingelte.
Maria stand allein vor der Tür. Auf ihren langen, pechschwarzen, glatten Haaren schimmerten Schnee- oder Regentropfen, das gewohnte breite Lachen lag auf ihrem runden Gesicht, und ihre schwarzen Augen blitzten, als sie ihre Arme ausbreitete.
» Merry Christmas! Frohe Weihnachten, Ebba!«
Schweigend umarmte Ebba ihre mollige Schwägerin, die nach frisch gewaschener Wäsche und warmem Kuchenteig roch. Maria war genau das Gegenteil von ihr; sie bestand nur aus Gefühl und Freundlichkeit.
Und wie sie plapperte! Wie ein kleiner Wasserfall, aus dem die Worte so rund wie Murmeln kullerten.
»Georg nimmt die Treppe, wie immer. Oh, es riecht wonderful! Ich würde meiner Familie so gern ein Rezept schicken, aber ich fürchte, sie würden in ganz Manila keine deutsche Gans finden.«
»Wie war die Fahrt?«
Maria wurde ernst. »Nicht gut.« Sie warf einen sorgenvollen Blick zurück zum Treppenhaus. »Er ist im Augenblick etwas nervous – nein, wie sagt man? Angespannt.«
»Komm, ich helf dir aus dem Mantel. Was meinst du mit angespannt?«
»Well, er glaubt, dass etwas nicht stimmt, und dann …« Sie stockte kurz, um nach einem Wort zu suchen. »Dann gibt er mir Schuld.« Maria fuhr sich über die Augen, danach lächelte sie wieder. »Das wird wieder okay. Vielleicht zu viel Arbeit im Moment. Vielleicht …«
Draußen im Treppenhaus war ein erstickter Laut zu hören. Maria unterbrach sich und eilte, gefolgt von Ebba, zur Wohnungstür zurück.
Mit bläulichen Lippen und schwer atmend lehnte Georg neben der Tür, den Mantel sorgfältig gefaltet über dem Arm, die Krawatte für seine Verhältnisse skandalös weit gelockert. Zitternd wischte er sich mit seiner rissigen roten Hand den Schweiß von der Stirn.
»Fünf Stockwerke«, flüsterte er und drückte sich mit halberhobenen Armen in den schmalen Flur, »sind etwas viel für mein Herz. Lasst mich bitte durch.«
Er hängte seinen Mantel über einen Bügel, strich ihn glatt und verschwand im Bad, um sich die Hände zu schrubben.
»Wenn du Hilfe brauchst, ruf mich an, Maria, hörst du?«, wisperte Ebba. »Jederzeit! Oder sollte man gleich mit Georg reden?«
»Oh, no, no, bloß nicht. Ebba, please! Bitte!«
Der Küchenwecker rappelte.
»Komm in die Küche, da ist sowieso gemütlicher als hier im Flur.«
»Kann ich helfen?«
»Deckst du den Tisch?«
»Und wenn du bist hier fertig, dann ich wische schnell Boden.«
»Nicht nötig.«
»Oh, du weißt doch! Ich habe nicht umsonst fünf Putzstellen.«
Maria war wirklich das Beste, was ihrem sauberkeitsbesessenen Bruder hatte passieren können, auch wenn es ein Reizthema zwischen den Eheleuten war, dass die Frau eines Steuerberaters es nicht nötig hatte, den Dreck fremder Menschen wegzuwischen. Mit dem eigenen Geld finanzierte sie sich ihre Deutschkurse, und das nötigte Georg, dem »Sparstrumpf«, wiederum Respekt ab.
Ebba drehte die noch blasse Gans auf den Rücken, stach mit einem spitzen Messer in die Flanken, sah die mitgebrachten Gewürze durch und entschied sich, den Beifuß dieses Mal wegzulassen. Stattdessen würde sie etwas Orangenschale zugeben.
Mit angewiderter Miene kam Georg in die Küche und riss das Fenster auf.
»Die ganze Wohnung riecht nach verbranntem Fett«, meckerte er, während er den Kühlschrank öffnete und die Vorräte inspizierte, um sie sodann seufzend nach Haltbarkeitsdatum und Größe zu ordnen. Gleich würde er dasselbe mit dem Vorratsschrank machen und Nudeln, Reis und Zucker umschichten. Dabei schimpfte er weiter. »Warum machst du nicht mal was anderes? Etwas Kaltes würde doch auch reichen.«
»Weil eine Familie Rituale braucht.«
»Welche Familie? Du vielleicht.«
Ebba verzichtete darauf, auf die Uhr zu sehen. Wie viele Minuten hatte es diesmal gedauert, bis Unfrieden ausbrach? Vielleicht sollte sie den Traum von heiler Familienwelt tatsächlich begraben. Vielleicht sollte sie akzeptieren, dass die Seidels auseinanderdrifteten. Vielleicht sollte sie aufhören, ihre Angehörigen einmal im Jahr zusammenzutrommeln. Auch noch hier in diese kleine Wohnung, in der man sich nicht aus dem Weg gehen konnte.
Wozu hatte sie damals diese Schuld auf sich geladen? Doch nur, um die Familie zu retten. Was hatte sie jetzt davon? Eine Mutter, die weiterhin flüchtete, einen Bruder, der mit sich selbst genug zu tun hatte, und …
Wieder klingelte es.
»Das muss Rosie sein. Dann war der Zug pünktlich.«
Ebba schob den Bräter zurück in den Ofen, schlängelte sich an Georg vorbei, der inzwischen das Gewürzregal durcharbeitete, und ging zur Tür. Sie verübelte es ihrer großen Schwester immer noch, so weit fortgezogen zu sein. Schleswig, die Schlei und die Ostsee mochten im Sommer vielleicht für Wassersportler reizvoll sein, aber über die Hälfte des Jahres war es doch trostlos da oben, gleichgültig wie flach es auch war. Kürzlich hatte Rosie auch noch die Buchhandlung »Eulennest« gekauft, in der sie bisher angestellt gewesen war. Sie würde also nie mehr zurückkommen.
Immerhin folgte Rosie der Einladung noch treu und brav jedes Jahr, auch wenn jeder wusste, wie schwer ihr das fiel. Da sich ihre Mutter weigerte, Freiburg zu verlassen, hatten sie keine andere Wahl, als sich im südwestlichsten Zipfel der Republik zu treffen.
Ebba erschrak, als sie ihre Schwester sah. Seit dem letzten Weihnachtsfest hatte sie noch weiter an Gewicht verloren und es offenbar auch aufgegeben, einen guten Friseur zu finden. Eine jugendliche Glitzerspange hielt die hellen Strähnen zu einem Pferdeschwanz zusammen. Weil sie blass und ungeschminkt war, sah sie magenkrank aus. Sie wirkte älter als vierzig, dabei hatte sie erst kürzlich ihren einunddreißigsten Geburtstag gefeiert. Fast unmerklich zuckte ihr Mund, als sie das Gewicht auf den anderen Fuß verlagerte, um Ebba an ihren braunen Lodenmantel zu drücken und ihr die Haare glatt zu streichen. Leider roch sie kein bisschen nach Wind und Meer, sondern nach Mottenkugeln und Bücherstaub.
Aber ihr Lachen machte alles wett; es verwandelte ihre blasse, unscheinbare Schwester jedes Mal in eine unwiderstehlich attraktive junge Frau. Noch einmal fuhren ihre Hände über Ebbas Kopf.
»Deine Haare, also wirklich! Regst du dich schon wieder auf? Lass sie doch wachsen! Dabei siehst du glücklich aus. Wie läuft die Galerie?«
»Besser als erhofft. Ich habe mit dem Standort ein Riesenglück gehabt. Warum kommst du heute Abend nicht mit und siehst sie dir an? Du kannst bei mir übernachten.«
Rosie rang ihre Hände und wurde rot, wie immer, wenn sie nicht wusste, wem sie es recht machen sollte.
»Mama wäre enttäuscht. Sie ist doch viel zu oft allein.«
»Ist sie nicht!«
»Ach, komm, meinst du den Betkreis? Der ist doch kein Ersatz für Familie oder Geborgenheit. Wenn sie wenigstens ein Haustier hätte! Ein Kätzchen würde schon reichen.«
»Sie hätte gar keine Zeit dafür.«
»Ach, Ebba, sei nicht so hart mit ihr. Ich glaube, es ist für sie wichtig, wenn ich bei ihr bleibe. Wenigstens für diese eine Nacht.«
Ende der Diskussion.
Ebba ging zurück in die Küche und hackte auf dem Wirsing herum, während Georg und Maria Rosie begrüßten.
Dann übernahmen Maria und Georg es, den Tisch zu decken. Rosie kam zu ihr in die Küche und gähnte herzhaft.
»Trinkst du einen Kaffee mit? Ich habe die Valium zwar schon um kurz vor sieben genommen, aber irgendwie steckt sie mir noch in den Gliedern.«
Sie warf ihren Mantel über den Stuhl, zupfte an ihrem braunen Schlabberpulli und bückte sich umständlich, um den Inhalt der unteren Küchenschränke zu inspizieren.
»Vergiss es. Da ist nur Kräutertee.« Georg war hinter ihnen aufgetaucht, und Ebba bemerkte seinen verkniffenen Gesichtsausdruck, mit dem er Rosies ausgestrecktes steifes Bein betrachtete.
Rosie blickte liebevoll lächelnd zu ihm hoch und richtete sich mit einem winzigen, unbewussten Stöhnen auf. »Klar. Ich hätte dran denken müssen und Kaffee mitbringen sollen. Meine Schuld.«
Ebba hämmerte noch heftiger auf dem Schneidbrett herum. Nein, es war ihre Schuld. Sie hätte daran denken müssen! Das Essen war ihre Idee gewesen, sie hatte allen gesagt, dass sie für alles sorgen würde. Sie war die Starke. Wenn sie einen Fehler beging, wurde immer jemand bestraft. Und meistens traf es Rosie.
Es hörte nie auf. Und es kam immer wieder hoch. Jedes Jahr an Weihnachten. Ausgerechnet Weihnachten. Dabei hatte sie diesen Termin für die alljährliche Familienzusammenkunft mit Bedacht gewählt. Sie alle hatten sich doch immer insgeheim nach dem Fest gesehnt.
In ihren Schläfen begann es zu pochen. »Hat jemand eine Kopfschmerztablette für mich?«, fragte sie.
Stille. Genauso gut hätte sie nach einer Bombe oder einem Joint fragen können. Tabletten einzunehmen war im Haushalt Frieda Seidel tabu. Selbst Rosie würde ihrer Mutter nie verraten, dass sie es nur mit Valium nach Freiburg schaffte.
Es dauerte eine Sekunde, bis sich die kollektive Schockstarre löste, Maria wieder mit dem Staublappen über die Möbel fuhr und Georg die Wassergläser wie Soldaten auf dem Esstisch aufstellte.
Rosie seufzte kurz und hinkte zu ihrer Reisetasche. »Ich habe was für euch«, verkündete sie gut gelaunt. »Schaut. Ich hoffe, ich habe das Richtige getroffen.«
Ebba ließ das Messer sinken. Nicht schon wieder! Sie hatten abgemacht, sich nichts zu schenken. Alle hielten sich daran, nur Rosie mal wieder nicht.
Zugegeben, das Prachtbuch über den Louvre war wunderschön. Bei Maria löste der Bildband über die Philippinen einen Schwall Tränen aus, und Georg murmelte verlegen Dankesworte, als er die extra pflegende Handcreme auspackte, die Rosie in Dänemark für ihn besorgt hatte.
Ebba jedoch blieb der Dank im Hals stecken. Sie wusste, dass Rosie eine Reaktion erwartete. Irgendeine Regung. Ein Lächeln, eine Umarmung, ein liebes Wort. Einen Ausdruck von Freude. Aber es ging nicht. Gefühle zu zeigen war etwas für schwache Menschen wie Maria, die sich kaum mehr beruhigen konnte. Man kam nicht sehr weit im Leben, wenn man anderen zeigte, wie es in einem aussah. Auch Jörg hatte schon ein paarmal irritiert gewirkt, wenn sie nach außen kühler reagierte, als er es sich wohl wünschte oder erwartete.
Ihr Kopf stand inzwischen lichterloh im Kreuzfeuer von Hammer und Amboss. Es dröhnte und klopfte, als würde ihr Schädel gleich explodieren.
Ebba legte das Buch auf einen Stuhl und presste ihre Finger gegen die Schläfen, massierte kreisend in den Schmerz hinein, doch der ließ sich nicht bändigen und breitete sich immer weiter aus, fuhr ihr in den Nacken, zog ihre Schultermuskeln zusammen. Und es wurde nicht besser, als ihr Blick auf Rosie fiel, die mit bebender Unterlippe gegen die Tränen kämpfte.
»Du hast es schon, oder? Es ist erst letzten Monat auf den Markt gekommen, deshalb dachte ich, du freust dich …«
Gleich würden alle Dämme brechen. Ebba rang sich ein Lächeln ab. »Doch, sehr schön, Rosie, aber wir wollten uns nichts schenken. Ich habe auch nichts für dich.«
»Ach, das ist es! Ich dachte schon, du freust dich nicht. Lass gut sein, Ebba, ich schenke doch gern, das weißt du. Du musst deswegen kein schlechtes Gewissen haben.«
Die Schmiede in ihrem Kopf bekam Unterstützung von mehreren Presslufthämmern, die jeden einzelnen Nerv bloßlegten. Vor ihren Augen begann es zu flimmern, sie musste sich setzen. Ganz kurz nur.
»Ist der Tisch gedeckt? Mama kommt gleich, dann können wir anfangen«, hörte sie sich sagen, und es wunderte sie, wie beherrscht das klang. Ganz und gar nicht nach jemandem, der gleich zu Boden gehen würde.
Energisch stützte sie ihre Hände auf die Knie und stand auf, streckte das Kreuz durch, ging ans noch offene Fenster und machte ein paar tiefe Atemzüge. Die kalte Luft tat gut. Sie musste sich beruhigen. Vielleicht fand sie irgendwo eine Tinktur oder einen Balsam, den sie auf die Schläfen reiben konnte. Solche Hilfsmittel ließ Frieda Seidel gelten. Aber Ebba wollte das Wort Kopfschmerz nicht noch einmal in den Mund nehmen. Schon gar nicht nachher im Beisein ihrer Mutter, denn das konnte weit Schlimmeres auslösen.
Nein, sie würde gar nichts sagen und sich nichts anmerken lassen. Man musste funktionieren, wie immer – auch an diesem Tag des Jahres.
DREI
Es dauerte trotzdem nicht mehr lange.
Im Nachhinein kam es Ebba vor, als hätten alle nur auf irgendeinen noch so kleinen Auslöser gewartet.
Diesmal geschah es, als ihre Mutter zur Tür hereinkam. Ebba stand gerade außer Sichtweite der Küche, was sie nur ungern tat, wenn etwas in den Töpfen köchelte. Maria war beim Staubsaugen an den Esstisch gestoßen und hatte aus Versehen eines von Georgs soldatisch aufgereihten Gläsern umgeworfen, dass es kaputtging und sie laut zu schluchzen begann. Was Georg mit Wortfetzen quittierte, aus denen maßlos angestaute Wut sprach.
»Absicht – Sabotage – seit Monaten schon – jetzt auch hier – lüg nicht«, zischte er, und Ebba war hinzugeeilt, weil sie dachte, er würde seine Frau gleich ohrfeigen. Rosie stand abseits, rang ihre Hände und murmelte etwas von »keine Absicht«, »es ist doch Weihnachten.«
Gleich würde das Pulverfass hochgehen.
Ebba machte ein paar Schritte ins Esszimmer und sammelte die Scherben zusammen. «Aufhören, alle!«, fuhr sie ihre Geschwister an, während draußen die Wohnungstür aufgeschlossen wurde. »Maria, hol einfach den kleinen Handfeger. Georg, würdest du bitte still sein? Niemand will dir etwas Böses. Das bildest du dir ein. Und Rosie, bitte! Setz dich am besten schon auf deinen Stuhl.«
Mit einem Ohr lauschte sie in die Küche. Und da hörte sie es auch schon: Die Ofentür schnappte zu. Sie merkte, wie sich ihr die Haare aufstellten.
Drei, vier große Schritte genügten, und sie stand neben ihrer Mutter, die sich noch im Mantel an der Gans zu schaffen machte.
Rosie war ihr gefolgt und hielt sie am Arm fest. »Nicht, Ebba, nicht aufregen. Sie meint es nur gut …«
Ebba schüttelte die Hand ab.
»Was hast du getan?«, schnappte sie und versuchte, einen Anflug von Panik niederzuringen.
Ihre Mutter drehte sich lächelnd zu ihr um. »Nichts. Nur etwas Wasser. Man riecht bis draußen, dass die Gans gleich anbrennt.« Sie stockte, und ihr rechtes Augenlid flatterte etwas. »Und eine Prise Beifuß. Eine Gans muss nach Beifuß riechen.«
»Das ist mein Essen!«
Frieda Seidels Lippen wurden schmal, und sie knöpfte sich den Mantel auf. »Nicht so laut, Elisabetha, benimm dich bitte.«
»Du isst die Gans doch gar nicht. Was soll das?«
»Nichts kann ich dir recht machen.«
»Wirst du bitte endlich akzeptieren, dass ich aus gutem Grund selbst koche und dass ihr nichts an meinen Töpfen zu suchen habt? Man kann schon wütend werden, wenn das nicht beachtet wird.«
»Diese Regeln stellst nur du auf.«
»Du weißt, warum.«
Ihre Mutter senkte den Kopf. »Ich kann doch nicht ahnen …«
»Nun streitet euch nicht. Es ist Weihnachten!«
»Rosie, halt dich da raus. Es geht einfach nicht, wenn ihr hinter meinem Rücken etwas ans Essen tut. Die Gans ist jedenfalls verdorben.«
»Du übertreibst. Du gehst ja auch ins Gasthaus zum Essen.«
»Nur in wenigen Ausnahmen. Wenn ich nicht sicher bin, was im Essen ist, kriege ich keinen Bissen herunter. Das weiß jeder hier. Erinnert ihr euch nicht mehr an die Regenwürmer und …«
Georg stürzte mit aufgekrempelten Ärmeln aus dem Bad herbei.
»Aufhören!«, rief er und schüttelte sich die Hände trocken. »Bitte, nicht wieder die alten Geschichten. Ebba, es waren Beifuß und Wasser, okay? Davon geht die Welt nicht unter.«
Ebba verschränkte die Arme und blitzte ihn wütend an, während sich ihre Mutter an die Hüfte fasste und humpelnd im Schlafzimmer verschwand.
»Ach ja? Davon geht die Welt nicht unter? Sehr interessant. Ich werde dich bei Gelegenheit daran erinnern.«
Rosie klatschte in die Hände. »Niemand meint es böse, nicht wahr? Können wir uns einfach an den Tisch setzen und friedlich sein? Es ist Weihnachten! Ebba, was gibt es als Vorspeise? Rote Bete und Feldsalat? Darf ich dir beim Servieren helfen?«
Unschlüssig sah Ebba von einem zum anderen, dann betrachtete sie den festlich gedeckten Esstisch, auf dem Maria gerade die Kerzen anzündete, und es kam ihr vor, als blickte sie direkt in den brodelnden Krater eines Vulkans.
Sie biss die Zähne zusammen. Vielleicht hatte Georg recht. Vielleicht hatte sie überreagiert. Es war nur Beifuß gewesen, nichts sonst. Es wäre schön, wenn sie es schafften, diesen Abend mit Anstand durchzustehen. Sie wünschte sich so sehr, dass ihre Familie endlich Frieden fand. Dazu musste jeder seinen Beitrag leisten, auch sie.
»Na gut. Georg, würdest du dann bitte die Gans tranchieren?«
Ihr Bruder betrachtete eingehend seine rissigen Hände. »Willst du das wirklich?«, fragte er mit leisem Entsetzen in der Stimme.
Maria rettete die Situation, indem sie ihn sanft zur Seite nahm, in ihrer Handtasche kramte und ein Paar Einmalhandschuhe hervorzauberte.
Rosie drehte das Radio mit dem Glockenläuten lauter, und Georg streifte die Plastikhandschuhe über und folgte Ebba in die Küche. Mit gerunzelter Stirn machte er sich daran, den Vogel kunstvoll und akkurat zu sezieren. Während Ebba die Teile in den Ofen zurückschob, pellte er sich aus den Handschuhen und verschwand im Bad, wo man ihn gleich darauf stöhnend die Finger schrubben hörte.
Ebba schmeckte die Gemüsesorten ab, dann gab sie Rosie das Zeichen, die Vorspeise aufzutragen. Der Kräutertee für ihre Mutter war aufgebrüht, in den schlanken Gläsern perlte das Mineralwasser, und sie selbst schenkte sich den mitgebrachten Rotwein ein und schwenkte die samtige Flüssigkeit andächtig in dem hohen, bauchigen Glas.
Ihre Mutter hatte sich in der Zwischenzeit umgezogen und trug nun ein dunkelblau schimmerndes Seidenkleid, auf dem die Kette mit dem Perlenkreuz gut zur Geltung kam. Naserümpfend schüttelte sie den Kopf.
»Für einen Abend könntest du wirklich auf Alkohol verzichten. Du weißt doch, was er anrichten kann«, sagte sie leise und faltete mit großer Geste die Hände, bevor Ebba etwas erwidern konnte.
»Mama, bitte«, versuchte sie es noch, aber es war zu spät.
»Wir haben Schuld auf uns geladen und müssen Buße tun«, begann ihre Mutter eindringlich. »Georg, Rosie, Ebba, faltet die Hände, schließt die Augen und betet mit mir um Gnade und Erlösung, denn wir haben gesündigt.«
Die Einzige, die mitmachte, war Maria. Die Schwestern tauschten beunruhigte Blicke aus, und Georg wurde bleich, während sich seine Lippen leicht bläulich färbten. Seine Augenhöhlen schienen plötzlich riesengroß zu sein, und die Nase wurde spitzer. Schweißtropfen traten ihm auf die Stirn, und er musterte angestrengt seine rissigen Finger.
»Unsere Schuld, unsere große Schuld«, murmelte Frieda unverdrossen, als merke sie nicht, dass es nicht mehr lange dauern würde.
»Amen«, unterbrach Ebba sie. »Lasst uns anfangen, ehe alles kalt wird.«
»Vergebung. Wir müssen um Vergebung bitten«, beharrte ihre Mutter. »Ich konnte nicht verhindern, Schuld auf euch zu laden, und deshalb ist es genauso auch meine …«
Krachend flog der Stuhl nach hinten, als Georg aufsprang und sich schwer auf die Tischplatte stützte. Es sah aus, als wolle er die Tafel umwerfen oder als sammelten sich schreckliche, tödliche Worte in ihm, an denen er entweder ersticken oder die er ihnen gleich wie einen Speer entgegenschleudern würde.
Rosie begann zu wimmern und krümmte sich, Frieda ergriff das Kreuz auf ihrer Brust und hob es hoch, als wolle sie einen Vampir vertreiben, und Maria stand langsam auf, als könne sie dadurch verhindern, was sich anbahnte.
»Es ist genug, Mama«, sagte Georg leise. »Wir wissen es, wir denken Tag und Nacht daran. Wir brauchen deine Gebete und deine Ermahnungen nicht. Niemand wird uns die Last nehmen, und wenn du noch so viel betest. Wir alle sind uns seit damals einig, dass niemand jemals darüber ein Wort verliert. Ich habe dich gestern am Telefon gebeten, uns damit in Ruhe zu lassen. Aber du …«
»Ich hätte deinem Wunsch gern entsprochen, aber ich kann doch nicht …«
»Ich kann nicht, ich kann nicht … Ich habe es satt, mir das länger anzuhören. Mein Leben lang hat mich dieses ›ich kann nicht‹ verfolgt. Ich sage dir eines, Mama: Du hättest sehr wohl gekonnt. Es wäre als Mutter sogar deine Pflicht gewesen, uns zu retten und zu beschützen. Wer hätte es sonst tun sollen?«
»Georg, bitte. Mama hat getan, was sie konnte, aber sie war eben schwach. Sie hat doch am eigenen Leib …«
»Entschuldige nicht alles und jeden, Rosie. Es wäre nie so weit gekommen, wenn sie gehandelt hätte, anstatt immer nur zu jammern. Es hätte gereicht, dem Pfarrer einen Hinweis zu geben, anstatt sich in Psalmen und Bibelstellen zu wälzen. Weißt du eigentlich, was du uns angetan hast, Mama?«
Ebba schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. »Jetzt ist es genug. Du hast deine Meinung gesagt. Alles Weitere, was dir noch auf der Zunge liegt, wird dir später leidtun, Georg. Hör auf. Es bringt nichts. Es ist Vergangenheit. Wir müssen sehen, wie wir anständig weiterleben. Jetzt und heute und morgen. Also setz dich hin und iss.«
Georg aber blieb stehen. Er schwankte leicht, und Ebba sah ihm an, dass ihm das Herz wieder zusetzte. Maria hielt schon das kleine Fläschchen bereit, das er gleich brauchen würde. Es würde sein wie immer. Er würde im Bad verschwinden und nach ein paar Minuten wortlos zurückkommen und sich zu ihnen setzen, und sie würden über ihre beruflichen Pläne, Urlaubswünsche und Wohnorte reden, als sei nichts geschehen, und alles würde gut sein.
Aber diesmal dachte Georg nicht daran. Er streckte die Hand nach seiner Frau aus und ging mit ihr aus dem Zimmer, aus der Wohnung, aus dem Haus. Ohne ein Abschiedswort verließ er sie, und eine düstere Ahnung befiel Ebba, es könne vielleicht für immer sein.
VIER
Unten blieb er stehen und lehnte sich erschöpft an die Hausmauer. Wie hatte die Situation nur so außer Kontrolle geraten können? Es war unverzeihlich gewesen, wie er sich benommen hatte. Er fühlte sich beschmutzt, nicht nur, weil er sich auf dem Weg nach unten mit bloßen Händen am Geländer festgehalten hatte. Alles war in Unordnung geraten, in seinem Kopf kreiselten Gedanken und Erinnerungen wie losgelöst, dabei gehörten sie gebändigt, zurückgedrängt in ihre Schubladen, verschlossen, weggesperrt. Vergessen. Warum funktionierte das nicht? Es war ein Fehler gewesen hierherzukommen. Jedes Jahr war das bizarre Weihnachtsgeschehen ein Stück weiter auf diesen Eklat zugetrieben. Er hatte es doch kommen sehen! Warum hatte er sich dem wider besseres Wissen ausgesetzt?
Wenn er seinen Gedanken weiter freien Lauf ließ, würde er noch durchdrehen. Dann würde er in tausend Stücke zerbrechen, und sein Herz würde ihm den Rest geben. Davor hatte er Angst. Er war doch erst fünfunddreißig, und er hatte sich sein Leben gerade so eingerichtet, dass er sich gut darin zurechtfand. Er musste sich zusammennehmen. Am besten zählte er die Sterne am Himmel oder die Laternen in der Straße oder …
Ihm war kalt, wie immer in Situationen, die er nicht beherrschen konnte. Fast rechnete er damit, dass ihm seine eisigen, bläulichen Fingerkuppen erfroren abfallen würden. Er starrte sie an, zählte sie, zählte seine Mantelknöpfe.
Maria sagte etwas zu ihm, aber er verstand sie nicht. Er konzentrierte sich ganz auf die kalte, feuchte Luft, die nach Schnee roch, obwohl es etwas wärmer geworden war. Sie würden auf dem Heimweg also keine Schwierigkeiten haben.
Sein Magen krampfte sich zusammen, als er sich ausmalte, was dann sein würde. Würde er in Heidelberg alles so antreffen, wie er es verlassen hatte? Maria war die ganze Zeit bei ihm gewesen. Sie war nur kurz vor der Abfahrt noch einmal ins Haus gegangen, weil sie das Nitrospray für ihn vergessen hatte. Er hatte vom Wagen aus genau hingesehen; sie hatte zweimal abgeschlossen. Oder nicht? Die Frage quälte ihn schon seit der Abreise.
Maria griff nach seinem Arm und dirigierte ihn ein paar Straßen weiter, wo der Passat stand. Er ließ sie auf dem Beifahrersitz Platz nehmen und riss sich ein paar Bögen der Küchenrolle ab, die er hinter seinem Sitz verstaut hatte. Dann begann er mit spitzen Fingern, die Regentropfen von den Scheiben zu wischen, polierte die Vorder- und die Rücklichter, säuberte die Seitenspiegel und die Nummernschilder. Schließlich nahm er neues Küchenpapier, setzte sich ins Auto und wischte das Armaturenbrett ab.
Angeekelt betrachtete er anschließend seine Hände und kramte ein Desinfektionstuch aus der Manteltasche. Das sollte bis zur nächsten Raststätte genügen, wo er sich die Hände richtig würde waschen können.
»Kannst du fahren?« So rücksichtsvoll Maria die Frage auch formulierte – sie traf ihn. Es war grauenhaft gewesen. Er hatte sich nicht gut verhalten. Er war der Älteste der Geschwister, er hätte besonnen bleiben müssen. Aber er hatte versagt, wie immer. Wieder erfasste ihn übergroße Erschöpfung, und er musste sich sehr zusammenreißen, um nicht einfach die Augen zu schließen und ihr nachzugeben. Allein den Zündschlüssel herumzudrehen kostete ihn übermenschliche Kraft.
»Das verstehst du nicht«, gab er zurück, als der Motor ansprang, und er hoffte, sie würde sich wie üblich damit zufriedengeben.
»Es ist Weihnachten«, setzte sie nach, als er das Auto aus der Parklücke manövriert hatte.
»Weihnachten! Haben wir nie gefeiert, bis Ebba auf die Idee kam.«
»Aber jetzt ist es schöne Tradition, oder?«
Georg schaltete die Scheibenwischer ein. Eine Weile lang war nur das Rucken und Quietschen der Gummilippen zu hören, die Schlieren auf der Scheibe zogen. Höchste Zeit, eine Raststätte aufzusuchen und die Blätter auszutauschen – und die Erinnerungen abzuwaschen, die in ihm nagten. Außerdem hatte er vorhin vergessen, die Funktion von Blinker und Rücklichtern zu kontrollieren, obwohl das doch Vorschrift war.
Maria plauderte über die fröhlichen Familienfeste in ihrer Heimat, und er war zum ersten Mal froh über ihre Redseligkeit, auch wenn er ihr nicht zuhörte. Zu plastisch stand wieder alles vor seinem geistigen Auge, ausgelöst durch das Wort aus Ebbas Mund.
Regenwürmer.
Zehn Stück hatte er im Garten sammeln müssen; der Vater brauchte sie für das neue Bild. Zehn Würmer, die sich in seiner Handfläche wanden – sie sollten das Geheimnis des neuen Gemäldes sein. Er musste sie so lange in den zu einer Schale geformten Händen halten, bis der Vater sie in all ihrem realistischen Schrecken auf die Leinwand gebannt hatte. Dann, sobald die Farbe getrocknet war, würde er alles mit düsterem Braungrün übermalen. Ihm reichte das Wissen um das Geheimnis unter dem eigentlichen Bild, pflegte er zu sagen, und er duldete keinen Widerspruch, kein Aufbegehren, keinen Ekel, kein kindliches Grausen vor den glitschigen, kalten, sich schlängelnden Ungeheuern.
Er hatte in der kurzen Zeit, die ihm gegeben war, nur sechs Würmer im Garten finden können, so tief er auch in der vom Sommer ausgetrockneten Erde gegraben hatte. Wie immer war er in einer Zwickmühle gefangen: Brauchte er länger als befohlen, wurden die Schwestern bestraft. Brachte er in der richtigen Zeit weniger Würmer als gefordert, wurden sie ebenfalls bestraft. Er wollte ihnen so gern die Truhe und den Fenstersims ersparen, aber er schaffte es einfach nicht.
Am Abend, als sie in der Küche mit verheulten Gesichtern vor einem Berg undefinierbarer Vollkornmakkaroni mit brauner Soße saßen, erhob der Vater sein Glas.
»Esst, esst«, krakeelte er aufgekratzt, und sie gehorchten ihm, bis er lachend hinzufügte: »Schmecken euch Georgs Regenwürmer?« Scherz oder Wahrheit? Ebba mit ihren damals dreizehn Jahren hatte jedenfalls ihren Bissen wortlos ausgespuckt und am nächsten Tag das alleinige Regiment in der Küche übernommen.
Plötzlich war es still im Auto, und Maria sah ihn fragend an.
»Entschuldige, was sagtest du?«
»Was ihr früher an Weihnachten gemacht habt, wenn es keine Feier gab? Ist es nicht schrecklich für Kinder, wenn alle Freunde …«
»Wir hatten keine Freunde. Und wir waren froh, wenn der Heilige Abend herum war. Meistens war unser Vater schon am Nachmittag nicht mehr in der Lage, klare Gedanken zu fassen, geschweige denn zu malen oder später mit der Familie … Was rede ich da. Es ist vorbei. Es gibt keine Familientradition. Wir kommen zu diesen Treffen nur zusammen, weil Ebba es will, und natürlich auch, damit Rosie zufrieden ist und Mutter für uns beten kann.«
»Was sie meinte mit dieser Schuld von euch?«
Georg tat, als müsse er sich auf den Verkehr konzentrieren, und es wurde wieder ruhig im Wagen. Maria hatte gelernt, Fragen nicht zweimal zu stellen. Sie war eine gute Frau. Er war froh, dass er gleich nach der bestandenen Prüfung zum Steuerberater zu dieser Agentur gegangen war. Maria war das sanftmütigste Wesen, das er hatte finden können, und noch dazu teilte sie sein Bedürfnis nach makelloser Sauberkeit und Ordnung.
Nur wenn alles unter Kontrolle war, war das Leben perfekt.
Maria unterbrach seine Gedanken. »Warum trefft ihr euch nur einmal im Jahr? Wenn ihr euch öfter besuchen würdet, gäbe es vielleicht nicht diese Spannungen.«
»Weil wir kein Bedürfnis verspüren, uns öfter zu sehen.«
»Aber ihr seid doch eine Familie.«
»Familie!«
»Ja, Familie. Bei uns wir besuchen uns jeden Sonntag, telefonieren zwischendurch oder sehen irgendjemanden aus der Familie. Das war so schön.«
»Hast du Heimweh?«
»Schon okay. Ich weiß, dass du nicht fliegst. Ich bin gern bei dir, und es soll dir gut gehen.«
Ihm lag eine bissige Antwort auf der Zunge, denn es konnte eigentlich nur sie sein, die ihm seit Wochen diesen Schabernack spielte. Wer sonst sollte es auf ihn abgesehen haben? Sie hatten kaum private Kontakte in Heidelberg, es gab niemanden, der ein Interesse daran haben konnte, dass er durchdrehte. Nur Maria. Sie würde das Haus verkaufen, seine Konten plündern und auf die Philippinen zurückkehren, wo niemand sie finden würde. Andererseits war es schwer vorstellbar, dass hinter der Sabotage wirklich seine sanftmütige, ergebene Ehefrau steckte.
Ach, am besten, er beobachtete alles noch für eine Weile, möglichst ohne den Verstand zu verlieren. Und dann würde er ihr eine Falle stellen.
Ebba war wie gerädert, als sie endlich die Tür zu ihrem Penthouse aufschloss. Was für ein verkorkstes Fest! Sie sollte es aufgeben, die Familie zusammenhalten zu wollen. Das machte alles nur noch schlimmer. Nachdem Georg gegangen war, war ihre Mutter im stillen Gebet abgetaucht, Rosie hatte sich gewunden, weil sie nicht wusste, wem von beiden sie es nun recht machen sollte, und auch sie selbst hatte keinen Ausweg gefunden, die Situation noch zu retten, sondern hatte stumm die Teller zusammengestellt.
Am meisten machte sie sich um Georg Sorgen. Er war blass und nervös gewesen, und dieser abrupte Aufbruch passte nicht zu ihm. Vielleicht hatte sein Zustand mit Marias Andeutungen zu tun. Was bildete er sich nur ein, dass er plötzlich sogar seine perfekten Manieren vergaß?
Sie wuchtete den Korb mit dem fast unberührten, verkorksten Festessen, vor dem es sie ein wenig ekelte, das ihre Mutter aber nicht hatte aufheben »können«, auf die Küchentheke und versuchte, die Dosen, Schüsseln und Teller irgendwie im Kühlschrank zu verstauen. Jetzt wäre es schön gewesen, wenn sie Jörg und seine Tochter für morgen hätte zum Essen einladen können. Aber sie selbst hatte darauf bestanden, dass sie sich während der Feiertage nicht gegenseitig anriefen. Sie wollte es langsam angehen mit ihm; nichts war grässlicher, als von jemandem sofort vereinnahmt zu werden.
Dabei war es jetzt fast umgekehrt: Sie hätte gern mit ihm über den Tag geredet. Er hatte sich vor Kurzem sehr eingehend nach Georg erkundigt, und sie hatte entgegen ihrer Vorsätze dessen Schrullen erwähnt, über die sie sich beide etwas lustig gemacht hatten. Jedes Mal, wenn sie die Wohnungstür oder die Galerie abschloss, musste sie zum Beispiel an ihren Bruder denken. Er würde eine halbe Stunde brauchen, um endlich beruhigt in den Feierabend gehen zu können. Bis dahin hätte er das Schloss ein Dutzend Mal kontrolliert und zwischendurch die Sache noch schlimmer gemacht, weil er wieder hineingehen und Strom, Fenstergriffe und Wasserhähne inspizieren musste. Armer Kerl. Und nun litt er noch unter weiteren Verfolgungen? Arme Maria!
Ebba dimmte die kleine Lampe auf der Anrichte, das Tag und Nacht brannte, knipste das Deckenlicht aus und lehnte sich in ihrem weißen Sofa zurück, um das Funkeln der Lichter in der Stadt unter ihr zu genießen. Sie beglückwünschte sich jeden Tag aufs Neue zum Kauf dieser Wohnung; ein echter Glücksgriff war das gewesen, wenn auch nicht billig. Russen und Osteuropäer machten die Preise in Baden-Baden kaputt, aber sie hatte ja genug Geld. Das Erbe von damals hatte für die Galerie gereicht, und nach deren fulminantem Start hatte sie sich gleich diese hundertvierzig Quadratmeter über den Dächern des Stadtkerns leisten können. Rechter Hand auf dem Florentinerberg thronte dunkel das unbewohnte Neue Schloss, unter ihr ragte der leicht bauchige Zwiebelturm der rosafarbenen Stiftskirche empor, und links im Tal waren die angestrahlten grauen Zwillingstürme der Stadtkirche auszumachen, die nur einen Steinwurf von ihrer Galerie entfernt lag.
Ebba goss sich ein Glas italienischen Rotwein ein und ließ ihren Blick durch den riesigen dämmrigen Raum schweifen, der Bibliothek, Küche, Essraum, Mediencenter, Wohnzimmer und Arbeitsplatz zugleich war. Die ausgehängte Tür, die an der Wand lehnte, störte ein wenig, aber sie würde in ein paar Tagen fort sein.
So hatte sie immer leben wollen. Alle Möbel waren weiß, die Wände und Decken ebenso. Nur der fast schwarze Holzfußboden bildete dazu einen dramatischen Kontrast.
Bilder würden hier fehlen, hatte Jörg gestern festgestellt, aber sie wollte die Wände nicht zuhängen. Gemälde gab es in der Galerie genug, und zwar nur solche, die ihr wirklich gefielen. Diese Rechnung ging auf: Die Kunden rannten ihr die Tür ein, und sie zahlten jeden Preis, ohne mit der Wimper zu zucken. Manchen brachte sie die Bilder persönlich ins Haus, gleichgültig, ob in Frankfurt, Rottweil oder auf Mallorca. Jörg hatte mit seinen Fotos dafür gesorgt, dass die Galerie mit einem Schlag international bekannt wurde. Sie hatte sogar die Anfrage bekommen, auf der Art Basel einen Stand zu präsentieren, doch davor schreckte sie zurück, denn sie wusste genau, was die Organisatoren dort zu sehen hofften.
Aber ihr Privatarchiv öffnete sie nur in wenigen Ausnahmen. Jörg war einer der Ersten gewesen, der die Bilder hatte sehen dürfen, und seine Fotos der Exponate hatten diesen Boom ausgelöst, auch wenn sie den meisten Interessenten beschied, dass die Werke unverkäuflich waren. Dass sie glaubte, die Bilder brächten Unglück, weil sie mit den Tränen der Familie gemalt worden waren, behielt sie für sich. Drei von ihnen hatte sie dann doch veräußert – zu unglaublichen Preisen, die ihr den Kauf des Apartments ermöglicht hatten. Jetzt aber blieb das Archiv geschlossen. Sie bekam Kopfschmerzen, wenn sie vor den Bildern stand, sie flüsterten und kreischten zugleich in ihrem Kopf, die grellen Farben bohrten sich in ihre Augen, und der stets dunkle, grünbraune Hintergrund löste Depressionen bei ihr aus. Es war besser, die Stahltüren geschlossen zu halten.
Ebba nippte an ihrem Glas und versuchte, ihre Gedanken in andere Bahnen zu lenken. Georg fiel ihr wieder ein, ihr armer großer Bruder, der sich seine Kindheit und Jugend hindurch so unermüdlich bemüht hatte, Fehler zu vermeiden, um Rosie und ihr selbst die schlimmsten Auswüchse zu ersparen. Leider war es ihm nie gelungen. Was war es nur, das ihn nun so sehr beunruhigte? Vielleicht sollte sie Maria heimlich anrufen und fragen? Aber das ging nicht unbemerkt. Maria kam abends später als Georg nach Hause und würde sich nicht trauen, in seiner Gegenwart über seine Probleme zu reden. Ein Handy besaß sie nicht. Vielleicht sollte sie die beiden einmal besuchen? Ja, das war eine gute Idee. Zufrieden stellte Ebba das Glas auf den Tisch. Man musste nur nachdenken, dann fiel einem immer ein Ausweg ein.
Schon als sie in die Straße einbogen, sah Georg, dass nichts in Ordnung war. Im Flur brannte Licht, außerdem im Wohnzimmer und hinter den Kellerfenstern.
Maria gab einen erstickten Laut von sich und blickte ängstlich zu ihm herüber. »Ich habe die Tür abgeschlossen, zweimal. Ganz bestimmt«, flüsterte sie und hielt sich die Hand vor den Mund, als sei ihr übel.
Ihm drehte sich ebenfalls der Magen um, und er war froh, dass sie in Freiburg nichts gegessen hatten. Der Schmerz in seinem Magen rührte nicht vom Hunger, er begann zu brennen, arbeitete sich durch die Speiseröhre nach oben in den Brustraum, dann zum Hals, in den Arm, bis in die Hände, die ihm plötzlich nicht mehr gehorchten, als er den Autoschlüssel abziehen wollte.
Schweißtropfen perlten in seinen Hemdkragen, durchnässten seine Achseln, ließen ihm das Hemd am Rücken festkleben.
Sprachlos blieb er sitzen, öffnete nur automatisch den Mund, als Maria ihm das Spray hinhielt.
Sein Herz beruhigte sich, seine Angst nicht.
»Bleib sitzen«, sagte er rau und wollte sich aus dem Auto winden, doch dann hielt er inne.
Maria weinte, erst lautlos, dann begann sie zu schluchzen, und ihr Körper zuckte in heftigen Stößen. »Ich – war – das – nicht!«, stieß sie hervor. »Bitte glaub mir doch!«
Er sah zum erleuchteten Haus, dann zu ihr. Er wollte es gern glauben. Eigentlich war es nicht möglich, dass sie in den paar Sekunden vor der Abfahrt auch noch im Keller gewesen war. Aber vielleicht hatte sie einen Komplizen. Er musste das beobachten, unbedingt. Ehe er keinen Beweis hatte, sollte er vielleicht von ihrer Unschuld ausgehen. Alles andere wäre ungerecht.
»Hör auf zu heulen, Maria«, murmelte er und nahm sie halbherzig in den Arm. »Alles wird gut.«
Und wenn sie wirklich unschuldig war?
Es dauerte ein paar Sekunden, dann traf ihn die Erkenntnis wie ein Schlag.
Zitternd strich er ihr die Haare aus dem Gesicht und küsste sie auf die Stirn, während er weiterhin auf die Fenster starrte und dem eisigen Schrecken nachspürte, der in ihm hochkroch.
»Vielleicht hat Mama recht«, flüsterte er langsam. »Vielleicht ist es Zeit zu büßen.«
FÜNF
Donnerstag, 22. März 2007
»Ich habe sie, Frau Hilpert! Gleich zwei Exponate von Sibylle Wagner! Sehen Sie: rotlichtschatten und rothorizont.«
Immer noch begeistert, beugte sich Ebba über ihren Laptop und stellte ihn für ihre Assistentin etwas quer zum Licht.
»Plexiglas vor Acryl auf Hartfaser. Dieses Rot ist einzigartig, betörend und so kraftvoll, dass es mich gestern wie ein Magnet durch die ganze Ausstellungshalle angezogen hat. Dabei hatte ich erst keine Lust, auf die art KARLSRUHE zu gehen. Und dann das. Das ist genau, was Monsieur Leblanc in Straßburg sucht. Es hat mich wie ein Blitz getroffen.«
Frau Hilpert zog die Augenbraue hoch – ein Zeichen höchster Anerkennung. »Gratulation. Selbst auf dem Schirm beeindruckend. Wann kommen sie? Soll ich sie in Empfang nehmen?«
»Ich bin spätestens Ende nächster Woche zurück. Die Treffen vor der Art Paris sind viel interessanter als die überlaufene Messe selbst. Übernächste Woche, Dienstag oder Mittwoch, sollen die Bilder geliefert werden, und am Freitag oder Samstag bringe ich sie nach Straßburg. Ich bin mir sicher, dass Leblanc sie kaufen wird.«
»Tut es Ihnen nie leid, Bilder, die Ihnen etwas bedeuten, wieder abgeben zu müssen?«
»Aber nein. Das Finden, dieser Blitz und natürlich dieses kurzfristige Gefühl des Besitzens – das ist es, was mir den Kick gibt. Danach kann ich loslassen – zumal in diesem Fall. Wäre Monsieur Leblanc nicht gerade auf der Tagung in New York, wäre er wahrscheinlich direkt nach Karlsruhe gefahren, um die Originale zu begutachten.«
»Und hätte Sie um die Provision gebracht.«
Frau Hilpert blies eine Strähne aus der Stirn, die sich aus der strengen kastanienbraunen Hochfrisur gelöst hatte, und zupfte ein unsichtbares Fädchen von ihrem schlichten, schwarzen Hosenanzug. Nichts vermochte sie aus der Ruhe zu bringen, und dafür schätzte Ebba sie. Sie konnte sich den Galeriebetrieb ohne ihre Assistentin nicht vorstellen. Frau Hilpert war Mitte fünfzig, eine Wiedereinsteigerin mit solider kunsthistorischer Ausbildung, und mit ihrer kühlen Eleganz der ruhende Pol im großen Frühjahrschaos. Ohne Klage hatte sie seit vier Wochen durchgearbeitet, obwohl sie lediglich einen Halbtagsvertrag besaß.
»Nur noch Paris, dann können Sie Ihre Überstunden abfeiern, das verspreche ich. Aber Paris – das wollte ich mir nicht entgehen lassen.«
Frau Hilpert kniff ein Auge zu und zeigte einen Anflug von einem Lächeln. »Und das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Dazu ist die Stadt ja wie geschaffen.«
Ebba vertiefte sich in den Computerbildschirm, um zu verbergen, wie sie sich auf den Ausflug freute. Es würde der erste gemeinsame Urlaub mit Jörg werden, morgen Früh sollte es losgehen. Sie hatte ein Hotel in der Nähe der Oper gebucht, und das Wochenende würde nur ihnen beiden gehören, keine Treffen, Geschäftsessen oder Reportagetermine. Einerseits freute sie sich auf die Tage mit Jörg und natürlich auf Paris im Frühling, andererseits war es ein Experiment. Sie trafen sich zwar jedes zweite Wochenende, aber so ganz hatte sich keiner von ihnen bislang dem anderen gegenüber geöffnet. Ebba gab sich die Schuld daran. Je mehr jemand von ihr wusste, umso schutzloser fühlte sie sich. Wahrscheinlich hatte sich das auch auf Jörg übertragen, denn auch er sprach lieber über allgemeine Themen als über sich und seine Gefühle. Nur wenn die Rede auf seinen Großvater Anton kam, bei dem er aufgewachsen war, taute er auf und erzählte mit leuchtenden Augen über rührende Kindheitserlebnisse, um die Ebba ihn glühend beneidete.
Wie fremd sie sich im Grunde immer noch waren, hatte sich vor einigen Wochen gezeigt, als sie gemeinsam in die Nähe von Besançon gefahren waren, wo Ebba den bekannten Bildhauer Jörg Schad in dessen Atelier hatte treffen wollen.
Sie hatten die Nacht in einem kleinen Gasthof verbringen wollen, den Jörg ausgesucht hatte, und sie hatte Zustände bekommen, weil sie schier erstickt wäre an der Enge, der Düsternis, der erdrückenden dunklen Holzbalkendecke, dem dicken Federbett … Sie hatten noch in der Nacht zurückfahren müssen, was Jörg allerdings erstaunlich gelassen nahm. Er zeigte sich verständig, obwohl sie ihm auch diesmal eine Erklärung schuldig geblieben war.
Jetzt also Paris. Das Hotel und die Zimmer sahen auf den Internetseiten großzügig und ausreichend luftig aus, der Rest würde sich in der Stadt der Liebe hoffentlich von selbst ergeben. Sie prüfte noch einmal die Reservierungsbestätigung und druckte ein paar Adressen von Lokalen in der Nähe des Hotels aus. Mit anonymen Essen in Restaurants hatte sie zum Glück kaum Probleme, ganz anders war das bei privaten Kocheinladungen – da malte sie sich die schrecklichsten Zutaten aus, die – bewusst oder unabsichtlich – in die Speisen gewandert sein mochten, und sie brachte keinen Bissen herunter.