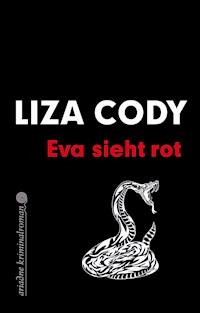14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
London. Deprimiert von verlorenen Träumen hockt Schriftstellerin Amy im Café, als der alte Song im Radio kommt: »See Jesse Tomorrow« von Elly Astoria, deren Mörder nie gefasst wurde. In Amy keimt die Idee, sich als Biografin zu versuchen. Sie recherchiert und spricht mit Leuten, die dabei waren, als Ellys Songs die Charts anführten und jeder ein Duett mit ihr wollte. Die Geschichten widersprechen sich. War SisterHood überhaupt eine richtige Band? Sex-Ap¬peal hatte nur Sängerin Madeline, der Rest war höchstens begabt. Ihr Agent, dieser windige Ganove, kam frisch aus dem Knast. Und dann der schreckliche Mord … Aufschlussreiches und Widersprüchliches, ¬Charmantes und Verstörendes fügen sich zu einem Kaleidoskop ohne Gewähr. Schlaglichter fallen auf Mythos und Realität des Showbiz. Filmische Fragmente, Spekulation und Dokumentation rangeln miteinander. Die Rolle der Ermittlerin wächst Amy über den Kopf … bis sie sich schließlich selbst verändert. Liza Cody spielt erneut mit den Grenzen des Genres und jongliert mit Erzählweisen, wie nur sie es kann: ¬mitreißend, sachlich, ironisch, zart, manipulativ und wahrhaftig.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 509
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Impressum
eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2019
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
www.culturbooks.de
Titel der englischen Originalausgabe:
Ballad of a Dead Nobody
© 2011 by Liza Cody
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: © karastock – fotolia.com
Printausgabe: © Argument Verlag 2019
Übersetzer: Martin Grundmann
Lektorat: Else Laudan
eBook-Herstellung: CulturBooks
Erscheinungsdatum: Mai 2019
ISBN 978-3-95988-141-8
Über das Buch
Eine Schriftstellerin am Tiefpunkt. Ein alter Song, der im Radio läuft. Die Idee, eine Künstlerinnenbiografie zu versuchen: Leben und Tod von Elly Astoria, ermordet in den 1980ern, Täter unbekannt. Aber wie eine Biografie schreiben, wenn die Hauptfigur ständig hinter den Leben anderer verschwindet? Welchen Aussagen ist überhaupt zu trauen? Alle Fährten sind kalt, die Geheimnisse sorgsam gehütet.
Abserviert und gedemütigt hockt Amy im Café und weint in ihren Milchkaffee. Da kommt im Radio dieser Song, See Jesse Tomorrow, der sie prompt auf eine Zeitreise schickt. Die Songwriterin starb jung. Ein blutiger, grauenhafter Mord. Über ihr Leben ist wenig bekannt. Aber ihre Musik war einmal wichtig. Amy macht sich auf die Suche nach den Puzzleteilen, die Leben und Tod von Elly Astoria erhellen könnten. Eine Biografie soll entstehen, seriös und möglichst würdigend. Doch es gibt viele Wahrheiten – und ein paar fiese Geheimnisse.
»Ihre Sprache ist mal klar, mal wirr, mal witzig, mal traurig – oft alles gleichzeitig und durchgehend originell.« Marcus Müntefering, Spiegel online
»Niemand schreibt so pointiert und schwarzhumorig aus dem Alltag wie Liza Cody.« Badische Zeitung
Über die Autorin
Liza Cody
Ballade einer vergessenen Toten
Roman
Inhaltsverzeichnis
Für MZL, ohne dessen Können als Bäcker
England hat viele große (Krimi-)Autor/innen, aber nur eine Liza Cody: Kühn und eigensinnig biegt sie das Genre, verschafft abseitigen Gestalten eine Stimme, rührt zu Tränen, stimuliert Lachmuskeln und packt mehr unbequeme Wirklichkeit in ein Buch als jede/r andere.
Und diese Figuren! Zicken, Hyänen und Lämmchen, Ruppige, Brave, Verrückte, Bürgerliche und Outlaws, Miststücke und Herzchen. Doch keine/r ist nur Klischee oder Persiflage, alle sind irgendwie echt, manchmal bis zur Schmerzgrenze.
In Ballade einer vergessenen Toten verstrickt uns Cody in eine vieldimensionale Collage aus Popgeschichte und Träumen von Ruhm, Thatcher-Ära und Musikbusiness. Der Ausgangspunkt ist London, Anfang des 21. Jahrhunderts. Schriftstellerin Amy sitzt im Café und brütet Selbstmitleid. Ein altes Stück läuft im Radio, ein Hit der später ermordeten jungen Songwriterin Elly Astoria. Von der niemand mehr spricht. Dabei war ihre Musik doch in den 1980ern wichtig. Etwas Besonderes. Eigen … Genau da beschließt Amy, eine Biografie zu schreiben. Wer war Elly Astoria wirklich? Warum wurde sie so grausam umgebracht?
Amy ist keine Detektivin. Sie will nur gewissenhaft recherchieren und dann die vielen parteiischen O-Töne zu einer möglichen Wahrheit montieren. Doch die Widersprüche springen ihr ins Gesicht, finden den Weg in die Gegenwart und fordern, dass Amy ihre Zuschauerinnenrolle aufgibt …
Ein ungefüger, wilder, tiefer, zumutender Roman voller Musik, Kritik und leiser Zärtlichkeit. Eine echte Cody.
Else Laudan
Die Unsichtbare
Fünfundzwanzig Jahre früher
Mit tauben Fingern dreht Elly den Schlüssel und schlüpft in den dunklen Flur. Die Glühbirne ist vor achtzehn Monaten durchgebrannt. Es gibt keinen Ersatz und auch keine Trittleiter, die Elly erklimmen könnte, selbst wenn sie eine Birne kaufen würde. Für die kleine Elly war der Flur eigentlich immer dunkel.
Sie trägt den Einkauf in die Küche. Die Milch kommt in den müffelnden Kühlschrank. Der Rest bleibt in der Plastiktüte. Sie macht zwei Tassen Tee, fischt eine zerdrückte Kekspackung unter den eingedellten Bohnendosen heraus und geht wieder durch den dunklen Flur. Am Fuß der Treppe bleibt sie stehen und horcht. Kein Mucks dringt aus dem Zimmer, in dem ihre Mutter schläft, aber der Raum scheint zu atmen. Sie setzt sich auf die Stufen und stellt vorsichtig rechts und links neben sich die Teetassen ab. Sie öffnet die Kekspackung und ertastet fünf Stück, die kaum zerbröckelt sind. Was übrig bleibt, lässt sie neben der einen Tasse liegen. Sie klopft mit der Spitze ihres Turnschuhs gegen die Tür. Dann steigt sie mit ihrer Tasse und den fünf Keksen die Treppe hoch. Sie lauscht und hört unten ihre Mutter: die schlurfenden Schritte, die aufgehende Tür, das Rütteln der Tasse auf der Untertasse, das Rascheln der Kekspackung, das Schließen der Tür. Keine Stimmen. Niemand ruft, brüllt oder weint. Alles ist gut.
Um diese Zeit am frühen Abend sind andere Kinder in Ellys Alter von der Schule heimgekehrt. Sie tun, was Kinder tun: essen, gucken fern, streiten mit Eltern und Geschwistern, hören Musik, drücken sich vor Hausaufgaben, schmökern, besetzen das Telefon. In ganz London bestehen die Kids auf ihr Recht, die Telefonnetze zu überlasten.
Elly zündet drei Kerzen an. Sie besitzt das batteriebetriebene Wrack eines Radiokassettenrekorders – Wert drei Pfund, vom Flohmarkt. Sie drückt die Abspieltaste und hört ›She’s A Rainbow‹ von einer Kassette mit Hits der 60er – fünfzig Pence an einer Marktbude. Sie streckt die linke Hand aus und schaltet ein kleines batteriebetriebenes Yamaha-Keyboard ein – umsonst, beim Schulkehraus. Ihre Finger greifen den B-Dur-Akkord. Sie denkt nicht darüber nach. Die Finger folgen der Sequenz: Es, B und F7. Ihr Bewusstsein ist ganz mit dem Text und dem barocken Klang des Klaviers beschäftigt. Wie schwer wird es sein, etwas Ähnliches auf der Gitarre hinzubekommen? Lohnt das Ergebnis den Aufwand?
Alles in allem fährt Elly ganz gut mit hübschen 60er-Jahre-Songs. Sie hat einen Platz im U-Bahn-Tunnel, und manchmal bleiben die Älteren stehen und hören ein Weilchen zu. Manche sprechen sie an, erstaunt, dass eine Jugendliche sich die Songs draufschafft, die vor so vielen Jahren ihre Herzen höherschlagen ließen. Sie erzählen ihr, wo sie waren, als sie zum ersten Mal ›Norwegian Wood‹ hörten, und mit wem. In ihre Augen tritt die Farbe von Unschuld, und es folgt das befriedigende Klingen von Münzen, die in den Gitarrenkoffer fallen. Dann lächelt Elly schüchtern und spielt ›Thank You For The Music‹, um die kalte Luft zu wärmen und die Menschen vergessen zu lassen, warum sie sonst so eilig durch den Tunnel hetzen.
Das macht Elly, während die Kids ihres Alters in der Schule hocken. Später, wenn sie im Bett sind, stellt sich Elly da auf, wo die Leute zusammentreffen, die aus dem Green Man Pub und aus dem Roxy-Kino kommen. Jetzt spielt sie aktuelle Hits der 80er und nimmt genauso viel ein, nur in kürzerer Zeit.
Seltsamerweise verfügt Elly über einen nahezu lückenlosen schulischen Anwesenheitsnachweis: Damit werden sie sie nicht drankriegen. Sie ist das unsichtbare Kind, das gewissenhaft eintrifft und antwortet, wenn ihr Name beim Anwesenheits-Check aufgerufen wird. Wenn sie mal nicht da ist, liegt grundsätzlich eine schriftliche Entschuldigung vor. Sollte ihr Klassenlehrer diese Zettel sammeln und irgendwann durchschauen, würde er überrascht feststellen, dass Ellys Entschuldigung selten eine eigene Erkrankung ist. Meistens lautet die Botschaft: »Bitte entschuldigen Sie Ellena, sie bringt mich heute zum Arzt.« Unterschrift: Jesse Astoria. Er könnte sich wohl fragen, was für eine Mutter von einer Elfjährigen zum Arzt gebracht werden muss. Aber selbst wenn, hätte er vermutlich weder die Zeit noch die Energie, der Frage nachzugehen.
Hin und wieder fängt sich Elly eine Erkältung ein, aber sie war noch nie ernstlich krank. Sie war auch nie verletzt. Manchmal wird sie zu Boden gestoßen und ihr Geld gestohlen. Aber heutzutage wittert sie den rostigen Dunst drohender Gefahr schon von weitem und läuft weg. Sie ist klein und schnell, und sie kann mit verblüffendem Tempo in einer Menge untertauchen. Verschwinden ist ihr einziges anderes Talent. Es ist ihr Überlebensprinzip.
Sie ist nicht stark genug für einen Kampf, und wenn ein anderer Straßenmusiker ihre Ecke beansprucht, verdrückt sie sich. Will einer der vielen Diebe und Schläger ihr Geld, dann haut sie ab, rettet sich und ihre Gitarre. Das meiste Geld ist ohnehin in den diversen Taschen ihrer vielen Mäntel und Jacken verstaut. Die Einzige, die sich regelmäßig bedient, ist ihre Mutter.
Sie macht sich keine großen Sorgen um Geld. Es reicht immer, um irgendwo ein Stück Brot zu kaufen, eine Dose Suppe oder Bohnen, eine Packung Kekse zum Teilen mit Jesse. Für ihre Mutter den Haushalt zu machen ist leicht. Sie kann Toast rösten. Sie kann Suppe aufwärmen. Sie kann ein Ei braten. Jesse ist nicht wählerisch und oft hat sie gar keinen Hunger. Essen ist nicht das, was Jesse durch den Tag bringt, und obwohl Elly immer mindestens die Hälfte von allem, was sie zubereitet, am Fuß der Treppe stehen lässt, isst sie es dann oft selbst, kalt, ein paar Stunden später, wenn sie runterkommt und es unberührt vorfindet.
Nichts von alledem kommt ihr ungewöhnlich vor, weil sie nicht abgleicht oder gegenüberstellt. Eigentlich denkt sie überhaupt nicht nach. Ihr Kopf ist voller Klänge und Bilder, die sie jederzeit problemlos abrufen kann, aber einen Bewertungsmaßstab hat sie nicht. Die einzige Zeit, in der sie saubere Kleidung trug, regelmäßig warm aß, früh ins Bett ging und sich unter ständiger Überwachung eines verantwortlichen Erwachsenen befand, war die Zeit, als Jesse weg war. Weggebracht wurde. Schreiend davongeschleift wurde. Elly schrie auch. Sie kann sich an den Klang erinnern und manchmal, sogar jetzt noch, hört sie ihn im Schlaf.
Sonst hörte es niemand. Das begriff sie schon damals, weil niemand Jesse retten kam. Niemand brachte sie Elly zurück. Und später, als der Pflegevater ihr in dem engen, blitzsauberen Badezimmer auflauerte, hörte es auch niemand, obwohl es draußen vor der weißen Tür, die nicht abgeschlossen war, vier Leute gab.
›She comes in colours everywhere‹, singt Elly im Kopf. ›She combs her …‹, Finger wechseln die Stellung, wechseln den Akkord, ›… hair. She’s like a rainbow.‹ Sie lächelt. Das ist ein hübscher trauriger Lovesong und er sollte ein paar Münzen einbringen.
Sie hält inne, um sich einen Keks in den Mund zu stopfen und das Band zum Anfang des Stücks zurückzuspulen. Sie ist vollkommen unbeschwert. Das blumige Klavierklimpern im Intro lässt sich nicht eins zu eins auf die Gitarre übertragen, aber sie wird was hinkriegen.
Sie denkt bei dem Song nicht an ihre Haare mit den dichten Kräusellocken und wilden Knoten, die sie nie kämmt und selten wäscht. Dieses Lied handelt nicht von ihr – sie ist niemandes Regenbogen. Die Bilder in ihrem Kopf zeigen glitzernde bunte Umrisse, die ein Muster zu einem präzisen Rhythmus tanzen. Im Hintergrund, leicht verschwommen, gibt es Burgen und Türme und Jungs und Mädchen mit seidigem gelbem Haar, alles ist hell und luftig und so weit entfernt von Ellys Zimmer, wie ein Szenario nur sein kann. Aber natürlich lebt Elly gar nicht in ihrem Zimmer mit dem abgetretenen Linoleum, den mottenzerfressenen Vorhängen und den Bergen von Schmutzwäsche. Elly tanzt mit verzwickten Mustern aus buntem Glitzern. Da sie sich nicht sehen kann, tut sie sich niemals leid.
Fünfundzwanzig Jahre später – der Stamm der Ausrangierten
Es war einmal eine Frau, weder alt noch jung, weder klein noch groß, weder hinreißend noch hässlich. Wobei sie besser aussehen kann als heute. Ihre Haut ist trocken und stumpf, denn sie hat keinen Nerv für Peelings und Cremes. Ihre Haltung ist schlecht, denn sie kann der Welt nicht mit gehobenem Kinn und geraden Schultern entgegentreten. Ein neuer Büstenhalter stünde ihr gut, aber sie bringt es nicht fertig, in eine Umkleidekabine zu gehen und ihren ungeliebten Körper zu sehen.
Heute immerhin ist Amy tapferer als sonst. Heute war sie im Supermarkt, um ihre Vorräte aufzustocken. Sie hat sich der grässlichen Tatsache gestellt, dass sie nur noch für eine Person einkauft und dass ihr ungeliebter Körper Essen braucht.
Dieser kleine Anflug von Courage treibt Amy weiter – in ein Café, wo sie allein am Fenster sitzt, nur eine Zeitung zur Gesellschaft. Sie spürt einen Schmerz in Schultern und Rücken und merkt, dass es ihr wehtut, aufrecht zu sitzen. Sie würde sich lieber unterm Tisch zusammenrollen, als gesehen zu werden. Sie glaubt, sie sieht aus wie eine ausrangierte Frau. Wer immer sie sieht, kann spöttisch mit dem Finger auf sie zeigen und johlen: Das ist die Frau, die Craig ausrangiert hat, ha-ha. Er hatte sie satt. Er hat jetzt eine Jüngere, schicker, begabter. Heißer.
Sie schämt sich und das bringt sie um.
Sie starrt blicklos auf den Rezensionsteil ihrer Zeitung und versucht zu ermessen, wie viel Zeit, Energie und Liebe sie an Craig verschwendet hat. Als sie ihn kennenlernte, hat sie davon geträumt, Schriftstellerin zu werden. Craig aber war bereits Schriftsteller, ein guter, ein erfolgreicher. Sie dachte, von ihm könne sie lernen. Und sie lernte. Sie lernte kochen für einen Schriftsteller, putzen für einen Schriftsteller, Finanzen und Dinnerpartys organisieren für einen Schriftsteller. Dann feuerte er sie.
Und nun muss sie lernen, einem Schriftsteller nicht länger nachzutrauern. Sie muss lernen, ihr eigenes Werk zu beginnen und ihr eigenes Leben zu leben.
Es ist eine weltweit anerkannte Wahrheit: Mitglieder des großen traurigen Stammes der Ausrangierten müssen ausgerechnet dann am tapfersten sein, wenn sie zutiefst eingeschüchtert und beschämt sind. Ist es da ein Wunder, dass die Therapiepraxen lange Wartelisten haben? Jeder Mensch braucht irgendwann mal seelische Hilfe. Die Ausrangierten brauchen sie am dringendsten.
Manchmal jedoch ergeht Gnade, wenn sie am wenigsten erwartet wird. Diese Frau in diesem Café ereilt die Gnade in Form eines Songs. Der Song heißt ›See Jesse Tomorrow‹. Geschrieben wurde er über zwanzig Jahre zuvor von einem Teenager namens Elly Astoria, berühmt für ihren kurzen kometenhaften Aufstieg und noch berühmter für die abartigen Umstände ihres Todes.
Dieser Song mit seiner schmerzlich-schönen Melodie und seinem herzzerreißenden Text bewirkt, dass die Frau ihren Kopf in die Zeitung steckt und weint. Doch er setzt auch die Alchemie in Gang, die Amy von einer ausrangierten, trauernden verlorenen Seele in eine Biografin verwandeln wird.
Sarah und das Yama – aus Amys Interviewmitschnitten für die Biografie
Sarah erzählte es folgendermaßen: »Elly war bloß irgendein Kind. Auffallen tun einem immer die Lauten, die Rabauken und Heulsusen. Jeder sagt, man soll Legasthenie auf Anhieb erkennen können. Aber wie denn? Buchstabieren können sie doch alle nicht. Sie haben alle eine Sauklaue. Sie sind alle tollpatschig und schluderig. Manche Mütter schicken sie ohne Frühstück in die Schule. Einige haben in der Nacht kaum geschlafen. Gott, es gab mal eine Mutter mit Zwillingstöchtern, die hatten an drei von fünf Tagen nicht mal ein Höschen an. Als ich das ansprach, schickte sie sie im Schlafanzug zur Schule. ›Ziehen Sie sie doch an‹, sagte sie. ›Vielleicht können Sie sich’s leisten.‹«
Wenn man eine verlotterte Grundschule im Norden Londons als Sinnbild für die Gesellschaft als Ganzes sah, so führte Sarah aus, dann war es doch kein Wunder, wenn nur die Schlimmsten und die Besten bemerkt wurden. Und folglich, rechtfertigte sie sich, verhielt sie sich genauso wie die Gesellschaft als Ganzes, als sie Elly nicht wahrnahm. Menschen, fand sie, waren darauf konditioniert, am meisten auf Extreme zu reagieren. Der Durchschnitt ist nicht bemerkenswert und wird demzufolge nicht bemerkt.
Dann kam es zu zwei Ereignissen. Das erste fand statt, als Sarah die Verantwortung für die Musik zur Weihnachtsaufführung übertragen wurde, das zweite zu Beginn des folgenden Schulhalbjahres.
Drei Weihnachtslieder wurden ausgewählt: ›While Shepherds Watched‹, ›Away In A Manger‹ und ›Once In Royal‹. Wer nicht hübsch genug war, um Maria zu spielen, nicht groß genug, um Joseph zu sein, nicht helle genug, um eine Rolle zu lernen, oder zu schüchtern für einen Auftritt, wurde in den himmlischen Chor gesteckt, und Sarah brachte ihnen Weihnachtslieder bei.
»Jedes Kind muss mitmachen«, tönte Miss Wilson, die Direktorin, obwohl sie und alle anderen Lehrkräfte nur zu gut wussten, wenn erst die Mehrzahl der Muslime, Hindus und Parsen ihre Kinder von der Darbietung abzog, würden etliche Kinder unbeschäftigt sein.
Die unauffällige Elly landete natürlich im Chor, wo sie in der letzten Reihe versauert wäre, hätte Sarah nicht plötzlich gemerkt, dass sie direkt vor ihrer Nase den seltenen Fall einer Siebenjährigen hatte, die das absolute Gehör besaß.
Es war ein Freitag, das Ende einer besonders aufreibenden Woche. Ein Aushilfslehrer klappte mit Grippe zusammen, und Sarah war gezwungen, sich mit einer pampigen Gruppe gemischten Alters herumzuschlagen, die doppelt so groß war, wie sie erwartet hatte. Sie hatte die Klasse gerade in den Griff bekommen und begonnen, ›Away In A Manger‹ einzuüben, als eine kleine verstörte Präsenz an ihrer Seite auftauchte.
»Das tut meinen Ohren weh«, sagte Elly und zeigte auf die himmlische Bagage und dann auf die Klaviertastatur. »Es klingt nicht richtig«, sagte sie.
»Das ist ein Weihnachtslied«, sagte Sarah. »Wir lernen es ja gerade erst. Wir können nicht erwarten, dass alles gleich von Anfang an stimmt.«
»Trotzdem …«, flüsterte Elly. Sie erbleichte zu einem kränklichen Gelb und verdrehte den Saum ihres schmuddeligen Sweatshirts zu einer festen Wurst. Sarah hatte sie noch nie so aufgewühlt erlebt. Tatsächlich hatte Elly ihres Wissens noch nie Aufmerksamkeit beansprucht. Diesem Umstand, so verblüffend er war, musste wohl Rechnung getragen werden, allerdings ging dem himmlischen Mob gerade die Konzentration flöten.
»Na schön, Elly«, sagte sie besänftigend. »Geh jetzt zurück an deinen Platz, wir besprechen das später. Ja? Gut, Kinder, noch mal von vorn. Eins, zwei, drei: Away in a manger, no crib for a bed, the little Lord Jesus … ach herrje.«
Denn Elly, weit davon entfernt, an ihren Platz zu gehen, begann beim ersten Akkord zu würgen und kotzte beim zweiten direkt neben den Klavierschemel, gerade als Sarah bei ›little Lord Jesus‹ war. Elly wurde ins Krankenzimmer geschickt.
Sarah biss die Zähne zusammen, wischte die Sauerei auf und errang langsam wieder Kontrolle. Elly kehrte zurück.
»Mit ihren Ohren ist nichts«, sagte Mrs. Jefferies, die mitgekommen war. »Vielleicht lag es am Mittagessen, oder es ist die Grippe.«
Bis zum Ende der Stunde saß Elly so weit vom Klavier entfernt, wie es ging, hielt sich mit beiden Händen die Ohren zu und sang anscheinend vor sich hin.
»Sie wirkte nicht krank«, erklärte Sarah Miss Wilson später. »Sie sah einfach nur meschugge aus, schaukelte vor und zurück wie eine Irre in der Anstalt und machte eine Viertelstunde lang bloß la-la-la.«
»Gestörter Familienhintergrund«, sagte Miss Wilson, ohne aufzublicken. »Es gibt keinen Vater, soweit ich weiß.«
»Natürlich habe ich hinterher mit ihr gesprochen, aber das war wie der Versuch, Blut aus einem Stein zu quetschen. Ihr Kommunikationstalent lässt zu wünschen übrig. Nein, so wie ich es verstanden habe, ging es um das Singen …«
»Deshalb das ganze Trara«, blökte Mrs. Jefferies.
»Sie meint, irgendwas stimmt mit dem Klavier nicht.«
»Tja, da hat sie recht«, seufzte Miss Wilson. »Es ist ewig nicht mehr gestimmt worden. Vielleicht sollten wir so ein elektronisches Klavier beantragen. Die braucht man doch nicht zu stimmen, oder?«
»Immerhin scheint sie das regelrecht zu quälen«, beharrte Sarah. »Ich wünschte, ich müsste keinen Musikunterricht geben.« Sie konnte Klavier spielen, aber nicht gut. Sicher fühlte sie sich nur, solange sie keine schwarzen Tasten anschlagen musste. Und selbst dann machte sie noch reichlich Fehler.
»Hilft nichts«, sagte Miss Wilson bestimmt. »Sie sind die Einzige mit der nötigen Grundausbildung. Keine Sorge, Musik ist nicht so wichtig.«
Aber Elly war sie wichtig. Als Sarah sie fragte, stupste sie die H-Taste an, dann D und G und sagte, dass sie nicht richtig klangen. Ein G-Dur-Grundakkord, dachte Sarah. »Wie müssten sie denn klingen?«, fragte sie. Und Elly sang H, D und G, dann D, G, H, dann G, H, D. Dann sang sie C, D, E, F und G und zeigte aufs Klavier. Sarah spielte C, D, E, F, G, während Elly dazu sang. Elly und das Klavier kamen zu unterschiedlichen Ergebnissen, und Elly rümpfte die Nase, als habe ihr jemand etwas ganz übel Stinkendes hingehalten. Sarah hörte schon, dass die beiden Gs leicht unterschiedlich klangen, aber sie hätte nicht sagen können, welches stimmte.
Am Abend telefonierte sie mit einem Freund, der auf die Guildhall-Musikschule gegangen war und Jazz in Pubs spielte.
»Interessant«, sagte er. »Ich borg dir mal mein kleines Yamaha – das benutze ich praktisch nie.«
Zwei Tage später brachte Jimmy in der Mittagspause das kleine Yamaha vorbei, und Sarah rief Elly vom Pausenhof herein. Elly und das Yamaha stimmten überein. Elly strahlte. Elly und das Yamaha stimmten nicht mit dem Klavier überein. Elly schnitt eine Grimasse.
»Interessant«, sagte Jimmy. Er spielte eine einfache Melodie. Elly sang sie haargenau nach. Er spielte eine längere, kompliziertere, Elly sang sie ohne jede Mühe. Er begann eine Dur-Tonleiter. Elly beendete sie absolut tonrein. Er bat sie, die fehlenden Noten in Dur-, Moll- und verminderten Akkorden zu ergänzen, und sie grinste, als habe sie noch nie im Leben so viel Spaß gehabt. Er spielte ›Fine And Mellow‹, und sie stand an seiner Seite und beobachtete seine Hände mit Augen so groß wie Untertassen.
Dann war die Pause vorüber, und Jimmy ging. Aber das Yamaha blieb da, als unbefristete Leihgabe. »Sie hat das absolute Gehör«, sagte Jimmy, »und sie hat sämtliche Intervalle im Kopf, der kleine Glückspilz. Wo sie das wohl herhat? Sind ihre Eltern musikalisch?«
Sarah wusste es nicht.
»Also, solche Ohren wachsen nicht auf Bäumen«, sagte er. »Erst sieben Jahre alt? Jemand sollte sie fördern.«
»Na toll«, sagte Sarah. »Du hast sie doch gesehen. Was denkst du, wie viel Geld hat die Familie? Wie viel Interesse? Sie hat jeden Tag dieselben dreckigen Sachen an. Sie bräuchte gesundes Essen und ein vernünftiges Paar Schuhe, aber ich schätze, nicht mal dafür reicht es.«
Doch zu Beginn des neuen Schulhalbjahrs erschien Elly sauber gekleidet und mit neuen Sandalen. Sie kam im Schlepptau einer bulligen Sozialarbeiterin und einer pummeligen Frau mit Brille und dünnem Pferdeschwanz. Elly sah nicht glücklich aus.
»Wie geht es dir, Elly, Schätzchen?«, fragte Sarah besorgt. »Hattest du schöne Weihnachten?«
»Meine Mom ist weg«, flüsterte Elly.
»Ach herrje. Wo ist sie denn hin?«, fragte Sarah leichtfertig.
»In ein großes Haus«, sagte Elly und drehte an einem Knopf ihrer sauberen blauen Strickjacke. »Es hat überhaupt keine Türen, also kann sie nicht wiederkommen.«
Das waren die letzten Worte, die Elly für den Rest des Schulhalbjahres und die Hälfte des folgenden von sich gab. Das stille kleine Schmuddelkind mit dem absoluten Gehör wurde makellos reinlich und stumm. Und sie schien in ihren frisch gewaschenen Klamotten zu schrumpfen.
Es war nicht ungewöhnlich für ein Kind auf der All Saints Junior, ein Elternteil im Gefängnis zu haben. Sarah hätte ein Dutzend benennen können. Sie konnte auch noch eine Handvoll drauflegen, die vorübergehend in Pflege untergebracht waren. Was sie noch nie erlebt hatte, war, einem Kind dabei zuzusehen, wie es langsam verschwand.
»Normalerweise«, sagte sie zu Mrs. Jefferies, »werden sie doch verhaltensauffällig: Sie suchen Streit, sie weinen, sie nässen sich ein.«
»Es gibt solche und solche«, sagte Mrs. Jefferies. »Wenn Sie erst mal so viel Erfahrung haben wie ich, werden Sie sich glücklich schätzen.«
»Beschreibung«, sagte Miss Wilson, ohne aufzublicken.
»Es ist nicht so, dass sie nicht aufpasst«, erklärte Sarah. »Sie tut alles, was man von ihr verlangt, wenn man es verlangt. Aber, na ja, sogar ihre Zeichnungen und Bilder werden immer kleiner.«
»Verstörende Motive?«
»Nein. Wenn wir Porträts malen, malt sie Porträts. Malen wir Tiere, malt sie Tiere. Das ist nicht das Problem. Es wirkt eher, als ob sie schrumpft, und sie war schon immer recht klein für ihr Alter.«
»Ich nehme an, sie vermisst bloß ihre Mutter«, sagte Miss Wilson. »Aber ich rede mal mit der Sozialarbeiterin, wenn Sie wollen.«
»Welche ist denn Elly?«, fragte Mrs. Jefferies.
Wie soll man sie beschreiben?, dachte Sarah. Klein? Gemischter Herkunft? Scheu? Es gab keine besonderen Merkmale außer diesen Ohren. Selbst wenn Sarah sich fest vornahm: ›Heute muss ich mal Elly aus der Reserve locken‹, merkte sie am Ende des Tages, dass sie es vergessen hatte. Ihre Zeit und Aufmerksamkeit war vollauf von Kindern beansprucht, die darum kämpften.
Wenigstens wurde sie bisher nicht schikaniert: Die Tyrannen und Mobber bemerkten sie ebenfalls nicht. Die Unscheinbare war vollends unsichtbar geworden.
Doch eines Tages, als Sarah Pausenaufsicht hatte, sah sie Elly allein am Rand des Schulhofs herumstehen und in eins der Fenster lugen. Sie ging hin. Elly fuhr herum, begann sofort an ihrem Knopf zu drehen und machte ein Gesicht wie eine ertappte Verbrecherin.
»Was hast du denn, Elly?«
Schweigen.
Sarah lehnte sich an die Mauer, ganz lässig, falls Elly sich noch mehr abschottete, sobald sie sich beobachtet fühlte. Nach einer Weile wandte sich Elly wieder dem Fenster zu, und aus dem Augenwinkel sah Sarah, wie sich ein Finger vorreckte und etwas auf die beschlagene Scheibe malte. Blitzartig wandte sie den Kopf, und schnell wie ein flüchtender Vogel wischte Elly mit dem Ärmel über das Glas. Doch zuvor erblickte Sarah unbeholfen gekrakelte Buchstaben: YA MA.
»Oh Elly«, rief Sarah, entzückt von sich selbst. »Das Yamaha, du möchtest das Yamaha.«
Aber Elly hatte die Botschaft gelöscht und dann sich selbst, und der Platz vor dem Fenster war leer. Diesmal würde Sarah die Gelegenheit nicht verstreichen lassen. Sie stöberte Elly in irgendeinem anderen finsteren Winkel auf, nahm sie an die Hand und zog das Kind durch die Garderobe den Flur entlang bis zu dem kleinen fensterlosen Raum, in dem allerlei Gerätschaften aufbewahrt wurden. Sie setzte das Keyboard auf seinen Ständer, verkabelte es und schaltete es ein.
»So, bitte sehr«, sagte sie. »Du kannst bis zum Ende der Pause spielen.«
Elly stand da, sagte nichts, tat nichts, guckte dumm.
»Na los«, sagte Sarah und gab ihr einen kleinen Schubs. Dann, einer weiteren Eingebung folgend, verließ sie rasch den Raum und schloss die Tür hinter sich.
Eine Stunde später, mitten in Naturkunde, fiel Sarah auf, dass es diesmal einen sehr guten Grund dafür gab, Elly nicht zu bemerken: Elly war nicht im Klassenzimmer. Sie ließ die Kinder beim Abmalen von Blumen allein und ging zu dem kleinen Abstellraum. Dort stellte sie fest, dass das Mädchen das Keyboard von seinem Ständer gehievt hatte. Es befand sich jetzt auf dem Boden, und Elly hockte im Schneidersitz davor, tief über die Tasten gebeugt. Die Lautstärke war so runtergeregelt, dass Sarah kaum etwas hörte, aber Elly spielte dieselben Akkorde und Läufe, die Jimmy für sie gespielt hatte. Sie wirkte so konzentriert, so versunken, sie sah überhaupt nicht wie ein Kind aus. Im Grunde kam sich Sarah vor, als störte sie eine sehr kleine Erwachsene bei der Arbeit.
Irritiert sagte sie: »Ab in die Klasse, Elly, du bist schon viel zu lange hier.« Bestürzt sah sie die klaren, lebhaften braunen Augen sich verschleiern: Verunsicherung, Schuldgefühl, Furcht. Elly sprang auf, stolperte gegen einen Stuhl mit abgebrochener Lehne, stieß sich den Ellenbogen an einem kaputten Tisch und schlüpfte wortlos durch die offene Tür hinaus.
»YAMA«, murmelte Sarah und reimte es auf Lama.
Von da an bis zum Ende des Schuljahrs, in dem Elly noch in ihre Klasse ging, hatte Sarah in Bezug auf Elly ein besseres Gefühl. Sie fand, sie hatte ihr mit dem Abstellraum eine Zuflucht verschafft. Und wenn sie schon mit keinem Menschen sprach, kommunizierte Elly immerhin auf ihre seltsame Art mit dem Yama. Zwar erwies sich Musiktherapie nicht als die Zauberhand, die sie aus ihrem Schneckenhaus lockte und in die ruppige Welt der Schulbildung einpasste. Es bewahrte sie lediglich davor, noch weiter abzudriften.
In jedem Fall fand sie nach sechs Monaten zu ihrer schmuddeligen Erscheinung zurück, also war vermutlich ihre Mutter wieder daheim. Und auch wenn Elly immer eins der Kinder blieb, die sich nie aus freien Stücken melden, begann sie wieder zu sprechen. Und vielleicht bezahlte die Mutter ja doch irgendwen, der ihrer sonst so vernachlässigten kleinen Tochter Klavierunterricht gab, denn als die nächste Weihnachtsfeier vor der Tür stand, stellte Sarah zu ihrer gewaltigen Erleichterung fest, dass Elly ›Away In A Manger‹ und ›Once In Royal‹ besser spielen konnte als sie. Sie hockte mit ihrem geliebten Yama im Bühnenhintergrund auf dem Boden und begleitete den grausigen, atonalen Chor. Natürlich sah sie aus wie ein zwergenhaftes Häufchen alter Schmutzwäsche, aber sie hielt Sarah den Rücken frei, so dass die sich ums Einüben der Texte kümmern und auf Wesentliches konzentrieren konnte wie Engelsflügel basteln, Raufereien unterbinden und Wutanfälle beschwichtigen.
Nachtrag – Anm. von Amy – Laut Brewer’s Dictionary of Phrase and Fable ist in der hinduistischen Mythologie Yama der erste Sterbliche, ein Sohn der Sonne. Im Tibetischen Totenbuch heißt es, wer großes Pech hat, dem hackt Yama nach seinem Tod den Kopf ab, schlürft sein Hirn und trinkt sein Blut. Das ist wohl nicht relevant genug, um es einzuarbeiten?
Harold und die Martin – aus Amys Interviewmitschnitten für die Biografie
»Doch, ich denk, man könnte schon sagen, dass ich es war, der ihr den Weg gewiesen hat.« So erzählte es Harold Chapman. »In aller Ahnungslosigkeit natürlich.« Er war ein Mann mit Sinn für Gerechtigkeit und beanspruchte nur die Ehre, die ihm seiner Meinung nach wirklich zustand. Was, wie er fand, zum Grundinventar eines Pfandleihers gehörte, allerdings dürften ihm das die wenigsten seiner Kunden abnehmen. Und vermutlich würden sie genauso wenig glauben, dass er kein reicher Mann war. Aber als er vor zwei Jahren das Geschäft aufgab, war der einzige Interessent für die Übernahme seiner Räumlichkeiten an der Seven Sisters Road ein Wohlfahrtsladen mit befristetem Vertrag.
»Das ist keine Branche für junge Leute«, sagte er. »Außerdem will ja kein Mensch mehr was verpfänden. Verpfänden ist aus der Mode. Sie verscherbeln ihr Zeug lieber, und dann kaufen sie sich was Brandneues, wenn sie bei Kasse sind. Nee, die Bude war ein Ramschladen. Geldverleih läuft heutzutage ganz anders.«
Also ein Ramschladen – eine miese, staubige, vollgestellte Durchgangsstation im Leben Tausender von Gegenständen, zu schäbig zum Aufheben, aber noch zu gut für die Mülltonne. Darunter befand sich auch eine zerkratzte, leicht verzogene Martin-Gitarre.
»Das war angestoßene Ware – spottbillig«, erinnerte sich Harold, »aber sie konnte sie sich nicht leisten. Ich hab sie für sie von der Wand geholt. Sie war so ein Winzling, sie kam nicht ran. Keine Ahnung, warum ich mir überhaupt die Mühe gemacht habe, ehrlich. Müssen wohl diese großen braunen Augen gewesen sein.«
Es folgte eine komische Transaktion, die sich über drei Monate hinzog und für Elly sichtlich von enormer Bedeutung war.
»Ich hab kaum auf sie geachtet«, sagte Harold. »Um ehrlich zu sein, ich dachte, sie stiehlt mir die Zeit. Sie blieb fast eine Stunde im Laden, und sie hockte auf so einem marokkanischen Lederpuff, stimmte das blöde Ding und spielte so leise, dass ich kaum was hörte. Dann stand sie auf und kam zum Tresen. Sie sagt, sie will die Gitarre, aber sie hat das Geld nicht. Ob sie in Raten zahlen kann? ›Ich mach keine Abstottergeschäfte‹, sag ich. ›Dieses Instrument verlässt den Laden erst, wenn du den vollen Preis bezahlt hast.‹ Und ich nahm die Gitarre und hängte sie wieder an die Wand, wo sie nicht rankam. Und für mich war’s damit gelaufen.«
Aber für das schmuddelige kleine Kind mit den großen braunen Augen war es nicht gelaufen, wie Harold, unerbittlich hinter seinem verkramten Tresen, bald merkte. Sie stand da, einen Fuß verlegen um den anderen gewunden, und malträtierte den Reißverschluss ihrer verdreckten Bomberjacke.
»Was ist?«, sagte Harold schließlich.
»Was, wenn jemand anders sie will?«
»Dann kriegt er sie.« Harold musste fast lächeln. Soweit er sich entsinnen konnte, hing die Gitarre seit mehr als zwei Jahren an der Wand, und niemand hatte je das leiseste Interesse daran bekundet.
»Was, wenn ich jetzt was anzahle und drauf spare?«
»Wie viel?«
Das Kind durchforstete fünf Taschen und hielt ihm eine Handvoll klebriger Münzen hin.
»Du machst Witze«, sagte er und betrachtete die schmutzigen Hände, die benagten dreckigen Fingernägel.
Sie legte das Kleingeld auf den Tresen und begann es umständlich zu sortieren. Dabei murmelte sie vor sich hin: »Zwanzig und fünf und fünf und zwei, macht …«
»Zweiunddreißig«, sagte Harold. »Bist nicht gerade gut im Zählen, was? Ich weiß nicht. Was bringen sie euch bloß in der Schule bei? Oder eher, was bringen sie euch alles nicht bei?« Er wartete, während sie dreimal nachrechnete und zu drei höchst unterschiedlichen Ergebnissen kam. Dann sagte er: »Du hast da siebenundsechzig Pence. Siebenundsechzig, klar? Ist das alles? Nennst du das eine Anzahlung?«
Sie begann aufs Neue in ihren Taschen zu wühlen.
»Hör auf!«, rief er. »Ich halte das nicht aus, und ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Also gut, du hast gewonnen. Ich sag dir, wie wir’s machen: Du tust deine siebenundsechzig Pence in diese Keksdose hier, und ich heb sie für dich auf. Und wenn du mit den restlichen tausendvierhundertdreiunddreißig anrückst, gebe ich dir die Gitarre.«
»Tausendvier–?« Elly war sichtlich entgeistert.
»Pence«, sagte Harold ungeduldig. »Das sind noch vierzehn Pfund, dreiunddreißig Pence, macht mit diesen siebenundsechzig Pence fünfzehn Pfund, genau das, was die verdammte Gitarre kostet.«
»Ach.« Ein Lächeln purer Erleichterung verwandelte das bange kleine Gesicht. »Und Sie verkaufen sie niemandem sonst?«
»Ich verkauf sie niemandem sonst«, stimmte er feierlich zu. Lag es am Lächeln? Wie konnte ein kleines Kind so ernsthaft und zugleich so unfähig sein? Sie war ein hoffnungsloser Fall, dachte er. Und er rechnete fest damit, dass sie, sobald sie das nächste Mal Lust auf Süßigkeiten hatte, ankam und erklärte, sie habe es sich anders überlegt, und ob sie ihre siebenundsechzig Pence zurückhaben könnte.
Aber das nächste Mal kam sie mit einem breiten Lächeln und einer Fünfzig-Pence-Münze an.
»Hast du eine Bank ausgeraubt oder was?«
»Ein paar Autos gewaschen.«
»Wie viele Autos hast du denn gewaschen für fünfzig Pence? Drei? Du liebe Güte, das war ja vorauszusehen. Hör zu«, riet ihr Harold, »du forderst fünfzig Pence pro Auto, alles andere ist reine Sklavenausbeutung. Wenn du einen anständigen Job brauchst, frag beim Zeitschriftenladen drei Türen weiter. Vielleicht kannst du Zeitungen austragen.«
Elly fragte dort nach, wie er später erfuhr, wurde jedoch abgewiesen.
»Mein Mann wollte sie um keinen Preis nehmen«, erklärte ihm Mrs. Mulgreb. »Er sagt, sie kommt aus einer üblen Familie. Ich hab sie nie beim Klauen erwischt oder so, aber früher wollte sie öfters Zigaretten holen, und Sie wissen ja, wir dürfen keine Tabakwaren an Kinder verkaufen. Für ihre Mutter, sagte sie, aber das sagen sie doch alle. Und sie sieht so fürchterlich aus.«
Elly ihrerseits erzählte ihm nichts, obwohl er sie fast jede Woche sah. Meist kam sie am Samstagnachmittag und häufig beladen mit schweren Einkaufstüten. Als einmal eine Tüte aufplatzte, sah er, dass praktisch alles, was sie gekauft hatte, wegen abgelaufener Haltbarkeit heruntergesetzt war. Er fragte sich kurz, ob sie heimlich billiger einkaufte, um das so Gesparte in die Keksdose zu tun. Aber rückblickend glaubte er nicht, dass sie berechnend genug war für solche Manöver.
»Kaufst du immer für die ganze Familie ein?«, fragte er.
»Meine Mutter ist krank«, sagte sie und sah sofort ängstlich und beschämt aus.
So lief es immer, wie er feststellte. Nach ihrer Familie zu fragen löste prompt Panik und Verlegenheit aus. Also ließ er es bleiben. Was er an ihr mochte, war das große breite Grinsen. Nichts wischte es schneller aus ihrem Gesicht als persönliche Fragen.
Es war schon befremdlich, selbst für diese heruntergekommene Gegend, ein Kind zu erleben, das niemals etwas Neues besaß, das wirklich hart arbeitete und auf etwas Gebrauchtes sparte. Kindern wurde heutzutage so viel nachgeworfen, fand er – Sportschuhe, Fahrräder, Skates, Klamotten, Klamotten, Klamotten. Elly wirkte wie ein Flashback aus der Kindheit vor dem Zweiten Weltkrieg, als man nichts hatte und nichts erwartete. Wie alt war sie? Acht, neun? Er konnte das nicht gut einschätzen, schon gar nicht bei Mädchen. Die sahen doch jetzt alle so wohlgenährt und entwickelt aus. Als Harold klein war, hatte jedes zweite Kind Rachitis, und niemand hatte je von einem Burger gehört.
Fünf Pfund und achtundzwanzig Pence waren in der Dose, bevor Harold Elly wieder auf der Gitarre spielen ließ.
»Jetzt gehört sie dir zu über einem Drittel«, erklärte er ihr. »Du hast dir das Recht verdient.«
Es war ein Spätnachmittag im Frühling, Elly hockte in einer Ecke, und die letzten Sonnenstrahlen schienen auf ihr verfilztes Haar. Sie strich mit dem Daumen so sacht über die Saiten, dass Harold auf der anderen Seite des Ladens nichts hörte. Als ob die Gitarre mit ihr flüsterte und sie lauschte.
Harold mochte keine abwegigen Gedanken, weshalb er sich rasch korrigierte: Sie kann überhaupt nicht spielen, entschied er. Sie tut nur so. Er ging hinüber, und sofort richtete sie sich auf und hielt ihm die Gitarre hin.
»Nein«, sagte er. »Du kannst weitermachen. Es ist noch eine halbe Stunde, bis ich zumache.«
»Aber schauen Sie doch«, sagte sie. »Da ist was draufgeschrieben.«
Er schob sich die Lesebrille auf die Nase und nahm mit beiden Händen die Gitarre, und ja, auf den feminin gerundeten Flanken waren Worte in den dunkelbraunen Lack geritzt.
Er las laut vor: »Sun house muddy water? So ein Quatsch. Du hoffst wohl, das senkt den Wert.« Er war daran gewöhnt, dass Leute nach Mängeln suchten, um den Preis zu drücken. »Tja, junge Dame«, fuhr er fort, »da bist du aber schief gewickelt. Ich hab fünfzehn Pfund gesagt, und was ich sage, das meine ich auch, kein Vertun.«
»Ja, aber was bedeutet es?« Elly blickte ihn erwartungsvoll an, als wollte sie, dass er ihr ein Märchen vorlas.
»Ist bloß Spinnkram«, sagte er und beäugte den verkratzten Lack. »Sun house muddy water ist ja nicht mal ein richtiger Satz. Taj Mahal – das ist irgendwo in Indien, oder? Oh, warte mal, Eric Clapton. Von dem hab ich schon mal gehört. Er spielt doch …« Nun fiel der Groschen. »Buddy Guy«, las er weiter. »Jimi Hendrix – von dem hab ich auch mal gehört. Keith Richards, Bill Broonzy, Tal Farlow, Robert Johnson, Magic Slim, Ry Cooder. Die kenn ich alle nicht, aber ich denk mal, das sind die Namen von Musikern, und ich wette mit dir um ein Pfund, dass sie allesamt Gitarristen sind.«
Zufrieden mit seiner Schlussfolgerung reichte er ihr die Gitarre zurück und verzog sich hinter seinen Tresen. »Wahrscheinlich alle tot«, fügte er hinzu. »Genau das hast du da – einen Haufen tote Gitarristen.«
»Woher sollte ich denn Bescheid wissen?«, sagte er Jahre später. »Es war ein Who is Who der Größten, tot und lebendig. Die alte Martin hat wohl mal jemandem gehört, der große Träume hatte und sie alle draufkritzelte, wie ein Graffiti. Ich schätze, man könnte das Vandalismus nennen, aber für sie war es wie eine Fortbildung. Weil nämlich, nachdem sie das verdammte Ding erst abbezahlt hatte, sparte sie weiter ihre Pennys und spürte hartnäckig jedem einzelnen Namen auf der Klampfe nach. Sie stöberte nach den ollen Kassetten, auf Flohmärkten, bei Trödlern, sonst wo. Ich hab selbst ein paar davon für sie aufgetrieben – Chuck Berry und Bo Diddley.
Na, und ob ich sie noch oft sah, nachdem sie die Gitarre gekauft hatte. Es war ja diese Ecke, wo sie mit der Straßenmusik anfing – direkt vor meinem Laden. Ich hatte sie ganz gern. Sie war wohl gar nicht übel – für einen kleinen Mischling. Aber ich weiß nicht, was die Leute an Musik finden – ich selbst bin komplett unmusikalisch.
Aber die olle Martin – tja, wer hätte gedacht, dass sie bei der Auktion zu so einem Preis weggeht? Ein Händler aus Texas hat sie gekauft, wissen Sie. Ich hab ihn kennengelernt. Er bat mich, ihm die Echtheit schriftlich zu bestätigen. Hab ich auch gemacht, natürlich gegen Gebühr. ›Keine zweite ist wie diese‹, hab ich gesagt und ihm all die Namen gezeigt – Memphis Slim, T-Bone Walker.
›Oh, Namen wohnt ein Zauber inne‹, hat er zu mir gesagt. ›Dieses Instrument ist ein Stück Zeitgeschichte.‹
Ein Stück Zeitgeschichte! Würd mich wundern, wenn mich das Ding ursprünglich mehr als drei Pfund gekostet hat. Ich hab ja zu Elly nur fünfzehn gesagt, damit sie abhaut und mir nicht länger die Zeit stiehlt. Woher sollte ich denn wissen, dass sie so ein komisches Kind ist?«
Auszug aus einem Brief von Dr. S. L. Ralston, Royal College of Music – aus Amys Unterlagen
Sarahs Geschichte ist, unverblümt gesagt, offenkundig Unsinn. Wie alt war Elly damals – sechs, sieben Jahre? Meiner Erfahrung nach haben Kinder in diesem Alter nur ein ›absolutes Gehör‹, wenn man ihnen die Noten vorbetet und wenn es den Erwachsenen um sie herum wichtig ist. Ohne einen solchen Hintergrund dürfte sie kaum in der Lage gewesen sein, eine Tonfolge zu ergänzen oder fehlende Noten eines Moll-, Dur- oder verminderten Akkords zu benennen, weil sie schlicht gar nicht begreifen würde, was man von ihr erwartet.
Meiner Ansicht nach ist die einfachste Erklärung, sofern wir diese Legende wirklich für bare Münze nehmen wollen, dass das Kind sehr gut ausgebildet wurde. Ich räume ein, dass sie von Natur aus musikalisch gewesen sein mag, aber die hier beschriebenen Handlungen übersteigen die Möglichkeiten eines jungen Menschen ohne Übung bei weitem. Die Vorstellung, dass sie ohne jegliche Praxis einen Chor auf dem Klavier begleitet, ist indiskutabel.
Wesentlich plausibler ist der Verdacht, dass Sarah die Rolle aufbauscht, die sie bei der Genese des rohen, aber unstrittig vorhandenen Talents einer später berühmt gewordenen Person spielte. Denn das ist ein Phänomen, welches sich häufig beobachten lässt.
Dasselbe gilt vermutlich für Harold Chapman, wiewohl mir seine Darstellung deutlich glaubhafter vorkommt (auch wenn der Markt für Fanartikel sicherstellt, dass die Auktionshäuser überquellen von Instrumenten, die einst Jimi Hendrix oder John Lennon und anderen gehört haben sollen).
Auf jeden Fall finden sich in Anekdoten jede Menge Anhaltspunkte dafür, dass Popmusiker ohne besondere musikalische Ausbildung ihre Griffe lernen, indem sie Note für Note die Stücke derjenigen nachspielen, die sie bewundern. Ein mühsamer Prozess, aber durchaus effektiv, wie ich hörte. Mr. Chapman lässt sich nicht darüber aus, wie alt Elly damals war, aber wenn sie alt genug war, die Verantwortung für die Familieneinkäufe zu übernehmen, war sie vermutlich auch alt genug, um mit dieser Prozedur zu beginnen.
Ich habe keine Einwände gegen diese Darstellung, auch wenn ›unmusikalisch‹ und ›absolutes Gehör‹ hier im Grunde leere Phrasen sind, gegen die ich Widerspruch erheben würde.
Jesse Astoria, die Mutter – eine gute Handvoll Interviews aus Amys Mitschnitten
Rob: Ich glaube, Jesse kam aus einer ganz guten Familie – Griechen, verstehen Sie, ziemlich streng und so. Wir haben nie groß drüber gesprochen. Vielleicht hat sie in der Gruppentherapie mal was erzählt, aber da hauten alle ständig dieselben tragischen Geschichten raus, ich hab nie groß zugehört. Würden Sie auch nicht, wetten? Das ist nämlich die einzige Chance, die Reha zu überstehen: nicht zuhören.
Echt, ich hab mir anfangs für sie die Eier abgeschwärmt, aber man will doch mit einer, für die man schwärmt, kein Mitleid haben. Dann bekam ich raus, dass sie schwanger war, also hab ich direkt die Biege gemacht.
Nein, wer der Vater war, hat sie nie gesagt.
Aber ich hab noch gehört, und das ist wieder echt typisch, wo sie sie einquartiert haben, nachdem sie mit der Reha durch war. Wissen Sie, ihr Problem war doch Suff und Drogen, richtig? Na, und die haben sie einfach in eine Pension direkt überm White Horse Pub gesteckt. Geniale Unterbringung für eine Alksüchtige, oder? Unfassbar, alles scheiß Irre, diese Sozialarbeiter.
Renata: Sie war eine Verrückte. Sie behauptete, der Vater wäre Jimi Hendrix. Ja, ich weiß. Ich sagte zu ihr: ›Na, da dürftest du aber höllisch Probleme mit der Unterhaltsforderung kriegen, schließlich ist der Kerl seit Jahren tot.‹ Aber sie erklärte, es wäre die Seele von Jimi Hendrix gewesen, wiedergeboren als irgendwer anders. Ich hätte wohl nicht so laut lachen sollen, denn sie schnappte ein und hielt den Mund. Ehrlich, jetzt wünschte ich, ich hätte überhaupt nicht gelacht, denn zu gern säße ich heute hier und könnte Ihnen das große Geheimnis enthüllen, wer Elly Astorias Vater war. Ich wünschte, ich wüsste es, aber damals wollte ich es gar nicht wissen. Jesse war eine solche Spinnerin, und ich hab überhaupt nur mit ihr geredet, weil ihr Bett neben meinem stand. Und ihr Baby haben sie erst mal dabehalten, weil es so untergewichtig war. Wie meins auch. Aber nicht aus demselben Grund. Mein Nathan war ja ein Frühchen, wofür ich nichts konnte. Elly hingegen kam genau am Stichtag, war aber winzig klein, weil Jesse während der Schwangerschaft nicht auf sich achtgegeben hatte. Ich bin nach meiner Entlassung jeden Tag hingegangen, bis ich Nathan mit nach Hause nehmen durfte. Aber Jesse sah man niemals die kleine Elly besuchen. Und wenn doch, dann schwöre ich, dass sie betrunken war. Oder Schlimmeres. Nein, das war nicht die Sorte Frau, mit der ich Umgang haben wollte. Allerdings, wissen Sie, sie konnte sich sehr gewählt ausdrücken, deshalb hatte ich anfangs ja durchaus Hoffnung gehabt.
Helen: Jimi Hendrix? Was für ein gequirlter Scheiß! Das war doch einfach bloß Jesses Art zu sagen, kümmer dich um deinen eigenen Kram! Wieso gerade Jimi Hendrix? Na ja, vielleicht weil dieser Typ, von dem sie hoffte, es wär der Vater, eben so ein größenwahnsinniger Gitarrist war. Aber natürlich war er weder der Vater noch ein toller Gitarrist. Bloß ein armseliger Möchtegern, der sich einredete, fünf Sekunden Scheinwerferlicht wären der Beginn einer schillernden Karriere.
Yeah, also größenwahnsinnig war der auf jeden Fall. Vor ein paar Wochen hab ich ihn noch mal im Fernsehen gesehen – in dieser Doku über Eintagsfliegen der Popgeschichte. Schon traurig, was?
Sie wollte erst abtreiben, wissen Sie, aber mit den Drogen und allem verlor sie total die Peilung, und dann war es zu spät.
Ja, ich kannte sie ganz gut in meiner wilden Zeit. Wir hingen zusammen ab, zogen durch die Clubs, machten rum. Erst hatten wir bloß ein bisschen Spaß. Aber sie muss wohl eine Suchtpersönlichkeit gehabt haben oder so. Wenn man sich auslebt, muss man halt auch wissen, wann Schluss ist. Es darf nicht so weit gehen, dass es die gesamte Existenz bestimmt.
Das letzte Mal hab ich sie in Camden Market gesehen, und sie war einfach nur peinlich.
Fragen Sie doch mal Becky nach ihr. Sie hält angeblich immer noch Kontakt.
Max Bleek (aus Kassawah): Kann mich an keine Jesse Astoria erinnern. Jetzt nerv mich nicht, ja. Es gibt immer haufenweise Ladys um einen rum, wenn sie glauben, du bist auf dem Weg nach oben. Ich erinner mich an keine Namen. Außerdem mach ich jetzt Dub.
Becky: Ich weiß, das klingt jetzt schräge, aber irgendwie starb Jesse an dem Tag, an dem Elly geboren wurde. Davor gab es noch Hoffnung. Danach schrumpelte sie irgendwie ein und verlor allen Mut. Als könnte ihre gesamte Energie nur für ein Leben reichen, und das war nun Ellys.
Ich gebe Elly keine Schuld – man kann doch einem Baby nicht die Schuld an so was geben. Aber die hätten sie ihr gleich nach der Geburt wegnehmen sollen. Nur dann hätte Jesse noch eine Chance gehabt, irgendwie klarzukommen. Und für Elly wär es auch besser gewesen. Oh, ich weiß, sie war supertalentiert und wurde für eine Weile mächtig berühmt, aber war sie auch glücklich? Ich meine, denken Sie bloß an all diese Lügen, den ganzen Schwindel. Die ganze Ausbeutung und Manipulation. Musik ist so ein schmutziges Geschäft.
Schon komisch, ja, von uns dreien – Jesse, Helen und mir – war Jesse eindeutig die Draufgängerin. Immer zu allem bereit. Vielleicht war das das Problem. Ich glaube, es war meine Ängstlichkeit, die mich rettete: Ich hatte viel zu viel Schiss, um mir jede Droge einzupfeifen – bei der Hälfte wusste man nicht mal, was es überhaupt war. Leute drückten einem kommentarlos ein Päckchen oder ein paar Pillen in die Hand. Ich tat meist nur so, als ob ich das Zeug nahm. Aber Jesse, die schluckte einfach alles. Und das führte zu, na ja, ungeschütztem Verkehr. Kein Witz, so was.
Ach ja, so ist das mit der Freundschaft. Eine Frage des Zeitpunkts, schätze ich. Später stellt sich raus, man hatte gar nichts gemeinsam. Unsere wurde reichlich strapaziert, als Jesse schwanger wurde. Weil, na ja, ich fand, sie spielte ein gefährliches Spiel, und ich mochte die Leute nicht, mit denen sie abhing. Ich hatte mein Studium nur für ein Jahr unterbrochen, würde also ab Herbst wieder auf die Uni gehen. Das wollte ich mir nicht versauen. Trotzdem hab ich versucht, in Verbindung zu bleiben.
Nein, keine Ahnung, und ich glaube, Jesse wusste es selber nicht. Es gab damals auch noch keine bezahlbaren DNA-Tests. Aber es wär natürlich schon interessant, oder? Ob es nun ein Musiker war. Ich meine, das ganze Talent muss doch irgendwoher gekommen sein. Gibt es so was wie ein Musik-Gen?
Jesses Dad hat ihr dann das Haus gekauft, so viel weiß ich. Nachdem sie aus der Reha kam, bevor Elly geboren wurde. Er glaubte, sie wäre total clean. Witzig, er verleugnete sie, aber kaufte ihr trotzdem ein Haus. Ich weiß noch, wie Helen meinte: »Ich wünschte, mein Vater würde mich so verleugnen.« Ich wünschte, er hätte ihr was Besseres gekauft. Diese Bude war winzig und stockduster und echt deprimierend. Ich meine, wer kann schon ohne Licht leben? Und Jesse, das war das Schlimme, die ging vollends den Bach runter. Geschlagen.
Nein, ich meine nicht, dass jemand sie misshandelt hat, wobei, wer weiß. Ich will sagen, sie wirkte total gedemütigt, so wie ein geprügelter Hund. Irgendwas hat alles Leben aus ihr herausgesaugt. Ich hab das Baby nie gesehen. Es lag in einem Zimmer oben, und das Radio war sehr laut gestellt. Ich erinnere mich noch, dass Jesse meinte, Rockit Radio wär ein prima Babysitter.
Chandra: Es wundert mich nicht, dass niemand vom Sozialamt mit Ihnen reden will. Bei so was möchten doch alle nur noch in Deckung gehen.
Es tut mir leid, aber ich erinnere mich nicht besonders deutlich, und auch die Namen würden mir wohl kaum was sagen, wenn ich sie damals nicht in den Nachrichten gehört hätte. Ich hab keinen Zugang mehr zu den Unterlagen, natürlich nicht.
Ich war, glaube ich, zweimal dort. Ich war sehr jung und hätte von Rechts wegen noch Supervision gebraucht. Das war auch das Problem, weshalb ich schließlich gekündigt habe. Viel zu viel Verantwortung und keinerlei Anleitung und Unterstützung. Ich meine, wie sollte ich denn für das gesamte Amt den Karren aus dem Dreck ziehen? Wann immer was schiefläuft, müssen die jungen, unerfahrenen Mitarbeiter es ausbaden. Und die Leute, von denen sie allein und ohne Unterstützung da rausgejagt werden, kassieren den goldenen Handschlag. Ist das fair?
Schon, ja, das Haus war wohl ein kleiner Saustall, aber ich hatte wirklich schon Schlimmeres gesehen. Mrs. Astoria war eine genesende Suchtkranke, die brauchen nun mal Zeit, um sich wieder aufzurappeln. Das Baby war klein, wie unter den gegebenen Umständen zu erwarten, aber immerhin nicht im Risikobereich, also ging das wohl in Ordnung.
Um die Wahrheit zu sagen, von manchem, was ich erlebt habe, war ich dermaßen schockiert, also wenn es irgendwo keine Maden gab … ja, Maden – die haben mich wirklich fertiggemacht. Also wenn es keine gab, dann ging ich davon aus, dass die Betroffenen halbwegs zurechtkamen. Nein, in Mrs. Astorias Haus gab es keine Maden.
Amy findet ihr Thema
Im reifen Alter von fünfunddreißig saß Amy in Do-Lally’s Café, trank einen Latte und bemühte sich, die Samstagsrezension im Guardian zu lesen, als Ellys Song ›See Jesse Tomorrow‹ aus den Boxen tönte. Er war vom Album Too Blue Too. Zum ersten Mal gehört hatte sie ihn Jahre zuvor in einem leihweise überlassenen Cottage vor einem qualmenden Holzofen mit drei Freunden. Einer der Freunde hatte den Arm um ihre Schultern gelegt. Der kleine Raum war warm und duftete nach Kerzen, trotzdem zitterte sie, wegen der jungen Liebe und dem, was das Leben verspricht, wenn die Liebe jung ist. ›See Jesse Tomorrow‹ mit seiner schmerzhaft schönen Melodie schien ihr eine Million Morgen zu verheißen, an denen das so sehr Gewünschte in Erfüllung ging. Alles würde morgen geschehen. Alles war möglich. Eine herbeigesehnte Zukunft würde beginnen. Nichts war verhunzt, denn morgen war noch nicht angebrochen.
Jahre später ist morgen vorbei und beerdigt. Die frische Liebe frisch geschieden. Nun zittert Amy vor Bedauern. Die schmerzhaft schöne Melodie gemahnt an grenzenloses Scheitern. Ihre Augen glänzen von Tränen über all den Kummer vergeudeter Liebe, verhunzter Morgen.
Damals hatte sie ›See Jesse Tomorrow‹ für ein Liebeslied gehalten. Jesse war ein androgyner Name, und sie stellte sich vor, wie die Sängerin den ganzen Abend auf ihren neuen Liebsten wartete. Heute wussten alle, die es interessierte, dass der Song sich an die tote Mutter der Sängerin richtete und der Text von Vergangenem und Trennung handelte, nicht von Sehnsucht. Für Elly und Jesse würde es kein weiteres Morgen geben. Und Amy schniefte hinter ihrer Zeitung in dem Gefühl, dass auch ihr die Zukunft ausgegangen war.
Und doch keimte da ein hauchfeiner sachlicher Gedanke, der sie vor dem totalen Absturz in den Schmerz der Melodie bewahrte. Sie dachte: Wie konnte ich mich bei der Aussage dieses Liedes nur so täuschen? Wie konnte ich einen derartig mit Reue gespickten Song als Motto nehmen, um mich zu verlieben? War es, weil ich damals jung war und voller Hoffnung und beim Blick ins Wasser nur mein optimistisches Selbst erblickte? Oder war Elly einfach so eine Songschreiberin – alles voller Schall und Rauch und Spiegelungen?
Sie plumpste in den Song, als wäre sie unbedacht in einen Grubenschacht gestolpert, und tauchte drei Minuten und siebenundvierzig Sekunden später wieder auf, putzte sich die Nase, verfluchte die Macht mieser Musik. Es war der Beginn eines Projekts.
Schluss mit der lähmenden Gefühligkeit, die frischgebackene Biografin fand in einer unaufgeräumten Tasche einen Stift und einen langen Kassenbon. Auf der Rückseite begann sie mit einer Liste außergewöhnlicher Frauen ohne besondere Reihenfolge: Elly Astoria, PJ Harvey, Kate Bush, Suzanne Vega, Tori Amos, Patsy Cline, Patti Smith, Laura Nyro, Carol King, kd lang, Joni Mitchell …
Die Liste auf der anderen Seite des Papierstreifens begann mit Griech Nat Yog und führte Milchprodukte auf, dann Fleisch, Konserven, Backwaren, schließlich Obst und Gemüse. Das gewissenhafte Protokoll einer Frau, die eine leere Küche bestückt.
Wenn sich das hier als fruchtbares Projekt erweist, dachte Amy, dann stecke ich diesen Kassenbon zwischen zwei Glasscheiben, rahme ihn ein und hänge ihn mir über den Schreibtisch. Auf einer Seite Essen, auf der anderen Frauen, die dir das Herz brechen.
Ihr Herz war momentan noch zu wund, um mit Selbstironie und Frauenmusik fortzufahren. Stattdessen schlürfte sie ihren erkaltenden Latte und suchte in der Zeitung nach dem Kreuzworträtsel – simple Wörter statt unkontrollierbarer Gefühle.
Das Beutelbaby und die Band
»Das müsst ihr euch einfach ansehen«, sagte Briony.
»Es regnet«, wandte Finn ein. Sie kuschelte sich enger an Ayishas Hüfte.
»Was denn?«, fragte Ayisha. Finns Oberschenkel klebte an ihrem, Finns warmer Bieratem kitzelte sie am Hals, und sie sehnte sich nach frischer Luft. Sie rutschte auf der Bank ein paar Zentimeter weiter und packte Finns Hand: der Wunsch nach Abstand getarnt als Verbindlichkeit.
»Eine Straßenmusikantin«, sagte Briony. »Vielleicht genau das, was wir suchen.«
»Bei dem Wetter?«, sagte Finn. »Die muss doch irre oder verzweifelt sein. Ich will niemand Irres oder Verzweifeltes in meiner Band.«
»Meiner Band«, »Unserer Band«, sagten Briony und Ayisha gleichzeitig.
»Außerdem ist sie längst weg, bis wir da sind. Ihr kennt doch Straßenmusiker.« Finn löste ihre Hand aus Ayishas festem Griff und schlang ihr den Arm um den Hals. Ein paar Bauarbeiter am Nebentisch warfen sich Blicke zu und kicherten.
Ayisha seufzte. »Ich dachte, wir wollten mit dieser Freundin von Maddie reden?«
»Deren Kerl ist nach Sheffield gezogen.« Briony sah angewidert aus. »Überraschung, Überraschung: Sie geht mit.«
»Verfluchte Kerle«, »Männer«, sagten Finn und Ayisha gleichzeitig.
»Diese Straßenmusikerin könnte was Besonderes sein«, fuhr Briony fort. »Ich bin stehen geblieben und hab ihr zugehört. Sie brachte ›Babooshka‹ und diese Eurythmics-Nummer.«
»Welche?«
»Äh, ›Right By Your Side‹, aber es war gar nicht so sehr der Song, sondern was sie auf der Gitarre anstellt. Sie hat nicht einfach nur geschrammelt. Es wirkte mehr, als hätte sie da ein komplettes Arrangement, echt eindrucksvoll.« Briony schaute ihre beiden Freundinnen an: Ayisha, stark, dunkel und ernst; Finn, stark, blond und stur. Bass und Schlagzeug. Ein gutes Team, aber nur, wenn Finn nicht zu dick auftrug. Im Pub machte Finn gern auf Macker. Sie gab die Testosterongesteuerte und wurde besitzergreifend. Ayisha reagierte ablehnend auf Testosteron, ob nun männlich oder weiblich.
Briony zog sich ihren feuchten Poncho fest um die Schultern und sagte: »Ich geh hin und rede mit der Kleinen.«
»Wir warten hier«, sagte Finn und umschlang Ayishas Hals noch fester.
»Ich komme mit«, sagte Ayisha und flüchtete.
»Aber …«
»Bin gleich zurück. Ist doch nicht weit, oder, Bri?«
»Zwei Minuten die Straße runter.«
»Pass auf die Drinks auf. Wir brauchen nicht lange.« Ayisha heftete sich an Brionys breiten Rücken und schlüpfte erleichtert in den nassen Abend hinaus.
Briony ging schnell für eine füllige Frau. Ihr Rocksaum schleifte durch Pfützen und klatschte gegen ihre Stiefel. Kupferfarbenes Haar quoll unter ihrer Kapuze hervor und wurde dunkel vom Regen. Ayisha lief neben ihr her wie eine Tochter – jünger, fitter und doch in Hetze, um Schritt zu halten.
Als sie auf die Straßenmusikantin stießen, stand sie fast unsichtbar in einer Toreinfahrt. Sie sang: »The beast in me has had to learn to live with pain …«
Die beiden Frauen blieben an einem Laternenmast stehen. Ein Pärchen eilte vorbei, hielt inne.
»… And how to shelter from the rain …«, sang die Straßenmusikerin weiter, heiser und ein bisschen nasal. Der Mann grub in seiner Tasche und warf eine Münze in den Gitarrenkoffer. Ayisha lächelte, bezaubert.
»… And in the twinkling of an eye …«, sang die Musikerin mit einem Kratzen in der Kehle. Das Paar zog weiter. Der Mann lächelte.
»… Might have to be restrained …«, sang die Straßenmusikerin.
»God help the beast in me«, sang Briony in zweiter Stimme mit der Straßenmusikantin mit. Auch eine Möglichkeit, sich vorzustellen, dachte Ayisha. Sie lehnte sich an den Laternenmast, während Briony vortrat. Die Straßenmusikerin nieste und hörte auf zu spielen.
»Wir wollten dich nicht unterbrechen«, sagte Briony. »Wo hast du denn so spielen gelernt?«
Die Straßenmusikantin nieste noch vier Mal und wischte sich die Nase an ihrem ohnehin schon nassen Ärmel ab.
»Komm mit und trink was mit uns«, sagte Briony. »Ich glaub kaum, dass du heute Abend besonders viel einnimmst.«
»Kino«, sagte die Musikerin und nieste erneut.
»Entlässt die Zuschauer frühestens in einer halben Stunde. Außerdem bist du nass bis auf die Haut. Bei so einem Wetter solltest du nicht mit einer Erkältung rausgehen. Du brauchst was Warmes. Deiner Stimme zuliebe.«