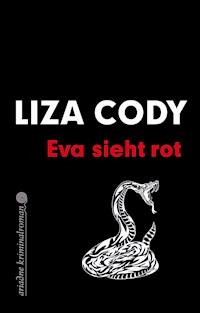12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Deutscher Krimi Preis 2017 Platz 4 der KrimiBestenliste, Februar 2017. Platz 2 der KrimiBestenliste, Januar 2017. Platz 4 der KrimiZEIT-Bestenliste: die besten Krimis des Jahres 2016. Platz 1 der KrimiZEIT-Bestenliste, Dezember 2016. Presse (Auswahl) »Liza Codys meisterlicher Krimi ›Miss Terry‹ ist ein Lehrstück über alltäglichen Rassismus – ein Buch der Stunde.« Sandra Kegel, FAZ »›Miss Terry‹ ist ein großes Buch. Wieder eigentlich kein Krimi, sondern das Ergebnis des haarfeinen, gewohnt präzisen Gesellschaftsmikroskopierens von Liza Cody. Das ist lustig. Und böse. So aktuell kann ein Kriminalroman sein.« Elmar Krekeler, DIE WELT, Krimi der Woche »Ein Krimi, der die Diskriminierung fremd aussehender Menschen thematisiert, aber auch die frauenfeindlichen Traditionen anderer Kulturen.« HR Info »›Miss Terry‹ liefert nicht nur Spannung, sondern auch wie nebenbei eine sozialkritische Bestandsaufnahme des (Miss-)Verhältnisses, in dem die einstmals offene Weltfahrer-Gesellschaft England und ihre Zuwanderer stehen.« Edina Picco, CrimeMag »Mit ihrem Krimi ›Miss Terry‹, der schon 2012 in England veröffentlich und erst jetzt ins deutsche übersetzt wurde, trifft die Autorin Liza Cody mitten ins Schwarze.« Nordwestradio »›Miss Terry‹ zeigt ein buntes Ensemble aus authentisch-britischen Unterschichtscharakteren und ›anderen‹ liebenswerten Randschicksalen.« Der Freitag »Sozialkritisch, aktuell und aufwühlend – mit einem Kriminalfall garniert. Absolut lesenswert.« Die dunklen Felle Das Buch Ein Reihenhaus nah am Fluss, mitten in der Stadt. Eine ruhige kleine Straße. Für Nita Tehri scheint es gut zu laufen: Sie hat Arbeit, eine hübsche Wohnung und einen sorgsam geregelten Tagesablauf. Sicher, sie sieht ein bisschen anders aus als ihre Nachbarn. Aber das ist kein Problem. Bis eines schönen Wintertags in der Guscott Road ein Müllcontainer aufgestellt wird … Die englische Grundschullehrerin Nita Tehri sucht keinen Streit, ist freundlich zu Nachbarn und Kolleginnen, buchstabiert geduldig ihren Namen, wenn man sie Miss Terry nennt. Eines Morgens wird ihrem Haus gegenüber ein Container abgestellt, gedacht für den Bauschutt einer Sanierung. Und plötzlich beginnt eine Hetzkampagne, für die Nita nicht gewappnet ist. Schließlich muss sie sich fragen: Wem nützt es, sie zum Opfer zu machen? Wer hat hier wirklich Dreck am Stecken?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über das Buch
Ein Reihenhaus nah am Fluss, mitten in der Stadt. Eine ruhige kleine Straße. Für Nita Tehri scheint es gut zu laufen: Sie hat Arbeit, eine hübsche Wohnung und einen sorgsam geregelten Tagesablauf. Sicher, sie sieht ein bisschen anders aus als ihre Nachbarn. Aber das ist kein Problem. Bis eines schönen Wintertags in der Guscott Road ein Müllcontainer aufgestellt wird …
Die englische Grundschullehrerin Nita Tehri sucht keinen Streit, ist freundlich zu Nachbarn und Kolleginnen, buchstabiert geduldig ihren Namen, wenn man sie Miss Terry nennt. Eines Morgens wird ihrem Haus gegenüber ein Container abgestellt, gedacht für den Bauschutt einer Sanierung. Und plötzlich beginnt eine Hetzkampagne, für die Nita nicht gewappnet ist. Schließlich muss sie sich fragen: Wem nützt es, sie zum Opfer zu machen? Wer hat hier wirklich Dreck am Stecken?
Über die Autorin
Liza Cody
Miss Terry
Deutsch von Grundmann & Laudan
Impressum
eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2016
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
www.culturbooks.de
Alle Rechte vorbehalten
Originaltitel: Miss Terry © 2012 by Liza Cody
Printausgabe: © Argument Verlag 2016
Umschlaggestaltung: Magdalena Gadaj
eBook-Herstellung: CulturBooks
Erscheinungsdatum: Oktober 2016
ISBN 9-783-959880-63-3
Vorbemerkung
Wie wird man eigentlich zum Opfer?
Ach, das ist nicht weiter schwierig. Manchmal reicht schon die Hautfarbe, oder das Geschlecht. Das ist natürlich nicht lustig, genauso wenig wie der Umstand, dass diese Zuspitzung sich gerade derzeit (und keineswegs nur in England) als bitter wahr erweist. Dünkel, Bosheit und Korruptheit verschanzen sich in altehrwürdigen Traditionen und hippen Glücksversprechen – und nisten aller Aufklärung zum Trotz auf beiden Seiten der Kämpfe, die um Kultur geführt werden. Die Konfrontation der Redlichkeit mit dem ganz normalen Gemisch aus Dummheit, Gier und Vorurteil geht in den seltensten Fällen gut aus.
Nur Liza Cody bringt es fertig, aus dieser Konfrontation einen Kriminalroman mit kabarettistischen Qualitäten zu machen. Die Wärme ihrer immer ein bisschen durchgeknallten Figuren, die mir allesamt aus dem realen Leben irgendwie vertraut sind, versüßt den Blick in den Abgrund sozialer Beschränktheit. Und ihre Erzählkunst zaubert aus dunkler Wahrheit ein böses, verschmitztes Genre-Märchen.
Und wenn sie nicht gestorben sind … Aber lesen Sie selbst.
Else Laudan
1 Die reizende Nita
Könnten wir Nita Tehri beim Schlafen zusehen, wir bekämen vermutlich einen ganz falschen Eindruck. Sie sieht zerzaust und lieblich aus, eine unabhängige moderne Frau allein in ihrem Doppelbett, in der Wohnung, die ihr gehört. Ihr Haar fächert sich übers Kopfkissen wie eine geöffnete Krähenschwinge. Ihr Mund ist weich vom Träumen, fast lächelt sie. Ihr entspannter Arm ist bis zum Ellbogen nackt, der Ärmel ihres Snoopy-Schlafanzugs hochgerutscht. Mit der eingerollten Hand vorm Gesicht wirkt sie beinahe jung genug, um noch am Daumen zu lutschen.
Aber manchmal erlaubt sich das Schicksal, lächelnden jungen Frauen Streiche zu spielen, und eines Morgens, es war noch dunkel, lieferte die Firma Galloway einen Bauschuttcontainer an und stellte ihn vor Nummer 15 auf, Nita fast gegenüber. Er war außen rot und verbeult, innen schwarz vor Alter und Rost. Er blieb nur dreieinhalb Minuten leer. Dann warf Harris Searle, auf dem Heimweg von der Nachtschicht im Krankenhaus, das Einwickelpapier seines Frühstücksburgers hinein, statt es zu Hause in seinem eigenen Mülleimer zu entsorgen.
Um halb acht tauchten in einem weißen Lieferwagen Handwerker auf, machten es sich bequem, tranken Kaffee und aßen Stullen, bis der Hauseigentümer eintraf, um sie in Nummer 15 einzulassen. Auch sie warfen ihren Abfall in den Container, was allerdings legitim war, da Bret West, der neue Eigentümer, ihn bestellt hatte.
An diesem Morgen trübte der Baulärm von Nummer 15 die Lebensqualität sämtlicher Anwohner am oberen Ende der Guscott Road. An der Ecke vor dem Frauenhaus gesellte sich Jen Brown zu Nita und sagte: »Die haben grad erst angefangen, aber der Krach macht mich jetzt schon verrückt – die nehmen wohl die ganze Bude auseinander.«
Mit kalten Fingern zupfte Nita an ihrem ordentlichen Haar, gebändigt von Haarband und Spange. »Baufirmen sind so. Kümmern sich keinen Deut um die Nachbarschaft. Aber ich bin ganz froh, dass der junge Kauz mit den blauen Haaren weg ist. Der gaffte immer so.«
»Sie hätten ihm ja mal was zum Angaffen bieten können.« Jen, ihrerseits zum Angaffen bekleidet mit schwarzen hohen Stiefeln und kurzem Rock, machte keine Zugeständnisse ans kalte Wetter, abgesehen von einem flauschigen rosa Schal. »Wenn man mich fragt, war sein Vater der spinnerte Kauz. Ständig hat er diese dreckige alte Leinentasche mit sich rumgeschleppt. Und sein Auto – also die Jungs im Erdgeschoss mussten glatt handgreiflich werden, damit er die Rostlaube nicht immer vor der Tür parkt.«
»Wie bitte?« Nita war entsetzt.
Jen warf blondes Haar zurück. »Sie haben ihm bloß die Scheibenwischer abgeknickt und vielleicht den ollen Außenspiegel. Sie konnten diesen Schrott vor ihrer Haustür einfach nicht mehr ertragen.«
»Ist mir ganz neu, dass die so pingelig sind. Wenn es ans Müllrausstellen geht, nehmen sie es längst nicht so genau, oder?«
»Müll ist bloß Müll«, erklärte Jen. »Aber sein Auto muss man in Ehren halten. Craig kommt zu spät in den Kindergarten. Also, Tüdelü und bis bald.«
Sie stöckelte los und Nita sah ihr nach – eine Nachtschwärmerin mit Kinderkarre. Jetzt war sie selbst spät dran und rannte zur Bushaltestelle.
Abends auf dem Heimweg warf sie einen Blick in den Container. Neben einem Berg aus Putz und verrotteten Holzbohlen befanden sich darin drei Zimmertüren und ein vertrockneter brauner Weihnachtsbaum. Es war Mitte Februar, und Nita fragte sich, wieso der Kauz mit den blauen Haaren und sein Vater ihren Baum so lange aufgehoben hatten.
Später, als Nita aus dem Fenster ihrer Dachwohnung den Halbmond und die menschenleere Straße anschaute, sah sie, dass eine der Zimmertüren verschwunden war, ihren Platz hatten zwei schwarze Abfallsäcke und ein zweiter Weihnachtsbaum eingenommen. Ein matter Gedanke an den ewigen Kreislauf des Mülls zog vorbei wie eine Schleierwolke vor dem Mond. Sie ging wieder ins Bett.
Am Morgen kaute sie am Wohnzimmerfenster ihren Toast und bemerkte, dass jemand ein halbes Dutzend leere Pappkartons in den Container getan hatte, dafür fehlte eine weitere Zimmertür. Die Handwerker kamen, und einer von ihnen warf einen prall gefüllten schwarzen Müllsack hinein, bevor er in Nummer 15 verschwand. Der Lärm begann, und Nita ging zur Arbeit.
An der Bushaltestelle traf sie Stu und Diane. Diane sagte: »Ich hab gehört, Nummer 15 wird komplett entkernt und in drei Wohneinheiten unterteilt. Studentenwohnungen. Man weiß ja, was passiert, wenn Studenten hier die Straße übernehmen, nicht? Da kann man auch gleich ausziehen. Ihnen gehört ja wohl Ihre Wohnung, richtig? Oh-oh, da rauschen sie den Bach runter, die Immobilienpreise.«
Stu sah auf die Uhr. »Verdammter Bus. Schon wieder zu spät. Diane, du musst denen noch mal eine Mail schicken.«
Nita sagte: »Die beiden, die unter mir wohnen, sind auch Studenten.«
»Medizinstudenten.« Diane zog die Nase kraus. »Schwule Medizinstudenten. Und selbst Eigentümer. Kann man sich bessere Nachbarn wünschen?«
In dieser Nacht stand Nita einsam und müde am Fenster und blickte hinab auf zwei verdreckte Öfen, die wirkten, als wären sie ganz ohne menschliches Zutun aufgetaucht. Warum sah sie eigentlich nie jemanden etwas hineinwerfen? Es war, als würde der Container seinen Inhalt von sich aus hervorbringen, ein riesiges rotes Eisenschwein, das unendlich abferkelte. Nitas müder Schädel produzierte das Bild einer monströsen modernen Fruchtbarkeitsgöttin, die unablässig Weihnachtsbäume, Türen und Öfen gebar.
Zwei Tage später wurde der überquellende Container gegen einen leeren ausgetauscht, und der Reigen begann von vorn.
Die Heimwege von Diane, Jen und Nita kreuzten sich vor dem Frauenhaus. Jen sagte: »Sie reißen jetzt in Nummer 15 die Wände raus. Ich hab säuische Kopfschmerzen. Mein Dave will schon nicht mehr zu Haus übernachten. Er sagt, er braucht seinen Schlaf. Er meint, unser Craigie schreckt mitten in der Nacht hoch, und dann kriegt er kein Auge mehr zu oder was auch immer. Mein Sexleben ist im Arsch, und an alldem ist nur Nummer 15 schuld. Ob ich den Bauherrn verklagen kann?«
Diane fragte: »Was machen eigentlich die Polizeiwagen in unserer Straße?«
»Da geht’s bestimmt wieder um die Blödmänner neben der alten Daphne«, erklärte Jen. »Letzten Sommer hat sie die Polizei gerufen, weil die Jungs ihr Dach als Party-Terrasse benutzten, die haben da nackig zu den Kaiser Chiefs getanzt und ihre Bierpullen in den Schornstein geschmissen. Die kann verdammt scheiß-kiebig werden, die Daphne.«
»Stu sagt, man darf nicht so viel fluchen vor dem Kind«, bemerkte Diane und schniefte hörbar. »Er nimmt das doch alles auf.«
»Stu kann mich mal am Arsch lecken«, verkündete Jen, »und du kannst dich selbst ficken.« Sie stürmte mit solchem Tempo davon, dass Craig lautstark zu protestieren begann.
Diane sah ihr erleichtert nach. »Ich wünschte, das Wohnungsamt würde sie irgendwo anders unterbringen. Sie wissen ja sicher, dass Dave nicht Craigs Vater ist?«
»Auf jeden Fall kümmert sie sich anständig um das Kind«, sagte Nita.
»Der Kleine ist doch den ganzen Tag in der Krippe, und sie kassiert Sozialhilfe, dabei arbeitet sie drüben in dem Billigmöbelhaus. Sie lebt von meinen Steuern. Ich überlege, ob ich sie anzeige.«
»Anzeigen, wen?«, fragte Harris Searle, der auf dem Weg zu seiner Schicht im Krankenhaus war. »Die Gelegenheit ist ja günstig, wo die Polizei hier gerade die Türen abklappert.«
»Was wollen sie denn?« Nita mochte Harris. Sie hatte noch nie groß mit ihm gesprochen, aber sie fand, dass er einen verlässlichen Eindruck machte.
»Da bin ich überfragt«, sagte Harris. »Als ich ging, sprachen sie gerade mit der alten Schrulle im Souterrain. Ich wollte mich nicht lange aufhalten. Ich war eh schon spät dran.« Schnell ging er weiter.
Diane sah ihm nach. »Er ist verheiratet«, sagte sie, »also schauen Sie ihn nicht so an.«
»Hab ich doch gar nicht.«
»Sie hat ihn verlassen, als der Hund gestorben ist. Daphne sagt, er ist immer noch verbittert, will aber keine Scheidung. Er mag Frauen nicht besonders.«
Nita hinterfragte weder Dianes Wissen noch ihre Meinung dazu. Sie selbst wohnte erst seit sechs Monaten in der Guscott Road. Es war eine Sackgasse, die am Fluss endete, und da es nur eine Fahrspur gab, mussten die Anwohner ständig aneinander vorbei, was ein trügerisches Gefühl von Vertrautheit mit sich brachte. Sie sagte: »Tja, ich mach mich dann besser mal auf den Weg.«
Aber Diane hatte es nicht eilig. »Sie sind doch Lehrerin, oder?«
»An der Midford-Grundschule.« Nita fühlte sich unbehaglich. Das ging ihr bei persönlichen Fragen immer so.
»Ja, man erzählt sich, dass Sie über die Ferien gar nichts zu tun haben. Tigs und Joe gehen auf Ihre Schule, stimmt’s? Diese lärmenden Blagen. Sie nennen Sie Miss Terry.«
»Tehri.« Nita buchstabierte es für sie.
»War ja klar, dass es so was Ausländisches sein muss. Also nichts für ungut. Haben Sie nicht ein bisschen Angst, dass die Polizei auch mit Ihnen sprechen will?«
»Nein. Wieso denn?«
»Ach, was weiß ich, Immigrantenprobleme, Terrorismus.« Ihre blassblauen Augen starrten Nita unschuldig an.
»Ich bin hier geboren«, sagte Nita geduldig. »Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich hab noch Hefte zu korrigieren.« Sie schritt auf ihren Hauseingang zu und nahm sich vor, Diane in Zukunft aus dem Weg zu gehen. Als sie am Container vorbeikam, bemerkte sie unter einem Berg von herausgerissenen Rigipsplatten und fünf Hängeschränken einen weiteren toten Weihnachtsbaum. Daneben wellten sich Stücke eines abgetretenen Treppenläufers voller undefinierbarer Kleckerflecken. Wie lange hatten der Kauz mit den blauen Haaren und sein Vater dort ohne Frau und Mutter gehaust? Für Nita raunten die toten Artefakte aus dem alten Haus von Verwahrlosung und Zerfall und davon, wie ohne eine sorgende Hand alles den Bach runterging. Sie selbst wäre ihrer ganzen Natur nach außerstande, mit einem dermaßen abgewetzten und versifften Teppich zu leben. Aber sie wusste auch, dass überall um sie herum Natur und Entropie unentwegt am Werk waren, die materielle Welt auseinandernahmen und zu Staub verarbeiteten. Sie schloss die Haustür auf und lief schnell nach oben in ihre frisch renovierte Eigentumswohnung.
Die Badezimmerfliesen blitzten vor Sauberkeit. Sie duschte und wusch sich den Verdruss des Tages aus dem Haar. Jetzt konnte sie die Abendnachrichten sehen, Essen machen und Schulhefte korrigieren, frisch und gefasst. Sauberkeit und Gefasstheit waren für Nita irgendwie untrennbar miteinander verbunden. Sie wusste nicht genau, woher das kam, machte aber wie so oft ihre Mutter dafür verantwortlich. Dafür, so schien es ihr, war ihre Mutter immer noch gut: schuld an allem zu sein, was Nita nicht recht verstand.
2 Man ermittelt
Es klingelte, als sie dabei war, Gemüse klein zu schneiden, der Reis köchelte schon. Eine Männerstimme fragte aus der Gegensprechanlage: »Miss Terry? Polizei, Constable Reed. Kann ich kurz auf ein paar Fragen raufkommen?«
»Tehri«, betonte Nita. »Können Sie sagen, worum es geht? Ich koche gerade.«
»Wir führen in Ihrer Nachbarschaft nur ein paar Ermittlungen durch«, sagte die metallische Stimme. »Es dauert nicht lange.«
Nita drückte auf den Summer und hörte die Tür unten im Haus auf- und wieder zugehen. Sie stellte sich an die Wohnungstür und legte die Sicherheitskette vor. Sie bezweifelte gar nicht, dass Constable Reed echt war. Sie wollte einfach nur klarstellen, dass sie vorsichtig war und sich nicht so leicht etwas vormachen ließ.
Er setzte sich auf ihr kleines Sofa, die langen Beine auf dem Wollteppich ausgestreckt, und wirkte so fehl am Platz wie ein Rasenmäher auf der Tanzfläche. Es saßen nicht oft Männer auf Nitas Sofa, außer den Jungs von unten, die nicht wirklich zählten. Sie war verunsichert und bot ihm Tee an. Sie hatte keine Ahnung, was für Benimmregeln gegenüber massigen, nicht eingeladenen Männern galten.
»Nein danke«, sagte er. »Sie haben von hier oben ja sehr gute Sicht auf die Straße. Wie steht’s denn mit dem Haus gegenüber – stört Sie der Lärm sehr?«
»Ich arbeite tagsüber. Und ich gehe früh aus dem Haus, also behelligt mich das nicht sonderlich.«
»Was ist mit dem Container? Der nimmt doch Parkplätze weg, nicht? Sie haben ja einen prima Blick darauf.«
»Ich habe kein Auto.«
»Im Ernst?«
»Ich bin Lehrerin«, führte Nita aus. »Ein Auto kann ich mir kaum leisten und brauche auch keins in einer Stadt wie dieser.«
Der Polizist guckte so verständnislos drein wie alle Männer, denen Automobile in die DNA eingraviert waren. Dann schüttelte er den Kopf und besann sich wieder auf sein Thema. »Aber ich schätze mal, Sie kriegen es mit, wenn Leute was in den Container werfen. Ich meine, Leute, die das nicht sollen?«
»Sie meinen illegale Abfallentsorgung?« Nita war es gewöhnt, dass Leute annahmen, sie sei nicht mit den richtigen Begriffen vertraut, aber es ödete sie an. »Sie sind doch sicher nicht wegen wilder Müllentsorgung hier?«
»Eigentlich nicht.« Constable Reed sah verlegen aus. »Ähm … jemand von Ihren Nachbarn erwähnte, Sie hätten in letzter Zeit einiges an Gewicht verloren.«
»Wie bitte? Wer hat Ihnen das gesagt? Was bitte geht Sie das an?« Sie erhob sich, die Hände in die Hüften gestemmt, als stünde sie vor einer Klasse achtjähriger Rüpel. Sah befriedigt, wie der Polizist rot wurde.
Er sagte: »Hören Sie, so läuft das in die falsche Richtung. Ich soll Sie doch bloß fragen, was Sie aus Ihrem Fenster erkennen konnten. Es heißt, Sie sind öfters gesehen worden, spätnachts, verstehen Sie, wie Sie rausgeguckt und die Straße beobachtet haben.«
»Ich schau mir den Mond an, und ansonsten kümmere ich mich um meine eigenen Angelegenheiten.« Nita war wütend. »Sie gehen jetzt besser, mein Reis brennt an.« Sie wandte sich ab und marschierte in die Küche. Der Reis war nicht angebrannt, aber gar, und sie nahm ihn vom Kochfeld. Ihre Hände zitterten. Noch nie hatte sie einen erwachsenen Mann zurechtgewiesen. Verinnerlichte kulturelle Altlasten, dachte sie. Und zum zweiten Mal an diesem Abend gab sie ihrer Mutter die Schuld.
Sie hörte ihre Wohnungstür ins Schloss fallen, hörte Reeds schwere Schritte auf der Treppe und merkte, dass sie den Atem angehalten hatte.
Schlimme Dinge widerfahren Frauen, die sich gegen große Männer auflehnen. Sie erschrak, wie automatisch ihr dieser Gedanke kam. »Ich bin Lehrerin«, sagte sie laut zu Küchenmesser und Schneidebrett. »Das ist ein achtbarer Beruf. Er kann nicht einfach in meine Wohnung hereinschneien und mir sonst was unterstellen.« Sie schnetzelte Chili, Ingwer, Pilze, Chinakohl und Koriander und versuchte sich zu beruhigen. Das Gemüse zischte im heißen Öl und duftete phantastisch, doch sie hatte keinen Hunger mehr. Trotzdem füllte sie einen Teller und trug ihn ins Wohnzimmer, in der Hoffnung, dass der Rest der Abendnachrichten ihr das Gefühl zurückbrachte, selbst über ihre Wirklichkeit zu bestimmen. Das Fernsehbild zeigte jedoch einen staubigen Ort, wo große Männer mit Turbanen wütend herumbrüllten und mit Gewehren in die Luft schossen.
Sie warf einen Blick aus dem Fenster und sah zwei Tauben auf dem Dach von Nummer 15. Ein Männchen stolzierte im Kreis um ein Weibchen herum, das reglos dasaß. Plötzlich hüpfte das Männchen auf den Rücken des Weibchens, presste es auf die Dachschindeln, spreizte die Flügel und flatterte triumphierend. Ein paar Sekunden, und das war’s. Er flog davon und ließ sie allein zurück, ein einsamer grauer Schatten auf traurigen grauen Schieferschindeln.
Sie stand auf und ließ die Jalousie runter. Hoffentlich hatte niemand von der anderen Straßenseite aus verfolgt, wie sie den Tauben zusah. Immerhin hatte irgendwer der Polizei schon zugetragen, dass sie nachts gern am Fenster stand. Wer beobachtete sie denn bloß? Warum wurde überhaupt über ihr Tun und Lassen spekuliert? Ihr kam Dianes Bemerkung über Terrorismus in den Sinn. Aber Diane wohnte auf derselben Straßenseite wie Nita und konnte sie folglich gar nicht sehen, wenn sie rausguckte. Und wen außer ihr selbst ging ihr Gewicht etwas an?
Nita trug ihren Teller in die Küche zurück. Sie spannte Folie darüber und schob ihn in den Kühlschrank. Vielleicht bekam sie später noch Hunger. Sie füllte den Kessel, um sich eine Tasse Tee zu machen. Es klingelte.
Ein Mann sagte: »Sergeant Cutler. Können wir kurz miteinander reden?«
»Worüber, Sergeant Cutler?« Nita bog den Hals, um die Verspannung in ihrem Nacken loszuwerden. »Ich habe eben erst mit Constable Reed gesprochen, und er war nicht gerade höflich.«
»Könnten Sie mich einlassen, Miss Terry? Möglicherweise lässt sich das mit einem kleinen Gespräch klären.«
Sergeant Cutler sah beinhart und müde aus. »Was dagegen, dass ich die Jalousie öffne? Ich würde gern mal hinausschauen.«
»Möchten Sie vielleicht auch die Möbel umstellen?«, entfuhr es Nita unüberlegt. »Hören Sie, warum sagen Sie mir nicht einfach, was Sie von mir wollen? Ich kann Ihnen nicht helfen, wenn Sie mir keine klaren Fragen stellen.«
»Was dagegen, dass ich die Jalousie öffne?« Sergeant Cutler klang wie ein Automat. Er wartete nicht auf ihre Erlaubnis, sondern zog die Jalousie hoch und spähte hinaus auf die rasch dunkler werdende Straße.
Nita wandte sich ab und marschierte in die Küche. Sie stellte den Kessel wieder an. Ihre Hände waren schwitzig. Sergeant Cutler folgte ihr. »Reed teilte mir mit, Sie hätten äußerst empfindlich reagiert.« Er sah zu, wie sie die Kanne vorwärmte und methodisch, Schritt für Schritt, einen anständigen Tee zubereitete.
»Für mich zwei Stück Zucker«, sagte er, als sie fertig war. »Und nur einen Tropfen Milch.«
»Wollen Sie mich auf die Schippe nehmen?«
»Vielleicht hatten wir keinen so guten Start.« Er strich mit groben Fingern über ihre cremefarbene Arbeitsplatte. Dann ergriff er das Küchenmesser und prüfte die Spitze. »Scharf.« Er leckte sich Blut vom Daumen.
Nita zog eine Schublade auf und stellte ihm eine Blechdose mit Pflastern hin. Jetzt, da sie die Farbe seines Blutes kannte, war sie ihm wohl eine Tasse Tee schuldig. Sie goss einen Becher voll, tat zwei Stück Zucker und einen Tropfen Milch hinein und reichte ihn ihm wortlos.
Er folgte ihr zurück ins Wohnzimmer und sah zu, wie sie die Jalousie wieder herunterließ. Sie setzte sich ihm gegenüber, fest entschlossen, ihn zu einer klaren Ansage zu nötigen, ehe sie sich vorauseilend zu irgendetwas äußerte.
»Wir möchten gern mehr über vorgestern Abend wissen«, sagte er schließlich.
Nita sagte nichts.
»Ich meine den Abend, bevor der Container zur Leerung abgeholt wurde.«
Nita schwieg.
Sergeant Cutler seufzte und fragte dann: »Als Sie an jenem Abend aus dem Fenster sahen, Miss Terry, haben Sie da jemanden gesehen, der versucht hat, irgendetwas unbemerkt in den Container zu tun?«
»Nein, habe ich nicht«, sagte Nita. »Warum?«
»Haben Sie versucht, unbemerkt etwas in den Container zu tun?«
»Nein, selbstverständlich nicht. Warum fragen Sie mich das? Was haben Sie denn gefunden?«
»Wer sagt, dass wir etwas gefunden haben?«
»Das schließe ich aus Ihren Fragen.«
»Lassen Sie das«, sagte Sergeant Cutler. »Antworten Sie einfach ehrlich auf die Fragen, dann können wir gut miteinander auskommen.«
»Schön.«
Sie legte die Hände ineinander und wartete auf die nächste Frage, aber Cutler stand auf und sagte: »Tja, das wäre erst mal alles. Sollte Ihnen noch etwas einfallen, was Sie mir besser gleich erzählt hätten, dann rufen Sie mich auf der Wache in der Wallace Street an.«
Er ging, und Nita begab sich in die Küche, um die Teebecher in den Geschirrspüler zu tun. Sie öffnete das Küchenfenster. Mit Sergeant Cutler darin hatte sich ihre Wohnung winzig, eng und stickig angefühlt. Sie atmete tief durch. Die Abendluft ließ sie frösteln, half aber nicht gegen das Bedürfnis nach mehr Platz. Sie nahm ihren warmen Mantel vom Haken im Flur und ging hinaus. Vor der Wohnungstür von Toby und Leo blieb sie stehen und horchte, aber es war kein Mucks zu hören. Manchmal gingen sie nach der Arbeit noch ins Sportcenter der Universität, um ihre Muskeln zu stählen und zu straffen, und kamen erst spätabends heim.
Vor der Haustür hielt sie inne und spähte nach rechts und links. Die Streifenwagen waren verschwunden. Sie erwog einen Spaziergang runter zum Fluss, vielleicht stieß sie ja dort auf Nachbarn aus der Guscott Road, die Lust auf ein Schwätzchen hatten. Sie hatte das Gefühl, dass sie hier niemanden gut genug kannte, um einfach bei ihm zu klingeln oder anzuklopfen. Diane und Jen waren reine Bushaltestellenbekanntschaften. Sie war noch nie bei ihnen zu Hause gewesen und keine von ihnen bei ihr. Daphne wohnte mit ihren beiden erwachsenen Söhnen zusammen, und Nita hatte öfters mit ihr über die Topfpflanzen gesprochen, die sie im Sommer vor dem Haus zog. Seit es kalt geworden war, hatte sie Daphne kaum noch gesehen, und die Pflanzen waren entweder eingegangen oder ins Haus geholt worden. Der alten Schrulle aus dem Souterrain bei Harris war sie überhaupt noch nie begegnet.
Nita wurde bewusst, dass sie in einer Straße mit dreißig Reihenhäusern kaum jemanden kannte. Keine Ahnung, wie sie in Erfahrung bringen sollte, ob die Polizei außer ihr noch jemanden so unhöflich und grob bedrängt hatte. War sie die Einzige? Oder wussten die Nachbarn vielleicht, was die Polizei eigentlich wollte? Das verdross Nita am meisten: wie beide Polizisten ihr stur vorenthalten hatten, was zu erfahren schließlich ihr gutes Recht war.
Sie wandte sich in Richtung Hauptstraße. In der Nähe war ein Pub namens The Green Man, in dem sie schon mal mit Toby und Leo gewesen war. Vielleicht saßen da drin ein paar Anwohner aus der Guscott Road und tauschten sich darüber aus, was die Polizei sie gefragt hatte. Sie konnte ganz zufällig dazustoßen, eine Runde ausgeben und in Erfahrung bringen, was sie wussten. Vor der Tür zum Pub zögerte sie kurz, dann eilte sie weiter, als habe sie das alles nie gedacht. Noch so eine kulturelle Altlast, wie sie leicht ungehalten feststellte. Sie betrat niemals allein einen Pub.
Nita tat so, als habe sie ein Ziel, und wanderte fast eine halbe Meile, bis sie vor dem 24-Stunden-Supermarkt landete. Sie ging hinein und kaufte eine Packung Schokoladenkekse. Das war nicht weiter schlimm, versicherte sie sich. Sie würde sie im Gehen essen und morgen früher aufstehen und zur Schule laufen, statt den Bus zu nehmen. Sie konnte sogar gleich loslegen, indem sie einen Umweg nach Hause nahm – über die Brücke und dann den langen Fußmarsch unten am Fluss entlang. Schokoladenkekse konnten ihr nichts anhaben, wenn sie zusammen mit der Sünde gleich die Sühne ableistete.
Zügig stapfte sie durch die kalte Nachtluft, fütterte sich mit behandschuhten Fingern, blies weißen Atem in die Dunkelheit und dachte über die gesunde Mahlzeit aus Reis und Gemüse nach, auf die sie so gar keinen Appetit hatte. Es gab offenbar Notfallsituationen im Leben, gegen die ausschließlich Schokolade half. Aber es wäre sicher gescheiter, wieder mit Yoga anzufangen oder sich eine Meditationsgruppe zu suchen, statt erneut einer alten Sucht zu huldigen.
Nita brauchte noch eine halbe Stunde für den Heimweg. Sie war stolz auf sich. Stolz auch darauf, die letzten beiden Kekse einem Abfallkorb übergeben zu haben. Sie bog nach links in die Guscott Road ein, kam am Container vorbei und sah eine Matratze – die war noch nicht da gewesen, als sie ging – auf einem weiteren Weihnachtsbaum liegen. Vor ihrem Haus parkte ein Toyota mit Vierradantrieb samt Fahrer, der ein ärmelloses T-Shirt trug, exotisch tätowiert war und offensichtlich schlief.
Im Haus brannte keinerlei Licht, folglich waren die Nachbarn unten noch nicht heimgekehrt. Sie schloss auf, betrat ihre schweigsame Wohnung und prüfte sowohl den Anrufbeantworter als auch den Computer auf Nachrichten. Es gab keine, also duschte sie, machte sich bettfertig und hoffte, dass ihr Marsch sie genug ermüdet hatte, um schnell zu schlafen.
* * *
Vielleicht war das, was sie weckte, irgendein Trunkenbold, der grölend aus dem Pub kam. Sie knipste die Nachttischlampe an und sah, dass es noch nicht einmal Mitternacht war. Sie stand auf, wie sie es immer tat, und trat ans Fenster. Der Mond war eine Nacht älter und trüber. Orangefarbene Straßenlampen wärmten die frostige Gegend. Sie hätte gern gewusst, ob der Mann im Toyota noch da war, aber es war zu kalt, um das Fenster aufzureißen. Ihr übermüdeter Verstand sagte ihr, dass er sicher ein Polizeispitzel war, der ihr nachspionierte. Falls er ihr Schlafzimmerfenster im Blick hatte, mochte er jetzt denken, sie wäre die Spionin, die ihn bespitzelte und nur darauf lauerte, dass er einschlief, um endlich ihre dunkelhäutige Bombe im Container zu deponieren und die Guscott Road in die Luft zu jagen. Er hatte sie durchschaut. Sie war aufgeflogen. Man hatte ihn gewarnt. Alle wussten es: Tagsüber gab sie die kreuzbrave Lehrerin für kleine Kinder und konnte kein Wässerlein trüben, doch des Nachts wurde sie zu etwas Wildem und Bösem, das man überwachen und im Zaum halten musste. Früher oder später würde man Präventivmaßnahmen ergreifen müssen. Doch ihre Schuld war ohnehin besiegelt, wenn erst herauskam, dass sie ganz vergessen hatte, die mit nach Hause gebrachten Schulhefte zu korrigieren.
Richter und Geschworene wären sicher beruhigt, könnten sie sie jetzt sehen, in ihrem viel zu großen Snoopy-Schlafanzug, wie sie vor Kälte gekrümmt in ihrem Arbeitszimmer hockte und pflichtbewusst das Richtige tat. Doch war das Buße genug, um die Götter gnädig zu stimmen, die Schlaf und Frieden verteilten? Unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen.
Bevor sie zurück ins Bett ging, warf Nita noch einen Blick aus dem Schlafzimmerfenster. Soweit sie sehen konnte, hatte am Altar der roten Containergöttin niemand weitere Opfergaben hinterlegt. Doch dann fing ein zuckendes Licht ihren Blick ein – da, auf der anderen Straßenseite, am Flussende der Sackgasse sah sie eine gegen die Kälte eingemummelte Gestalt von Tür zu Tür gehen und im Schein einer Taschenlampe die Namen neben den Klingeln studieren, sofern welche dranstanden. Jetzt wechselte die vermummte Gestalt die Straßenseite, und sie sah nichts mehr.
Auf dem Schild an ihrer Klingel stand schlicht und einfach eine 2. Niemand, der das las, konnte ahnen, dass sich hinter dieser unscheinbaren kleinen Zahl Nita Tehri verbarg. Niemand, es sei denn, er hätte mit der Polizei gesprochen oder mit den Nachbarn, die offenbar weit mehr über Nita wussten als Nita über sie. Mit mitternächtlicher Gewissheit folgerte sie, dass der Mann, der die Namensschilder inspizierte, der Polizeispitzel aus dem Toyota war. Sie ging ins Bad und drückte aus einer Blisterpackung eine Pille heraus. Sie schluckte sie mit Wasser aus ihrem Zahnputzbecher. Ersatzschlaf aus Plastik, mehr war heute Nacht nicht drin.
3 Unheimliche Einblicke
Früh am Morgen, der Frost schmückte noch die toten Weihnachtsbäume, verließ Nita das Haus, um zu Fuß zur Arbeit zu gehen. Kein Toyota weit und breit. Für Jen oder Diane war es noch zu früh, die Straße war wie ausgestorben. Trotz der Kälte tat es gut, im Freien zu sein und zu laufen. Das half den Schlafpillennebel lichten, der noch in ihrem Kopf waberte, und vertrieb das dumpfe Unbehagen der letzten Nacht.
Sie lief zügig und fühlte sich immer jünger und kräftiger, je weiter sie sich von zu Hause entfernte. Als sie schließlich die Schule erreichte, war sie sicher, die gestrige Schokoladensünde abgebüßt zu haben. Sie war früh dran – nur wenige Kinder und Eltern begrüßten sie, als sie die Glastür zur Eingangshalle aufdrückte. Auf dem Weg zur Lehrergarderobe kam ihr der stellvertretende Schulleiter entgegen. Er sah auf seine Armbanduhr und sagte dann: »Miss Terry, der Direktor bat mich, Ihnen auszurichten, dass er Sie in der ersten Pause in seinem Büro sprechen möchte. Er ist jetzt in einer Konferenz, deshalb übernehme ich heute die Anwesenheitskontrolle.«
»Ist gut«, sagte Nita. »Wissen Sie, worum es geht?«
»Ich würde mir nicht mal im Traum anmaßen, danach zu fragen.« Mit einem Stirnrunzeln eisiger Missbilligung wandte sich der Stellvertretende ab und ging nach draußen, um am Schultor Aufsicht zu führen.
Die ersten Stunden hätten in schönster Ruhe und Ordnung verlaufen können, wenn Ryan nicht gewesen wäre. Im Lehrerzimmer bezeichneten ihn alle außer Nita grundsätzlich als ›das Drecksgör‹. Er schikanierte andere Kinder und war eine Heulsuse und hatte, davon war Nita ziemlich überzeugt, eine Nahrungsmittelintoleranz, jedenfalls reagierte er extrem auf Zucker. Sie wusste immer, wann er Süßigkeiten und Brause zum Frühstück bekommen hatte. Und das schlimmste Frühstück bekam er vermutlich immer dann, wenn sein Vater mal zugegen war und seine Mutter zusammenstauchte.
Heute ging es damit los, dass er mit dem Bleistift auf Poppy einstach und Sams Gedicht über eine Schnecke zerriss – was ein Jammer war, denn es war ein sehr gutes Gedicht für einen Achtjährigen und enthielt dennoch keinerlei Hinweise auf elterlichen Beistand. Als Nita Ryan auf den Strafplatz für unartige Kinder zu setzen versuchte, trat er sie gegen den Knöchel und brüllte: »Mein Dad haut dich platt. Er macht batsch, batsch, batsch und bumst dich.« Ein unheimlicher Einblick in Ryans Familienleben, dachte sie, während sie sich abkämpfte, um ihn so sanft wie möglich von den anderen Kindern zu trennen.
Als die Pause begann, ging sie schnurstracks ins Büro des Direktors. Es war ein enger Raum mit einem Schreibtisch vor dem Fenster. Mr. Hughes saß stets mit dem Rücken zum Licht, so konnte er Nitas Gesicht sehen, sie aber nicht seins.
»Kommen Sie rein, kommen Sie rein«, dröhnte er. »Setzen Sie sich, setzen Sie sich.« Wie üblich legte er los, als hätte er zwanzig schwerhörige Kinder vor sich. »Also was soll das alles bedeuten, eine Polizeiermittlung? Ich sage: ›Doch nicht unsere Miss Tehri, Sie können unmöglich unsere liebe, junge Miss Tehri meinen?‹ Aber dieser Inspektor, oder was immer er ist, hat darauf beharrt.«
Ein plötzliches Rinnsal aus Schweiß kullerte von Nitas Rippen hinab zu ihrer Taille.
»Was um alles in der Welt wollen die denn?« Ihre Stimme zitterte, und sogar für ihre eigenen Ohren klang sie wie ein Kind aus ihrer Klasse.
»Um genau das zu erfahren, habe ich Sie hergebeten.«
»Anscheinend ist in der Straße, wo ich wohne, irgendetwas vorgefallen, aber sie sagen mir nicht, was los ist. Als ich gestern Abend nach Hause kam, haben sie Tür für Tür die Nachbarschaft abgeklappert. Ich glaube, sie haben so ziemlich alle befragt.«
»Ach, wirklich?« Mr. Hughes’ Augenbrauen zuckten skeptisch. »Also mir wurde eher der Eindruck vermittelt, dass es irgendwie um Einwanderungskontrollen geht.«
»Wie bitte?«
»Genau das habe ich ja auch gesagt, Miss Tehri. Aber man wollte wissen, ob ich je Ihren Pass und Ihre Geburtsurkunde gesehen habe, was natürlich völlig absurd ist. Alle, die mit Kindern arbeiten, werden selbstredend polizeilich überprüft, also müssten sie doch alle relevanten Angaben in ihren eigenen Akten verfügbar haben, statt mich mitten beim Abendbrot zu stören. Ich war wirklich alles andere als erbaut, wie Sie sich sicher vorstellen können.«
»Das tut mir leid«, sagte Nita.
»Sie hatten die Unverfrorenheit, mich zu fragen, ob Sie kürzlich geheiratet haben und ob jemand wie ich sich bei einer Hindu-Hochzeit eigentlich wohlfühlen würde. Sie haben doch nicht etwa geheiratet, ohne das Kollegium zu informieren, Miss Tehri? Die Polizei scheint zu denken, dass so etwas auch ohne Ihre Einwilligung geschehen könnte und dass Sie es womöglich deshalb nicht bekanntgeben möchten.«
»Ich versichere Ihnen, Mr. Hughes …«
»Es gab also keine heimliche Hochzeit? Ihnen ist hoffentlich klar, dass die Schulbehörde über jede Veränderung des Familienstands ihrer Mitarbeiter unterrichtet werden muss.«
»Ich verstehe überhaupt nicht …«
»Das ist bedauerlich, Miss Tehri. Ich hatte gehofft, Sie könnten mich aufklären.«
»Ich kann Ihnen versichern, dass ich nicht verheiratet worden bin. Aber ich verstehe nicht, was das die Polizei überhaupt angeht.«
»Ich ebenso wenig«, sagte Mr. Hughes und starrte Nita ausdruckslos an.
»War das ein gewisser Sergeant Cutler?« Nita gab sich große Mühe, nicht ängstlich zu klingen.
»An seinen Namen kann ich mich nicht erinnern. Aber das tut auch nichts zur Sache. Was mich beunruhigt, ist die Vorstellung, Sie könnten in irgendetwas verwickelt sein, was dem Ruf unserer Schule schadet.«
»Das bin ich eindeutig nicht«, beteuerte Nita und heuchelte Selbstsicherheit. »Ich schwöre es.«
»Also gibt es sonst nichts weiter, was Sie mir sagen wollen?«
»Doch, da ist noch etwas.« Sie setzte sich gerader hin und löste ihre verschränkten Arme. »Können wir nicht irgendetwas wegen Ryan unternehmen? Ich mache mir ernsthaft Sorgen um ihn.«
»Ich sollte wohl nochmals mit seiner Mutter reden«, sagte Mr. Hughes ohne das geringste Interesse. »Kann das nicht warten bis zum nächsten Elternabend? Dann könnten Sie selbst mit ihr sprechen.«
Auf dem Weg zum Lehrerzimmer stieß Nita auf Poppy, die weinend in einer Ecke hockte. »Der Ryan, Miss. Er will Sam mit dem Messer ein Auge ausstechen.«
»Das macht er schon nicht.« Nita nahm die Kleine an der Hand und führte sie in Richtung Schulhof.
»Aber er hat ein Messer«, sagte Poppy schluchzend. »Ich hab es gesehen.«
»Ach du meine Güte.« Nita rannte los.
* * *
»Wo hat das kleine Drecksgör bloß so ein Messer her?« Miss Whitby warf die Frage in den Raum. »Acht Jahre alt, und schon bewaffnet und gefährlich.« Sie war groß, blond und schön, und sie rauchte. Sie würde sich von Mr. Hughes keinerlei Unsinn bieten lassen, dachte Nita. Wäre Ryan in ihrer Klasse, so hätte sie Mr. Hughes gleich beim ersten Vorfall gezwungen, etwas zu unternehmen. Jetzt betrachtete Miss Whitby den mit Reis und pikantem Gemüse gefüllten Teller, den Nita aus der Lehrerzimmer-Mikrowelle nahm, und sagte: »Das sieht aber gut aus. Das Kantinenessen müffelt heute wie Mundgeruch.«
»Nehmen Sie sich doch etwas«, sagte Nita geschmeichelt. »Es ist viel zu viel für mich.« Sie teilte das Essen und reichte der Kollegin den Teller.
Der Stellvertretende sagte: »Nun muss Mr. Hughes Ryan wohl von der Schule verweisen. Unserem Ruf wird das gar nicht guttun.«
»Wäre es besser, wenn Ryan Sam mit dem Messer erstochen hätte?«, fragte Miss Whitby und probierte Nitas Essen. »Das ist ja köstlich, wirklich köstlich.«
»Manchen Lehrern gelingt es durchaus, ihre Klasse im Griff zu haben«, bemerkte der Stellvertretende.
»Das ist unfair«, sagte Miss Whitby mit vollem Mund. »Wir wissen alle, wie Ryan ist.«
»Ich habe bereits vier Mal um Unterstützung oder Eingreifen gebeten«, sagte Nita, ermutigt durch die Schützenhilfe von Miss Whitby. Normalerweise nahm Miss Whitby gerade genug Notiz von ihr, um ihr guten Morgen zu sagen. Trotz allem hatte sie das Gefühl, es könnte noch ein guter Tag werden. Vielleicht wurde Miss Whitby ihre Freundin, und ein bisschen von ihrem Selbstvertrauen mochte auf Nita abfärben. Ihr war klar, dass man ihr unterstellte, sie sei zu lasch. Was nicht stimmte, aber vielleicht verschaffte ihr ja eine große, schöne, selbstbewusste Freundin etwas mehr Glaubwürdigkeit.
Sie begann den Nachmittagsunterricht mit mehr Elan als üblich. Ryans Mutter kam ihn abholen, und nicht mal die wütenden Blicke, die sie auf sie abfeuerte, brachten Nita aus dem Konzept. Ohne Ryan ging die Klasse besser mit und war weniger abgelenkt.
Ihre gute Laune hielt sich, bis sie aus dem Bus stieg und Jen und Diane vor dem Schaufenster des Frauenhauses miteinander sprechen sah. Sie blickten auf, als sie über die Straße auf sie zukam. Ohne ein Wort drehten sich beide auf dem Absatz um und eilten davon. Mit einem flauen Gefühl lief Nita zu ihrem Haus und hätte fast den Polizeiwagen übersehen, der zwei Türen weiter geparkt war. Als sie ihn bemerkte, kehrte sie rasch um und lief zurück zur Straßenecke. Aber wohin jetzt? Hier gab es nichts, nur das Frauenhaus. Nita ging sehr selten in den dazugehörigen Laden, denn sie verabscheute den Geruch von ungewaschenen Secondhand-Klamotten. Aber die beiden alten Frauen, die dort arbeiteten, waren nett und freundlich und grüßten sie oft mit einem Lächeln oder Winken.
An diesem Nachmittag bemerkte die kleinere mit den weißen Locken: »Der Winter nimmt und nimmt kein Ende. Bestimmt wären Sie jetzt lieber wieder da, wo es warm ist.«
»Sie doch bestimmt auch«, antwortete Nita höflich.
Die kleine Frau sah verwirrt drein. »Was soll’s denn heute sein?«
»Ich schau mich nur mal um.« Nita tat, als wolle sie die Kleiderstange am Fenster durchsehen, um den Polizeiwagen im Blick zu behalten.
»Weiter hinten haben wir ein paar hübsche indische Stoffe.« Die kleine Frau verharrte hinter ihr.
»Ich brauch ein Jackett für die Arbeit.« Als sie zwischen den Plakaten hindurchlugte, die von innen am Fenster klebten, sah Nita, dass ein Stück vor dem Polizeiwagen der unheimliche weiße Toyota parkte, vor Nummer 21.
»Aber Sie sind ja dermaßen zierlich«, sagte die Frau, »Sie könnten glatt Kindergrößen tragen. Ich fürchte, so kleine Jacketts haben wir im Moment nicht auf Lager.«
Nita drehte sich um, sah sie direkt an und fragte: »Wissen Sie, was da los ist, warum die Polizei hier ist?«
»Also die sind gestern früh hier in den Laden gekommen und wollten wissen, ob wir spätabends noch gearbeitet haben, was wir nicht haben. Auf uns alle wartet eine Familie und ein Zuhause. Also was auch immer da passiert ist, es geschah nach halb sieben. Aber kennen Sie den Mann, der oben wohnt? Der immer auf und ab marschiert und äußerst laut Wagner hört, wenn ihm seine Medikamente ausgehen? Und der seine Rechnungen zerreißt und aus dem Fenster wirft? Also der kam um die Mittagszeit herein und wollte das Taschenbuch über den Krieg haben, das wir gerade ins Fenster gelegt hatten, und der sagte, sie haben im Keller von Nummer 15 Leichen ausgegraben. Er meint, Leichen von Leuten, die die Regierung nicht mochte. Aber ich nehme nicht alles für bare Münze, was er sagt, immerhin glaubt er, Hitler sei noch am Leben und halte sich bei bester Gesundheit im St. John’s-Seniorenwohnheim auf. Das ist gleich hier um die Ecke, nur ein paar Schritte von der Bushaltestelle entfernt. Er hält Hitler für einen verkannten Heiligen. Glaubt man das? Vielleicht sollten Sie sich mal bei den Kindersachen umschauen, obwohl Kinder ja selten Jacketts tragen.«
»Leichen ausgegraben?«
»Ich weiß, Liebes, das ist wirklich verrückt, nicht? Da drinnen gräbt doch niemand außer den Handwerkern. Versteh einer, wie der auf solche Ideen kommt.«
»Vielleicht denkt er, die liegen da schon seit dem Krieg«, sagte Nita. »Schade, dass Sie keine Jacketts haben, die mir passen. Auf Wiedersehen.«
Die alte Dame öffnete ihr die Tür und ließ sie hinaus. Im Davongehen fühlte Nita ihre Blicke wie Nadeln im Hinterkopf. Rasch drehte sie sich um und sah gerade noch, wie sich die Tür schloss, deshalb täuschte sie ein freundliches Abschiedswinken vor. Seltsam aufgeheitert schaute sie in den Container, als sie daran vorbeikam. Leichen, dachte sie, waren immerhin besser als Bomben. Angenommen, die Polizei hätte ein Päckchen Ammoniumnitrat oder Aluminiumpulver gefunden, und sie hätte das einzige verdächtige Gesicht in der Guscott Road?
Die Vorstellung, dass jeder ein Massenmörder sein konnte, aber nur sie eine Bombenbastlerin, amüsierte sie ein wenig. Sie malte sich aus, wie sie mit alchemistischer Besessenheit Ammoniumnitrat und Aluminiumpulver – die einzigen Zutaten, die ihr einfielen – in ihre kupferne Tajine warf, ein paar Molchsaugen und etwas Alraunwurzel hinzugab, das Ganze umrührte und es köcheln ließ, bis es so weit war, per Handy gezündet zu werden. Sie würde endlich allen Erwartungen gerecht werden und die ganze Guscott Road in die Luft jagen, mitsamt ihrem Haus, ihrer hart erkämpften Zuflucht, Privatsphäre und Unabhängigkeit.
Verrottete Fensterrahmen und Glasscherben bedeckten den neusten totgeborenen Weihnachtsbaum im Container. Nita schauderte beim Anblick eines dreckstarrenden gesprungenen Handwaschbeckens, bevor sie sich abwandte und in ihrem eigenen Haus verschwand. Diesmal setzte sie sich gleich an die Hausaufgaben ihrer Kinder. Eine Wiederholung der gestrigen Nachlässigkeit kam nicht in Frage, erst nach getaner Arbeit durfte das Wochenende beginnen. Nita fiel ein, dass sie das als Studentin genauso gehalten hatte. Manchmal schien es fast, als sei ihre Verwandlung von der Studentin zur Lehrerin noch nicht ganz abgeschlossen.
Erst als die sorgfältig korrigierten Hefte sicher in ihrer Tasche verstaut waren und die Tasche neben der Tür für Montagmorgen bereitstand, erlaubte sie sich, auf ihrem Anrufbeantworter und in ihrem Mailprogramm nach neuen Nachrichten zu sehen.
Ihr Bruder Ash rief immer nur an, wenn er wusste, dass sie nicht zu Hause war. E-Mails schickte er ihr grundsätzlich nicht, weil er fürchtete, ihr Vater könnte sie nachverfolgen. Heute Abend sagte seine aufgezeichnete Stimme: »Hallo, Niti, wollte dir nur kurz erzählen, dass Mina wieder schwanger ist. Dachte, das willst du wissen. Ma bereitet die nächste Reise übers dunkle Wasser vor. Kannst dir ja vorstellen …« Er brach ab und legte auf. Es gab nicht viel Privatsphäre im Haus der Familie Tehri, nicht mal für den Sohn. Und kaum Vergebung, wenn man es ohne Erlaubnis oder den Schutz der Ehe verließ.
Eine E-Mail bestätigte das ›freudige‹ Ereignis. Mina wirkte müde: Das war ihre vierte Schwangerschaft in fünf Jahren, plus Abtreibung eines weiblichen Fötus. Gelegentlich rief Mina zu nächtlicher Stunde an, und die Schwestern redeten darüber. Die Erinnerung brachte beide immer noch zum Weinen. Am Ende solcher Gespräche sagte Mina meistens: »Natürlich liebe ich meine Familie. Ich liebe sie alle, mit Haut und Haaren. Aber du, Nitaschatz, lass dich bloß nicht kleinkriegen. Sie werden schon noch irgendwann einlenken. Ganz bestimmt.«
Nita duschte, doch bevor sie dazu kam, sich die Haare zu trocknen, klopfte es an der Tür. Toby rief: »Niedliche Nita, lass mich ein. Ich muss mich vor Leo in Sicherheit bringen.« Er platzte herein, in den Armen eine Tasche voller knallbunt eingewickelter Päckchen, die mit rosa Schleifchen und glitzernden Sternchen verziert waren. »Dieser neugierige Kerl hat mein Versteck entdeckt. Nita, du musst das bitte bis zu seinem Geburtstag unter deinem Bett verwahren, sonst verdirbt er sich die ganze Überraschung. Er hat die Selbstbeherrschung eines Dreijährigen, wofür ich Gott normalerweise dankbar bin, aber um diese Jahreszeit könnte ich ihn immer umbringen.«
»Warum war das denn zu Weihnachten kein Problem?«, fragte Nita und schuf etwas Platz unten in ihrem Kleiderschrank.
»Zu viel Ablenkung. Er findet, Weihnachten ist für alle da, aber sein Geburtstag, da geht’s ausschließlich um ihn, ihn, ihn.« Toby verstaute alles fein säuberlich. »Du bist wirklich eine einzige Enttäuschung, wenn es um Schuhe geht. Wo sind die Highheels mit den gefährlichen Absätzen, wo die juwelenbesetzten Ballerinas? Darf ich dir die Haare bürsten? Sie sind so wunderschön, wenn sie trocknen. Versprich, dass du sie niemals abschneidest. Du solltest sie offen tragen, statt sie mit deinem eisernen Willen zu bändigen. Sie sind total exotisch.«
»Genau das fürchte ich ja.« Nita reichte ihm die Bürste. »Toby, was habt ihr nach Weihnachten mit eurem Baum angestellt?«
Toby bürstete mit langen, festen Strichen, als wäre sie ein Pferd und er der Stallbursche. »Na, wir haben ihn weggeworfen, ist doch klar.«
»In dem Container da drüben tauchen immer wieder diese toten Dinger auf, dabei ist Weihnachten schon ewig her.«
Toby hörte auf zu bürsten. »Hat die Polizei mit dir gesprochen?«
»Die waren so was von unverschämt. Ich wollte danach bei euch vorbeischauen, aber ihr wart nicht da.« Ihr Blick traf im Spiegel auf seinen. »Und sie haben den Schulleiter beim Abendessen gestört und über mich ausgefragt.«
»Mich haben sie nach der Visite abgepasst.« Er legte die Bürste weg. »Komm mit uns mit, wir gehen was trinken. Muntert dich mal ein bisschen auf.«
»Ich hab noch nichts gegessen.«
»Ooh, wolltest du etwa dieses feurige Hühnchengericht machen?«
»Es ist in einer halben Stunde fertig.«
»Ich sag’s Leo. Er liebt dein Hühnchen.«
Es machte keinerlei Mühe. Nita hatte jede Menge scharf gewürztes Huhn in der Tiefkühlung. Sie musste nur Reis kochen, was sie sowieso vorgehabt hatte. Jetzt würde sie Gesellschaft haben. Und sie hatte erfahren, dass Leo ihre Kochkunst liebte. Ohne Vorwarnung stiegen ihr Tränen in die Augen. Sie sagte: »Bringt euch Bier mit und seid pünktlich.«
»Jawohl, Miss«, rief Toby von der Tür her und flitzte die Treppe hinunter.
4 Das tote Baby
Sie aßen wie kleine Jungs – Ellbogen auf dem Tisch – und schauten kaum hoch, bis die Teller leergeputzt waren. Nita stand daneben und teilte auf Wunsch Nachschlag aus. Sie kam sich vor wie ihre Mutter, die nie mit der Familie am Tisch saß und doch dick und immer dicker wurde von all den Kostproben beim Kochen. Die beiden wirkten wie Brüder, hellhäutig mit braunem Schopf, adrett gekleidet, voller Eifer unter ihrer zynischen Attitüde.
Das ist so zeitgemäß, dachte Nita stolz, zwei schwule Jungs in meiner Küche, zwei Männer in meiner Küche. Ich koche für zwei Kerle, die nicht mit mir verwandt sind. Es ist ganz normal. Vielleicht ist das Kantinenessen im Krankenhaus wie das in der Schule und müffelt, wie Miss Whitby sagen würde, nach Mundgeruch. Dann bin ich eben nicht gut, sondern bloß besser als Kantinenkost.
»Das war himmlisch«, sagte Leo schließlich und sah mit leuchtenden Augen auf.
»Wir könnten im Wohnzimmer noch einen Tee oder Kaffee trinken«, schlug Nita vor. »Da ist es gemütlicher.«
Sie brühte sich Tee auf, und die Jungs trugen ihr Bier ins andere Zimmer. Der Wasserkessel brodelte, und sie hörte die beiden miteinander reden. Es war schöner, als wenn das Radio lief.
»Ich sag’s ihr«, verkündete Toby, als sie mit ihrem Becher hereinkam.
»Ich weiß nicht«, sagte Leo und nahm einen Schluck aus seiner Flasche.
»Sagst mir was?«, fragte Nita. Sie setzte sich ihnen gegenüber in den kleinen Sessel.
»Es geht darum, was die Polizei wissen wollte«, sagte Toby. »Sie haben verlangt, dass wir dichthalten.«
Leo sagte: »Sonst reiten wir uns nämlich direkt in die braune stinkende Masse.«
»Aber die Bullen machen uns kein leckeres feuriges Hühnchen, und sie wechseln sich auch nicht mit uns beim Flur- und Treppeputzen ab.«
»Allerdings«, sagte Leo, »ist das Ganze ziemlich schräg, und ich möchte nicht, dass du dich aufregst.«
»Himmel, nun kommt schon!«
»Also schön«, sagte Toby rasch, »Sergeant Cutler wollte Folgendes wissen: Wie lange wohnst du hier schon? Kennen wir deinen Mann? Und haben wir dir geholfen, das Baby zu kriegen?«
»Was?«