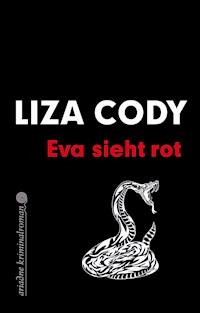Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Argument Verlag mit Ariadne
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ariadne
- Sprache: Deutsch
Band 1 der Eva-Wylie-Trilogie: »Ich bin nie krank, ich habe nie Kopfschmerzen,und wenn ich mich verletze, mache ich nicht schlapp. Kannst du das auch von dir sagen? Hä? Raus damit, was hättest du denn gemacht, wenn es dich quer über die Straße katapultiert hätte, mit einer Tür auf dem Latz?« Eva Wylie ist die Londoner Killerqueen: eine Profi - Catcherin mit Schandmaul und Dickschädel, die mit zwei bissigen Hunden auf einem Schrottplatz haust. Natürlich braucht sie ab und zu einen lukrativen Nebenjob. Und gerät dabei in Teufels Küche.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Liza Cody
Was sie nicht umbringt
Die Eva-Wylie-Trilogie
Band1
Aus dem Englischen
von Regina Rawlinson
Ariadne Kriminalroman 1201
Argument Verlag
Eva Wylie kam über mich wie eine Sturmflut. Fassungslos versank ich in den brachialen Kapriolen und hirnverbrannten Ratschlägen einer begriffsstutzigen Wuchtbrumme, deren Realität mit meiner herzlich wenig gemein hatte. In Evas Welt sind solche wie ich Spießer oder Feindinnen. Und sie legte mich im Handumdrehen aufs Kreuz.
2013 lauschte ich dem ohnmächtigen Zornausbruch einer schönen jungen Schriftstellerin über das aktuell kolportierte Frauenbild (wir saßen in einem Berliner Lokal mit Blick auf Bushaltestelle samt Werbetafel, ganz normal, laszive Brünette mit viel Haut). Mir wurde klar, dass Eva Wylie neu aufgelegt gehört. Ein Vierteljahrhundert zuvor betrachtete Liza Cody ein Poster des zähnefletschenden Wrestlingstars Klondyke Kate, daneben hing eine Lippenstiftreklame. In der Folge schuf sie Eva Wylie, über die sie sagt: »Eva ist keine vernünftige Frau. Sie ist ein Alptraum der Gesellschaft – was wird aus einem hässlichen, ungebildeten, wütenden, vernachlässigten Kind, wenn es zum großen, starken, hässlichen Weib heranwächst? Es ist knallhart, die Hässliche zu sein in einer Welt, die Frauen nach Jugend, Schönheit und Sexyness bewertet. Eva denkt, wenn sie denn mal denkt, dass sie ihren Nachteil in einen Vorteil verwandelt hat, indem sie beim Profi-Wrestling die Böse gibt. Sie ist verquer genug, um Buhrufe, Pfiffe und den wütenden Hass des Publikums als Erfolg zu verbuchen. Und ich bin verquer genug, darin ein feministisches Statement zu sehen.«
Anfang der 1990er, als Krimiautorinnen den harten Kerlen des Genres mit Verve ihre Männerdomänen streitig machten, wusste ich nichts vom Kunstgriff der »unzuverlässigen Erzählerin«. (Nebenbei: Eva würde jedem, der sie unzuverlässig nennt, die Fresse polieren.) Ich wusste nur, dies war rasante, knackig frische Genreliteratur voller Witz und Milieuschärfe, serviert durch eine schwitzende, trampelige Catcherin, die mir brutal ihre selbstgeschusterten Binsenweisheiten vor den Latz knallt. Ungeniert, ungestüm, unwiderstehlich. Die preiswürdige Übersetzung von Regina Rawlinson wird Evas Kodderschnauze ebenso gerecht wie dem trudelnden Beat des mit dem Silver Dagger gekürten Originals. So ist die Eva-Wylie-Trilogie: zeitlos, ungeschminkt, ein Meilenstein.
Else Laudan
Inhalt
Cover
Titel
Die Autorin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Weitere Bücher
Impressum
1
Im Gang brüllte sich ein kleiner Kerl die Lunge aus dem Hals. Sah richtig lieb aus mit seinem grauen Regenmantel und dem Schal. Die Schlägerkappe hing ihm übers Auge.
»Gemeines Kampfschwein!«, brüllte er.
Ich konnte ihn in dem Gegröle und Geschrei deutlich hören. Komisch, auf was für Ideen die Leute kommen.
»Halt die Schnauze!« Ich zeigte ihm den Stinkefinger.
Aus dem Augenwinkel sah ich, wie die Blonde Bombe sich wieder hochrappelte. Ich drehte ihr den Rücken zu.
In der zweiten Reihe hüpfte ein altes Muttchen vor Wut auf dem Sitz herum. »Du Tier«, kreischte sie. »Du potthässliche … Schlampe!«
»Selber Schlampe«, schrie ich.
Die Blonde Bombe boxte mich in den Rücken, und ich knallte in die Seile. Die erste Reihe wurde lebendig. Ich kriegte Schuhe, Programmhefte und Handtaschen um die Ohren gehauen. Ich wälzte mich in die Ringmitte.
Die Blonde Bombe schmiss sich auf mich und drehte mir den Arm auf den Rücken.
Die erste Reihe tobte.
»Mach sie alle«, heulten sie. »Reiß ihr den Arm aus.«
Die Blonde Bombe krallte sich in meine Haare und riss mir den Kopf hoch. So eine linke Titte.
»Pass auf«, sagte ich. »Denk an meine Zähne.«
Sie wusste, dass ich Zahnschmerzen hatte, trotzdem knallte sie mein Gesicht auf die Bretter. Blöde Kuh.
Mit ihr auf dem Rücken stemmte ich mich hoch, bis ich auf allen vieren war. Sie schlang mir den Arm um den Hals. Das kriegt sie nie richtig hin, bei ihr kommt dabei immer eher ein Würgegriff raus als eine Klammer. Aber so was sieht keiner, auch nicht die in der ersten Reihe. Und die erste Reihe war mittlerweile völlig aus dem Häuschen.
»Aua-aua-aua«, jaulte ich, um die Stimmung anzuheizen.
Die Blonde Bombe drückte mir mit voller Kraft die andere Hand ins Gesicht. Sie ist wirklich eine Ratte. Sie wusste genau, dass ich Zahnschmerzen hatte. Ich wurde fuchtig.
Ich spannte die Quadrizepse und kam langsam hoch. Sie hing wie eine Klette an mir. Ihre Brüste quetschten sich gegen meine Schulterblätter, und der Drahtkörbchen-BH, mit dem sie sich die Oberweite vergrößerte, stach mir in die Wirbelsäule.
Sie dachte, ich würde mich hinstellen. Sie lernte es eben nie.
Als ich mich halb aufgerichtet hatte, rollte ich mich nach vorne ab und legte sie flach auf den Rücken. Ich drehte mich um und landete in letzter Sekunde auf ihren Schultern. Sie hatte nicht mehr genug Puste, um eine Brücke zu machen. Jetzt hatte ich sie.
Der Ringrichter kam angeschlendert. Er ließ sich Zeit, weil es im Zuschauerraum plötzlich ganz still geworden war.
»Eins …«, sagte er.
»Du Tier!«, brüllte jemand. »Du feiges, dreckiges Tier!«
Und schon gellten die Buhs durch den Saal. Es hört sich an wie auf dem Viehmarkt, wenn ich einen Kampf gewinne.
Die Bombe wollte eine Brücke machen. Aber ich war so stinksauer auf sie, dass ich sie nicht hochkommen ließ.
»Zwei«, sagte der Ringrichter zögerlich.
Die Buhs verfolgten mich bis in die Garderobe. Es war ein guter Abend gewesen.
Ich will dir einen kostenlosen Rat geben. Wenn du es in diesem Leben als Bösewicht zu etwas bringen willst, rechne nie mit Applaus. Zähl lieber die Buhs. Das ist der sicherste Weg herauszufinden, wie gut du wirklich bist.
Als wir in dem kalten Korridor hinter der Halle um die Ecke bogen, konnte ich sie immer noch buhen hören. Die Falsche hatte viel zu schnell gewonnen.
»Au, mein armer Rücken«, jammerte die Bombe. »Bei den Würfen könntest du ruhig ein bisschen vorsichtiger sein. Morgen früh bin ich bestimmt grün und blau.«
»Und du hättest ruhig mal an meine Zähne denken können«, sagte ich. »Du wusstest doch, dass ich Zahnschmerzen habe.«
»Hatte ich vergessen«, sagte sie. Verlogenes Stück. Ihr rieselten die Pailletten von dem schicken Trikot, und sie zog eine Glitzerspur hinter sich her. Aber ich hatte nicht die Absicht, ihr das zu sagen, vor allem nicht, nachdem sie keine Rücksicht auf meine Zähne genommen hatte.
Als wir in die Garderobe kamen, saß da schon ihr unterbelichteter Freund rum.
»Armes Baby«, sagte er zur Bombe. Mich sah er böse an. Ich hätte nett zu ihm sein sollen, weil er mich nach der Show wieder mit nach London nehmen wollte. Deshalb hätte ich wohl seiner Meinung nach das arme Baby gewinnen lassen müssen.
»Mach die Biege«, sagte ich. »Ich will mich umziehen.«
»Ich habe schon mehr nackte Frauen gesehen als du warme Mahlzeiten«, sagte er. So ein Blödmann.
»Bei mir gibt’s nichts zu spannen«, sagte ich. »Da hast du dich verrechnet.«
»Meinst du etwa, da leg ich gesteigerten Wert drauf?«
»Dann schieb ab«, sagte ich.
Aber er wollte der Bombe mit den fettigen Flossen die Schultern massieren. Sie hätte einem fast leidtun können, wenn sie sich nicht so genüsslich schnurrend an ihn geschmiegt hätte.
Will eigentlich jeder Mensch gebraucht werden? Wollen sich eigentlich alle Frauen begrapschen lassen – sogar von einem Schwachkopf mit fettigen Flossen? Also, ich weiß die Antwort darauf nicht, aber ich bin schließlich ein anderes Kaliber. Natürlich bin ich nicht besonders gern groß und hässlich, aber man muss zugeben, dass fast alles im Leben auch seine guten Seiten hat. Zum Beispiel ist es sehr gut, wenn man nicht von dem unterbelichteten Macker der Blonden Bombe beliebäugelt wird, auch wenn er einen Ford Granada fährt.
In diesen alten Theatern auf dem Land heizen sie die Garderoben nicht. Wahrscheinlich war das Gebäude sowieso längst zum Abbruch freigegeben. Eine Dusche gibt es nicht. Man muss sich einigermaßen mit einem Waschbecken in der Ecke behelfen.
Das würde mir an sich nichts ausmachen. Der Schuppen war fürs Catchen sowieso nicht geeignet, und solche Dreckslöcher sind noch das Beste, was man auf den untersten Stufen der Karriereleiter überhaupt erwarten darf.
Was mir allerdings doch etwas ausmachte, war die Tatsache, dass ich schwitzend und mit Zahnschmerzen so lange in der Zugluft herumstehen sollte, bis seine Lordschaft die Blonde Bombe genug getätschelt hatte.
Aber ich musste höflich bleiben. Der letzte Zug aus dem Möhrenland nach Hause war bestimmt schon seit Stunden weg. Je größer die Entfernung von London, desto früher der letzte Zug, das weiß jedes Kind. Irgendwie musste ich wieder zurück.
»Mach schon«, sagte ich. »Zieh Leine.« Ich bemühte mich wirklich um einen freundlichen Ton.
»Eva ist schüchtern«, sagte die Blonde Bombe. Na ja, was soll man auch sonst von einer Catcherin erwarten, die im Ring Lippenstift der Marke Champagner Fizz trägt?
»Schüchtern? Eva Wylie? Dass ich nicht lache.«
Es gibt nichts Erbärmlicheres als einen Schwachkopf, der sich Schlauheiten herausnimmt, und kein Ford Granada gibt einem das Recht, mich zu beleidigen. Ich stopfte seinen Kopf ins Waschbecken und drehte den Hahn auf. Dann schnappte ich mir meine Puma-Sporttasche, Jacke und Schuhe. Es war besser zu verschwinden, bevor ich richtig böse wurde.
Im Korridor lief ich Mr.Deeds in die Arme. Er sah selber ziemlich böse aus.
»Wenn ich fünfzehn Minuten will«, sagte er, »dann will ich fünfzehn Minuten. Keine sieben. Keine zehn. Auch keine zwölfeinhalb.«
»Tut mir leid, Mr.Deeds«, sagte ich. Mr.Deeds ist der Boss.
»Reiß dich zusammen, Eva«, sagte er. »In solchen Kuhkaffs haben sie für Frauen im Ring sowieso nicht viel übrig. Es war schwer genug, euch überhaupt ins Programm zu kriegen. Du musst den Zuschauern was bieten für ihr Geld.«
»Ich bin ausgerutscht«, sagte ich. »Und Stella hat einen schlimmen Rücken. Wir konnten nichts dafür, Mr.Deeds.«
»Ausgerutscht? Das soll wohl ein Witz sein!«, sagte er. »Ich bin doch nicht blind. Ausgerutscht! Und es sollte mich verdammt noch mal nicht wundern, wenn Stella tatsächlich einen schlimmen Rücken hätte – jetzt, nach dem Kampf!«
»Tut mir leid, Mr.Deeds«, sagte ich noch einmal. Ich hatte langsam die Nase voll davon, im zugigen Korridor zu stehen und mich zu entschuldigen. Ich entschuldige mich nicht gerne, schon gar nicht, wenn mir die Zähne wehtun, aber es bleibt dir nicht viel anderes übrig, wenn dein Brötchengeber sauer auf dich ist.
»Wenn du dich an die Spielregeln hältst, Eva, kannst du eine schöne Stange Geld verdienen«, fuhr er fort. »Aber wenn du uns verarschst, fliegst du raus. R-A-U-S. Kapiert?«
»Raus.«
»Genau«, sagte er. »Nächste Woche sieht es anders aus, okay?«
»Okay, Mr.Deeds.«
Seine Zigarre paffend watschelte er von dannen. Fetter Saftsack. Immer sind es die fetten Saftsäcke, die einem das Gehalt bezahlen. Er hat einen Hintern wie ein Elefant. Das Problem ist nur, er hat auch ein Gedächtnis wie ein Elefant.
Ich war irgendwie angeschlagen nach dem Gespräch mit Mr.Deeds, aber ich wollte unbedingt noch zu Harsh, bevor ich ging. Ohne die Geschichte mit Stella der Bombe wäre ich noch geblieben und hätte mir seinen Kampf angesehen. Harsh ist klasse. Er ist ein Athlet, und ein größeres Kompliment gibt es nicht.
Ich klopfte an seine Garderobentür. Leider war er nicht allein, wie ich gehofft hatte. Eigentlich nicht überraschend. Richtig nette Typen gibt es nicht so viele, und Harsh kann einfach jeder gut leiden.
Seine Freundin machte mir die Tür auf. Ich kann sie nicht ausstehen. Na ja, ich sage zwar, ich kann sie nicht ausstehen, aber eigentlich kenne ich sie gar nicht. Sie ist ein winziges Persönchen, und in dem eisvogelblauen Sari, den sie heute Abend trug, sah sie wie eine Prinzessin aus. In ihrer Nähe komme ich mir immer vor wie ein Heuhaufen in einem Hurricane. Ich hätte mich lieber doch waschen sollen.
»Hallo, Eva«, sagte Harsh. Er stand an der Wand und dehnte seine Achillessehnen. Er gehört zu den wenigen, die sich vor dem Kampf anständig warm machen. Darum hat er auch seltener Verletzungen als die meisten anderen. Außerdem hat er eine tolle Körperbeherrschung. Ich wärme mich auch richtig auf. An der Körperbeherrschung arbeite ich noch.
»Möchtest du eine Cola, Eva?«, fragte Soraya. Sie hat reizende Manieren, aber ich kann sie trotzdem nicht leiden.
»Ich wollte gerade gehen«, sagte ich. Es war immerhin möglich, wenn auch nicht sehr wahrscheinlich, dass Harsh vorschlug, ich sollte noch bleiben, und mich hinterher in die Stadt mitnahm.
»Bis nächste Woche dann«, sagte er.
»Wir übernachten in Bath«, sagte Soraya zu mir. Und dann fiel mir ein, dass alle außer Stella der Bombe und mir noch einen Auftritt im Pavillon hatten.
»Also dann, bis die Tage«, sagte ich, als ob ich wunschlos glücklich wäre.
»Gute Nacht, Eva«, sagte Soraya. Und Harsh lächelte mich an. Er hat ein wunderbares Lächeln, der Harsh. Strahlend weiße Zähne, alle genau in der richtigen Größe.
2
Auf Schlacke kannst du nicht schleichen.
Diesen Trümmerhaufen nennen sie das Grand Theatre, dabei ist noch nicht mal der Parkplatz auf der Rückseite besonders grandios. Kunterbunt stehen die Wagen auf Schotter und Schlacke durcheinander. Das Grand Theatre! Ein grandioser Witz.
Immerhin war der Parkplatz nicht beleuchtet. Das ist das Gute an den beschissenen Auftritten im Möhrenland – die Parkplätze sind nie beleuchtet. Du könntest fast meinen, sie wollen, dass du dich selber bedienst.
Ich fand einen Renault 12, der mich quasi einlud, ihn mir auszuborgen – die Fahrertür schloss nicht richtig, und die Verkabelung war lose. Als ich ihn angelassen hatte, sah ich, dass der Tank noch fast voll war.
Eigentlich tat ich dem Besitzer einen Gefallen – vorausgesetzt, er war versichert.
Wozu sich Sorgen um eine Mitfahrgelegenheit in die Stadt machen, wenn dir die Möhrenmampfer ihre Autos praktisch hinterherwerfen?
Obwohl es noch nicht besonders spät war, als ich in Frome losfuhr, war kaum mehr einer auf den Straßen. Dadurch fühlte ich mich irgendwie einsam. Ich habe gern ein bisschen Trubel um mich rum, aber so was kannst du im Möhrenland lange suchen. Wahrscheinlich gehen sie alle früh in die Heia, nachdem sie sich ihre Mary-Poppins-Videos reingezogen haben. Nicht mal eine offene Frittenbude konnte ich finden. Was diese Landeier wohl treiben, wenn sie mal Spaß haben wollen?
Ich hatte Hunger. Wer so gebaut ist wie ich, braucht nach sportlicher Betätigung was zu essen. Aber ich habe noch einen kostenlosen Rat auf Lager: Halte nie in einer Kleinstadt, in der du dir gerade einen Wagen geborgt hast, an, um dir was zum Essen zu besorgen. Jeder ist mit jedem verwandt, einer sieht dich immer und holt die Bullen.
Ich hatte mir in den letzten paar Jahren viel Selbstbeherrschung angeeignet. Also fuhr ich stur an allen Kneipen vorbei und hörte nicht auf meinen knurrenden Magen.
Harsh hat mir mal was über den berühmtesten Ringkämpfer aller Zeiten erzählt. Er hieß Milon von Kroton, und er hat im Training immer ein Kalb durch die Gegend gewuchtet. Immer dasselbe Kalb. Das Kalb wurde größer und schwerer, und Milon musste stärker und immer stärker werden, um es überhaupt noch schultern zu können. Harsh meinte, Milon wäre seiner Zeit voraus gewesen, und mit dieser Geschichte ging es ihm um die Grundprinzipien des Krafttrainings und darum, dass man die Muskeln langsam an immer größere Belastungen gewöhnen muss.
Milon hat fünf olympische Medaillen gewonnen, also würde ich mir an deiner Stelle eine höhnische Bemerkung über seine Trainingsmethoden lieber verkneifen. Hätte Milon von Kroton allerdings Ähnlichkeit mit mir gehabt, hätte er sein Kalb früher oder später mit Röstkartoffeln und viel Soße verspeist.
Es ist nicht ratsam, an Röstkartoffeln zu denken, wenn du halb verhungert bist — jedenfalls nicht, wenn du unbeschadet an der nächsten Dönerbude vorbei und in einem geliehenen Wagen aus der Stadt kommen willst, ohne geschnappt zu werden.
Ich hasse es auf dem Land. Je weiter du von der Stadt weg bist, desto dunkler wird es, und mit den Scheinwerfern fängst du lauter tote Sachen ein. Andauernd überfährst du Leichen – Igel, Kaninchen, Füchse und Viecher, die schon von so vielen Wagen plattgefahren worden sind, dass du nicht mehr erkennen kannst, was sie mal waren. Hat es Federn, war es ein Vogel, hat es keine, kannst du bloß raten.
Du wirst aus stieren, grünen Augen angeglotzt.
Alles auf dem Land ist entweder gefährlich oder tot. Menschen sind vielleicht tatsächlich nicht viel besser als Tiere, aber wenigstens lassen sie andere Menschen nicht tot auf der Straße rumliegen. Sie bringen sie weg, damit sie nicht wieder und wieder überfahren werden. Du musst dir bloß mal vorstellen, wie es in London aussehen würde, wenn einfach alles, was unter die Räder kommt, liegen gelassen würde.
Und dann das Essen.
Fünfzig Kilometer hinter Frome hielt ich an einer Imbissstube. Sie wollten gerade zumachen, als ich ankam, und es waren bloß noch ein paar Reibeplätzchen übrig. Reibeplätzchen! Ich muss schon sagen. Auf dem Land kann ich es ehrlich nicht aushalten.
Einmal haben sie versucht, mich aufs Land zu verpflanzen. Ich war sieben Jahre alt, und es war irgend so ein Pflegschaftsdeal. Ich sollte von einem komischen Ehepaar in Pflege genommen werden, das in Cambridgeshire ein großes Haus hatte, wo sie sich Ponys und Hunde und ungefähr noch fünf andere Kinder hielten. Es war einer von den Deals, bei denen alle Sozialarbeiterinnen glasige Augen und feuchte Höschen bekommen.
»Was meinst du, wie es dir da gefallen wird, Eva«, haben sie gewiehert. »Viel Platz zum Toben. Und lauter grünes Gras und Bäume.«
Meiner Meinung nach haben diese Sozialklempner nicht die leiseste Ahnung von Stadtkindern. Wir mussten um neun ins Bett. Wir hatten nichts zu tun. Die Ponys waren hinterlistige Biester. Die Hunde haben gefurzt und hatten Flöhe und haben das schöne grüne Gras vollgeschissen. Und was das komische Ehepaar angeht, die beiden waren Religionsfreaks, die haben erwartet, dass sich alle Kinder miteinander vertragen sollten.
Wie kommen die Leute bloß darauf, dass du mit jemandem gut auskommen musst, bloß, weil er genauso alt ist? Kinder, die in Pflege gegeben werden, kommen schließlich von überall her. Sie sind durcheinander. Ganz egal, aus was für einer Familie du kommst, dein Zuhause vermisst du immer. Manche Kinder wollen dich einmachen, manche Kinder klauen, manche Kinder machen ins Bett, manche Kinder spielen mit Feuer, manche Kinder können nicht sprechen. Und so was soll nun prima miteinander auskommen und dankbar sein für das Gras und die tückischen Ponys.
Die Natur soll dir ja angeblich guttun. Aber das stimmt nicht. Die Natur beißt und sticht oder vergiftet dich, einfach nur so. Und außerdem gibt es auf dem Trafalgar Square mehr Vögel, als ich je auf dem Land zu sehen gekriegt habe – die toten auf den Straßen mitgerechnet.
Nein. London ist der einzige Ort, wo es zum Aushalten ist. Lass dir bloß nichts anderes erzählen.
In London kommst du immer durch: Irgendwie kannst du da immer ein paar Kröten machen – und ein Plätzchen zum Pennen findet sich auch. Zimperlich darfst du nicht sein, aber wenn du überleben willst, ohne dass dir zu viele Fragen gestellt werden, dann geht das nur in London.
Du darfst allerdings nicht auf den Kopf gefallen sein. Was man von mir nun wirklich nicht behaupten kann. Viele Leute glauben, ich wäre dumm – weil ich eine ziemliche Kante bin. Dicke Muckis, kleines Hirn, stimmt’s? Na, wer das meint, der ist in etwa so helle wie ’ne Eierkohle.
Und wer das mir gegenüber laut ausspricht, der fängt sich ein dickes Knie ein.
Ich ließ den Wagen am Bahnhof Waterloo stehen und schlappte zu Fuß nach Hause.
In dem Jahr hatte ich ein Zuhause. Und einen richtigen Job.
Der Zaun war oben mit Stacheldrahtschlingen gesichert. Ich holte die Schlüssel raus und sperrte die Vorhängeschlösser am Tor auf. Vorsichtshalber pfiff ich – wiii-uuuuu. Es war nach Mitternacht, und die Hunde waren bestimmt ausgehungert.
Sie kamen aus dem Dunkeln auf mich zugeflogen, rammten mir die Köpfe gegen Knie und Oberschenkel.
»Hallo, Ramses«, sagte ich. »Hallo, Lineker.«
Sie waren keine üblen Kerle, dafür, dass sie Hunde waren, nur ein bisschen übereifrig. Sie liefen vor mir her zum Zwinger, und ich schloss auf. Ich mischte ihnen ein paar Schaufeln Hundeflocken unter ihre ekelige Futterpampe und wartete, bis sie es runtergeschlungen hatten.
Dann nahm ich die Taschenlampe und machte meine Runde.
Das Gelände war weitläufig, also dauerte es seine Zeit. Am besten war es auf dem Gebrauchtwagenparkplatz, weil der nämlich beleuchtet war. Ich musste bloß den Zaun überprüfen und zwischen den Wagen nachsehen, ob auch keiner auf den Rücksitzen kampierte.
Als Nächstes überzeugte ich mich, ob die Türen zum Verkaufsraum und den Büros abgeschlossen waren.
Am schlimmsten war es auf dem Schrottplatz. Zwar gab es da einen großen Scheinwerfer, nur war leider die Birne hinüber. Ich habe es Mr.Gambon schon dreimal gesagt, aber der ist ein echter Geizkragen.
»Der Schrott ist doch Tausende wert«, habe ich zu ihm gesagt. »Sie haben da haufenweise Ersatzteile rumliegen. Mit einer Glühbirne wäre mir sehr geholfen.«
»Faules Stück«, sagte er. Zu mir! Wie konnte ich aber auch so blöd sein, ihn um etwas zu bitten, was mir die Arbeit erleichtert hätte? Genauso gut hätte ich ihm gleich eine Lizenz zum Neinsagen geben können.
Demnächst muss ich mal den Besitzer deswegen anhauen, dachte ich. Aber seitdem er nach Ongar gezogen ist, kriege ich ihn kaum noch zu Gesicht.
Lineker schnupperte an einem Haufen Eisenstangen, aber Ramses hielt auf den Zaun zu. Ich folgte Ramses, weil er so aussah, als ob er etwas Bestimmtes angepeilt hätte. Als ich ihn einholte, biss er gerade einer großen Ratte das Hinterteil ab.
Oben am Zaun brannten ein paar trübe Funzeln, und darunter hing ein Schild, auf dem »Armour Protection« stand. Ich weiß nicht, was Armour Protection ist oder ob es hier so was je gegeben hat, aber der einzige Schutz, den die Anlage jetzt hatte, waren Ramses, Lineker und ich.
3
Mein Zuhause war ein aufgebockter Wohnanhänger.
Der Besitzer von dem ganzen Krempel kauft nicht nur gebrauchte PKWs und Nutzfahrzeuge, sondern manchmal auch Caravans und Wohnmobile. Meine Kiste hatte fast ihr ganzes Leben in der Gegend von Poole Harbour in Dorset verbracht, und wenn das Wetter feucht genug ist, mieft die Einrichtung immer noch nach Salzwasser und Meeresschimmel.
Ich hätte ja lieber einen fahrbaren Untersatz mit Rädern, dann könnte ich ihn im Notfall an einen Wagen hängen und mit Sack und Pack umziehen. Um einen stillgelegten Hänger vom Fleck zu kriegen, musst du ihn auf einen Laster hieven, und so was braucht seine Zeit. Aber als der Besitzer mich eingestellt hat, konnte er mir nur diese Kiste ohne Räder anbieten. Und – Mief hin oder her – ich musste zugeben, ein Platz im Obdachlosenasyl konnte dagegen nicht anstinken.
Zu der Zeit passte mein gesamtes Hab und Gut noch in eine Plastiktüte. In den sechs Monaten, die ich in dem Hänger wohne, hat sich ein bisschen mehr angesammelt, aber ich kann mir etwas darauf einbilden, dass ich trotzdem im Falle eines Falles innerhalb von zehn Minuten mit dem Nötigsten bepackt und abmarschbereit sein könnte.
Ich will dir ein Geheimnis verraten – ich schleppe ständig eine Zwei-Unzen-Tabaksdose mit mir herum, und in dieser Dose habe ich alles, was ich zum Licht- und Feuermachen, zum Kochen und für kleinere Wehwehchen brauche. Wachsstreichhölzer, eine flach geschabte Kerze, Skalpellklingen, Draht, ein Sägeblatt, wasserfestes Pflaster, Nadel und Faden, Aspirin, Teebeutel und Brühwürfel. Schon erstaunlich, was man alles in einer Zwei-Unzen-Tabaksdose unterbringen kann, wenn man wissenschaftlich vorgeht.
Die Idee habe ich aus dem SAS Survival-Handbuch. Ich fühle mich sicherer damit, und ich kann es nur jedem empfehlen, der regelmäßig mitten in der Nacht hochschreckt, weil er vor Überschwemmungen, Feuersbrünsten, radioaktiven Niederschlägen oder Obdachlosigkeit Angst hat. Lass dir eins gesagt sein: Sei stets auf das Schlimmste gefasst, dann schläfst du besser.
Die Nacht ist für mich die schlimmste Zeit. Ich gehe lieber weg und unternehme was, als dass ich alleine im Dunkeln liege und nicht einschlafen kann. Darum ist dieser Nachtwächterjob auch so ideal für mich. Ich darf nicht einschlafen, und wenn ich Gesellschaft brauche, sind immer Ramses und Lineker da oder ich kann durch den Zaun mit irgendwelchen Nachtschwärmern ein paar Worte wechseln.
Nachdem ich meinen Rundgang beendet hatte, ging ich zum Hänger, weil ich Kohldampf hatte. Ein Briefumschlag klebte an der Tür. Ich riss ihn auf und las den Zettel im Licht der Taschenlampe. Er war von heute, und es stand eine Nachricht darauf: Morgen Abend um sechs, Mr.Cheng.
Mr.Cheng macht nie viele Worte. Mr.Cheng ist überhaupt ein sehr zugeknöpfter Mensch. Wahrscheinlich glaubt er, ich kann nicht lesen und er tut mir einen Gefallen, wenn er mir kurze Briefe schreibt. Er meint, alle Nicht-Chinesen wären dumm, und verglichen mit Mr.Cheng sind sie es vielleicht sogar. Ich könnte ihn jederzeit kleinkriegen und in die Tasche stecken. Aber das würde ich mir nie erlauben, weil sich Mr.Cheng nämlich keine Unverschämtheiten gefallen lässt.
Ich steckte den Zettel ein und schloss die Tür auf.
Ich war sehr zufrieden. Was Mr.Cheng auch von mir wollte, es lief auf jeden Fall darauf hinaus, dass ich mir morgen ein bisschen Knete nebenbei verdienen konnte. Extraknete ist nie zu verachten. Mit diesem Job verdiene ich mir das Nötigste – ein Dach über dem Kopf und was zum Essen –, aber wenn ich was auf die hohe Kante legen oder mir die Zähne richten lassen will, brauche ich einen kleinen Nebenverdienst. Deshalb das Catchen und Mr.Cheng.
Ich ließ die Hängertür offen, damit der Meeresmief abziehen konnte. Ehrlich gesagt, miefte ich selber nicht schlecht. Wegen dem Krach mit dem Macker der Blonden Bombe hatte ich mich in Rübenstadt nicht waschen können.
Harsh sagt, ein Kämpfer muss in Dingen der Körperpflege immer hundertprozentig auf sich achten, also pumpte ich mir Wasser hoch und setzte zwei volle Kessel aufs Gas.
Ich habe auch einen Heißwasserboiler, aber der braucht Strom, und ich verbrauche im Hänger keinen Strom. Wer Strom verbraucht, kriegt Stromrechnungen. Der Hänger ist ans Netz angeschlossen und hat einen Zähler, aber der Mensch, der den Zähler abliest und entscheidet, was ich zu blechen habe, ist Mr.Gambon. Und nachdem er mich in den ersten Monaten ein paarmal saftig übers Ohr gehauen hat, habe ich beschlossen, dass ich auf den Scheißstrom verzichten kann. Ich habe Taschenlampen, und ich habe Gas. Wenn das Gas alle ist, besorge ich mir eine neue Flasche, und wenn die Batterien leer sind, kaufe ich mir neue.
Ich bin mein eigener Herr. Stimmt’s?
Nachdem ich mich gewaschen hatte, zog ich mir einen sauberen Trainingsanzug an. Dann machte ich mir eine Kanne Tee und wärmte ein paar Büchsen Eintopf auf. Harsh sagt, ich soll grünes Gemüse essen, aber in dem Eintopf waren nur Kartoffeln und Möhren. Zwar nicht gerade grün, aber immerhin Gemüse, das musste reichen. Harsh sagt auch, dass ich kein Weißbrot essen soll. Aber ich mag kein Graubrot und vor allem kein Vollkornbrot, mit den ganzen Körnern drin. Es kommt vor, dass man sich Zahnschmerzen einfängt, wenn man draufbeißt.
Es kommt auch manchmal vor, dass ich denke, Harsh redet nur Scheiße. Fast alles, was er mir rät, ist entweder anstrengend oder es schmeckt nicht.
Kompromissbereit aß ich zwei Schnitten Weißbrot und zwei Schnitten Graubrot.
Beim Essen starrte ich mein Plakat an. Ich hatte die Taschenlampe so hingestellt, dass das Licht voll darauf fiel. »Eva Wylie«, stand darauf, »Die Londoner Killerqueen«.
Auf dem Foto sah ich nach rechts in die Kamera. Ich war ganz in Schwarz und ließ meinen Bizeps spielen. Kein schlechter Bizeps, auch wenn ich es selber sage.
»Brutal«, sagte ich zu mir. »Echt brutal.«
Es gab mir das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein. Es gab mir das Gefühl, real zu sein.
Aber nach einer Weile sah ich nach unten in den Topf. Ich sollte nicht aus dem Topf essen, ich weiß, aber ich bin ja alleine, also macht es nichts. Die verkrusteten Eintopfreste auf dem Boden erinnerten mich irgendwie an die toten, von vielen Wagen plattgefahrenen Füchse auf der Straße.
Ich fragte mich, wo wohl die Zeit geblieben war, und schon ging es mir nicht mehr so gut. Die Zeit macht das manchmal – offenbar spielt sie Bockspringen mit sich selber. Und dann fühlt man sich ganz verloren.
Lineker bellte, also riss ich mich zusammen und sah nach, was anlag.
Lineker ist ein schönes Tier. Nichts als Muskeln. Sein kurzes Fell ist so glänzend, dass es aussieht, als hätte ihn einer mit der Spraydose eingesprüht. Aber sein Bellen … irgendwie fistelig und übergeschnappt, wie die Stimme eines kleinen, rothaarigen Mannes.
Ramses hat O-Beine und einen Stiernacken. Er bellt nicht oft, aber wenn er bellt, hört es sich an wie ein Elektrobass – eigentlich ziemlich melodisch, aber auch gefährlich.
Vor dem Zaun standen zwei Jugendliche, die mit Stöcken nach Lineker stocherten. Lineker war total aus dem Häuschen. Aber Ramses stand im Dunkeln und wartete.
Wenn du zwei Jungs auf einem Haufen siehst, hast du zwei Leute vor dir, die was im Schilde führen. Das weiß jedes Kind. Ich wette mit dir um einen Wochenlohn, dass drei Viertel von allem Unheil auf dieser Welt von männlichen Jugendlichen im Alter zwischen acht und achtzehn Jahren angerichtet wird.
Was soll’s? Solange sie in meinem Revier nichts anrichten, kann es mir egal sein.
Ich sagte: »Ihr seid aber spät noch unterwegs.« Bloß nichts überstürzen, das ist die Devise. Ich hätte sie sofort wegjagen können, aber ich behielt meine relaxte mentale Einstellung bei. Wenigstens mal jemand, mit dem man reden konnte.
Der Bursche mit dem Stock trat vom Zaun weg. Sein Kumpel sagte: »Wir haben bloß mit dem Hund geredet.«
»Seid lieber vorsichtig«, sagte ich. »Er ist ziemlich bösartig.«
»Mein Bruder hat einen Dobermann«, sagte der Junge mit dem Stock zu niemand Bestimmtem. Sein Kumpel glotzte mich komisch an.
»Du bist ja gar kein Kerl«, sagte er plötzlich. »Du bist ja ’ne Tussi.«
»Das gibt’s doch nicht!«, sagte sein Kollege.
»Ungelogen.«
»Godzilla!« Er schmiss den Stock an den Zaun, und sie hauten ab. Lineker stürzte mit wütendem Gebell hinter ihnen her.
»Verpisst euch, ihr Arschgesichter!«, brüllte ich.
Eigentlich schade. Seit die Polizei die Mädels aus der Mandala Street umquartiert hat, ist es in dieser Ecke ein bisschen ruhig geworden. Ich hätte schon Glück haben müssen, wenn ich bis um halb acht, wenn ich den Männern den Platz aufsperrte, noch mit irgendwem ein Wort wechseln konnte.
Die Typen reden nicht viel mit mir, aber sie respektieren mich.
Sie respektieren mich aus zwei Gründen. Erstens – ich kann mit den Hunden umgehen. Zweitens – es sind keine Diebstähle mehr vorgekommen, seit ich hier das Kommando habe. Nicht ein einziger.
Mehr erwarte ich auch gar nicht. Nur ein bisschen wohlverdienten Respekt.
4
Ich wachte ungefähr um zwei Uhr nachmittags auf. Sonnenlicht quetschte sich durch die orangeroten Vorhänge, und im Hänger sah es aus, als ob es brannte.
Die riesige Schrottpresse malmte und krachte, begleitet von der vertrauten Geräuschkulisse aus Geschepper, Gepolter und Männergeschrei.
Auf einem Schrottplatz ist es nie zu leise zum Schlafen.
Ich sprang auf und brachte rasch meine Dehnübungen hinter mich.
Ich wollte meine Ma besuchen, und ich musste vor drei Uhr bei ihr sein.
Das ist die beste Zeit, wenn du mit meiner Mutter reden willst, solange sie noch alle beisammen hat. Vor eins steht sie nicht auf, und ansprechbar ist sie erst, wenn sie den ersten Schnaps intus hat. Dann hat sie ein paar gute Stunden, aber danach geht es rapide bergab mit ihr, bis sie ungefähr um vier Uhr in der Früh wieder ins Bett geht.
Sie hat es im Leben nicht leicht gehabt, also kannst du dir deine Vorwürfe sparen.
Wenn man sagt, dass jemand es im Leben nicht leicht gehabt hat, stellt man sich doch einen alten Menschen vor, oder? Na los, du kannst es ruhig zugeben.
Dabei ist meine Ma noch nicht mal vierzig, und sie könnte auch noch ziemlich gut aussehen, wenn sie nur ein bisschen auf sich achten würde. Wenn sie abends ausgeht, aufgedonnert und aufgetakelt wie ein Christbaum, sieht sie richtig knackig aus – wenn ihr das Licht nicht gerade ins Gesicht strahlt. Du glaubst es kaum, dass sie stockbesoffen ist und dass ihr schon in ein paar Stunden das Make-up verschmiert am Kinn klebt.
Sie wohnt in einem Hochhaus, im zweiten Stock – was von Vorteil ist, weil nämlich der Aufzug nie funktioniert. Und wenn man bedenkt, in was für einem Zustand sie immer nach Hause kommt, würde sie die meisten Nächte auf der Treppe verbringen, wenn sie nur eine Etage höher wohnte.
Der Wind pfiff trotzdem durchs Treppenhaus, und ziemlich eklig sogar, auch weiter unten. Ich klopfte bei ihr an und wartete.
Als sie kam, öffnete sie die Tür nur einen Spalt und lugte hindurch wie ein verschrecktes Kaninchen. Jedes Mal, wenn sie die Tür aufmacht, sieht sie aus, als ob sie Angst hat, was mich bei ihrem Lebenswandel auch gar nicht wundert.
Als hinter mir ein paar Kids auf dem Skateboard vorbeizischten, zuckte sie zusammen.
»Komm lieber rein«, sagte sie und drehte sich um.
Als sie an der Schlafzimmertür vorbeikam, zog sie sie zu. Das bedeutete, dass sie letzte Nacht einen Kerl an Land gezogen hatte, der noch immer seinen Rausch ausschlief.
Wie schon gesagt, du darfst ihr keine Vorwürfe machen – irgendwie muss jeder zusehen, wie er das Geld für die Miete zusammenkriegt.
Wir gingen in die Küche durch.
Du denkst jetzt womöglich, dass es von allen Zimmern in diesem Loch, das meine Mutter ihr Zuhause nennt, in der Küche am schlimmsten aussieht. Falsch gedacht. Es sieht am besten aus. Und das erklärt sich ganz einfach dadurch, dass sie die Küche nie benutzt, höchstens mal, um sich eine Tasse Pulverkaffee aufzubrühen. Das Essen kommt in Mas Leben erst nach dem Trinken. Wenn sie Hunger hat, holt sie sich einen Hamburger.
In der Küche sagte sie als Allererstes zu mir: »Wenn er reinkommt, sagst du, du bist meine Schwester, ja?«
Ich lachte, und sie muss mir wohl irgendwas angemerkt haben, denn sie sagte: »Vergiss es – du bist eine Nachbarin.«
Ich sagte: »Wo wir gerade von Schwestern reden …«
»Fang bloß nicht wieder damit an«, fiel sie mir ins Wort. »Mir platzt der Kopf.«
Ich setzte schweigend den Kessel auf und machte uns zwei Tassen Pulverkaffee. Sie holte eine Flasche aus dem Schrank unter der Spüle und kippte sich einen Schuss in die Tasse.
»Nur damit es weggeht«, sagte sie. Sie kann das Lügen nicht lassen, meine Ma.
Ich gönnte ihr ungefähr eine Minute, dann sagte ich: »Es ist wichtig, Ma. Hast du was gehört?«
»Das ist der einzige Grund, warum du herkommst«, sagte sie. »Um mir wegen ihr Löcher in den Bauch zu fragen. Alles andere ist dir doch scheißegal, sogar deine arme, alte …«
»Mutter«, ergänzte ich. Sie kann sich nicht überwinden, das Wort in den Mund zu nehmen.
»Du sollst das nicht sagen«, fauchte sie und warf über die Schulter einen Blick auf die Tür. Sie trat sie zu. Sie hatte nackte, dreckige Füße, und ihre dicken Onkels waren schief, weil sie immer in zu spitze Schuhe gequetscht wurden.
»Was soll ich denn sonst zu dir sagen?«, fragte ich. Ich wurde langsam wütend.
»Ich habe schließlich einen Namen.«
»Und ich habe eine Schwester!«
»Jetzt halt endlich den Rand!«, schrie sie. »Sie will nichts mit dir zu schaffen haben. Guck dich doch an.«
»Woher willst du das wissen?«, schnauzte ich sie an. »Wir haben uns immer gut vertragen.«
»Das ist ewig her.«
»So lange auch wieder nicht.«
Dann hörten wir, trotz der Brüllerei, plötzlich die Klospülung.
Ma stand auf. Sie nahm ihre Tasse und den Kaffee, den ich mir gemacht hatte. Sie wollte ins Schlafzimmer.
»Die Tür findest du alleine«, sagte sie zum Abschied.
Am liebsten hätte ich was zerdeppert.
Aber frühes Training zahlt sich aus, und wenn wir als Kinder überhaupt eine Lektion gelernt haben, dann war es die, immer auf Zehenspitzen um Mas Männer rumzuschleichen. Wenn Ma einen Mann im Haus hatte, sind wir entweder schnell verduftet oder wir haben so getan, als wären wir nicht da. Ma war nie besonders wählerisch mit den Typen, die sie anschleppte.
Das war im Grunde ihr Unglück.
Ich ging ins Wohnzimmer. Mir kam der Gedanke, dass Ma eigentlich nie Kinder hätte haben dürfen. Aber sie hat sich welche angeschafft. Und eins davon war ich.
Das andere war Simone.
Das Wohnzimmer war die reinste Müllkippe. Alter, kalter Rauch hing dick in der Luft. Bierdosen und Aschenbecher waren vom Couchtisch auf den Fußboden gewandert. Irgendwer hatte am Fernseher eine Flasche zertrümmert, und ein angebissener Hamburger war in den Teppich getreten worden. Im Großen und Ganzen sah es aus wie auf einer von dieser Landstraßen, für die ich nichts übrighabe.
Hätte Ma mal einen Freund wie Harsh gehabt, dachte ich, wäre alles viel sauberer gewesen. Und Harsh wäre vielleicht mein …
Daran durfte ich nicht denken.
Das, wohinter ich her war, lag hinter dem Fernseher unter einem Stapel von Mas »Wahre Liebe«-Illustrierten. Sie liest den Schrott nicht mehr – sogar meine Ma lernt manchmal noch was dazu –, aber immer, wenn sie umzieht, schleppt sie den alten Plunder mit, ihre Bücher, wie sie dazu sagt.
Unter Mas Büchern lag ein altes Fotoalbum. Unsere Oma hat es Ma hinterlassen, als sie gestorben ist. In dem Album klebte ein Bild, das ich sehen wollte. Es war das letzte Foto, auf dem Simone und ich zusammen drauf waren.
Ich blätterte das Album rasch durch. Die Bilder von Ma als jungem Mädchen wollte ich nicht sehen. Davon kriege ich immer einen Kloß im Hals, weil sich Simone als Zehnjährige und meine Ma als Zehnjährige sehr ähnlich gesehen haben. Unheimlich ähnlich.
Ich fand die Seite. Da waren wir, bei unserer Oma im Wohnzimmer.
Ich weiß noch ganz genau, wann das Bild gemacht worden ist. An Simones zwölftem Geburtstag, zwei Tage, bevor sie in Pflege kam und weggeholt wurde. Also war es zwei Tage vor dem Tag, an dem ich sie zum letzten Mal gesehen habe.
Sonst waren wir immer zusammen weggeschickt worden. Und wenn wir zurückdurften oder abgehauen waren, haben wir uns bei Ma wiedergetroffen. Und wenn wir Ma nicht finden konnten, sind wir zu unserer Oma gegangen.
Aber damals haben sie uns getrennt. Und ungefähr ein Jahr später ist dann meine Oma gestorben.
Simone ist nie wieder nach Hause gekommen.
Ich habe später gehört, dass sie zu Pflegeeltern gekommen ist, und bei denen muss es ihr wohl gefallen haben, weil sie dageblieben ist. Oder, was eher wahrscheinlich ist, sie hat ihnen gefallen, und sie haben sie zum Dableiben überredet.
Es war schwer, Simone nicht zu mögen, aber ich muss dir sagen, dass sie kein charakterfester Mensch war. Sie ließ sich leicht überreden. Vor allem, wenn ich nicht bei ihr war und sie nicht daran erinnern konnte, wo wir hingehörten.
Ich starrte lange auf das Gesicht von früher. Sie war so hübsch. Kaum einer wusste, dass wir Schwestern waren. Ich war größer als sie, obwohl ich ein Jahr jünger bin. Und hübsch bin ich noch nie gewesen.
Am allerwichtigsten war es, ihr Gesicht nicht zu vergessen. Manchmal habe ich einen Alptraum. Ich gehe die Straße runter, und eine Bettlerin hält mir die Hand hin. Und ich gehe einfach vorbei. Ich erkenne Simone erst, als sie mich ruft. »Eva«, sagt sie. »Ich hätte dich überall wiedererkannt. Aber du hast mich vergessen.«
Aber ich habe sie nicht vergessen. Und eines Tages finde ich sie. Es muss einfach so kommen, weil schließlich jeder sagt, dass Blut dicker ist als Wasser. Und deshalb weiß ich auch, dass Simone nach mir sucht. Sie sucht mich bestimmt. Und sie kann mich nur finden, wenn sie zuerst Ma findet, weil ich viel erlebt habe, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben.
Ma hat auch viel erlebt, aber wenigstens ist sie im selben Stadtviertel geblieben. Und darauf setze ich. Darum gehe ich Ma alle paar Monate besuchen. Darum und natürlich auch, weil Blut nun mal dicker ist als Wasser, und das gilt sogar für Ma.
Irgendeiner muss schließlich die Familie zusammenhalten.
5
Die Geräusche, die aus Mas Schlafzimmer kamen, hörten sich so an, als ob jemand einen Asthmaanfall hatte.
Ich wusste, dass ich noch ein bisschen länger ungestört im Wohnzimmer rumschnüffeln konnte. Dazu hatte ich nicht oft Gelegenheit. Ich klappte das Album zu und fing an, den Rest des Bücherstapels nach Briefen zu durchsuchen.
Bei Ma musste man nämlich auf alles gefasst sein. Sie war imstande, Briefe ungeöffnet wegzuwerfen, wenn sie Angst hatte, es könnten Rechnungen oder Vorladungen sein.
»Nichts wie Scherereien«, sagte sie dann. »Scherereien mit einer Briefmarke auf dem Umschlag.«
Manchmal, wenn sie wieder ein paar Schnäpse zu viel gekippt hat, befördert sie einfach alles, was durch die Tür kommt, mit einem Fußtritt in die Ecke. Sie könnte eine halbe Million im Toto gewonnen haben oder am nächsten Tag wegen Sozialhilfebetrug vor Gericht müssen. Sie würde es nie erfahren.
Ich musste mit einer Sozialarbeiterin auf die Beerdigung von meiner Oma. Dafür haben sie mich extra rausgelassen.
Ma war nicht da. Sie sagte, es wäre ihr zu sehr an die Nieren gegangen, aber wenn du mich fragst, hatte sie einfach einen im Kahn.
Ich ging hin, weil ich dachte, Simone wäre da. Und – jetzt hältst du mich bestimmt für eine richtige Kuh – ich war Oma richtig dankbar dafür, dass ich ihretwegen aus dem Jugendheim rauskonnte und Simone sehen durfte.
Aber Simone war auch nicht da.
Das war die große Frage, die sich mir hinterher gestellt hat: Warum nicht? Warum war Simone nicht gekommen?
Ma wusste es nicht. Sie war stinksauer auf mich, weil ich sie deswegen andauernd gelöchert habe.
Monate später, als ich meine Strafe abgesessen hatte und wieder zu Hause war, fand ich einen Brief. Er war von Simones Sozialarbeiterin, und sie hatte geschrieben, sie wäre nach eingehenden Gesprächen und Beratungen mit Simones neuer Familie zu dem Schluss gekommen, dass es nicht im Interesse des Kindes wäre, es einer solchen emotionalen Belastung auszusetzen.
Mit anderen Worten, sie hatten es ihr verboten.
Hätte Ma mir das gesagt, hätte ich mir nicht monatelang Gedanken und Sorgen machen brauchen.
Aber Ma hatte den Brief noch nicht mal aufgemacht.
Verstehst du jetzt, was ich meine?
»Nicht im Interesse des Kindes« – tolle Phrase, was? Als Kinder hatten wir einen Witz. Der ging so. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Sozialarbeiter und einem Pitbullterrier? Antwort: Der Pitbullterrier rückt das Kind wieder raus.
Ich musste aufhören, an die alten Zeiten zu denken. Ich hatte schon einen Kloß im Hals.
Aber bei dem Gedanken an Sozialarbeiter kam ich auf eine Idee.
Es war Jahre her, seit ich das letzte Mal Simones Pflegeeltern besucht hatte. Vielleicht konnte ich die Adresse rauskriegen und ihnen einen Besuch abstatten. Freuen würden sie sich nicht darüber. Beim letzten Mal hatte es ihnen auch nicht gefallen, aber damals war ich noch ein Kind gewesen. Damals wusste ich noch nichts von Selbstdisziplin und einer relaxten mentalen Einstellung.
Das asthmatische Gekeuche aus Mas Schlafzimmer ebbte ab. Als es ganz still wurde, stand ich auf und ging zur Tür.
Dann sagte eine laute Stimme: »Wo zum Henker ist meine Brieftasche?«
Ich hätte früher wieder gehen sollen.
Ma sagte was, was ich nicht verstehen konnte.
Dann sagte er: »Her damit, du Schlampe!«
Und damit fing der Ärger an.
Ma kam ins Wohnzimmer gestürmt, die Haare hingen ihr ins Gesicht, sie hatte nichts an. Sie verkroch sich hinter dem Sofa.
Als er hinter ihr herkam, zog er sich noch den Reißverschluss an der Hose hoch. Er hatte kein Hemd an, und seine Tätowierungen waren nicht zu übersehen.
Ma sagte: »Du musst sie im Club vergessen haben, du musst sie im Club verloren haben, du musst …«
Aber so blöd war er denn doch nicht. Er sagte: »Ich habe nirgendwo was verloren. Rück sie raus, du Schlampe.«
»Dann muss sie im Auto sein. Im Treppenhaus …«
»Schnauze!«
»Ich helf dir suchen …«
Er langte über das Sofa, packte ihr Handgelenk und drehte es gemein herum.
»Du Mistkerl!«, kreischte Ma.
»Du diebisches Flittchen!«, sagte er und ballte die Faust.
Daraufhin krallte ich mich mit der einen Hand in seine Haare, mit der anderen in seinen Hosenboden. Ich stellte mich hin, als wäre ich im Ring, riss ihn um und hob ihn gleichzeitig hoch.
Er flog im hohen Bogen bis zur Tür, wo er auf dem Hintern landete.
Ma wurde über die Rückenlehne mitgerissen und fiel in die Polster. Das Sofa kippte um.
Sie musste die Brieftasche des Mistkerls wohl unter ein Polster gestopft haben. Kaum lag das Sofa nämlich auf der Seite und die Polster waren überall auf dem Boden verstreut, konnte ich sie deutlich sehen.
Ma sah sie auch, sie hörte nämlich auf zu kreischen und setzte sich drauf.
Ich fühlte mich großartig.
Der Gipskopf auf dem Boden sagte: »Wer bist du denn?«
»Abmarsch, Mister.«
Er wollte aufstehen, aber ich trat ihm den Arm weg, und er kippte wieder um.
Er wollte nicht kämpfen. Schade eigentlich, weil ich wirklich in Stimmung war. Er rutschte irgendwie auf dem Hosenboden aus dem Zimmer. Im Korridor rappelte er sich hoch und schoss wie ein Windhund aus der Startbox zur Wohnungstür raus.
Ich ging ins Schlafzimmer, sammelte seine restlichen Klamotten ein und brachte sie ihm nach draußen.
Er stand fröstelnd in dem zugigen Treppenhaus. Tätowierungen halten nicht besonders gut warm.
Er sagte: »Die hat meine Brieftasche geklaut.«
»Du hast ja gehört, was sie gesagt hat«, meinte ich. »Du musst sie verloren haben. Und jetzt zieh Leine, sonst gehe ich noch nach unten und spring dir auf die Karre.«
Wenn du einen Mann kleinkriegen willst, brauchst du bloß seinen Wagen bedrohen. Er nahm seine Klamotten und ging.
Als ich wieder reinkam, hockte Ma immer noch auf dem Fußboden. Irgendwo hatte sie eine Flasche aufgetrieben, die sie sich nun hinter die Binde goss.
Sie sagte: »Er hat mir wehgetan. Er hat mir den Arm verrenkt.« Ein Geplärre wie von einem Kleinkind.
Ich sagte: »Zieh dir was über.«
Ich war richtig gut drauf, aber ich konnte es nicht leiden, dass Ma nichts anhatte. Sie sah so schwach und jämmerlich aus.
»Zieh dich an«, wiederholte ich.
»Mein Arm tut weh«, sagte sie, an der Flasche nuckelnd. »Ich glaube, ich muss zum Arzt.« Sie blieb einfach sitzen.
Mir reichte es. Ich war schon draußen und hatte die Tür hinter mir zugeknallt, da fiel mir Simones alte Adresse wieder ein. Ich klopfte und wartete. Ich klopfte noch mal.
»Ja?«, schrie Ma hinter der Tür.
»Die Familie«, schrie ich zurück. »Simones Pflegeeltern. Wo wohnen die?«
»Du bist eine Nervensäge«, sagte sie durch den Briefkastenschlitz. »Weißt du das? Du bist eine richtige Nervensäge.«
Ich wartete. Irgendwie dachte ich, sie würde vielleicht dieses eine Mal was für mich tun. Aber es passierte nichts. Also ging ich.
Solange ich denken kann, wird Ma schon von Männern verprügelt. Das kann man ihnen nicht mal unbedingt verdenken. Manchmal würde ich ihr am liebsten selber eine scheuern.
Ich kann bloß nicht verstehen, warum sie sich das immer noch gefallen lässt.
Man braucht sich doch nur im Fitnessstudio ein bisschen Kraft antrainieren. Wenn man stark ist, nehmen sich die Männer keine Frechheiten raus.
Mich schlägt keiner mehr – es sei denn, ich werde dafür bezahlt.
Ich hoffe, Simone ist stark. Wenn irgendwer Kraft wirklich nötig hat, dann ein hübsches Mädchen.
Natürlich war ich von Geburt an im Vorteil. Ich bin schon immer ziemlich bullig gewesen. Aber die Statur allein macht es auch nicht. Bullige Schwächlinge kennen wir doch alle.