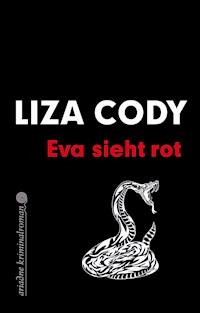12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Hannah Abram war bei der Metropolitan Police – bis sie ihren Sergeant in den Kanal warf. Jetzt ackert sie in Digbys ranziger Imbissbude und hat Wut im Bauch. Die Fälle der Schnellimbissdetektivin sind läppisch: Wo treibt sich mein Kerl rum, wer klaut meine Kartoffeln, wo ist mein Hund, wer kippt mir Müll vor die Tür? Dann hat Hannah plötzlich eine Stalkerin am Hals. Nervig, aber im Grunde harmlos – oder doch nicht? »Die Schnellimbissdetektivin« ist Cody pur: rasant und ruppig, mit präzisem Blick für Krisen und rabenschwarzem Galgenhumor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Impressum
eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2024
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
www.culturbooks.de
Alle Rechte vorbehalten
Titel der englischen Originalausgabe:
The Short-Order Detective
© 2024 by Liza Cody
Printausgabe: © Argument Verlag 2024
Lektorat: Else Laudan
Erscheinungsdatum: Juni 2024
ISBN 978-3-95988-254-5
Über das Buch
Hannah Abram war bei der Metropolitan Police – bis sie ihren Sergeant in den Kanal warf. Jetzt ackert sie in Digbys ranziger Imbissbude und hat Wut im Bauch. Die Fälle der Schnellimbissdetektivin sind läppisch: Wo treibt sich mein Kerl rum, wer klaut meine Kartoffeln, wo ist mein Hund, wer kippt mir Müll vor die Tür? Dann hat Hannah plötzlich eine Stalkerin am Hals. Nervig, aber im Grunde harmlos – oder doch nicht?
Die Schnellimbissdetektivin ist Cody pur: rasant und ruppig mit präzisem Blick für Krisen und rabenschwarzem Galgenhumor.
Über die Autorin
Liza Cody (* 1944) wuchs in London auf, wurde an einem üblen Mädcheninternat zur Legasthenikerin, studierte dann Kunst und arbeitete u. a. als Roadie, Fotografin, Malerin und Möbeltischlerin sowie in Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett, bevor sie zum Schreiben kam. Ihre Kriminalromane um die Londoner Privatdetektivin Anna Lee wurden mit etlichen Preisen ausgezeichnet, in viele Sprachen übersetzt und fürs Fernsehen verfilmt. In den Neunzigern begann sie mit der weltweit als Genrebreaker berühmt gewordenen Bucket-Nut-Trilogie um Catcherin Eva Wylie, für die sie u. a. den Silver Dagger erhielt. Es folgten zahlreiche weitere Romane, die stets mit der Gattung Kriminalliteratur spielen und rastlos ihre Grenzen dehnen und überschreiten. Für Lady Bag erhielt Cody 2015 den Deutschen Krimipreis, 2017 für Miss Terry, und 2019 den Radio Bremen Krimipreis für Ballade einer vergessenen Toten und für ihr Lebenswerk.
Liza Cody
Die Schnellimbissdetektivin
Deutsch von Iris Konopik
Vorbemerkung von Else Laudan
Seit vier Dekaden schmiedet Liza Cody rockige Krimis aus der zugespitzten Normalität eines Landes, das von uns bloß eine Kanalbreite entfernt ist. Ihre Figuren stürmen das Genre und prägen es wie ganz unwahrscheinliche Gütesiegel. Von der allzu blond verfilmten ersten Privatdetektivin Englands über die ungehobelte Wrestlerin (Eva Wylie-Trilogie) und die Musikbusiness-Intrigantin (Gimme more) bis zur legendären Pennerin (Lady Bag) kommentieren, karikieren und verkörpern Codys Frauen die Kehrseiten der großen Erzählung, die Risse im Lack, die bösen Blamagen und schlimmen Schandtaten des Systems. Literatur über Geknechtete, Gebeutelte und Loser, nie beflissen oder freudlos, vielmehr hohnlachend oder mit beißendem Galgenhumor, triumphal ungeschönt. Jedes Buch ein Geschenk, weil immer voll auf die Zwölf, unverschämt, subversiv und voller Wärme.
Und jetzt, wo es immer enger wird, die Schere immer weiter auseinandergeht, wo selbst der Mainstream der Krise gewahr wird, jetzt zaubert Liza Cody uns eine neue Figur aus dem Hut, den sie so gern trägt. Die Neue heißt Hannah, noch keine dreißig, und auch wenn sie längst weiß, dass ihre Welt kein gerechter Ort ist, muss sie noch viel lernen. Die Fälle, die sie bearbeitet, wenn sie sich nicht gerade am Grill neue Brandblasen holt, sind so schäbig und desolat wie der Alltag im Post-Brexit-London nach den ersten Wellen der Pandemie. Und bevor ich jetzt ganz weit aushole und wortreich feiere, wie grandios dieser Krimi die banalen Sorgen und Nöte echter Menschen in Szene zu setzen weiß, lesen Sie / lest ihr ihn lieber selbst. Am besten gönnt man sich dabei irgendwas Ungesundes zu essen – Fritten oder Sandwiches passen ideal, aber Pizza tut’s auch. Film ab!
1
Ich bin fürs Stillsitzen nicht gemacht. Der Wadenmuskel in meinem linken Bein zuckt, warnt vor einem drohenden Krampf. Mein hässlicher alter Honda müffelt. Aber hier sitze ich, drücke mich am Sonntagabend vor einem Wohnblock in Streatham herum. Ich weiß, in welcher Wohnung »dieses blonde Flittchen« wohnt. Sie liegt im zweiten Stock, durch die Vorhänge scheint Licht.
»Ist doch ’n Klacks, Hannah Abram«, murmele ich, nur zum Beweis, dass ich noch lebendig bin und nicht vor Langeweile gestorben. Aber ich wünschte, ich würde noch rauchen. Nichts bringt dich besser durch öde Überwachungsstunden als eine Zigarette oder zwei, wenn du all deine Sandwiches verputzt hast und eine Banane und eine halbe Packung Schokohaferkekse.
Immerhin, es ist weder kalt noch regnet es, und Ryan Reynolds bleibt selten über Nacht weg. Hat Mrs. Reynolds mir zumindest versichert. Ryan ist »mit seiner Mannschaft nach dem Snookerturnier noch einen trinken«. Hat er seiner Holden zumindest erzählt. Snooker, meine Fresse, wie öde!
Hier also die Preisfrage an die notleidende Privatdetektivin: Beschatte ich einen verlogenen, treulosen Saftsack für eine verunsicherte, tränenblinde Klientin, oder arbeite ich für eine, die seit Ewigkeiten weiß, dass ihre Ehe eine rottende Leiche ist, aber den verlogenen, treulosen Saftsack drankriegen will, um das Haus und den Löwenanteil des gemeinschaftlichen Eigentums zu behalten?
Schert es mich?
Kein Stück. Aber es hilft, was zum Nachdenken zu haben in den dunklen Stunden, wenn der Saftsack und die Blondine eindeutig mehr Spaß haben als ich.
Ryan Reynolds verlässt die Wohnung um dreiundzwanzig Uhr siebenundvierzig, also schicke ich der Holden eine Nachricht: »Er sollte in zwanzig Minuten zu Hause sein.« Die Holde schreibt zurück: »Ok danke für das bisherige Material. Reden morgen.«
Ich habe im Grundbuch und im Wählerverzeichnis nachgeschlagen und den Namen des Wohnungseigentümers ermittelt, der sich von dem der Bewohnerin unterscheidet. Ich habe außerdem festgestellt, dass Ryan der Lüstling einen eigenen Schlüssel besitzt. Das spricht Bände, was die Dauer der Beziehung angeht. Das hab ich Mrs. Reynolds aber nicht aufs Butterbrot geschmiert. Manche Schlüsse muss eine Klientin schon selbst ziehen. Oder mir einen ganzen Haufen extra zahlen.
Mrs. Reynolds bezahlt mich tageweise. Das Beschatten, Warten und Herumdaddeln auf meinem iPad hat anderthalb Tage gebraucht. Sie meckert schon wegen des halben Tags, also wird dieser Job weder meinen Dispo aufmöbeln noch meinen Ruf als gewiefte Ermittlerin, die jeden Penny wert ist.
Ich folge Mr. Rs schwarzem Mercedes-Kleinwagen zurück zu seiner Straße, weniger aus Gewissenhaftigkeit, sondern weil es auf meinem Weg liegt. Dann gehe ich nach Hause ins Bett, schleiche die knarzende Treppe hoch, um Eleanor und Olive nicht zu stören.
Früher hatte ich eine eigene Wohnung. Früher hatte ich eine feste Stelle bei der Met, der London Metropolitan Police. Aber die Stelle hab ich verloren, als ich meinen Sergeant in den Kanal schubste, und die Wohnung ging flöten, als die Krankheit meine Optionen auf einen Teilzeitjob in Digbys Sandwich-Bude eindampfte. Dieser Sturz von der Karriereleiter bedeutet, obwohl ich heute nur noch eine Dachkammer habe (Rauchen, Trinken, Fleisch und Männer verboten), muss ich mich abstrampeln wie eine hungrige Ratte, um die Miete zusammenzukriegen. Meine Vermieterinnen Eleanor und Olive unterrichten Vorschulkinder, und Digby ist ein erzbigotter Ausbeuter.
2
Das Sandwich Shack hockt am Rand des Volksparks wie eine hässliche Kröte. Nach fünf Stunden Schlaf steh ich wieder da, in meiner saubersten OP-Maske, und mache Frühstück für putzmunteres Gassigang-, Jogging-, Radfahr- und Frühschicht-Volk. Die Grillplatte spuckt mir Speckfett auf die Arme, zu Boden kullernde Würstchen müssen gerettet werden, der Toaster hat seine übliche Vormittagskrise und zwei Stunden zu spät kommt Digby reinstolziert. Seine Miene kräht: »Ich mag kleiner sein als der durchschnittliche Zehnjährige, aber ich wurde heut Nacht flachgelegt – schreib dir das hinter die Ohren!«
Fünf Minuten danach schleicht sich Dulcie rein, die Neue im Sandwich Shack, sichtlich verlegen. Unbedingt will ich beiden meine speckige Schütze in den Hals stopfen und ihre Schädel in den Geschirrspüler rammen.
Stattdessen beherrsche ich mich und gebe Dulcie den Pfannenwender, ein Haarnetz, Schürze und Maske. Ich mach mir einen heißen Kakao mit Schlagsahne und Streuseln, greif mir ein warmes Croissant und geh raus zu einem freien Tisch im Rauchbereich.
Unklugerweise kommt Digby hinterher und blafft: »Wer hat gesagt, dass du Pause machen kannst?«
Meine ruhige Fassade bröckelt. Ich sage: »Ich hoffe, dir wachsen Hämorrhoiden in der Nase genau wie in deinem fetten Arsch.« Tunke das Croissant in den heißen Kakao, beiße herzhaft hinein und warte, während er an seiner Antwort feilt.
Schließlich japst er ein Lachen, sagt: »Guter Spruch«, und stolziert wieder rein. Was ich wohl Dulcie zu verdanken habe. Er hat mich schon wegen weniger gefeuert – mehrfach.
Ich schlucke gerade die letzten Krümel meines Croissants runter, da kreuzt ohne Termin meine Klientin auf, Mrs. Ryan Reynolds. Normalerweise treffe ich Klienten außerhalb der Arbeitszeit im Büro hinter der Küche. Aber ich kann mit Digby nicht über Bürozeiten verhandeln, nachdem ich seine Nase und seine Hämorrhoiden im selben Satz verwurstet habe. Also deute ich auf den freien Stuhl.
Sie setzt sich. Sie ist mit Sorgfalt gekleidet und geschminkt. Nach gebrochenem Herzen sieht sie nicht aus.
»Das kommt ungelegen«, sage ich im Ton eines Profis, den man übervorteilen will – mit meinem halben Becher Kakao und meinem Krümelteller vor mir eine schwer zu spielende Rolle.
»Ich bin auf dem Weg zu meinem Anwalt«, übergeht sie das. »Ich brauche die Fotos, die Sie gestern Abend gemacht haben.«
»Okay«, sage ich und hole mein Telefon aus der Tasche. Dann zögere ich. »Und natürlich«, füge ich zuckersüß hinzu, »brauche ich das Honorar, das wir vereinbart haben.«
»Der Auftrag ist nicht erledigt«, sagt sie. »Mein Anwalt meinte, er braucht wahrscheinlich eine eidesstattliche Aussage.«
»Sie haben mich beauftragt, herauszufinden, wo sich Ihr Ehemann rumtreibt, mit wem er zusammen ist, und Fotos zu machen, die das belegen. Das habe ich getan. Wir haben ein Honorar für den Auftrag vereinbart. Von einer eidesstattlichen Aussage war keine Rede, deshalb ist eine eidesstattliche Aussage in meinem Kostenvoranschlag nicht einkalkuliert.«
Ihr Kinn springt vor. Ihr Lipgloss glitzert eisrosa. Ich seufze. Es ist heutzutage so schwer, sich halbwegs anständig über Wasser zu halten.
»Vorschlag«, sage ich, »Ihr Anwalt hat vermutlich einen Satz für eidesstattliche Aussagen. Wenn er eine von mir braucht, überlassen wir es doch ihm, dafür zu sorgen.« Ich hab das starke Gefühl, dass sie alles, was ich für sie bezeugen sollte, längst gewusst hat. Und sich jetzt eifrig selbst überzeugt, dass es witzlos ist, mich zu bezahlen, wo sie mich doch gar nicht gebraucht hat. Sie nestelt an der Schließe ihrer Handtasche. Ich will sie ihr aus der Hand reißen und brüllen: ›Wenn Sie so kacken-kniepig sind, machen Sie ein Vorhängeschloss dran.‹ Stattdessen beiße ich mir auf die Zunge und warte. Ich kann das. Mein Kiefer tut weh davon, aber ich lerne gerade: Wo Geld im Spiel ist, machen diejenigen die Regeln, die es besitzen, und wer es haben will, muss sich fügen. Die Erfahrung hat mich gelehrt, dass es nicht gut für mich ausgeht, wenn ich einer Frau mit ihrer Handtasche eins überbrate.
Die Frau knirscht mit den Zähnen und sagt: »Ohne Aussage kein Geld.«
Siehste, kein Format. Das macht die Krankheit und die Isolierung vom Rest der Welt. Alle denken, alle anderen wollen sie bloß übers Ohr hauen. Ich auch.
Mit geballter Faust sage ich freundlich: »Ohne Geld keine Fotos.«
Sie guckt auf die Faust. »Zeigen Sie mir die Fotos.«
Ich tippe mit dem Daumen auf das Album-Symbol, wähle ein Foto von Ryan, wie er aus einer eindeutig mit 137 bezeichneten Tür kommt, und zoome auf Bildschirmgröße. Dann halte ich das Telefon so, dass sie es sehen kann. »Ist das Ihr Mann?«
»Ja.«
Ich tippe wieder aufs Display, um die Ziffer zu vergrößern. »Ist das die Hausnummer, die ich Ihnen gestern Abend genannt habe?«
Sie nickt.
Ich schalte das Telefon aus. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Widerstrebend sagt sie: »Geben Sie mir Ihre Bankverbindung. Ich überweise das Geld, sobald ich zu Hause bin.«
Ich blecke die Zähne, was bei Dunkelheit glatt als Lächeln durchgehen könnte, und sage: »Wie die Dinge liegen, hätte ich es lieber in bar. Auf der High Street ist ein Geldautomat. Ich kann warten.«
Später, als die Miete für die kommende Woche sicher in meiner Tasche steckt, sagt Digby: »Du hast die Körpersprache eines Schuldeneintreibers. Traust du deinen eigenen Kunden nicht?«
»Du vielleicht?«, gebe ich zurück.
»Auch wieder wahr«, brummt er, dreht sich um und holt einen Riesenschinken aus dem Kühlschrank. Zeit, die Sandwiches für Mittag zu machen.
3
Bevor ich hier anfing, mochte ich das Sandwich Shack. Und den Volkspark mag ich immer noch.
Ich kam das erste Mal her, da war ich Frischling in einer riesigen Truppe aus Polizei und Freiwilligen, die das Gelände nach einer seit zwei Tagen vermissten Siebenjährigen absuchte. Es war eine Meile weit weg von ihrem Zuhause, aber ein paar Jungs hatten gemeldet, sie hätten sie mit einem Mann gesehen. Der Mann war schwarz, weiß, dick, dünn, groß, klein, alt und jung. Aber alle waren sich einig, dass das Mädchen blond und blauäugig war und einen flaschengrünen Schulblazer anhatte. »Das kommt daher«, sagte der alte Bulle, der mich ausbildete, »weil das Foto im Lokalblatt so aussah.« Er war sehr erfahren und sehr zynisch. »Jetzt geh und hol uns einen Americano und ein Bratwurstsandwich von der miesen Bude da drüben.«
Das war mein erster Zusammenprall mit Digby, der Polizisten in Uniform nicht leiden kann. Es war lange bevor ich merkte, dass er niemanden leiden kann, deshalb nahm ich es persönlich.
Ich war gerade einen weiteren Kaffee holen, als der Ruf kam und alle zu einem Dickicht drängten, wo sie die Leiche des Mädchens fanden. Ich hab sie nicht gesehen, weil ich sofort zur Gafferabwehr abkommandiert wurde. Da habe ich das erste Mal erlebt, wie schnell eine Mädchenleiche ein großes Publikum anzieht.
Wie sich herausstellte, war der Täter der junge Kerl, der die Leiche »entdeckt« hatte. Er war für ganze zwei Stunden ein Held, bis er gestand.
Ich war erstaunt, aber der alte Bulle sagte: »Oh ja. Das ist ein Typus.Sie wissen, was alle wissenwollen. Sie fühlen sich allmächtig, weil es ihnen einen Kick gibt, dass sie wertvolle Informationen haben, die außer ihnen niemand hat. Dann können sie nicht anders, sie müssen sich auch noch mit dem ›Fund‹ brüsten.«
Ich weiß noch, dass ich dachte: Ein bisschen wie mein Freund. Das war ein Typ, der Informationen wie Waffen benutzte – warf mir Bröckchen hin, verschwieg aber nach Belieben das Wesentliche – beispielsweise wo er war und mit wem.
Jetzt hab ich keinen Freund, und Digby kann mich noch immer nicht leiden. Manche Dinge ändern sich, andere nicht.
Während er mir den Rücken zudreht, mache ich zwei zusätzliche Sandwiches – ein Huhn-Mayo, ein Schinken-Käse-Senfgurke –, wickele sie ein und verstecke sie in der Schürzentasche. BZee mag Fleischfüllung, aber Digby passt derzeit auf wie ein Schießhund, wie viel Füllung wir in die Sandwiches packen und was mit den Resten passiert. Alle spüren den Druck wegen Krankheit, Inflation und unterbrochenen Lieferketten. Diese Faktoren plus die unbestreitbare Tatsache, dass Digby schon immer ein mieser Sack war, ergeben eine Situation, in der es immer schwieriger wird, mir BZee warmzuhalten.
Ich muss mir BZee warmhalten, denn er ist Meister im Finden von entlaufenen oder geklauten Hunden. Noch ein Merkmal dieser harten Zeiten: Dognapping ist ebenfalls zur Epidemie geworden. Ich kann ja nicht beschwören, dass BZee immer Hundefinder und niemals der Hundedieb ist, aber meine Beziehung zu ihm ist symbiotisch. Es gibt im Volkspark reichlich Leute mit Hund, mehr als vor der Krankheit. Da wurden die weltweiten Welpenvorräte weggekauft.
Weil die gesamte Imbisskundschaft weiß, dass ich Ex-Cop und Privatdetektivin bin, klopfen immer mehr ihrer Haustiere beraubte Menschen an meine Tür.
Erstaunlich, oder, dass fast alle vermissten Hunde reinrassig sind. Aus irgendeinem kuriosen Grund ist die durchschnittliche Promenadenmischung aus dem Tierheim nicht annähernd so beliebt. So oder so, ein Hund ist nicht einfach ein Hund. Wenn ein Hund abhandenkommt, ist das für die betroffene Person ein verlorenes Familienmitglied. Hier kommen BZee und ich ins Spiel. Und unsere Erfolgsquote ist um Längen besser als die der Bullen – die grenzt haarscharf an null. Unsere Erfolgsquote ist schon verdächtig hoch. Aber Argwohn kann ich mir nicht leisten. Ich muss meinen Lebensunterhalt verdienen.
BZee ist ein magerer, vernachlässigter Junge, der wie viele andere nicht genug zu essen kriegt. Ich füttere ihn durch; er hilft mir »verschwundene« Hunde wiederfinden. Unser gemeinsamer Feind ist Digby.
Im Moment lauert BZee bei den Bäumen jenseits des Joggingpfads, behält das Sandwich Shack scharf im Blick und wartet, bis Digby mit dem Frühstücks- und Mittagsgeld zur Bank rennt. Bargeld wird zum Problem. Seit der Krankheit wollen die meisten Kunden Kreditkarten benutzen und ihr kostbares Leben nicht mit schmutzigen Scheinen und Münzen gefährden, die irgendwelche Kranken angefasst haben könnten. Digby ist ganz ihrer Meinung. Und eine Zeitlang haben wir nur Essen zum Mitnehmen verkauft und Bargeld verweigert. Dann haben Digby und ich uns darüber gezofft, denn die meisten Kinder haben keine Kreditkarten, auch viele alte Leute nicht und schon gar nicht die Unbehausten.
»Na und?«, meinte Digby. »Die werfen eh nicht mit Geld um sich.«
»Niemand wirft derzeit mit Geld um sich«, konterte ich. »Ist dir das nicht aufgefallen? Was noch schlimmer ist, niemand gibt mehr Trinkgeld, und du hast keinen Bedienungszuschlag eingeführt.«
»Na und?«, sagte er wieder. Ich wusste, er wartete darauf, dass ich die Beherrschung verlor.
»Wenn du mich um mein Trinkgeld bringst«, sagte ich, »will ich mehr Lohn.«
»Hah!«, krähte Digby. »So viel zu armen kleinen Wichten und ungewaschenen Obdachlosen – es geht doch nur darum, dass du mehr von meinem Geld willst.«
»Na schön, du zu kurz geratener gemeiner Geizhals«, schrie ich, auch wenn ich wusste, das würde ihn mit Genugtuung erfüllen. »Ich kündige.« Damit schmiss ich die verhasste Schürze auf den Boden und stürmte nach draußen.
Natürlich fand er keinen Ersatz und ich keinen anderen Job. Also schob er vier Tage später eine handgeschriebene Nachricht durch meinen Briefschlitz, in der er mir mitteilte, wir könnten wieder Bargeld nehmen, vorausgesetzt, ich reinigte es. Aber meinen miesen Stundenlohn um mehr als ein läppisches Pfund anzuheben könne er sich nicht leisten.
Also steht jetzt neben der Kasse und dem Trinkgeldglas ein Antivirenspray, und ich schätze, wir haben das sauberste Bargeld in Südlondon. Geldwäsche.
Jetzt warten BZee und ich ungeduldig darauf, dass Klein-Digby sich in seinen Riesenmantel wickelt und zur Bank geht. Alles nur, weil BZee und ich die Überzeugung teilen, dass es unfair ist, wenn ein Hund, selbst einer mit Stammbaum, mehr wert ist als ein hungriger Teenager, selbst einer mit zweifelhafter Moral.
Digby gehört natürlich nicht zu unserem Club, und er lässt sich Zeit. Endlich wendet er sich mir zu und sagt: »Ich hab dir einen Liebesdienst erwiesen, Hannah. Das ist gegen meine Religion, wie du genau weißt, also lösch diesen affigen Ausdruck von deiner hässlichen Visage und hör zu.«
Tatsächlich steht mir der Mund offen. Aber ich bin misstrauisch. Digbys und meine Vorstellungen von einem Liebesdienst liegen so weit auseinander wie London und New York. Bei sehr seltenen Gelegenheiten haben wir kooperiert, aber das hat uns einander nie nähergebracht. Wir sind gezwungen, im Sandwich Shack zusammenzuarbeiten, denn obwohl er der beschissenste Arbeitgeber im gesamten Gaststättengewerbe ist, bin ich anderweitig nicht vermittelbar. Die Met hat mich gefeuert. Ich bin zu Unrecht als gewalttätige Männerhasserin verschrien. Und zu Recht für schlechte Manieren, die ich persönlich eher als Aversion gegen Scheißequatschen bezeichne. Gäbe es einen Wettbewerb im Scheißequatschen, Digby würde den Weltrekord halten.
Er sagt: »Eine Freundin von mir –«
»Du hast Freunde?« Ich kann’s mir nicht verkneifen.
»Mehr als duSoziopathin«, knurrt er. »Kannst du zur Abwechslung mal zuhören? Ich hab Kundschaft für dich. Eine Freundin von mir hat einen Patensohn, der Hilfe braucht. Er kommt um halb sieben her, nachdem du den Laden dichtgemacht hast.«
»Ich hab heute um halb fünf Schluss«, sage ich. »Du und Dulcie seid mit Dichtmachen dran.«
»Ich geb Dulcie heute Nachmittag ein paar Stunden frei«, sagt Digby mit lüsternem Grinsen, »damit sie ihre kranke Großmutter besuchen kann. Ich dachte, du bräuchtest den zusätzlichen Geldregen. Aber mach, wie du willst.« Damit rauscht er ab, ohne die elementaren Fragen zu beantworten, nämlich wer, was, wo, warum.
»Fusselbart!«, schreie ich ihm hinterher. Aber er dreht sich nicht mal um. Lässt Dulcie stehen, die rot wird wie eine Erdbeere im Juli und mit ihren Schürzenbändern spielt. Ich verpasse ihr einen so bösen Blick, dass sie unaufgefordert anfängt, die Tische abzuräumen.
Da seh ich BZee über die Wiese kommen. Und es fängt an zu regnen. »Na toll«, sage ich und drehe mich zu Dulcie um.
Sie lässt alles stehen und liegen und duckt sich, als wollte ich ihr den Kopf abschlagen. »Ich kann nix dafür«, nuschelt sie. Sie ist drall und leicht picklig, hübsch, aber hohl.
Mit so viel Nachsicht, wie ich aufbringen kann, sage ich: »Wir alle machen Fehler. Aber jetzt will ich, dass du dich verpisst.«
»Was?«, fragt sie so kleinlaut, dass ich in ihren Augen das misshandelte Kind sehe, obwohl sie über zwanzig ist. Noch unbedingter als sonst will ich auf Digbys Gesicht einen Stepptanz hinlegen.
»Ach Kacke«, sage ich. »Geh ins Büro, mach die Tür zu, räum da auf und komm erst wieder raus, wenn ich’s dir sage.«
»Okay«, sagt sie und guckt zu mir hoch, als wäre ich ein feindlicher General. »Aber wenn du mich nur wegschickst, um dem Kleinen, der sich nicht reintraut, diese Sandwiches zu geben, die du für ihn gemopst hast, dann lass mal. Ich benutz die Wertmarke und hol ihm ein paar gratis Chips dazu.«
Manchmal, sehr selten, muss ich zugeben, dass auf meine Menschenkenntnis nicht hundertpro Verlass ist.
Sie sagt: »Er geht auf meine alte Schule. Er pennt auf dem Gehweg vor dem Wohnblock seiner Mutter, wenn sie einen Kerl dahat. Ich wünschte, ich könnte ihn selber durchfüttern. Okay?«
»Okay«, sage ich und winke BZee aus dem Regen nach drinnen.
»’sgeht?«, sagt er.
»Kennst du Dulcie?«, frage ich.
»Vom Sehn«, sagt er und guckt zu, wie sie die Wertmarke für den Verkaufsautomaten aus der Kasse holt. Er stellt sich neben sie und zeigt. Sie zieht dreimal Chips mit Räucherspeckgeschmack und eine Dose Cola.
Sie und ich wischen eifrig die Tische ab und übersehen geflissentlich, wie gierig er schlingt. Als er fertig ist, schneidet sie ihm ein Stück Schoko-Cheesecake ab und fängt an, den Geschirrspüler einzuräumen. Sie ist sehr viel taktvoller als ich. Ich hätte mich sofort hingesetzt und übers Geschäft geredet. Und ziemlich sicher hätte ich nicht an den Cheesecake gedacht.
BZee ist plötzlich so schläfrig, dass er die Arme auf dem Tisch kreuzt, seinen Kopf drauflegt und die Augen zumacht. Ich will schon gegen seinen Stuhl treten, als Dulcie meine wattierte Jacke holt und ihm sanft über die Schultern legt. Sie schaut auf die Uhr und sagt: »Ich muss los. Ich soll Punkt halb fünf am Parkplatz sein, hat er gesagt.«
»Was Digby angeht –«
Sie unterbricht mich. »Ich verrate nichts, ehrlich.«
Ich fange noch mal an. »Okay, aber was Digby angeht –«
»Lass stecken«, sagt sie und geht raus.
Der heftige Regen fegt den Volkspark leer. Bis auf ein paar fröstelnde Kunden, die an der Verkaufsluke um heiße Getränke betteln, lässt sich niemand blicken. Ein typischer Spätsommernachmittag in Südlondon.
Als der Regen nach einer Stunde aufhört, wecke ich BZee und schenke ihm zähneknirschend die zwei unverkauften Pizzastücke, die ich eigentlich für mein Abendessen vorgemerkt habe. Siehste, alle nennen mich Hannah Herzlos, dabei speise ich die Hungrigen und gewähre ihnen Schutz vor dem Regen. Niemand kennt mein wahres Ich.
Er sagt: »Hab ’n Hinweis gekriegt wegen dem Golden Retriever.«
Er meint Moira Lancers Hund Gus, seit drei Tagen verschollen. Sie liebt ihn zärtlicher als ihre Kinder.
»Ja?«, sage ich. Ich koche uns beiden einen Becher Tee, für ihn mit Milch und vier Zucker.
»Ja«, sagt er, reibt seine verkrusteten Augen mit den Fäusten und gähnt. »Die wolln hunnert in bar, keine Fragen. Machbar?«
Moira gehört eine der tipptopp gepflegten viktorianischen Villen, die den Volkspark säumen. Natürlich ist das für mich machbar. Ich weiß auch, dass Gus kastriert ist und damit für den Weiterverkauf zu Zuchtzwecken ungeeignet. Folglich geht es um Lösegeld. Die niedrige Forderung sagt mir, dass wohl BZees Kumpel verantwortlich sind.
Ich warte einen Moment und starre ihm unnachgiebig in die Augen. Aber eigentlich wäge ich ab zwischen dem, was ich tun sollte, und dem, was ich in der Vergangenheit getan habe und wieder tun werde. Es ist nicht meine Aufgabe, den Reichtum umzuverteilen oder kriminelle Kleinunternehmer zu ermutigen. Aber die Zeiten sind hart, und die Regierung scheint nichts zu tun, um BZee das Leben zu erleichtern. Genauso wenig wie Moira Lancer.
Sieh’s mal so: Ich geb ihr die Chance, wie ein guter Mensch zu handeln, ob sie’s weiß oder nicht. Und ich bring ihr ihren Hund unversehrt zurück.
Ich nehme mein Telefon und rufe sie an. Als sie rangeht, sage ich: »Wenn Sie jetzt gleich hundertfünfzig Pfund auftreiben können, ist Gus noch heute Abend wieder zu Hause.« Hundert für die Hundeentführer und fünfzig für die Mittelsfrau, also mich, scheinen angemessen.
BZee schaut über den Rand seines Bechers. Ein Eintagsküken könnte nicht unschuldiger gucken.
»Oh mein Gott!«, kreischt Moira. »Sie haben ihn gefunden! Ist er wohlauf? Ist er verletzt? Vermisst er mich?«
Ich kann fast nicht antworten, fürchte loszulachen. Muss mich ermahnen, dass sie zwar eine Idiotin ist, aber ihren Hund wirklich liebt und um ihn trauert.
Ich sage: »Ich hab ihn nicht gesehen. Ich verhandle. Hier geht’s um Bares, keine Diskussionen. Wenn die Sache schiefgeht, ist der Hund der Leidtragende. Sie verstehen mich?«
»Ich will einfach nur Gus heil wiederhaben.« Sie fängt an zu weinen. »Ich zahle, was sie verlangen, und tue, was sie sagen.«
»Dann bringen Sie mir jetzt hundertfünfzig Pfund in gebrauchten Scheinen. Ich bin bis sechs hier.«
Als ich den Anruf beende, sehe ich BZee an. Ich sage: »Sie kommt. Hol den verdammten Hund. Warte zwischen den Bäumen. Übliche Stelle. Ich winke, wenn ich das Geld in der Hand habe. Verscheißerst du mich, war’s das. Okay?«
»Das sagen Sie immer«, beschwert er sich.
»Ich meine es auch immer«, erkläre ich unnötigerweise. »Jetzt hau ab und tu, was du tun musst.«
***
»Kann man denen nicht das Handwerk legen?«, fragt Moira. »Warum können Sie nicht die Polizei einschalten? Wozu habe ich den Tierarzt bezahlt, damit er ihm einen Ohrchip setzt?«
Ich seufze. Jetzt, wo sie Gus fest in den Armen hält, kommen die Beanstandungen. »Die Cops sind nicht interessiert. Außerdem, beim letzten Mal, als die Polizei eingeschaltet wurde, trieb der Hund dann in einem Sack in der Senke. Und die nächsten zwei zurückgebrachten Hunde hatten abgeschnittene Ohren. Einer starb an Blutvergiftung.«
»Wie furchtbar«, ruft sie. »Können Sie denn nichts dagegen tun?«
»Ich habe keine Befugnisse. Sie sind zu mir gekommen, weil Sie wissen, dass ich so was hinkriege. Ich habe Kontakte und sperre die Ohren auf. Aber Gus retten ist alles, wozu ich bereit bin. Sie wollen den Status quo kippen? Na dann viel Glück – die nächsten verängstigten Besitzer werden sich freuen.«
»Aber es ist falsch«, sagt sie störrisch. »Es ist ein Verbrechen.«
»Keine Debatte.« Ich gucke auf die Uhr. Beinahe Zeit, das Sandwich Shack zu schließen und auf meinen nächsten Klienten zu warten – wer immer er ist. Noch so ein kleines Elend, vermute ich; noch ein Symptom dafür, dass alles auseinanderfällt. Denn es fällt alles auseinander. Wenn nicht, säße ich warm und trocken bei der Met, statt in Digbys Sandwich Shack meinen Lebensunterhalt zusammenzukratzen und die Privatschnüfflerin zu mimen.
***
Myles Emerson ist eine Überraschung. Er trägt eine Maske, hat eine Handvoll Desinfektionstücher dabei und ein Antivirenspray, das er großzügig über Tisch und Stuhl verteilt. Obwohl er den Stuhl entseucht hat, bis die Farbe Blasen wirft, holt er ein Stück Plastikfolie aus seinem Rucksack und legt es über die Sitzfläche, ehe er sich niederlässt. Sein Scheitel ist mit dem Lineal gezogen, er trägt OP-Handschuhe und Papierüberzieher über den Schuhen.
Ich gucke zu, wie er den Tisch so umgestaltet, dass Salz, Pfeffer, Zucker und Serviettenhalter exakt in der Mitte und im gleichen Abstand zueinander stehen. Das alles braucht Zeit. Ich sage: »Ich wollte Ihnen eigentlich ein Heißgetränk anbieten, aber ich vermute, Sie würden ablehnen.«
»Ich habe mir was Eigenes mitgebracht«, sagt er.
Also braue ich mir einen starken Tee und er gießt aus einer spacigen Thermoskanne etwas in eine Edelstahltasse, das nach popligem heißem Wasser aussieht. Um Zeit zu sparen, stelle ich meinen Stuhl exakt gegenüber von seinem und mindestens zwei Meter entfernt auf. Ich kann mich nicht bremsen und sage: »Ist es anstrengend, Sie zu sein?«
Trotz der Maske meine ich zu sehen, dass er lächelt. Er sagt: »Danke, dass Sie das bemerken. Die meisten Leute bekunden lediglich Ungeduld.«
»Oh, das mach ich bestimmt bald auch«, erwidere ich. »Ich hab mir sagen lassen, ich hätte beschissene Umgangsformen. Soll ich mich im Voraus entschuldigen?«
»Nicht nötig, ich bin daran gewöhnt. Ich bin schon seit der Pubertät so. Die Krankheit hat es natürlich verschlimmert.« Er schaut nach unten auf seine Hände, die präzise gefaltet in seinem Schoß liegen. Ich merke, dass er atmet wie meditationsgeübte Leute.
Ich will laut seufzen und sagen: ›Verdammt, komm in die Hufe‹, aber diesmal reiße ich mich am Riemen. Wenn ich sein Verhalten mal als Symptom einer extremen Angststörung deute, kann ich ihm im Stillen gratulieren, denn dafür schlägt er sich wacker. Oder mir gratulieren, dass ich die Klappe halte. Allerdings frage ich mich doch, ob dies einer von Digbys Versuchen ist, mich in den Wahnsinn zu treiben.
Er sieht hoch und beginnt: »Ich bekomme ständig Betrugsanrufe. Jede Menge. Sie bestimmt auch – ich glaube, das ist eine Folge der Armut.«
Ich nicke. Tatsächlich haben Drohungen und Versuche, Kontodaten zu klauen, in den letzten Jahren stark zugenommen. Die Leute müssen sehr viel wachsamer sein, zugleich sind sie sehr viel verletzlicher.
Er fährt fort: »Aber in jüngster Zeit gab es eine Handvoll Anrufe, die mich besonders beunruhigen.« Aus der Innentasche seines Mantels zieht er ein Handy, säubert es ebenso wie seine Hände mit einem antibakteriellen Wischtuch und tippt auf dem Bildschirm herum.
Eine Frauenstimme sagt: »Dies ist eine Debitkarten-Betrugswarnung: Von Ihrem Konto wurde für einen einzelnen Einkauf im Ausland der Betrag von zweitausendachthundert Pfund abgebucht. Wenn diese ungewöhnliche Aktivität eine nicht autorisierte Transaktion darstellt, die Sie nicht selbst vorgenommen haben, drücken Sie auf Ihrer Tastatur die Eins …« Er stoppt die Aufnahme und guckt mich an.
Ich gucke zurück, enttäuscht. So was kann ich nicht stemmen. Wenn das Betrugsdezernat, das Amt für Verbraucherschutz oder sonst eine Betrugsbekämpfungsinstanz es nicht schaffen, grenzübergreifende Abzocke in den Griff zu kriegen, kann ich es auch nicht.
Er deutet meinen Gesichtsausdruck richtig. »Keine Sorge«, sagt er. »Ich schicke Sie nicht in die Fremde, um einen internationalen Betrugsring zu zerschlagen.«
»Warum denn nicht?«, frage ich und klimpere mit den Wimpern. »Sehe ich nicht aus wie 007?«
»Natürlich tun Sie das«, sagt er todernst. »Und ich bin sicher, Ihre Eiersalatsandwiches sind geschüttelt, nicht gerührt.«
Wie beruhigend, denke ich. Er kommt vielleicht meschugge rüber, aber er ist es nicht. »Also was kann ich für Sie tun?«, frage ich. »Ich nehme an, Sie haben auf Ihrer Tastatur die Eins gedrückt, nur um zu sehen, was passiert?«
»Richtig. Und bekam eine sehr schlechte Verbindung zu jemandem, für den Englisch alles andere als die Muttersprache ist. Der Geräuschkulisse nach war es ein überfüllter Raum, vielleicht sogar ein Bahnhof. ›Entschuldigung‹, habe ich gesagt. ›Falsche Nummer.‹ Und aufgelegt. Es war eindeutig ein Phishing-Versuch. Also …« Er hält inne.
»Also?«
»Also wie würden Sie ganz subjektiv die Stimme in der Nachricht beschreiben, die ich Ihnen gerade vorgespielt habe? Sagen Sie mir einfach, was für eine Sorte Frau Sie sich vorstellen, wenn Sie so eine Stimme hören.«
Ich revidiere mein schmeichelhaftes Urteil über seinen Geisteszustand und starre ihn nur an.
»Tun Sie mir den Gefallen – ich frage aus gutem Grund.« Wieder liest er meine Gedanken. Vielleicht ist er es gewöhnt, dass Leute ihn für Klapsmühlenfutter halten.
»O-kay«, sage ich vorsichtig. »Na, sie klang nach Bildung, Mittelklasse, Engländerin; nicht jung – vielleicht Mitte dreißig; ziemlich nett und herzlich und dabei professionell. Ist das die Art von Antwort, auf die Sie aus sind?«
»Ja«, sagt er, »und ich bin ganz Ihrer Meinung. Warum sollte nun aber eine Frau, wie Sie sie beschreiben, für eine Verbrecherbande arbeiten, die Menschen erschreckt, damit sie Kontodaten preisgeben und infolgedessen alles verlieren?«
»Arbeitslose Schauspielerin?«, sage ich ohne nachzudenken. »Verzweifelt auf der Suche nach einem Job, egal was.« Wie üblich denke ich dabei an mich selbst. Da sehe ich das Glitzern in seinen Augen. »Sie glauben, Sie kennen die Stimme, richtig?«
4
Myles sagt: »Dies ist die Geschichte einer modernen dysfunktionalen Familie.«
Ich hebe die Hand. »Selbst bei altmodisch funktionalen Familien schnalle ich die Beziehungen nicht. Darf ist aufzeichnen?«
Er nickt und wartet, während ich die Sprachaufnahme starte. Dann sagt er: »So schlimm ist es gar nicht. Meine Mutter hat Ginas Vater geheiratet, als ich sieben war und Gina zwanzig. Ich fürchte, das ist Ginas Stimme, die da vor einer ›unautorisierten Transaktion‹ warnt. Sie ist meine Stiefschwester. Sie müsste jetzt dreiundvierzig sein.«
»Okay«, sage ich. »Keine Blutsverwandtschaft.« Ich denke, dann ist er also dreißig, nur ein paar Jahre älter als ich. Er wirkt jünger; seine Haut ist blass und faltenlos, als ob er unter der Erde lebt. Seine Augen sind treuherzig blau, aber er hat etwas undefinierbar Seltsames an sich. Ich kann nicht den Finger darauf legen, aber als Lehrer würden ihm die Kinder die Hölle heißmachen.
»Korrekt«, sagt er, »keine Blutsverwandte. Aber sie war gut zu mir, als ihr Bruder und ihre Schwester es nicht waren. Sie hegten ganz klassisch einen Groll gegen meine Mutter und ließen diesen Groll an mir aus.«
Ich unterbreche ihn wieder. »Ist Emerson Ihr Familienname oder der Ihrer Stieffamilie?«
»Meiner. Ich habe ihn wieder angenommen, als ich achtzehn wurde. Also ja, Gina hieß Gina Margaret Turner.«
»Gina von Georgina?«
»Nein. Einfach Gina. Und richtig: Ich glaube, ich will, dass Sie sie finden. Also ja, das ist der Name auf ihrer Geburtsurkunde.«
Wo anfangen? Ich sage: »Worin besteht das Problem?«
»Mein Stiefvater ist tot, meine Mutter hat Alzheimer, Stiefschwester Emma Turner lebt in Neuseeland und Stiefbruder Gordon Turner ist ein feindseliger Depp.« Er hält inne und desinfiziert wieder seine behandschuhten Finger. »Heute habe ich zum ersten Mal seit fast fünf Jahren das Haus verlassen, und das ist verflucht stressig. Wenn es Ihnen also nichts ausmacht, würde ich es gern auf meine Art erklären. Wir werden uns nicht noch mal persönlich treffen. Wäre WhatsApp für Sie in Ordnung?«
»Ja. Aber bevor es losgeht, müssen wir ein paar Eckdaten klären.« Ich meine natürlich Geld. Seine Klamotten sehen nach Traditionsgeschäft aus und seine Maske ist so ziemlich die teuerste auf dem Markt, aber das heißt nicht, dass ein Typ auch postwendend zahlt – vor allem wenn ich scheitere. Es kann sich um einen stinknormalen Vermisstenfall handeln oder aber um eine komplizierte und zeitaufwendige Suche.
»Ich berechne Achtstundentage«, erkläre ich ihm. »Ich führe Buch über meine Zeiten. Ich bin keine Anwältin, eine Stunde sind bei mir also sechzig Minuten. Und ich will einen Vorschuss in bar.«
»Man sagte mir bereits, dass Sie eine ewig gestrige Hardlinerin sind.« Er klingt, als würde er grinsen. »Aber niemand hat behauptet, dass Sie Geld unterschlagen. Nicht mal Ihr Boss, Digby, hat angedeutet, dass es hier Unstimmigkeiten bei den Einnahmen gibt.«
»Bloß weil er mich nie erwischt hat.« Ich lasse es wie einen Witz klingen und er lacht. Aber die Verköstigung von BZee vor knapp zwei Stunden war ein Diebstahlsdelikt.
Er sagt: »Ich bin Digby nicht begegnet und habe es auch nicht vor. Er hat Ihnen keine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben. Aber meine Patentante meint, er will nicht, dass Sie für jemand anderen arbeiten als ihn. Sie sagte, er sei ein ›komischer kleiner Vogel‹. Aber er erwähnte, dass ihn niemand mehr übers Ohr zu hauen versucht, seit er eine Expolizistin auf der Lohnliste hat. Und er sagte, dass die Expolizistin in Teilzeit ›läppische kleine Fälle bearbeitet, für die die Polizei sich zu fein ist‹.«
Ich starre ihn an. »Die ›läppischen Fälle‹ sind die kleinen Tragödien, die normale Leute in den Wahnsinn treiben. Meine Erfolge landen nicht bei Gericht, aber sie sind ein Trost für Menschen, die sich mit ihren Problemen sonst nirgendwohin wenden können.« Sogar für meine Ohren klinge ich wie eine scheinheilige, schwülstige Schnepfe, deshalb füge ich hinzu: »Und ich will trotzdem einen Vorschuss in bar.«
Er oder seine Patentante haben sich im Vorfeld über mich schlau gemacht und er hat das Geld dabei. Ich ziehe OP-Handschuhe an, desinfiziere einen Kuli und quittiere den Empfang des blütenweißen Umschlags mit fünfundzwanzig nagelneuen Zwanzig-Pfund-Scheinen.
»Also gut«, sage ich, »was kann die Polizei nicht für Sie tun?«
»Wenn man nicht den Notruf wählt, ist es praktisch unmöglich, mit einem echten Menschen zu sprechen. Aber als ich bei meinem örtlichen Revier endlich durchkam, hörte ich den Mann am anderen Ende brüllen: ›He, Sarge, ein Durchgeknallter wegen noch so einer scheiß vermissten Person.‹ Da habe ich aufgelegt.« Er schaut altmodisch drein und fügt hinzu: »Wie nicht anders zu erwarten, bin ich empfindlich, wenn man mich durchgeknallt nennt.«
»Ich schreib’s mir hinter die Ohren«, sage ich. Er bezahlt mich nicht für mein berühmtes Taktgefühl und meine Diplomatie, und ich steige besser so ein, wie ich weiterzumachen gedenke.
Er wartet und beäugt den Umschlag, als könnte er einen Fehler rückgängig machen. Ich verstaue ihn sicher in der Gesäßtasche meiner nicht gerade hygienischen Jeans.
»Um Zeit zu sparen, habe ich ein Dokument mit den bekannten Fakten über Gina vorbereitet. Es enthält auch die Adressen ihrer Geschwister, meine Kontaktdaten und die meiner Patentante, außerdem alles, was ich noch über ihre Freundinnen und Freunden weiß, et cetera.« Er schiebt einen weiteren Umschlag über den Tisch.
»Gut«, sage ich und nehme ihn an mich. »Jetzt erzählen Sie mal, warum Sie ›fürchten‹, die Stimme in der Sprachnachricht könnte Ginas sein.«
»Weil sie, wenn sie es ist, mindestens einmal für sehr finstere Typen gearbeitet hat. Die Banden, die diese Sorte Finanzbetrug begehen, sind keine Menschenfreunde, die ihre Mitarbeiter anständig behandeln. Ausbeutung heißt ihre Devise.«
Ich nicke.
»Ich will wissen, ob sie in Schwierigkeiten steckt. In meinem Leben gab es nicht so viel Großmut, dass ich bedenkenlos eine Person aufgebe, die unter schwierigen Bedingungen gut zu mir war.«
»Weiter.«
»Mein erster Schultag, nachdem Mutter und ich zu den Turners gezogen waren: Ich ging in die Grundschule, Emma und Gordon auf die weiterführende Schule in derselben Straße. Sie sollten mich mitnehmen. Aber als der Bus kam und wir drei einstiegen, hat mich Gordon im letzten Moment rausgeschubst. Emma hat mir bloß lachend zugewinkt, als der Bus wegfuhr. Ich war in einer Pfütze im Rinnstein gelandet, und da saß ich nun, pitschnass, heulte und wusste nicht, was ich tun sollte.
Gerettet hat mich Gina, die auf dem Weg zur Hochschule war. Sie machte mich einigermaßen sauber, beruhigte mich und brachte mich zur Schule. Sie lieferte mich im richtigen Klassenzimmer ab, entschuldigte sich charmant für die Verspätung, erklärte sie mit ›einem Unfall‹ und versprach, mich nach der Schule am Tor abzuholen. Und das tat sie. Sie ermahnte mich, den Vorfall niemals vor einem anderen Familienmitglied zu erwähnen – auch nicht Mutter – und so zu tun, als wäre ich allein mit allem klargekommen. Sie sagte, das Einzige, was gegen Mobbing hilft, ist, so zu tun, als hätte es keine Auswirkungen.« Er hält inne, wartet auf meinen Kommentar.
Ich kriege es hin, nicht in meinem sarkastischsten Ton ›Och, armes Würstchen‹ zu sagen, und er macht weiter.
»Das war der einzige gute Rat, den ich bekam. Ich glaube, meine Mutter und Mr. Turner wollten nicht wahrhaben, dass ihr Versuch, zwei Familien zusammenzuführen, gescheitert war. Aber letztlich ist meine Mutter eingeknickt und hat mich aufs Internat geschickt.« Er unterbricht sich. »Entschuldigung, eigentlich war ja Gina das Thema und nicht, warum sie mir so viel bedeutete.
Also, als ich sieben war, war sie zwanzig und startete in ihr zweites Jahr an der Schauspielschule. Selbst ihr Vater, der ihre Berufswahl immer strikt ablehnte, musste zugeben, dass sie Talent hatte. Ihr Bruder und ihre Schwester, beide elende Schleimer, machten sich über sie lustig, dass sie ›eine Show abzog‹, ›dramatisierte‹ und ›um Aufmerksamkeit buhlte‹. Wie immer bestärkte meine Mutter ihren Mann in seiner kleinkarierten Meinung über den Beruf. Gina muss sich von ihrer leiblichen Familie im Stich gelassen gefühlt haben. Ich selbst habe sie natürlich verehrt.
Die erste Aufführung, zu der sie mich mitnahm, war ein Weihnachtsmärchen, Aschenputtel, und obwohl sie nur eine kleine Rolle hatte, konnte ich nicht fassen, wie wunderbar und witzig sie war. Danach hat sie mich hinter der Bühne allen vorgestellt; und alles kam mir überlebensgroß vor – Männer in Frauenkleidern, Frauen in Seidenstrümpfen und Pailletten, alle in einem leutseligen Rausch, wo sie selbst das Lob eines kleinen Jungen begierig aufsogen. Ich beschloss, ebenfalls Schauspieler zu werden. Was weder Gina noch mir bei ihrer Familie und meiner Mutter Pluspunkte brachte.«
Er hat wohl meine skeptische Miene bemerkt, denn er sagt: »Ja, absurd. Mit etwa zwölf fielen mir nach einer schweren Grippe alle Haare aus und ich entwickelte eine Obsession in Bezug auf Keime und fing an, mir zwanghaft die Hände zu waschen – ein ziemliches Hemmnis für jeden, der von einer Zukunft im Ensemble träumt.« Er erhascht meinen Blick auf seinen gepflegten dunklen Schopf und fügt hinzu: »Es ist nachgewachsen, das ist kein Fifi.«
Er ist ein bisschen zu fix für meinen Geschmack. Meine Expertise im Zuhören habe ich von einem alten Bullen gelernt, der sagte: ›Ohren auf, Mund zu, Pokerface, und um Himmels willen nie mit einem Zeugen streiten oder ihn auslachen.‹ Den Mund zu halten, das können fast alle bestätigen, fällt mir am schwersten. Bis eben dachte ich, dass ich mich ganz gut schlage.
Ich sage: »Okay, Schlaumeier, Sie beschreiben, wie sich Gina von einer Familie entfremdet hat, die auch Sie nicht recht akzeptieren konnte – das verbindet, nehme ich an?«
»Genau. Aber ich erzähle Ihnen auch, warum sie und ich den Kontakt verloren. Ich wurde aufs Internat geschickt und später auf ›Förderschulen‹, die mutmaßlich mit meinem Zustand umgehen konnten.«
»Und nichts hilft?«, frage ich.
»Eine breite Palette angsthemmende Medikamente kombiniert mit Verhaltenstherapien. Unter normalen, ruhigen Bedingungen habe ich es im Griff. Aber eine Pandemie?« Er schnaubt verächtlich. »Und der Stress und die Ängste, die mit einer Wirtschaftskrise einhergehen? Keine Chance.«
»Also müssen Sie vorerst damit leben?«
»Eigentlich habe ich einen guten Tag«, merkt er an und sieht aus, als überrasche er sich damit selbst. »Ich bin hier, oder? Und ich ertrage Sie. Sie sind nicht gerade die einfühlsamste, unübergriffigste Person, die mir je begegnet ist.«
»Danke«, sage ich. »Ich geb mein Bestes.« Ich bin müde und manierenmäßig nicht in Hochform. Ich habe über zwölf Stunden am Stück im Sandwich Shack gestanden. Und Invaliden hätscheln gehört eh nicht zu meinen großen Stärken.
5
Eins muss ich zugeben: Neurosen-Myles hat seine Störung vorteilhaft genutzt. Er hat mich mit einem detaillierten, getippten Informationsblatt versorgt. Soweit ich Ignorantin das beurteilen kann, gibt es nicht mal ein falsch gesetztes Komma. Er hat sogar das eine oder andere Semikolon eingestreut. Das, finde ich, ist Angeberei.
Mit Myles’ fünfhundert Tacken in der Tasche, wo sie sich an das Honorar schmiegen, das Moira Lancer mir für das »Finden« von Gus gezahlt hat, gönne ich mir auf dem Heimweg ein indisches Essen zum Mitnehmen. Scharfe indische Gerichte sind die einzige Möglichkeit, Fleisch an meinen veganen Vermieterinnen vorbeizuschmuggeln. Glaub mir, die riechen einen Cheeseburger auf eine halbe Meile Entfernung – das hab ich in der ersten Woche rausgefunden, als ich um ein Haar auf die Straße gesetzt worden wäre.
Ich lecke mir Jalfrezi-Soße von den Fingern und beschließe, als Erstes die Patentante meines reinlichen Klienten anzurufen. Sie ist die Einzige auf der Liste, der ich mich nicht erklären muss, und ich bin müde. Also tippe ich Sophia Smithsons Nummer ein und höre: »Wenn das eine Betrugsmasche ist oder der Versuch, mir etwas zu verkaufen, seien Sie gewarnt – ich habe überhaupt kein Geld. Also hauen Sie ab und belästigen Sie jemand anders.« Es ist keine automatische Ansage.
Als ich mit Lachen fertig bin, sage ich: »Ich find’s auch nett, mit Ihnen zu reden, Ms. Smithson. Myles Emerson hat mir Ihre Nummer gegeben. Hier ist Hannah Abram, die –«
»Oh, richtig«, sagt sie. »Ich weiß, wer Sie sind. Was kann ich für Sie tun?« Sie klingt eher, als wollte sie mir etwas tun.
»Na ja, das meiste, was mir Myles aus erster Hand über seine Stiefschwester sagen kann, hört mit knapp sechzehn auf. Alles andere stammt von den Turners und klingt nach Rechtfertigungen dafür, dass sie sie verstoßen haben. ›Für mich ist sie tot‹, hat der Vater, glaub ich, gesagt.«
»Gina war eine Idiotin«, sagt Sophia Smithson ungeduldig. »Was hat sie denn erwartet? Sie heiratet einen schwulen kubanischen Balletttänzer, bekommt gleichzeitig Arbeit bei einem Softpornoproduzenten in Paris und glaubt, dass dieses bürgerliche Schlangennest das billigt und sie unterstützt. Die haben sie fallen lassen.«
Bevor ich einen Kommentar abgeben kann, höre ich ein Klacken, als das Telefon auf einer harten Unterlage landet. Dann das Gluckern eines Getränks, das eingeschenkt wird. Ich seufze und warte.
Sophia seufzt ebenfalls und sagt: »Aber sie war lieb zu Myles – das muss ich ihr lassen. Womöglich nur, um die anderen zu ärgern. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, warum Irma, seine Mutter, in so eine Familie eingeheiratet und ein aufgewecktes Kind wie Myles der Gehässigkeit und Kleingeistigkeit der Turners ausgesetzt hat. Vielleicht konnte sie ein Leben ohne Ehemann nicht ertragen, egal wie kontrollsüchtig und borniert er war. Solche Frauen gibt es.
Tja, der grässliche kleine Mann ist jetzt tot, ein Glück. Die Tochter ist einem Rohstoffhändler ans andere Ende der Welt gefolgt. Der grimmige Gordon kämpft mit mir immer noch um das, was er sein ›Erbe‹ nennt, das seiner Ansicht nach für Irmas Pflege vergeudet wird. Als Irma gemerkt hat, dass sie allmählich plemplem wird, hat sie zum Glück mir eine Vorsorgevollmacht erteilt. Hätte man Gordon die Pflege überlassen, läge sie jetzt auf der Straße.«
Sophia klingt wie eine Dozentin, unmöglich, sie zu unterbrechen. Als sie Luft holt, werfe ich mich in die Bresche. »Hat Irma zu Gina Kontakt gehalten, nachdem die Familie sie verstoßen hatte?«
»Irma war verblendet«, sagt Sophia. »Sie dachte, sie könnte Frieden stiften und diese Verräter zum Einlenken bringen. Dabei konnte jeder sehen, dass sie froh waren, ein schwarzes Schaf zu haben, an dem sie sich abreagieren konnten. Niemand hörte auf sie; sie war schließlich keine ›echte Turner‹. Also ja, sie versuchte, zu Gina Kontakt zu halten, nachdem die Turners klargestellt hatten, dass es keine Versöhnung geben würde. Ich denke, sie wusste sehr viel mehr über Myles’ Misshandlung durch die Turners, als sie je eingestanden hat. Ich –«
»Warum in aller Welt hat sie sich nicht Myles geschnappt und ist gegangen?«, platze ich dazwischen. Anders ist mit dieser autokratischen alten Schachtel kein Dialog möglich.
»Ich sagte es bereits«, entgegnet sie ungeduldig. »Hören Sie doch zu. Sie wollte verheiratet sein – egal wie unbehaglich es für sie und Myles war.
Und wo wir schon beim Thema Unbehagen sind, sollte ich offen aussprechen, dass mir die Maßnahme, die Myles jetzt ergreift, nicht ganz geheuer ist. Sie müssen wissen, dass er obsessiv werden kann, wenn er ein Projekt verfolgt. Was gedenken Sie zu tun, wenn Sie alle vertretbaren Wege beschritten haben und er Sie bedrängt weiterzumachen?«
»Warum nicht das Pferd vom Schwanz her aufzäumen?«, blaffe ich. »Ich hab noch nicht mal angefangen. Und bei einem Wachhund wie Ihnen bin ich sicher, dass Sie mich beim geringsten Anzeichen von Schindluder erschießen und vierteilen werden.«
Sie kichert unvermittelt, aber bestreitet es nicht. »Irma hielt ziemlich regelmäßigen Kontakt, bis Gina nach Kuba ging. Sie hat Alessandro nur geheiratet, damit er ein befristetes Visum bekommt. Sie dachte wohl, dass es auch andersrum funktioniert. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber als Irma das nächste Mal von ihr hörte, war sie in Miami.«
Sie hält inne. Ich höre Eiswürfel klirren und frage schnell: »Gab es eine Scheidung?«
»Nicht dass ich wüsste. Tja, das nachzuprüfen könnte sich lohnen. Sie kann nicht wieder heiraten, solange sie von Alessandro nicht geschieden ist. Offiziell ist sie vielleicht immer noch Gina Ruiz. Oder sie nennt sich wieder ›Turner‹, auch ohne Scheidung. Oder sie ist wiederverheiratet und kann jeden x-beliebigen verfluchten Namen haben. Viel Glück damit.«
Während ich etwas hinkritzle, das Ruiz nahekommt, werfe ich ein: »Davon hat Myles mir nichts erzählt.«
»Irma hat ihn mit nichts behelligt, was ihn ihrer Meinung nach aufregen könnte. Als Teenager und in seinen frühen Zwanzigern war sein Zustand instabil. Sie meinte, er müsse Stress und Aufregung vermeiden.«
»Wie geht es Irma jetzt?«, frage ich. »Könnte ich sie vielleicht besuchen?«
»Sie hat gute und schlechte Tage, wie Sie sich denken können. Aber nein, ich werde nicht gestatten, dass Sie mit einer Frageliste bei ihr reinschneien, wann immer es Ihnen passt. Ich bestehe darauf, dass Sie vorab bei mir anfragen, damit ich Vorkehrungen treffe, und dass ich bei jedem Besuch dabei bin. Wäre das akzeptabel?«
»Spreche ich mit derselben Sophia Smithson, die Irmas verstorbenem Gatten Kontrollsucht unterstellt?«, sage ich, ehe ich mich bremsen kann.
»Ganz sicher sogar«, sagt sie. »Und das sollten Sie sich merken.« Damit trennt sie die Verbindung und lässt mich mit einem Mund voll unausgesprochener Beschimpfungen zurück.
Ich muss aufhören, andere das letzte Wort haben zu lassen, auch wenn es Klientinnen sind. Ich fläze mich mit hochgelegten Füßen auf mein schmales Bett. Was will ich mehr? Ich will ein Auto, das meinen Ex grün anlaufen lässt vor Neid. Ich will einen Partner, der nicht heimlich Duschfotos von mir macht und dann als Lachnummer an die Leute vertickt, mit denen ich arbeite. Ich will einen anständigen Job mit Krankenversicherung oder genug Geld, um meinen eingeklemmten Weisheitszahn behandeln zu lassen. Ich will …
6
Am nächsten Morgen warte ich, bis Eleanor und Olive weg sind, ehe ich aufstehe und ausgiebig und verschwenderisch dusche. Ich werde erst nach zehn zur Arbeit antreten. Von Frühschichten hab ich die Nase gestrichen voll. Digby kann Maden essen, bevor ich wegen seines unvorstellbaren Sexlebens noch mehr Schlaf einbüße. Digby und Dulcie – er ist doppelt so alt und halb so groß wie sie.
Erstaunlich, wie kühn ich werde, wenn ich einen dicken Packen Knete in der Tasche habe.
Ich bin mitten bei der Online-Suche nach Gina Turner, Gina Margaret Turner, Gina Ruiz, Gina Margaret Ruiz, Gina Turner Ruiz und Gina Margaret Turner Ruiz, als Digby anruft. Er sagt: »Wo zur Hölle bist du?«
»Hab’s dir doch gesagt«, sage ich. »Ich hab zwei Wochen lang jeden Tag die Frühschicht gemacht und mehrere Tage auch die Spätschicht. Heute nehm ich frei. Ich hab’s dir gestern gesagt.« Habe ich nicht, aber die Absicht zählt auch. »Du fette Kapitalistenkröte«, schließe ich, »du verstößt gegen die Vorschriften für anständige Arbeitsverhältnisse. Schieb dir das in deinen Gierschlund und erstick dran.«
»Du bist gefeuert!«, brüllt er.
»Zu spät, hab schon gekündigt«, brülle ich zurück. Ich lege auf. Die einzige Chance, einen freien Tag zu ergattern, besteht manchmal darin, dass Digby mich abserviert.
Ich grüble über den neuen Auftrag nach. Mein Klient meint, er hat die Stimme seiner Stiefschwester erkannt – in der Aufnahme eines Phishing-Anrufs, der das Opfer mit der Drohung, sein Geld einzubüßen, dazu treibt, noch viel, viel mehr aufs Spiel zu setzen. Schuld ist die rasant zunehmende Gier. Als ich heute Morgen mein Laptop hochfuhr, musste ich zwei Sonderangebote für Viagra löschen; eine andere Sorte Angebot von Yolanda, die mich süß fand und versprach, all die schmutzigen Dinge mit mir zu machen, die andere Frauen verweigern; den Versuch einer Versicherungsgesellschaft, mir Angst einzujagen, damit ich mich gegen Atomkrieg und Weltuntergang durch Klimanotstand versichere – je nachdem, was zuerst eintritt; und einen Anlageexperten, der meine Ersparnisse in weniger als einem Monat verdoppeln wollte. Ich habe diverse Anrufe verpasst: ein Verkäufer für Doppelverglasung, jemand wollte meine Einfahrt asphaltieren, und ein Mann versprach meinen Wasseranschluss zu analysieren, weil es Drohungen gab, ihn mit einer extrem gefährlichen Organophosphatverbindung zu verseuchen.
Die sogenannten Ordnungshüter sind praktisch zahnlos gegen die gierigen, mahlenden Kiefer des Online-Kapitalismus. Erstens sind die Täter immer mindestens einen Schritt voraus, und zweitens handelt es sich in der Regel um internationale Machenschaften, teils sogar von ausländischen Regierungen finanziert, die auf Destabilisierung abzielen. Also sorry, Leute, schärft einfach euren angeborenen Verstand und verdächtigt alle, die ihr nicht kennt, euch beklauen zu wollen.
Aber zurück ans Werk. In Großbritannien ist unter keinem von Ginas Namen ein Sterbeeintrag oder eine weitere Eheschließung aktenkundig. Was natürlich keine der mannigfaltigen Alternativen ausschließt, darunter mein Favorit: ein Quickie in Vegas.
Mein Kontakt bei der Kfz-Zulassung teilt mir mit, dass vor vier Jahren ein Auto auf Gina Margaret Turner angemeldet wurde. Das ist der Name in ihrem Führerschein – sie hat sich also den Zirkus erspart, ihn zu ändern. Er gibt mir eine Adresse. Jetzt habe ich einen Funken Hoffnung, dass ich hierzulande eine Fährte aufnehmen kann. Überall sonst wäre ich nutzlos: eine transkontinentale Privatdetektivin bin ich ganz bestimmt nicht.
Soweit ich sehe, hat Gina kein Profil auf Facebook, Twitter, TikTok, Instagram oder in irgendeinem anderen mir bekannten asozialen Netzwerk. Auch kann ich keine Website von ihr finden. Bei einer Schauspielerin ein schlechtes Zeichen. Ihre drei Freundinnen von der Schauspielschule sind präsent: eine kriegt kleine Rollen vor allem in historischen TV-Dramen wie Downton Abbey; eine andere spielt kleine Rollen in Polizei- und Arztserien; die dritte hat die Schauspielerei ziemlich schnell an den Nagel gehängt, wurde Mitglied einer Band und starb ein paar Jahre später an Drogenmissbrauch. Das Leben in der Kunst ist hart.
Das alles kostet mich öde Zeit, Rückenschmerzen und Koffein.
Ich ziehe mein Bett ab, pack die Laken und den Großteil meines überquellenden Wäschekorbs zusammen und trage das Ganze zum Waschsalon Clean Machine auf der Hauptstraße. Ich darf weder Eleanors und Olives Waschmaschine benutzen noch ihren Trockner. »Wir hatten schon öfter Probleme mit Mietern wegen unsachgemäßen Gebrauchs.« Das ist die einzige Erklärung, die ich bekommen habe.
Zum Glück mag ich die feuchte Wärme von Waschsalons. Das Klötern und Summen der Maschinen finde ich friedlich, und vom Waschpulvergeruch muss ich nicht niesen. Ich kann dort arbeiten und geschäftsmäßige Gesprächsanfragen an Ginas Freundinnen und Verwandte verschicken. Niemand muss wissen, dass ich gleichzeitig die Wäsche von zwei Wochen nachhole. Und niemand sieht, dass meine von einem heftigen Regenguss durchnässten Haare windschief getrocknet sind und dass ich eine zerrissene Trainingshose trage und mein schlabbriger Pulli an einem Ellbogen ein Riesenloch hat.
Wie der Zufall es will, lerne ich so meinen nächsten Klienten kennen. Er kommt rein wie ein Mann mit einem kaputten Rücken. Ich schätze ihn auf über siebzig, nur dass er eine ziemlich modische Barttracht hat, ein Funkeln in den traurigen Augen und eine Mütze, die ihm jemand mit Sinn für Humor gestrickt haben muss.
Er sagt: »Ich habe Sie in diesem Sandwich-Laden im Volkspark gesehen. Jemand erzählte, Sie waren mal Polizistin.«
Ich warte ab. Er sieht freundlich aus und trotz der schludrig gestrickten Kopfbedeckung beinahe zurechnungsfähig. Aber wie jede weiß, die ihr Geld wert ist, braucht es mehr Beweise als den äußeren Schein.
»Wobei störe ich?«, fragt er und übersieht höflich meine kreiselnden Drecksplünnen. Das Schlimmste wird hoffentlich vom Seifenschaum verdeckt.
Er fährt fort: »Ich habe gehört, dass Sie manchmal Ihr Fachwissen nutzen, um Probleme zu lösen, die die Leute nur ungern publik machen.«
»Klingt ganz nach mir«, sage ich, stopfe mein Telefon in die Tasche und strecke die Hand aus. »Hannah Abram.«
»Carl Barber«, sagt er. Wir schütteln Hände.
»Ein paar Türen weiter ist ein Café, direkt neben dem Tattoo-Studio«, sagt er. »Darf ich Ihnen einen Kaffee ausgeben?«
»Klingt verlockend«, sage ich. »Aber vor einem Monat hat jemand meinen fast neuen Bettbezug aus dem Trockner gemopst. Seither lasse ich meine Wäsche nicht mal unbeaufsichtigt, um mir eine Zeitung zu holen.«
»Verständlich«, sagt er. »Aber es gibt ja auch noch to go.«
»Sind Sie ein Klient oder ein Anmach-Künstler?«, frage ich. »So oder so könnten Sie eine Enttäuschung erleben. Aber wenn Sie meinen professionellen Rat einholen wollen, kostet Sie das einen Flat White und ein Pain au chocolat.«
»Gebongt«, sagt er und verschwindet nach draußen in einen weiteren heftigen Guss.
Ich sollte nicht zulassen, dass ein alter Kerl mit kaputtem Rücken friert und nass wird und sich vielleicht den Corona-Tod holt, während er mir Kaffee und ein Teilchen kauft. Aber er hat es angeboten. Wer bin ich, das womöglich einzige Angebot des Tages abzulehnen? Immerhin bin ich technisch gesehen arbeitslos. Und habe damit mein »Büro« eingebüßt. Eines Tages wird Digby mich nicht wieder einstellen. Vielleicht zieht er bereits Dulcie dazu heran, meinen Posten als unterbezahlte Arbeitssklavin zu übernehmen, allerdings mit Zusatzpflichten, bei deren Vorstellung mein Hirn zu bocken anfängt.
Carl Barber kommt nass, aber mit zwei großen Kaffees und einer erfreulich fettigen Papiertüte zurück. Ich fange an, mich für ihn zu erwärmen.
Sein Problem ist schlicht, aber zermürbend. Verursacht durch jemanden, den er den Mülljustizler nennt. Erst denke ich, er macht Witze, aber nein. Er wohnt im Souterrain eines vierstöckigen Hauses in einer kleinen Straße in der Nähe. Jede Mittwochnacht kippt jemand den für die Abholung am nächsten Morgen rausgestellten Müll übers Geländer auf die Kellertreppe vor seinem Schlafzimmerfenster. Und zwar nicht x-beliebigen ollen Müll, sondern zu lange gelagerten, unsortierten oder nicht ordentlich eingetüteten Müll. Darunter Küchenabfälle, die bei Möwen und Tauben und besonders bei Stadtfüchsen als Drei-Gänge-Menü gelten. Und bei Ratten.
Der arme alte Knacker mag es nicht, dass Ratten so dicht bei seinem Schlafzimmer mümmeln und rammeln. Wer kann es ihm verdenken?
»Es trifft nicht nur mich«, sagt er. »Er oder sie nimmt auch andere Häuser ins Visier. Aber ich bekomme bei weitem die größte Zuwendung. So langsam nehme ich das persönlich. Und es passiert immer in der Nacht vor der Recycling- und Müllabholung. Deshalb muss ich jeden Donnerstag früher aufstehen, Treppe und Kellerabgang saubermachen, den ganzen Abfall neu eintüten und hoffen, dass die Müllabfuhr ihn mitnimmt.«
Beim Erzählen scheint der Alte vor meinen Augen zu altern. Ich sage: »Sie haben keine Ahnung, wer das macht?«
Er schüttelt den Kopf. »Ich bin so lang aufgeblieben, wie ich konnte, und so früh aufgestanden wie möglich, aber ich habe nie jemanden erwischt.«
»Die Stadtverwaltung?«, frage ich. »Die Cops?«
Er schüttelt den Kopf.
»Nur um das klarzukriegen«, sage ich, »was genau soll ich machen?«
»Herausfinden, wer der Mülljustizler ist. Ich will mit ihm oder ihr reden.«
»Hmm«, mache ich. »Wissen Sie, diese Aktionen sehen für mich recht zwanghaft aus und nicht gerade vernünftig. Gibt es in Ihrer Straße keine Kameras?«
»Es gibt eine an dem Ende zum Volkspark hin, wo die teuersten Häuser stehen. Aber das ist nur Show – die funktioniert schon seit Jahren nicht mehr.«
»Wie sieht’s mit Nachbarschaftswache aus?«
»Es ist keine sehr nachbarschaftliche Nachbarschaft«, sagt er traurig. »Heißt das, Sie wollen den Auftrag nicht?«
»Nein. Aber womöglich muss ich ein, zwei Nächte Ihr Haus observieren, und das kostet. Außerdem ist so eine gestörte Person vielleicht niemand, dem man allein auf die Pelle rücken will.«
Plötzlich schnurrt mein Telefon. »Entschuldigung«, sage ich zu Carl. Es ist eine Nachricht von Ginas Bruder Gordon. Sie lautet: »Da Gina nicht den Anstand hatte, letztes Jahr zur Beerdigung meines Vaters zu kommen, kann sie meinetwegen in der Hölle schmoren.«