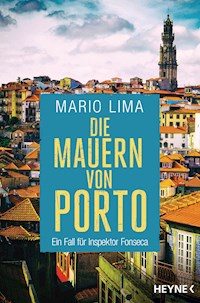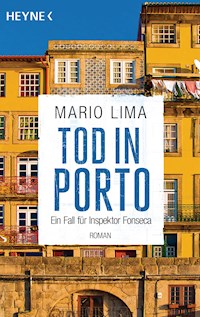Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Serie: Inspektor Fonseca
- Sprache: Deutsch
Ein vielschichtiger Fall. Ein besonderes Land: Portugal. Die alte Hafenstadt Porto, am Morgen nach einem heftigen Herbststurm. Straßen sind überflutet, der Verkehr ist zusammengebrochen. Auch bei der Mordkommission stecken die meisten im Stau, als die Meldung eingeht: Ein Leichenfund in einem abgelegenen Haus am Atlantik. Für Ana Cristina, frisch von der Polizeischule, ist das die Chance, endlich an einer richtigen Mordermittlung beteiligt zu werden. Diesmal ist sie dabei, in dem ersten Wagen, der am Tatort eintrifft. In dem Haus liegen zwei Tote, ein Mann und eine Frau. Ein rätselhafter Doppelmord, der immer neue Fragen aufwirft. Eine Spur führt zurück in die dunkle Vergangenheit Portugals, die noch gar nicht so lange her ist. Ana Cristina setzt alles daran, ihren ersten Fall zu lösen. Doch selbst der erfahrene Inspektor Fonseca stößt hier an seine Grenzen. Das Verbrechen hat Dinge in Gang gesetzt, die nicht mehr aufzuhalten sind. Unbemerkt bahnt sich ein Drama an, das tödlich enden wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 663
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Glossar der portugiesischen Ausdrücke im Anhang
Sie waren jetzt fast da. Links in der Dunkelheit lag schon der offene Atlantik. Der Regen wehte beinahe waagerecht durch das Scheinwerferlicht und prasselte wie irrsinnig gegen die Wagenseite.
Der Fahrer hielt nervös das Lenkrad umklammert und hatte sich vorgebeugt, um besser sehen zu können. Sturmböen rüttelten an dem Lieferwagen. »Hätte ich mich bloß nie darauf eingelassen!«
»Das hättest du dir früher überlegen müssen. Also reiß dich jetzt zusammen!« Der Mann auf dem Beifahrersitz saß zurückgelehnt da, beide Hände in den Taschen seines Regenmantels. »Du weißt doch: wir müssen es tun. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht.« In der Tasche schloss er einmal probeweise seine Hand um den Griff des Messers. »Es wird schon gutgehen. Wir müssen nur die Nerven behalten. Du auch!«
»Ja, ja, ich versuch’s ja...«
Vor ihnen tauchten weißgetünchte Mauern aus der Dunkelheit auf. Der Fahrer bremste und bog in eine schmale Einfahrt. Dahinter traf der Regen sie mit voller Wucht von vorn. Zwei verschwommene Lichter, das war alles, was von den beiden Häusern zu erkennen war.
Der Lieferwagen fuhr bis hinter das zweite Haus. Dort hielt er an, der Fahrer machte Motor und Scheinwerfer aus. Der andere fragte: »Hast du den Schlüssel?«
»Ja, habe ich.«
»Dann los!«
Sie stiegen gleichzeitig aus, klappten die Wagentüren hinter sich zu und rannten geduckt zum Haus hinüber. Unter dem kleinen Vordach trafen sie wieder zusammen. Der Fahrer steckte den Schlüssel ins Schloss.
Der andere hielt sich dicht hinter ihm. Ein leises Klacken, das Öffnen der Haustür: das war das Signal. Er presste dem Fahrer die Hand auf den Mund und stach mit dem Messer zu. Ein einziger Stich, von hinten ins Herz, glatt und sauber.
Der Fahrer gab kaum einen Laut von sich. Der Mann spürte, wie er in seinem Arm erschlaffte, und ließ ihn vorsichtig vornübersinken.
Er sah sich kurz um. Dann packte er den Toten, schleifte ihn in den Flur und schloss die Tür hinter sich. Ein, zwei Atemzüge lang stand er im Dunkeln und horchte. Er war da, wo er hinwollte. Er war im Haus.
In dem Moment ging das Licht an.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
1
Porto, einundzwanzigster November.
Auch am Morgen hielten Wind und Regen unvermindert an. Im Westen schlug eine mächtige Brandung an die Küste. Unaufhörlich donnerten die Brecher auf die Felsen und überspülten den Strand. Die Gischt wehte bis über die Straße, und bei den großen Palmen der Uferpromenade schwangen alle Wedel nach einer Seite.
In langen Schwaden trieb der Regen über die Hügel der Stadt, über die trutzige Kathedrale und den Bischofspalast, über Kirchen und Klöster und das verschachtelte Dächergewirr der Altstadt. Auf den Brücken über den Douro staute sich der Berufsverkehr, und auch auf den übrigen Einfallstraßen ging es nur stockend voran, Wagen an Wagen, mit eingeschalteten Scheinwerfern, in kilometerlangen leuchtenden Schlangen.
»Muito bom dia! Es ist acht Uhr dreißig.« Der Radiosprecher klang so munter wie immer. »Der Starkregen der vergangenen Nacht hat überall im Großraum Porto zu Überschwemmungen geführt. Die Feuerwehr bemüht sich nach Kräften, die verstopften Gullys wieder freizubekommen, aber bis jetzt muss im gesamten Stadtgebiet mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Besonders betroffen sind – «
Ana Cristina schaltete um auf Musik. Sie brauchte keine Stauwarnung mehr, sie stand schon im Stau, auf dem inneren Stadtring. Ab und zu ging es mal ein, zwei Meter vorwärts, dann leuchteten auch schon wieder die roten Bremslichter auf. Die anderen Autos waren beinahe das einzige, was sie erkennen konnte, der Rest der Welt verschwand in Dunst und Regen. Schemenhaft tauchten die blauen Schilder über der Fahrbahn auf und wurden nach und nach größer: ›IC 23, Ponte Freixo, A 1 Lisboa‹.
Sie fing an, an ihrem Haargummi herumzunesteln, löste es schließlich, schüttelte ihr langes dunkles Haar und band sich dann den Pferdeschwanz noch einmal neu. Sie hatte eine kurze Lederjacke an und enge Jeans, und neben ihr auf dem Beifahrersitz lag die Plastiktüte mit ihren schicken neuen Stiefeletten. Im Moment trug sie ein Paar grellrosa Gummistiefel.
Das Schild ›Porto, Paranhos‹ erschien und rückte Meter für Meter näher. Ihre Ausfahrt, endlich. Als sie in die Rua Assis Vaz einbog, war sie fast eine Stunde zu spät dran, aber bei dem Wetter ging sie davon aus, dass sie nicht die einzige war.
Sie bremste vor dem nüchternen grauen Gebäude, das direkt an der Kreuzung stand. Mit seiner halbrunden Betonfassade und den automatischen Schranken vor der Einfahrt hätte es einfach ein Parkhaus sein können. Nur auf einem kleinen Wappenschild am Eingang stand ›Polícia Judiciária‹: Kriminalpolizei. Die Schranke hob sich ganz selbstverständlich vor ihrem Wagen und sie fuhr die Rampe hoch. Ein Wachmann lächelte ihr zu und winkte kurz.
Während sie durch die Garage fuhr, hielt sie Ausschau nach dem Mercedes ihres Chefs. Er war nirgends zu sehen. Vielleicht war er ja wirklich noch nicht da.
Also schnell jetzt.
Kaum hatte sie eingeparkt, langte sie nach der Plastiktüte, machte die Fahrertür weit auf und schwang ihre Beine hinaus. Sie stellte die Stiefeletten vor sich auf den Boden und wollte gerade den ersten Gummistiefel ausziehen, als sie Schritte hörte.
»Nein, der ist auch nicht da«, sagte jemand, der offenbar im Gehen telefonierte. »Hat aber angerufen. Steht im Stau.«
Sie erkannte die Stimme sofort, und schon sah sie ihn auch zwischen den geparkten Wagen auf sich zukommen: Inspektor Rui Pinto, wieder in einem seiner feinen Anzüge. Er hatte einen Regenmantel über dem Arm, und mit der anderen Hand hielt er sein Mobiltelefon ans Ohr. Sein schwarzes Haar war an den Seiten straff zurückgekämmt und glänzte, als sei es nass geworden, aber daran glaubte sie nicht recht. Vor etwas Gel im Haar scheute er auch sonst nicht zurück. Er musste so Anfang dreißig sein, etwa zehn Jahre älter als sie selbst, und für ihren Geschmack wusste er ein bisschen zu genau, wie gut er aussah.
»Nein, die sind beide schon weg«, sagte er. »In Gaia ist eine Wasserleiche angetrieben. Nicht mehr ganz taufrisch, wenn ich das richtig gehört habe. Kommt wohl von weiter flussaufwärts, und das Hochwasser hat sie irgendwo losgerissen.«
Als er Ana Cristina bemerkte, nickte er ihr lächelnd zu, und sie sah, wie sein Blick auf ihre leuchtend rosa Gummistiefel fiel. Er blieb stehen und deckte kurz sein Telefon ab. »Lassen Sie die mal gleich an. Wir müssen los. Außerdem sehen die klasse aus!«
Sie lächelte etwas bemüht zu ihm hinauf.
»Ja, ja, alles etwas schwierig heute Morgen. Ana ist gerade reingekommen, die könnte ich mitnehmen.«
Sie rollte die Augen gen Himmel. Na, wunderbar! Inzwischen war sie ziemlich sicher, dass er mit dem Chef telefonierte. Sie schüttelte den Kopf und wartete ab.
»Ja, machen wir. Und Sie kommen dann auch hin? – Gut, ich melde mich dann.« Pinto nahm sein Telefon vom Ohr und drückte die Taste.
Ana steckte ihre Stiefeletten zurück in die Plastiktüte, warf sie in den Wagen und stand auf. »Bom dia.«
»Bom dia. Der Chef kommt heute später, bei dem hat’s reingeregnet. Alles unter Wasser, sagt er. Die Sache ist die: wir haben einen Leichenfund in Perafita.«
»Aha?« Sie schloss ihren Wagen ab. »Und was ist da passiert?«
Pinto zuckte die Achseln. »Bis jetzt wissen wir nur, dass da ein toter Mann im Hausflur liegt. Hier entlang, bitte. Die Schutzpolizei hat die Sache gerade eben gemeldet, ein Streifenwagen ist vor Ort. Ein Einzelhaus am Rande von Perafita, irgendwo hinter der Raffinerie.« Er nahm einen Autoschlüssel aus der Tasche, drückte darauf, und ein ganzes Stück vor ihnen klackte es und ein Citroën ließ seine Hecklichter aufleuchten. »Der Mann ist vermutlich erstochen worden. Von hinten.«
»Das heißt, es war Mord?«
»Sieht so aus.«
Ana ließ sich nichts anmerken, nur ihre Schritte wurden etwas schneller. Eine richtige Mordermittlung, von Anfang an! Das war mal etwas anderes als der Kleinkram, der ihr sonst so zugeschoben wurde. Sie brauchte endlich eine Aufgabe. Sie wollte beweisen, dass sie etwas konnte. Schließlich war sie frisch von der Polizeihochschule und vom Dienstgrad her noch Inspectora estagiária: Inspektorin im Praktikum.
Sie hörte, wie ein Auto die Rampe heraufkam und wandte sich misstrauisch danach um. Das fehlte noch, dass ihr jetzt einer den Fall vor der Nase wegschnappte. Aber nein, der Wagen kam ihr ganz unbekannt vor.
Pinto hatte auch gar nicht hingesehen, er telefonierte schon wieder. »Ja, ich fahr jetzt nach Perafita. Wie sieht’s denn aus auf der IC 1?« Er öffnete die Fahrertür. »Immer noch? Na gut, danke.« Er legte sein Telefon aufs Wagendach und zog den Regenmantel an. »Die IC 1 ist dicht. Mal sehen, ob wir irgendwie anders durchkommen.«
»Das werden wir schon«, sagte Ana, mit einem Lächeln. »Fahren wir auf jeden Fall erst mal los!«
Eine halbe Stunde später standen sie im Stau auf der Avenida da Boavista, und es regnete, dass die Scheibenwischer kaum dagegen ankamen. Irgendwo weit vor ihnen zuckte der Widerschein eines Blaulichts an den nassen Fassaden. Vorne und hinten wurde immer wieder laut gehupt. Pinto telefonierte die meiste Zeit. Zwischendurch fragte er einmal: »Das ist dann Ihr erster Mordfall, was?«
»Ja«, konnte sie gerade noch sagen, dann erklang schon von neuem die Erkennungsmelodie seines Telefons.
Wieder sah sie still aus dem Seitenfenster. In dem Mercedes neben ihr saß ein älterer Herr, der ebenfalls ununterbrochen telefonierte. Offenbar benutzte er eine Freisprechanlage. Ganz allein in seinem Wagen, redete und redete er und gestikulierte dauernd mit beiden Händen. Sie war immer noch dabei, ihm zuzuschauen, als Pinto plötzlich sagte: »Was? Und wo?«
Sie sah ihn an.
»Ja«, sagte er. »Ja.« Es schien etwas Ernstes zu sein. »Ja. – Aha? Und woher wissen wir das so genau? – Moment mal. Reden wir hier von derselben Nachbarin, die den Mann gefunden hat? – Und die läuft da jetzt immer noch im Haus herum? – Ja, ja, wir sind gleich da.« Er drückte die Taste. »Jedenfalls hoffen wir das.«
»Was ist los?«
»Sie haben noch eine Leiche gefunden. Drinnen im Haus. Im Wohnzimmer liegt eine Frau.« Er schüttelte den Kopf. »Und identifiziert ist sie auch schon!«
»Identifiziert?« Das alles klang nicht gerade nach einem Ablauf wie im Lehrbuch.
»Ja, von einer Nachbarin! Wissen Sie, was die gesagt haben? Sie hätten sie ›nicht aufhalten können‹! Zugegeben, solche Nachbarinnen gibt es.«
»Das heißt, die haben nicht einmal den Tatort abgesperrt?«
Pinto hob beide Hände. »Schutzpolizei! Wer weiß, was die da sonst noch gemacht haben. Wahrscheinlich wieder ein paar Kippen irgendwo hingeworfen. Bei denen kann man froh sein, wenn sie den Tatort nicht aus Versehen in Brand gesteckt haben, bevor man da ist.«
»Na, das fängt ja gut an.«
»Wieso, ist doch normal.« Er hupte zweimal kurz hintereinander. Sofort fingen auch andere Fahrer wieder an zu hupen. »So, irgendwie müssen wir hier jetzt mal weg! Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit.«
Er schaltete den Blinker ein, fuhr an und schwenkte einfach links aus dem Stau hinaus auf die Gegenfahrbahn. Als sie an der Reihe der Autos entlangfuhren, die vor ihnen gestanden hatten, steigerte sich das Hupen zu einem wütenden Dauerton. Einen Moment lang wunderte sich Ana, dass die Spur überhaupt frei war und ihnen niemand entgegenkam, aber dann sah sie auch schon den Grund. Hinter dem Feuerwehrwagen mit dem blinkenden Blaulicht stand die breite Avenida komplett unter Wasser, und der Gegenverkehr wartete drüben am anderen Ufer.
Ein Feuerwehrmann kam winkend auf sie zu: ›Halt, halt! Zurück!‹ Aber Pinto fuhr ungerührt weiter und hielt erst direkt neben ihm an. Er ließ sein Seitenfenster herunter und zeigte die Dienstmarke der Polícia Judiciária. »PJ«, sagte er. »Wir müssen durch!«
»Das geht nicht! Das sehen Sie doch! Da saufen Sie ab bis hier! Wir tun ja schon, was wir können!«
»Wie sieht’s denn da links aus? Kann ich da nicht seitlich vorbei?«
»Nein, können Sie nicht! Sie können höchstens wenden und zurückfahren!« Der Feuerwehrmann richtete sich abrupt auf. »Oh, Scheiße! Jetzt kommen die hier alle an!« Er hob beide Arme. »Zurück! Zurück, hab ich gesagt! Hier ist gesperrt!«
Pinto ließ seine Seitenscheibe hoch und gab unauffällig Gas. Ein paar Meter fuhren sie durch flaches Wasser, dann stand ein Lieferwagen im Weg. Pinto hupte ihn an, aber er rührte sich nicht. »Können Sie hinten was sehen?«
Ana drehte sich um. Der Regen prasselte laut aufs Wagendach. »Nein, nicht wirklich!« Aber schon fuhren sie rückwärts.
Pinto bremste und bog dann auf eine Art Vorplatz ein, auf dem Fahnenmasten standen. Ana sah den erleuchteten Eingang eines Hotels vorbeiziehen, dann waren sie hinten auf einem Parkplatz. Vor ihnen tauchte eine Schranke auf. Pinto fuhr an das Wärterhäuschen heran, klopfte an die Scheibe, und sie wurde zögernd aufgeschoben. »PJ. Alles in Ordnung bei Ihnen? Na, prima. Dann machen Sie bitte die Schranke auf, ja?« Der Parkwärter stellte keine Fragen.
Als sie weiterfuhren, sagte Ana: »Diese Frau … Hat man Ihnen etwas über die Todesursache gesagt?«
»Nein, nichts. Steht wohl noch nicht fest.«
»Und wer ist sie? Was sagt die Nachbarin?«
»Die sagt, es ist die Ehefrau. Die beiden Toten sind wohl die Leute, die in dem Haus gewohnt haben. Die beiden allein, sagt sie. Keine Kinder oder sonst jemand.«
An der nächsten roten Ampel hob er sein Telefon ans Ohr. »Ja, Inspektor Pinto hier, PJ. Wir sind auf dem Weg zu Ihnen.« Die Ampel wurde grün und er fuhr wieder an. »Wie ist das, mit der weiblichen Leiche: können Sie etwas über die Todesursache sagen? – Nicht einmal eine Vermutung? Wonach sieht es denn aus? – Was soll das heißen, ›merkwürdig‹? – Ja, das würde ich ja gern. Bis gleich.« Er sah Ana an und sagte: »Irgendetwas kommt ihnen ›merkwürdig‹ vor. Sie können sich ›gar nicht erklären, was da passiert ist‹.«
»Mehr hat er nicht gesagt?«
»Nein, er meinte, wir sollen uns das lieber mal selber ansehen.«
»Na gut, warten wir’s ab.« Etwas unwillig blickte sie hinaus in den Regen. Ein Auto immer dicht hinter dem anderen, fuhren sie eine enge, dunkle Straße entlang. Nach einer Weile sagte sie: »Ein Ehepaar …«
»Tja«, sagte Pinto, »in neun von zehn Fällen heißt das: Einer von ihnen hat den anderen umgebracht. Und hinterher Selbstmord begangen.«
»Angenommen, es stimmt, dass der Mann von hinten erstochen wurde …«
»Dann wäre das die Frau gewesen, das ist richtig. Ich weiß nicht, früher war ein Messermord ja eher Männersache. Aber die Frauen von heute, hm?« Er sah sie von der Seite an. »Die holen eben auf in allen Bereichen.«
Ana lächelte kurz zurück, aber sie sagte nichts dazu.
Die Straße führte jetzt bergab, und dort unten, zwischen den Häusern mit den kleinen Balkonen, sah sie plötzlich das Meer: die riesigen Atlantikbrecher, die so machtvoll herangerollt kamen, dass sie sich beinahe erschrocken in ihren Sitz zurücklehnte.
Sie nahmen die Küstenstraße Richtung Norden, fuhren im Containerhafen über die Brücke und dann weiter am offenen Meer entlang, links immer die tosende Brandung. Als vor ihnen im Dunst die rotweiß gestreiften Schlote der Raffinerie auftauchten, rief Pinto wieder bei den Schutzpolizisten vor Ort an.
Das Haus war nicht einfach zu finden. Hinter der Raffinerie begann eine unübersichtliche Gegend, die nicht mehr Stadt war und auch noch nicht Land. Der Regen wehte über kahle Felder, an deren Rändern Lager- und Fabrikhallen standen und moderne Bürogebäude mit hell erleuchteten Fensterreihen. Maschendrahtzäune zogen vorbei und Brachgrundstücke voller Schotter.
»Was? Das kann nicht sein. Dann stimmt das nicht, was Sie mir vorhin gesagt haben!«
Pinto fuhr rechts ran. Sie standen jetzt an einem weiten, umgepflügten Acker.
»Schalten Sie doch mal Ihr Blaulicht an, vielleicht sehe ich das irgendwo.«
Es dauerte einen Moment, aber dann sahen sie, genau auf der gegenüberliegenden Seite des Ackers, ein winziges zuckendes blaues Licht. »Ja, gut, ich sehe Sie! Lassen Sie das an, bis wir da sind, ja?«
Sie fuhren an einer hohen Feldsteinmauer entlang, an den Gartentoren älterer Wohnhäuser. »Können Sie es noch sehen?«
»Nein, aber ich denke, es muss da hinten rechts sein.«
»Also, die müssen sich wirklich gegenseitig umgebracht haben. Jemand anders hätte die ja nie gefunden.«
»Halt! Da war es eben!«
Pinto legte den Rückwärtsgang ein. Zwischen zwei alten Stallgebäuden führte eine schmale Straße hindurch, und hinten auf dieser Straße stand der Streifenwagen mit dem blinkenden Blaulicht.
Sie fuhren hinein. Die beiden einzigen Häuser standen auf der rechten Seite. Dahinter hörte das Kopfsteinpflaster auf und ein Feldweg führte weiter auf den Acker, den sie eben umrundet hatten. Die Häuser waren beide ziemlich klein, und eins sah so unbelebt aus wie das andere. Sämtliche Fensterläden schienen geschlossen zu sein.
Der Streifenwagen stand vor dem hinteren Haus. Undeutlich sahen sie die Polizisten darin sitzen. Pinto fuhr langsam heran und hielt an. Er deutete auf den Schlamm und die Pfützen ringsum und sagte: »Sehen Sie, hier können Sie Ihre Gummistiefel gebrauchen.« Sie stiegen aus.
Den Kragen seines Regenmantels hochgeschlagen, klopfte Pinto an die Seitenscheibe des Streifenwagens und machte ein Zeichen zum Haus hin. Ana öffnete die Gartenpforte und trat rasch unter das Vordach.
Das Blaulicht ging aus, die Polizisten stiegen aus und kamen herüber. Man begrüßte sich, Pinto stellte sie beide vor. Die Uniformierten sahen Ana von oben bis unten an. Der eine lächelte und brummte etwas wie »Mm-hm?«
»War die Haustür offen?« fragte Pinto.
»Soweit wir wissen, ja. Die Nachbarin hat gesagt, die Tür hätte heut Morgen so im Wind hin- und hergeschlagen. Daraufhin hat sie mal nachgesehen, ob alles in Ordnung ist.«
»Die Nachbarin aus dem Haus da?« Hinter dem Gartenzaun stand ein kleiner rotbrauner Hund und kläffte sie an.
»Ja. Da wohnt Dona Teresa. Die muss schon auf die achtzig zugehen. Aber noch ganz helle, wenn Sie mich fragen. Die hat uns ja auch angerufen.«
»Ja, ja, ich weiß.« Pinto blickte noch einmal über den weiten Acker, hinüber zur Raffinerie und aufs Meer. Dann sagte er: »Gut, wir gehen jetzt hinein. Können Sie hier absperren? Das ganze Grundstück, ja? Alles, was dazugehört.«
»Wird gemacht.« Die Polizisten wirkten beinahe erleichtert. Absperren im Regen schien ihnen jedenfalls lieber zu sein, als noch einmal mit hineinzukommen.
Pinto zog sich Latexhandschuhe an und gab auch Ana ein Paar. Dann wandte er sich der Haustür zu und schob sie vorsichtig, ohne die Klinke zu berühren, ein Stück weiter auf. Im Flur brannte Licht.
Ana spürte plötzlich ihr Herz klopfen. Jetzt war es soweit.
Die Tür ließ sich ganz öffnen, ohne irgendwo anzustoßen. Direkt dahinter lag der Tote, auf dem Bauch. Als erstes sah Ana seine Schuhsohlen. Sie sahen ziemlich sauber aus. So als hätte er sich noch die Füße abgetreten.
Während Pinto sich über den Toten beugte, musste sie noch draußen warten.
»Sieht tatsächlich so aus, als wäre er erstochen worden.« Pinto richtete sich wieder auf. »Aber wenig Blut. Ich hab schon Sachen mit dem Messer gesehen, da wär ich auch froh gewesen, wenn ich Gummistiefel angehabt hätte.«
Er ging langsam weiter hinein, und Ana trat hinter ihm durch die Tür.
Der Kopf des Toten lag halb auf der Seite. Sein Mund stand offen. Er hatte angegrautes Haar, aber ansonsten hätte sie kaum sagen können, für wie alt sie ihn hielt. Er trug eine ausgebeulte Cordhose und eine Windjacke aus Kunststoff. Der kleine Riss in der Jacke wäre gar nicht weiter aufgefallen, wenn da nicht das angetrocknete Blut gewesen wäre. Aber es stimmte: es war wenig Blut. Und das konnte nur eines heißen: Er musste sofort tot gewesen sein.
Ein einziger Messerstich. Schon glaubte sie nicht mehr, dass das die Frau gewesen sein könnte. Vielleicht war sie mit demselben Messer getötet worden. Aber wie? Genauso schnell? Oder hatte der Täter den Mann nur rasch ausgeschaltet, um sich dann dem eigentlichen Opfer zuzuwenden? Sie blickte auf, und Pinto war nirgends zu sehen.
Vorsichtig ging sie an dem Toten vorbei und die wenigen Schritte weiter den Flur entlang. Es war kalt in dem Haus und es roch nach feuchten Wänden und nach Schimmel. Eine schmale Treppe führte nach oben. Rechts sah es nach Küche aus. Links war eine kleine Garderobe, und dahinter stand Pinto in einer offenen Tür, hinter der ebenfalls Licht brannte. Er hatte ihr den Rücken zugewandt und er rührte sich nicht. Das musste das Wohnzimmer sein. Sie wusste, er sah die Frau dort liegen.
Am liebsten hätte sie ihn gefragt: ›Ist es sehr schlimm?‹ Aber sie sagte nichts.
Als er sie hinter sich hörte, ging er langsam ein, zwei Schritte in das Zimmer hinein. Ana atmete noch einmal tief durch, dann folgte sie ihm.
Sie hatte alles mögliche erwartet, aber das nicht.
Die Frau lag mitten im Zimmer auf dem Teppich, in dem schwachen Licht der Deckenlampe, und sie lag da wie aufgebahrt: auf dem Rücken, die Beine zusammen, die Hände über der Brust gekreuzt. Sie war vollständig bekleidet, und nichts an ihrer Kleidung wirkte beschädigt oder in Unordnung gebracht. Sie hatte schwarze, hochhackige Schuhe an, schwarze Strümpfe, einen knielangen schwarzen Rock und eine helle Bluse. Eine goldene Halskette und ein Armreifen glänzten im Lampenlicht. Sie wirkte ganz friedlich. Auf ihrem Bauch, die Hände halb verdeckend, lag ein Strauß weißer Chrysanthemen, als hätte ihn jemand zum Abschied dorthin gelegt.
Ana hörte, wie der Regen gegen die Fensterläden prasselte. Nebenan bellte immer noch der kleine Hund. Sie sagte nichts, und auch Pinto schien keine Lust mehr zu haben, Vermutungen anzustellen.
Behutsam trat sie näher. Als sie sich vorbeugte, um besser sehen zu können, fiel ihr eigener Schatten über das Gesicht der Toten. Sie sah, dass die Augen der Frau geschlossen waren und dass sie sehr dunkles, vielleicht schwarzes Haar hatte.
»Wir brauchen mehr Licht«, sagte sie. »So kann man ja nichts erkennen.« Unter den Chrysanthemen meinte sie, einen dunklen Fleck auf der Bluse zu sehen, aber ob das Blut war, hätte sie nicht sagen können.
»Immerhin wissen wir jetzt, was die so merkwürdig fanden.«
»Ja. Allerdings.«
Eine Weile standen sie noch so da, beide mit gesenktem Kopf und unwillkürlich die Hände gefaltet. Dann ertönte aus Pintos Jackentasche wieder der Klingelton seines Telefons.
2
Eine halbe Stunde später hörten sie draußen einen Wagen vorfahren. »Das wird er wohl sein«, sagte Pinto.
Ana ging vorsichtig um den Toten im Flur herum und öffnete die Haustür. Neben dem Streifenwagen hielt der Mercedes des Chefs. Die Fahrertür ging auf und Chefinspektor Fonseca stieg aus, eine massige, untersetzte Gestalt. Er schlug den Kragen seines Jacketts hoch, hielt die Revers vor der Brust zusammen und stapfte dann durch den Regen herüber.
Ana lächelte leise. Er kam ihr vor wie ein Grizzlybär, der etwas brummig war, weil er bei diesem Wetter seine Höhle verlassen musste.
»Bom dia«, sagte er, indem er das blauweiße Absperrband der Schutzpolizei hochhob und unterdurchging. »Das ist ja wirklich gut versteckt hier!«
»Bom dia. Ja, wir hatten auch Mühe, es zu finden.«
Fonseca trat mit unter das Vordach. »Bah, was für ein Wetter!« Er fuhr sich mit der Hand über sein nasses graues Haar, das wie immer sehr kurz und sehr akkurat geschnitten war.
Pinto erschien hinter ihnen in der Tür, eine große Taschenlampe in der Hand. »Wie sieht’s aus zu Hause?«
»Der Wasserstand sinkt langsam wieder.« Fonseca ordnete beiläufig sein Jackett und seine Krawatte. »Meine Haushaltshilfe kümmert sich jetzt darum. Ich kann ja nicht einfach so davon abfahren, dann kommt mir das ganze Parkett hoch.« Während er das sagte, blickte er zurück zur Einfahrt. Er sah sich das Nachbarhaus an, den kläffenden Hund. »Heute Morgen war das ganze Wohnzimmer überschwemmt. Alles unter den verdammten Terrassentüren durchgelaufen.« Dann ließ er seinen Blick an den Gartenzäunen entlangwandern, bis hin zum offenen Acker. »Begreifen kann man das ja nicht. Wieso baut man die Türen nicht so, dass das Wasser nicht unterdurchläuft? Ich hab das mal einen Freund gefragt, der ist Bauunternehmer. Und was sagt er? Er zuckt die Achseln und sagt: Da kann man nichts machen, bei ihm zu Haus läuft das Wasser auch unter der Tür durch.« Er schüttelte den Kopf. Dann zog er sich ein Paar Latexhandschuhe an. »Das bisschen Absperrung hier, das reicht nicht. Die Wagen müssen hier weg und vorn muss die ganze Einfahrt dichtgemacht werden.« Er blickte in fragende Gesichter. »Nein, nicht sofort. Jetzt gehen wir erst mal rein.«
Während die beiden Männer sich den Toten im Flur ansahen, stand Ana Cristina noch draußen unter dem Vordach. Pinto hatte ganz selbstverständlich das Reden übernommen, und Fonseca stand jetzt breit und unbeweglich in der Haustür, ihr den Rücken zugewandt. Einer der Schutzpolizisten saß wieder in dem Streifenwagen, und sie hatte das deutliche Gefühl, dass er sie die ganze Zeit anstarrte.
Es dauerte und dauerte. Sie hörte, wie Fonseca nach Einbruchspuren fragte.
»Nein, nichts«, sagte Pinto. »Von der Küche aus geht noch eine Tür in den Garten, aber die ist auch in Ordnung. Einen Keller gibt es nicht. Fenster sind alle unversehrt, im ganzen Haus sind die Fensterläden geschlossen. Deswegen ist es auch so dunkel. Licht brennt nur hier und im Wohnzimmer. Na ja, Sie sehen ja, was das bringt.«
»Schwache Stromzuteilung heute, was?«
»Kann schon sein, bei dem Wetter. Es flackert auch dauernd.«
Fonseca löste sich aus dem Türrahmen und folgte Pinto ins Haus, und sie ging still hinterher. »Rechts ist die Küche«, erklärte Pinto, kurz mit der Taschenlampe in die Richtung leuchtend. »Falls es Sie tröstet: Das ist die Wetterseite, und unter der Tür läuft es anscheinend auch durch. Aber: Jemand hat den Türspalt mit Putzlappen verstopft.«
»Aha?« sagte Fonseca, als hielte er das für eine bemerkenswerte Idee.
So was hat bei ihm natürlich auch immer seine Frau gemacht, dachte Ana. Und jetzt ist sie weg und er wundert sich, dass es hereinregnet.
»Irgendwelche Spuren, die auf Raub hindeuten? Aufgerissene Kleiderschränke, ausgekippte Schubladen?«
»Nein, nichts dergleichen. Nach Reichtümern sieht es hier auch nicht gerade aus. Im Wohnzimmer sind ein paar Familienfotos zu Bruch gegangen, aber das ist auch alles. Das Wohnzimmer ist hier.«
Ana schloss etwas dichter auf. Sie wollte unbedingt hören, was der Chef sagte, wenn er die Frau sah. Er sagte: »Hmm …« und streckte dann die Hand nach der Taschenlampe aus. »Darf ich mal?«
Langsam und vorsichtig, den Lichtkegel auf den Teppich vor seinen Füßen gerichtet, trat Fonseca näher an die Tote heran. Auch er blieb eine Weile schweigend stehend, den Kopf gesenkt. Dann richtete er das Licht auf den Blumenstrauß, die gekreuzten Hände, und beugte sich vor. »Da ist Blut, oder?«
»Ja«, sagte Pinto, »die Wunde ist von der Hand verdeckt. So lässt sich da nichts Genaues sagen. Aber leuchten Sie einmal seitlich. Auf dem dunklen Teppich kann man es kaum erkennen, aber da ist ebenfalls Blut. Sehen Sie?«
»Ja. Das kann natürlich alles mögliche heißen. Dass sie noch eine weitere Verletzung hat, auf dem Rücken.«
»Sicher, das müssen wir abwarten.«
Ana konnte einfach nicht länger den Mund halten. »Aber es könnte auch heißen, dass sie erschossen wurde.«
Die beiden Männer drehten sich etwas erstaunt nach ihr um.
»Ich meine nur, wir haben jetzt alle diese Vorstellung von dem Messer im Kopf. Aber wenn man das Messer mal weglässt, wird es gleich viel plausibler, finde ich. Von der Lage der Wunde her könnte es ein glatter Herzdurchschuss sein. Vorn ein kleiner Einschuss, mehr nicht, sie ist sofort tot. Und hinten, aus der Austrittswunde, läuft dann noch eine ganze Zeit lang das Blut aus. Das würde genau so aussehen.«
Einen Moment lang herrschte Stille, und sie fragte sich, ob sie zu weit gegangen war. Aber Fonseca lächelte nachsichtig. »Gut. Ich werde mir das merken. Mal sehen, was nachher der Doktor sagt.« Er wandte sich wieder der Toten zu. Erst jetzt leuchtete er ihr mit der Taschenlampe ins Gesicht.
»Für wie alt würden Sie sie halten?« fragte Pinto.
»Schwer zu sagen. Vielleicht so in meinem Alter, was? Mitte bis Ende vierzig.« Fonseca sah sie lange an. »Ja, nicht mehr ganz jung. Und jetzt ist sie sogar tot. Aber man sieht immer noch, dass sie eine schöne Frau gewesen ist.« Er richtete sich wieder auf. »Und sie hat auf sich gehalten. Sie ist schlank geblieben. Und sie duldete kein einziges graues Haar. Das Schwarz ist garantiert gefärbt.«
Ana stimmte ihm in allen Punkten zu. Ihr selbst war allerdings noch mehr aufgefallen. Aber das musste warten. Für den Augenblick hatte sie sich Zurückhaltung auferlegt, so schwer es ihr auch fiel.
»Was ist mit den Blumen?« sagte Fonseca. »Chrysanthemen. Die bringt man zu Allerheiligen auf den Friedhof, nicht? Blumen für die Toten. Hat der Täter sie mitgebracht?«
Ana biss sich auf die Unterlippe. Und staunte dann, als Pinto ihr ein Handzeichen gab, das soviel hieß wie: ›Nun sag’s schon.‹ Sie hatte das nämlich vorhin entdeckt. »Wir glauben, dass die Blumen schon hier waren«, sagte sie. »Wenn Sie einmal hier herüberkommen würden.«
Der Esstisch mit den kleinen Stühlen stand im Weg. Der gewichtige Chefinspektor zwängte sich nur knapp daran vorbei. Ana hörte, dass sein Atem etwas pfeifend ging. Sie zeigte auf eine Anrichte in der Zimmerecke, auf der eine Art Hausaltar aufgebaut war.
Fonseca richtete den Lichtkegel der Taschenlampe darauf, und die weiße Figur in der Mitte leuchtete hell auf, eine schmale, langgestreckte Statuette der Heiligen Jungfrau. Die Handflächen wie zum Gebet zusammengelegt, blickte sie milde lächelnd auf die drei Hirtenkinder hinab, die ihr zu Füßen knieten, von ein paar weißen Lämmchen umgeben. Die ganze Gruppe stand auf einem Sockel mit der goldenen Aufschrift ›Nossa Senhora de Fátima‹. Davor standen zwei Kerzen und eine metallene Blumenvase. Fonseca leuchtete in die Vase. Auf dem Wasser trieben einige weiße Chrysanthemenblüten.
»Stimmt, das sieht gut aus.« Er sah Pinto an. »Was war das mit diesen Familienfotos?«
»Da drüben.« Pinto zeigte in die gegenüberliegende Ecke des Wohnzimmers.
Dort stand eine düstere Polstergarnitur. Ein klobiges Sofa kehrte dem Raum seine Rückseite zu – davor lag die Tote –, und an der Wand dahinter befand sich ein einfacher offener Kamin. Auf dem Kaminsims stand eine Fotografie in einem verschnörkelten Rahmen. Ein anderer Rahmen lag umgekippt daneben.
Fonseca und Pinto traten vorsichtig näher, Ana blieb etwas hinter ihnen stehen, direkt neben der Toten.
»Wir können wohl davon ausgehen«, sagte Pinto, »dass auch die anderen Bilder auf dem Kaminsims gestanden haben.« Ungefähr zehn, zwölf Bilder in verschiedenen Größen lagen durcheinander auf dem Fliesenboden. Manche Glasscheiben waren zerbrochen, verstreute Scherben glitzerten im Licht der Taschenlampe. »Wie gesagt, soweit wir bis jetzt sehen konnten, sind es die üblichen Familienbilder. Eltern, Großeltern, Kinder.«
»Kinder?« fragte Fonseca. »Was für Kinder?«
»Ich weiß es nicht. Dieses Mädchen hier scheint mehrfach aufzutauchen, aber vielleicht sind es auch verschiedene. Da, wenn Sie genau hinsehen …«
Die beiden Männer beugten sich etwas vor. In diesem Moment spürte Ana, durch den Gummistiefel, eine Berührung an ihrem Bein. Sie zog scharf die Luft ein und hielt sie an. Ganz ruhig bleiben, das ist Quatsch, das gibt es nicht.
Sie blickte an sich hinab und sah in die schwarzen Knopfaugen des kleinen Hundes von nebenan. Mit heraushängender Zunge holte er mehrmals kurz Luft und kläffte sie dann fröhlich an.
Fonseca und Pinto fuhren herum. »Was ist denn jetzt –?«
Von der Haustür her rief eine Stimme: »Bobi! Bobi! Kommst du wohl her!«
Der kleine, rotbraune Hund hoppelte munter um die Tote herum, auf die andere Seite, und schnüffelte an ihr. Sie starrten ihn alle drei an und wussten nicht, was sie tun sollten. Schwanzwedelnd stand er da und fing dann von neuem an zu kläffen.
Pinto klatschte zweimal in die Hände. »Na los, hau ab! Raus mit dir!«
Aber der Hund bellte nur noch lauter und trippelte aufgeregt hin und her.
»Sachte, sachte«, sagte Fonseca. »Der darf uns hier nicht alles durcheinanderbringen.«
»Bobi? Wo steckst du denn?« rief die Stimme vom Eingang.
Ana hatte inzwischen in ihrer Lederjacke ein Papiertaschentuch gefunden. Sie knüllte es zusammen und sagte: »Bobi! Guck mal hier! Was ich hier habe!«
Der Hund spitzte die Ohren. Sie warf das Papierknäuel durch die offene Tür und er sprang mit einem Satz über die Tote hinweg und rannte hinterher.
Ana folgte ihm mit ein paar raschen Schritten. »Nein, nein, nein! Da geht’s lang!«
Sie scheuchte den Hund um die Ecke.
»Bobi! Da bist du ja!« Mitten im Flur stand eine kleine alte Frau mit einem schwarzen Kopftuch, in einem schwarzen Mantel, einen zusammengeklappten, tropfnassen Regenschirm in der Hand. Der Hund sprang kläffend um sie herum. »Bom dia.« Die alte Frau sah sie lächelnd an.
»Bom dia«, sagte auch Chefinspektor Fonseca, von hinten hinzutretend. »Dieses blauweiße Band da draußen, das ist eine Polizeiabsperrung. Und eigentlich – «
»Ja, das weiß ich ja, die habe ich auch nicht übertreten! Ich bin durch den Garten gekommen, hier hinten herum, da ist keine Absperrung. Ich wollte nur fragen, ob vielleicht jemand von Ihnen einen kleinen Kaffee möchte.«
»Einen Moment. Sie sind die Nachbarin, die die Polizei gerufen hat?«
»Ja, ja. Ich bin Teresa!«
Der Hund hatte aufgehört zu bellen, und Ana sah, wie er schwanzwedelnd an der männlichen Leiche schnüffelte. »Entschuldigen Sie«, sagte sie leise und drängte sich an der alten Frau vorbei.
»So, Bobi, Schluss jetzt. Komm schön her. Na, komm. Ja, feiner Hund.« Sie packte ihn am Halsband und gab ihm einen Schubs nach draußen. Er jaulte und wollte gleich wieder herein, aber da hatte sie schon die Haustür geschlossen.
»Dona Teresa«, hörte sie Fonseca sagen, »der Mann hier im Flur und die Frau dort im Wohnzimmer, kennen Sie die?«
»Ja, natürlich. Das sind ja meine Nachbarn.«
»Können Sie uns ihre Namen sagen?«
Die alte Frau drehte sich um. »Das da, das ist João.«
»João. Und die Frau?«
»Das ist Maria.«
»Maria. Gut. Wissen Sie auch ihre Nachnamen?«
So etwas wie eine Türklingel mit Namensschild hatte das Haus nicht, und auch am Briefkasten stand kein Name.
»Ja, der João, der hieß, glaube ich, nach seinem Vater. Oder nach seinem Großvater? Also, wenn Sie mich so fragen … Für mich war er ja einfach immer nur João. Und die Maria … die war eben Maria. Die war ein sehr netter Mensch. Er eigentlich auch. Beide sehr nette Menschen.« Die alte Frau schüttelte den Kopf. »Und jetzt sind sie beide an einem Tag gestorben, nicht wahr? Meu Deus, wie ist es bloß möglich ...«
»Das möchten wir auch gern wissen«, sagte Fonseca. »Dona Teresa, ist Ihnen letzte Nacht etwas Besonderes aufgefallen? Haben Sie irgendetwas gesehen oder gehört?«
»Gesehen hab ich gar nichts, nein. Und gehört? Die ganze Nacht hat alles mögliche geklappert und gescheppert. Bei dem Wind, den wir hier hatten! Einmal hat es so gekracht, dass ich aus dem Schlaf hochgefahren bin.«
»Wissen Sie, wie spät es da war?«
»Nein, das kann ich nicht sagen.«
»Wann haben Sie die beiden zum letzten Mal lebend gesehen?«
»Warten Sie … Also Maria gestern Abend, als sie die Fensterläden zugemacht hat.«
»Können Sie sich da vielleicht an die Uhrzeit erinnern?«
»Ach, wissen Sie, Uhrzeiten … Aber es fing gerade an, dunkel zu werden. Da hat sie immer alles zugemacht und die Tür abgeschlossen. Jedenfalls, wenn sie allein im Haus war.«
»Haben Sie noch mit ihr gesprochen?«
»Ja. Sie hat mich gefragt, ob ich für die Nacht noch etwas brauchte, oder ob sie mir bei irgendetwas helfen könnte. Wir wussten ja aus dem Fernsehen, dass der Sturm kommt. Ich hab gesagt: ›Danke, nein, ich komme schon zurecht!‹ So war sie, wissen Sie.«
Ana hob ihre Hand und Fonseca nickte ihr zu.
»Was hatte sie da an?« fragte sie. »Als sie die Fensterläden zugemacht hat?«
Dona Teresa runzelte die Stirn. »Dasselbe wie vorher. Einen Pullover, glaube ich, und eine Jeanshose. Sie war ja noch im Garten gewesen. Ja, überhaupt … Wer versorgt denn jetzt die Hühner?«
»Die Hühner?« fragte Fonseca.
»Ja, da sind acht, neun Hühner im Stall. Und der Hahn.«
Pinto sah Ana an. »Das wird wohl an Ihnen hängenbleiben. Sie haben immerhin das passende Schuhwerk an. Falls die Hühner von der Farbe nicht blind werden.«
»Die Hühner können vielleicht noch einen Augenblick warten«, sagte Fonseca. »Dona Teresa, wann haben Sie den Mann, João, zum letzten Mal gesehen?«
»Gestern Abend überhaupt nicht mehr. Aber ich hab seinen Wagen gehört. Er ist ziemlich spät von der Arbeit gekommen.«
»Sind Sie sicher, dass es sein Wagen war, den Sie gehört haben?«
»Ja, den kenne ich genau, das ist so ein Lieferwagen. Der weiße Lieferwagen, der hier hinter dem Haus steht. Der ist von seiner Firma. Sein eigenes Auto ist ja schon ewig kaputt, das hat überhaupt keine Räder mehr. Das steht auch da hinten, da wächst schon das Gras drüber.«
»Er ist spät von der Arbeit gekommen, sagen Sie. Haben Sie auf die Uhr gesehen?«
»Nein. Nein, das habe ich nicht.«
»Aber es war später als gewöhnlich?«
»Wie man’s nimmt. Seine Zeiten waren öfter mal unregelmäßig, er hat ja bei Nuno gearbeitet, bei dieser Spedition. Das kam immer drauf an, wohin er gefahren ist. Wenn er in Spanien war, hat er da manchmal sogar übernachten müssen.«
Von diesem Nuno schien sie nicht viel zu halten. Ana erwartete fast, dass Fonseca da nachhakte, aber er machte lieber erst mal weiter.
»Wie war das heute Morgen? Sie müssen sehr früh aufgestanden sein.«
»Ach, ich sagte doch schon, ich hab mich gar nicht richtig hingelegt. Und heute Morgen dachte ich, wenn ich den Hund füttere, geh ich gleich mal ums Haus und seh nach dem Rechten. Es war noch ziemlich dunkel, wissen Sie, und da hab ich nebenan das Licht in der Haustür gesehen. Die Tür schwang einfach so lose im Wind hin und her, und ich dachte: Was ist denn da los? Maria schließt doch immer ab. Und dann bin ich hinübergegangen und dann liegt da der João.«
»Was haben Sie dann gemacht?«
»Ich weiß nicht, ich war wie vor den Kopf geschlagen. Erst habe ich etwas zu ihm gesagt. Obwohl ich gleich wusste, dass er tot war. Das sieht man ja. Und dann hab ich nach Maria gerufen, aber sie hat nicht geantwortet.«
»Sind Sie hineingegangen?«
»Nein, das habe ich mich nicht getraut. Irgendwie hab ich es plötzlich mit der Angst zu tun bekommen. Ich bin wieder rübergegangen und habe die Polizei angerufen.«
»Ja, das war auch ganz richtig so.« Fonseca blickte nachdenklich vor sich hin. Dann sagte er: »Eines noch: Wann genau haben Sie erfahren, dass die Frau, dass Maria … ebenfalls nicht mehr am Leben war?«
»Das war, als die Polizisten schon hier waren. Die sind ins Haus gegangen und ich stand an der Tür, und da höre ich, wie der eine zu dem anderen sagt: ›Komm mal her! Hier liegt noch jemand! Eine Frau!‹ Und da bin ich hinein und dann hab ich sie dort liegen sehen.«
»Sie haben sie dort liegen sehen. Aber sie liegt nicht einfach so da wie hier der João, nicht wahr? Jemand hat sogar Blumen abgelegt. Wer hat das getan, was glauben Sie?«
Dona Teresa schien ernsthaft zu überlegen.
»Das weiß ich nicht«, sagte sie schließlich. »Ich dachte, das wäre João gewesen. Wer sonst? Ich denke, sie ist gestorben und er hat von ihr Abschied genommen. Und dann …« Sie bekreuzigte sich fahrig. »Dann hat er selber auch nicht mehr weiterleben wollen.«
Pinto holte tief Luft, als wollte er etwas sagen. Aber dann schüttelte er nur den Kopf.
»Ja, ja, das ist traurig«, sagte Dona Teresa. »Aber haben Sie gesehen, wie schön sie ist, noch im Tode? Das hätte sie sicher gefreut.«
»Ja, bestimmt.« Fonseca rückte seinen Krawattenknoten zurecht. »Gut, dann war das erst mal alles.«
»Und was ist nun mit dem Kaffee?« Dona Teresa blickte erwartungsvoll in die Runde.
»Ja … ich denke, das wär jetzt genau das Richtige!« sagte Fonseca. »Oder? Was meint ihr?«
Ana sah ihn etwas verwundert an, Pinto zuckte die Achseln.
»Ich habe aber nur Löslichen«, sagte Dona Teresa, »den Echten kann ich mir nicht mehr leisten.«
»Ach, so anspruchsvoll sind wir nicht. Setzen Sie doch schon mal das Wasser auf, wir kommen dann gleich.«
Pinto ging mit an die Tür und ließ sie hinaus. Dann standen sie zu dritt im Flur und sahen sich an.
»Also? Was sagt ihr?« fragte Fonseca. »Ist sie das gewesen, die die Leiche so hergerichtet hat?«
Pinto zögerte einen Moment. »Nein, ich denke, nicht. Die Blumen, gut, das würde ich vielleicht noch glauben. Aber derjenige, der die Leiche bewegt hat, der hat auch das Blut gesehen. Der wusste genau, was los war. Die Wunde ist doch mit Absicht verdeckt worden. Und dass diese alte Frau das gemacht haben soll … Nein, das sehe ich einfach nicht. Weshalb auch?«
»Weil sie sie mochte, die Maria«, sagte Fonseca. »Weil sie wollte, dass sie schön aussieht, ›noch im Tode‹, das haben wir ja gehört.« Er sah Ana an.
Sie schüttelte den Kopf. »Ich glaube es auch nicht … Natürlich, ein Psychologe könnte jetzt sagen: Was ist, wenn sie die Tote tatsächlich schon vorher entdeckt hat? Wenn sie das Blut gesehen hat? Wenn der Schock einfach zuviel für sie gewesen ist? Sie will es nicht wahrhaben, dass ihre Nachbarin ermordet worden ist. Sie richtet die Leiche her wie zu einer Aufbahrung und schafft so die Illusion, sie wäre einfach irgendwie ›gestorben‹. Eines natürlichen Todes vielleicht. So redet sie ja auch darüber.«
»Sicher«, sagte Pinto. »Das Problem bei Psychologen ist nur, dass sie von vornherein um drei Ecken denken.« Er lächelte. »Die meisten jedenfalls. Eine einfache Wahrheit würden die gar nicht mehr erkennen.«
Es war natürlich bestens bekannt, dass Ana Cristina nicht über ein Jurastudium zur Polizeihochschule gekommen war, wie die meisten anderen, sondern dass sie vorher Psychologie studiert hatte.
»Und wie sähe die aus, die einfache Wahrheit?« fragte Fonseca.
»Na ja«, sagte Pinto, »wir haben die Aussagen von drei Personen, und für meine Begriffe enthalten die keinerlei Widersprüche. Die Alte sagt, sie hat die Tote erst gesehen, nachdem die Polizisten sie gefunden haben. Gut, dann lag die Tote schon genau so da wie jetzt. Natürlich ist es ein Schock für sie, dass ihre Nachbarn – zwei Menschen, die sie kannte, und die sie gestern noch lebend gesehen hat – in der Nacht ermordet worden sind. Natürlich sieht sie dieser Tatsache nicht gern ins Auge. Sie versucht, sich etwas vorzumachen, das ist alles richtig. Aber ihre eigene Version – die Frau sei wohl ›gestorben‹ –, woher hat sie die? Das Wahrscheinlichste ist doch: der Anblick der Toten hat sie darauf gebracht. Wir haben ja selber ganz ungläubig davorgestanden, so friedlich sah das aus, mit den Blumen. Kein Wunder, finde ich, dass die Alte sich daran klammert. Und dann haben wir auch noch die Aussagen der Jungs aus dem Streifenwagen. Die bestätigen beide, dass sie völlig außer sich war, als sie die Tote gesehen hat. Und dass sie sie vorher dringend gebeten hat, doch nach der Frau zu suchen, weil sie sich Sorgen um sie gemacht hat. Ich weiß nicht … für mich passt das alles zusammen, und ich denke, so war es.«
»Ich auch«, sagte Ana.
»Gut«, sagte Fonseca, »dann sind wir uns ja einig. Drei Stimmen für Nein. Das bedeutet natürlich: Jemand ganz anderes hat die Tote so aufgebahrt. Aus einem Grund, den wir nicht kennen.« Er streifte sich die Latexhandschuhe ab und warf dabei einen Blick auf seine Armbanduhr. »Hier dürfte es gleich mit der Ruhe vorbei sein. Ich glaube, wir gehen mal unseren Kaffee trinken.«
3
Vorn in der Einfahrt standen jetzt die ersten Schaulustigen, unter Regenschirmen zusammengedrängt. Die Schutzpolizisten saßen wieder beide in ihrem Streifenwagen.
»Wir fahren jetzt unsere Wagen hier weg!« rief Fonseca ihnen zu. »Vorn an die Straße! Die ganze Durchfahrt wird gesperrt!«
Der Citroën musste als erstes weg. Pinto schlug den Kragen seines Regenmantels hoch und ging rasch hinüber.
»Ach, Ana?« sagte Fonseca. »Ich möchte, dass Sie sich mit dem Kaffeetrinken Zeit lassen, ja? Wir anderen werden es kurz halten, aber ich denke, Sie sollten der alten Dame noch ein bisschen Gesellschaft leisten.«
»Aha …?« Sie zog etwas die Augenbrauen hoch.
»Dies ist das Wichtigste, was Sie im Augenblick tun können. Ich möchte, dass Sie so viel wie möglich über die Opfer herausfinden. Über ihr Leben, ihre Vergangenheit. Lassen Sie sie einfach plaudern, die gute Teresa, verstehen Sie? Ganz unbefangen, so als hätte sie ihre Enkelin zu Besuch. Meinen Sie, Sie kriegen das hin?«
»Klar, kein Problem.«
Ein Motor wimmerte im Rückwärtsgang: Pinto setzte den Citroën zurück. Auch der Streifenwagen fuhr jetzt an. »Gut. Warten Sie hier. Ich bin gleich wieder da.«
Ana sah ihm nach, wie er durch den Regen zu seinem Mercedes hinüberging. ›Enkelin zu Besuch‹. Na, großartig … Aber ganz so enttäuscht wie im ersten Moment war sie schon nicht mehr. Was wäre, wenn tatsächlich etwas dabei herauskäme?
Ihr Mobiltelefon gab einen einzelnen Piepton von sich: SMS erhalten. Sie nahm es aus ihrer Jackentasche und sah nach, von wem. Mário. Sie lächelte leise und rief die Nachricht ab.
›Ana, ich halte es nicht mehr aus ohne dich sag schnell wo treffen wir uns?‹
Sie blickte verstohlen auf. Es war niemand in ihrer Nähe. Sie biss sich leicht auf die Unterlippe und tippte mit flinkem Daumen ihre Antwort:
›Kann jetzt nicht. Verfolge gerade einen Bankräuber.‹
Fonseca und Pinto kamen durch die Einfahrt zurück, und sie steckte ihr Telefon ein. Mit ein paar schnellen Schritten lief sie ihnen entgegen.
»Ach, die arme Kleine!« sagte Dona Teresa, in der offenen Haustür stehend. »Du siehst ja ganz verfroren aus!« Es fehlte nicht viel, und sie hätte ihr noch die Wange getätschelt. »Komm schnell herein und wärm dich etwas auf!«
Ana sagte leise zu Fonseca: »Ich sag doch, das mit der Enkelin ist kein Problem.«
»Kommen Sie durch in die Küche, da ist es am wärmsten!« Die alte Frau ging voran, eine schwarze Wolljacke über dem schwarzen Kleid, ihr dünnes weißes Haar zu einem festen Knoten gebunden.
Sie setzten sich an den Küchentisch, und Dona Teresa holte den Kessel und goss sorgsam den löslichen Kaffee auf. Fonseca nahm zwei Löffel Zucker, rührte dann in seiner Tasse. »Sie werden Ihnen fehlen, Ihre Nachbarn, nicht wahr?«
»Oh ja, das werden sie ...« Dona Teresa zog einen Stuhl zurück und setzte sich. »Das wird ja wieder sein wie vorher. Das Haus hat lange leergestanden, wissen Sie, und seit mein Mann nicht mehr lebt, war es hier oft ziemlich einsam.«
»Wie lange haben Ihre Nachbarn denn hier gewohnt?«
»Ein paar Jahre ... Ich weiß nicht. Drei oder vier?«
»Hat ihnen das Haus gehört?«
»Nein, nein, das gehört dem Bruder, Carlos. Der lebt in Venezuela.«
»Ist das ihr Bruder oder seiner?«
»Seiner, seiner. Von João! Die kenne ich ja alle noch als kleine Jungen! Das Ganze hier vorn an der Straße, das war mal alles ein Hof, wissen Sie, der gehörte dem alten Guilhermo. Und als der gestorben war, wurde es aufgeteilt, und zwar …«
Por amor de Deus! dachte Ana. Gleich werde ich mir ihre ganze Lebensgeschichte anhören müssen und die ihres verstorbenen Mannes und aller Brüder und Schwestern und Kinder und Kindeskinder. Und Fonseca, der daran schuld war, saß behaglich zurückgelehnt neben ihr und trank seinen Kaffee. Ab und zu sagte er etwas wie »Ach, ist das wahr« oder »Ja, ja, das glaube ich«, ansonsten ließ er Dona Teresa einfach so vor sich hin reden.
Pinto blickte aus dem Fenster. »Ich glaube, da tut sich was.«
»Sie hören es, die Pflicht ruft!« Fonseca erhob sich. Zu Ana sagte er, als sei ihm das gerade eingefallen: »Ach, bleiben Sie ruhig noch sitzen. Es wird ohnehin ein langer Tag. Wir sehen erst mal nach, was da los ist.«
»Ja, gut. Danke.«
»Na, das ist schön, Mädchen. Dann nehmen wir noch ein Tässchen!« Dona Teresa begleitete ihre Gäste hinaus.
Kaum waren sie durch die Tür, stand Ana auf und trat ans Fenster. Pinto hatte noch nicht einmal gelogen. Ein Mann mit Regenschirm, der einen Koffer trug, kam durch die Einfahrt, und gleich hinter ihm ein anderer mit einem Fotostativ. Sofort packte sie wieder die Ungeduld. Sie fühlte sich eingesperrt. Wieso hab ich mich nur darauf eingelassen?
Sie hörte, dass die alte Frau zurückkam und setzte sich wieder an den Küchentisch. Ihr Mobiltelefon piepte einmal kurz auf. Sie zögerte, aber dann dachte sie: Ach nein, jetzt nicht.
»Du hast eine SMS!« sagte Dona Teresa. »Willst du nicht nachsehen? Also, ich könnte das gar nicht aushalten!«
Ana musste lachen. »Einen Moment, ja? Wahrscheinlich ist es dienstlich.«
Sie nahm ihr Telefon aus der Tasche und sah nach. Mário.
›Ana, ich ziehe dich ganz langsam aus und küsse dich überall ab dass es dich völlig verrückt macht sag mir einfach wo ich dich finden kann!‹
Sie konnte ein Lächeln nicht unterdrücken. »Ich muss noch kurz antworten, ja?«
»Ja, ja, nur keine Eile.« Dona Teresa goss ihnen beiden noch einen Kaffee auf.
Ana tippte rasch ein:
›Lenk mich nicht dauernd ab. Deinetwegen habe ich jetzt danebengeschossen.‹
Sie sendete die Antwort ab und steckte ihr Telefon ein. Dann zog sie den Reißverschluss ihrer Lederjacke auf und lehnte sich zurück.
»Siehst du, jetzt ist dir doch warm geworden«, sagte Dona Teresa. »Das war von deinem Freund, was? Erzähl mir nichts! Du hättest dein Gesicht sehen sollen!« Sie lachte gutmütig und setzte sich wieder.
»Was war das für eine Frau, die Maria?« fragte Ana. »Sie haben sie sehr gemocht, oder?« Das war ihr jetzt einfach herausgerutscht. Sie hoffte, dass sie nichts Falsches gesagt hatte.
»Ja, das habe ich … Aber es war schade. Ich wusste ja immer, es war nur auf Abruf. Sie wäre nicht hiergeblieben.«
»Warum nicht?«
»Ach, hier zu wohnen, war für sie nur ein Übergang. Eine Notlösung. Ich bin sicher, sie hat die ganze Zeit darauf gewartet, wieder wegzukommen.«
»Sie war nicht von hier?«
»Nein. Sie und João hatten ein Haus in den Bergen bei Amarante. Ein schönes Haus, sie hat mir mal ein Bild gezeigt. Aber dann ist das abgebrannt und sie wussten wohl überhaupt nicht, wohin. Sie waren auch nicht ausreichend versichert gewesen. Und da hat sein Bruder ihnen das Haus hier nebenan überlassen. Das stand ja leer.«
»Ihr Haus ist abgebrannt?« Ana setzte sich wieder gerade auf. »Und wieso? Haben sie das gesagt?«
»Es war Brandstiftung!«
»Ist das sicher?«
»Ja. Das haben sie gesagt.«
»Und wann ist das passiert?«
»In dem Sommer, in dem es so furchtbar gebrannt hat. In den Nachrichten sah man nur noch die brennenden Wälder.«
»Vor vier Jahren, meinen Sie?«
»Ja, das kann sein. Und zum Winter sind sie hier eingezogen. Ich weiß nicht, ob sie seinem Bruder dafür Miete bezahlt haben. Viel bestimmt nicht. Sie haben auch sonst sehr bescheiden gelebt. Es wurde alles zurückgelegt, um ihr altes Haus wieder aufzubauen.«
»Sie sagten, der Mann hätte hier Arbeit gehabt? Bei einer Spedition?«
»Ach ja, der João, der hat immer nur Lastwagen gefahren. Was anderes hat der auch nicht gelernt ... Weißt du, die Maria, das war so eine Frau, da dachte man: Die hätte eigentlich etwas Besseres verdient.«
»Fand sie selber das auch?«
Dona Teresa lachte leise. »Das kann ich nicht sagen.«
»Wie haben die beiden sich denn verstanden?«
»Ganz gut, glaube ich. Jedenfalls habe ich nie mitbekommen, dass sie sich groß gestritten hätten.«
»Aber ihr hat es hier nicht gefallen?«
Die alte Frau fing an, ganz leicht mit dem Kopf zu nicken, so als stünde ihr dabei alles mögliche vor Augen. »Sie mochte das Meer … Doch, ja, dass man das Meer sehen kann, das hat ihr gefallen. Aber die Raffinerie, die mochte sie gar nicht. ›Das Meer ist so schön‹, hat sie gesagt. ›Warum muss man so hässliche Dinge wie Raffinerien direkt ans Meer bauen?‹ Ich hab gesagt: ›Weil das Öl mit dem Schiff kommt, wahrscheinlich.‹ Da hat sie gelacht und den Kopf geschüttelt, ich sehe es noch vor mir.«
Ana zögerte einen Moment. »Glauben Sie, dass sie unglücklich war?«
Dona Teresa blickte in ihre Tasse. »Ja, das glaube ich. Das war sie.«
»Und weshalb?«
»Ich glaube, sie wusste es. Sie wusste, dass ihre Stunde näher kam. Dass sie nicht mehr lange zu leben hatte.« Sie bekreuzigte sich.
»War sie denn krank?«
»Nein, das nicht. Es war irgendetwas anderes. Aber sie wusste es genau, da bin ich sicher.«
»Ich denke, sie hatten vor, ihr Haus wieder aufzubauen? Meinen Sie, sie wusste, dass sie das nicht mehr erleben würde?«
»Ja. Zum Schluss ja.«
»›Zum Schluss‹, sagen Sie? Das heißt, es hatte sich etwas verändert.«
»Ja, das hatte es wohl … Was immer es war, das ihr auf der Seele gelegen hat, es war schlimmer geworden.«
»Hat sie nie darüber gesprochen?«
»Nein, nie.«
»Können Sie sich erinnern, seit wann es schlimmer geworden ist?«
Ana sah die alte Frau jetzt ganz genau an. Sie sah, wie sie innerlich schwankte. Wie sie ein schlechtes Gewissen hatte. Wie sie beinahe einen Entschluss fasste und ihn dann wieder verwarf.
»Nein. Nein, ich weiß es nicht.«
»Ist hier noch irgendetwas passiert?«
»Nein. Nicht dass ich wüsste.«
Ana war sicher, da war etwas. Etwas, das sie unbedingt wissen musste … Aber es ließ sich jetzt nicht erzwingen.
»Hatten sie Kinder, die beiden?«
»Eine Tochter, ja!« Dona Teresa atmete sichtlich auf. »Die Inês. Ein sehr hübsches Mädchen, da kommt sie ganz nach der Mutter.« Aber schon fiel es ihr alles wieder ein. »Ai, Jesus! Jemand wird es ihr sagen müssen!«
»Das machen wir schon, keine Sorge. Wissen Sie vielleicht, wo wir sie erreichen können?«
»Ich weiß, dass sie in Frankreich lebt. Aber wo genau …?«
In Anas Jackentasche piepte wieder das Telefon. SMS. Dona Teresa hatte es anscheinend überhört, und sie selber kümmerte sich jetzt auch nicht darum.
»Kennen Sie die Tochter persönlich?«
»Nein, nur von den Fotos. Und was Maria so erzählt hat.«
»Sie ist nicht ein Mal hiergewesen? In den ganzen vier Jahren nicht?«
»Nein. Ganz bestimmt nicht. Das wüsste ich.«
»Gibt es noch andere Verwandte, hier in der Nähe?«
»Von ihrer Seite nicht, nein.« Dona Teresa überlegte. »Und von João? Nein, der alte Bernardo ist ja nun auch schon tot.« Sie zuckte bedauernd die Achseln. »Und der Rest lebt sonstwo auf der Welt. Die sind ja früher alle weggegangen. Ich glaube, da ist nur noch Nuno übrig.«
»Nuno?«
»Ja, das ist ja sein Neffe.«
»Der Nuno mit der Spedition?«
»Ja, als sie hierhergezogen sind, hat João bei ihm angefangen.«
»Und dieser Bruder, dem das Haus gehört, Carlos, in Venezuela, das ist dann …?«
»Nunos Vater. Aber der hat sich da drüben eine Negerin genommen, weißt du, der Carlos, das ist ja so ein Verrückter. Und da hat seine Frau sich scheiden lassen. Die ist dann wieder zurückgekommen und hat Nuno mitgebracht. Wie alt war er da? Neun oder zehn vielleicht.«
»Also, Carlos hat João das Haus überlassen und Nuno hat ihm Arbeit verschafft.«
»Ja, man muss sich doch unter die Arme greifen. Dafür ist die Familie doch da.«
»Ja, ja. Aber João war ja der Ältere, der Onkel, und dann bei seinem eigenen Neffen in der Firma anzufangen … Wie sind die beiden denn zurechtgekommen?«
»Das weiß ich nicht. Aber mit Nuno …« Dona Teresa winkte ab. »Das wird wohl nicht immer ganz einfach gewesen sein.«
»Wieso, was ist denn mit ihm?«
»Ich will ja nichts sagen, aber … der Nuno, der war schon immer ein kleiner Halunke.« Sie schüttelte den Kopf. »Als das Haus nebenan noch leerstand, da hat er den Schlüssel gehabt, um da ab und zu nach dem Rechten zu sehen. Was haben die da manchmal für Feste gefeiert! Ai, ai, ai! Standen da einfach alle im Garten und haben irgendwo hingepinkelt, mir über den Zaun gekotzt. Und ein paar Frauen sind da manchmal herumgelaufen! So Brasilianerinnen, das waren bestimmt alles Illegale. Ich dachte, der macht hier noch ein Bordell auf. Ich war heilfroh, als das vorbei war, das kannst du mir glauben! Nein, nein, mit João und Maria als Nachbarn, das war schon etwas anderes.«
»Das waren ruhige Leute, nehme ich an.«
»Ja, sehr ruhig. Ich glaube, die haben hier nicht ein einziges Mal Besuch gehabt. Sie haben sehr zurückgezogen gelebt. Die Maria, die war schon fast menschenscheu, die war praktisch immer hier, so wie ich. Nur zur Kirche ist sie gegangen und mal einkaufen, aber nie allein, immer mit João und dem Wagen. Da haben sie mich manchmal mitgenommen, das war sehr nett. Ja, ja … Wer weiß, was jetzt mit dem Haus passiert. Ich hoffe nur, es wird nicht wieder so wie vorher.« Von draußen war plötzlich aufgeregtes Gegacker zu hören. Auch der Hund fing wieder an zu bellen. »Sollen wir nicht doch langsam mal die Hühner füttern?«
»Ich weiß nicht, ob das schon möglich ist. Da drüben muss erst alles genau untersucht werden.«
»Ach ja … Untersuchen und nachbohren und Fragen stellen. Als ob das noch etwas nützen würde. Davon wird auch niemand wieder lebendig. Ist es nicht so?«
Ana atmete einmal tief durch. Lass es, dachte sie. Sag einfach gar nichts dazu.
Aber sie nahm es als Zeichen zum Aufbruch. »Pronto, ich geh dann mal. Wir haben gleich Mittagspause. Aber ich seh noch nach den Hühnern. Versprochen.«
Sie überlegte dann tatsächlich, ob sie kurz hinten herum zum Hühnerstall gehen sollte, aber es regnete so sehr, dass sie es lieber bleiben ließ. Sie schlug den Kragen ihrer Lederjacke hoch und lief schnell vorn die Straße entlang.
Unter dem Vordach stand ein Kriminaltechniker im weißen Schutzanzug, der sich gerade seine weißen Handschuhe anzog. Als er hörte, wie sie durch die Gartenpforte kam, sah er sie misstrauisch an. »Bom dia?« sagte er, und es war klar, was das heißen sollte: ›Wer sind Sie und was haben Sie hier zu suchen?‹
»Bom dia!« sagte Ana, lächelnd und unbekümmert, und trat mit unter das Vordach. Sie fasste sich in den Nacken, befreite ihren Pferdeschwanz und ließ ihn einmal hin- und herschwingen. »Ich bin Inspektorin und arbeite an dem Fall.«
»Ah ja.« Er senkte einen zweifelnden Blick bis hinab auf ihre rosa Gummistiefel. Dann zog er sich seine Kapuze über den Kopf. »Com licença«, sagte er und drängte sich an ihr vorbei zur Tür.
Als er sie öffnete, konnte sie sehen, dass der Flur jetzt von einem starken Scheinwerfer ausgeleuchtet war. In dem hellen Licht sah sie die Schuhsohlen des Toten, der noch genau so dalag wie vorher.
Sie hatte keine Lust, direkt hinter dem Mann im Schutzanzug herzugehen, also nahm sie ihr Telefon und rief erst noch die neuste SMS ab.
›Ana, hab ein Herz und lass den Bankräuber laufen nur dieses eine Mal.‹
Sie überlegte, dann antwortete sie:
›Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Wo er doch so ein hübscher Junge ist.‹
Sie wartete noch einen Moment und wollte dann gerade hineingehen, als das Telefon von neuem aufpiepte. Wieder Mário.
›Achtung neue Instruktionen sofort erschießen den Kerl!‹
Sie lächelte, steckte ihr Telefon dann aber ein und schob die Haustür weiter auf.
Fremde Stimmen waren zu hören. »Das ist dann Nummer zwölf. Kann ich mal die Zwölf haben, bitte?«
Sie trat ein und ging langsam an dem Toten vorbei. Der Scheinwerfer blendete sie.
An der Ecke mit der Garderobe blieb sie stehen und sah sich um. Rechts aus der Küche hörte sie Pintos Stimme. Links, in der Tür zum Wohnzimmer, stand der Mann im weißen Schutzanzug. Auch das Wohnzimmer war jetzt grell erleuchtet.
Plötzlich sah sie vor sich am Boden das zerknüllte Papiertaschentuch. Jemand hatte ein Zentimetermaß danebengelegt, das genau angab, wie weit es von der Wand entfernt lag, und eine gelbe Nummerntafel mit einer 8 danebengestellt.
Der Mann im Schutzanzug drehte sich nach ihr um. Es war tatsächlich derselbe wie eben. »Ja?«
»Das Taschentuch da … das können Sie wegschmeißen. Das ist von mir.«
Der Mann sah sie ungläubig an. »Sie haben hier ein Papiertaschentuch fallenlassen?«
Pinto trat aus der Küchentür. »Nein, das war so: Sie hat hier mit dem Hund von nebenan Fangen gespielt, und weil sie gerade kein Stöckchen zur Hand hatte – «
»Ja, ja, sehr witzig«, sagte der Mann im Schutzanzug. »Jetzt lassen Sie uns bitte unsere Arbeit machen, ja?«
Pinto zuckte die Achseln. »Sehen Sie, so schwer hat es oft die einfache Wahrheit.«