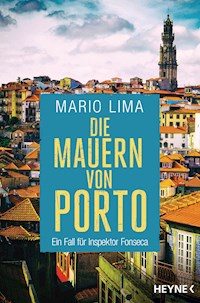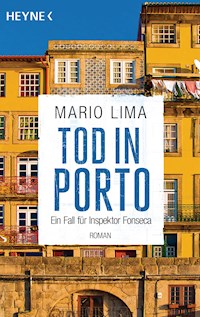
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Das Team von Inspektor Fonseca hatte schon mit eisbeschlagenen Vinho-Verde-Gläsern auf den wohlverdienten Sommerurlaub angestoßen, als plötzlich ein Mann brasilianischer Herkunft erschossen neben seinem Sportwagen aufgefunden wird. Wenig später taucht ein Video auf, das mit dem Fall in Verbindung steht: Eine Zunge und ein Paar Ohren, genagelt an eine Holztür. Die „brasilianische Methode“ mit Spitzeln umzugehen. Das Video hatte acht Empfänger. Sind weitere Morde geplant? Wie viel weiß der Arbeitgeber des Ermordeten, ein windiger Immobilienmakler? Und was hat die Tochter eines berühmten Anwalts aus Sao Paulo mit dem Ganzen zu tun?
Der Fall führt die Ermittler Fonseca, Ana und Pinto in die brasilianische Unterwelt Portos, die sehr viel größer und mächtiger ist, als die malerische Kulisse der portugiesischen Küstenstadt es erahnen lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Ähnliche
Das Buch
Porto im Hochsommer. Vor einer Diskothek wird morgens um vier ein Mann erschossen, aus einem vorbeifahrenden Wagen heraus. Der Mann ist Brasilianer und hat seit Jahren in Portugal gelebt.
Für Chefinspektor Fonseca und seine Leute beginnt damit ein Fall, der sie immer tiefer hineinführt in den brasilianischen Albtraum aus Gewalt, organisiertem Verbrechen und einer alles zersetzenden Korruption. Aus dem großen »Bruderland«, wie Brasilien gern genannt wird, hat sich eine düstere Affäre in das kleine Portugal verlagert – und es ist mehr als zweifelhaft, ob die Polícia Judiciária dem wirklich gewachsen ist.
Der Autor
Mario Lima ist das Pseudonym eines deutschen Autors, der seit vielen Jahren in Portugal lebt. Mit seiner Frau und drei Katzen wohnt er im grünen Norden des Landes. Dort kümmert er sich auch gern um seine Weinreben und keltert selbst etwas roten Vinho Verde.
www.mario-lima.com
MARIOLIMA
TODINPORTO
Ein Fall für Inspektor Fonseca
ROMAN
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Glossar der portugiesischen Ausdrücke im Anhang.Originalausgabe 06 / 2019Copyright © 2019 by Mario LimaCopyright © 2019 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 MünchenRedaktion: Steffi KordaUmschlaggestaltung und Karten: Anke Koopmann, Designomicon, unter Verwendung von Motiven von © Shutterstock (Neirfy/ShustrikS/Bardocz Peter)Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN: 978-3-641-23460-7V003www.heyne.de
Das Video ist nur dreiunddreißig Sekunden lang. Es ist etwas wackelig, eine einfache Aufnahme mit dem Mobiltelefon. Der Blick geht einen Gartenweg entlang, der direkt auf die Holztür eines niedrigen Schuppens zuführt. Irgendetwas hängt an der Tür, das aus dieser Entfernung noch nicht zu erkennen ist.
Die Kamera bewegt sich langsam darauf zu. Auf der einen Seite des Weges bleibt eine große Yucca zurück, auf der anderen der Stamm einer Palme. Schritt für Schritt geht es näher heran, dann sieht man es ganz deutlich: Es sind zwei menschliche Ohren, die an die Tür genagelt sind. Das eine links, das andere rechts, und dazwischen, auf Höhe der Ohrläppchen: eine herausgeschnittene Zunge.
Die Kamera geht ganz nahe heran und bewegt sich nicht mehr. Ein paar Sekunden sind nur noch die Ohren im Bild, die herabhängende Zunge, die drei langen Nägel.
Dann ist das Video vorbei.
1
Der Himmel über Porto war strahlend blau, die Möwen zogen ihre Kreise. Es war heiß jetzt um die Mittagszeit, aber eine sanfte Sommerbrise strich den Rio Douro entlang und brachte den Geruch des Meeres mit.
Die Kellner hatten drei Tische zusammengerückt, für die Vorspeise war schon gedeckt. Entspannt, in kurzärmeligen Hemden, saß die Gruppe unter den großen weißen Sonnenschirmen: sieben Männer von der Mordkommission der Polícia Judiciária.
»Kinder, wie haben wir das gemacht?« Chefinspektor Fonseca, ein massiger, untersetzter Mann um die fünfzig, saß an der Stirnseite der Tafel. Er hob sein Glas. »Pünktlich zum Ferienbeginn beide Fälle abgeschlossen! Ich finde, wir können uns ruhig mal selber loben.«
»Das können wir!«, kam es aus der Runde. »Den Urlaub haben wir uns weiß Gott verdient!«
»Streng genommen«, sagte Inspektor Dinis, »haben wir ja noch bis morgen Bereitschaft.«
»Buuuh!«
»Spielverderber!«
Dinis zuckte mit den Schultern. »Ich sage ja nur, wie es ist.« Er konnte nicht anders, er war einfach so. Mit seiner Halbglatze sah er auch eher aus wie ein nüchterner Verwaltungsbeamter.
»Na, kommen Sie …«, sagte Fonseca. »Sehen Sie sich doch mal um. Was soll sein, hm?«
Das Restaurant lag am Südufer, und von der Terrasse hatte man einen weiten Blick über die Dächer der Portweinkellereien bis hinab zum blauen Fluss. Bunt bewimpelte Barkassen fuhren unter dem hohen Bogen der Ponte Dom Luís hindurch. Drüben, am Kai der Ribeira, leuchteten die weißen Markisen der Cafés, und das Häusergewirr der Altstadt staffelte sich die Hügel hinauf wie seit Jahrhunderten. Die Welt war ein sonniger, friedlicher Ort.
»Einfach mal abschalten, Dinis.« Rui Pinto hob jetzt ebenfalls sein Glas. Mitte dreißig, gut aussehend und nicht ganz uneitel, hatte er auch heute wieder etwas Gel in seinem schwarzen Haar. »Die Verbrecher sind doch auch längst in den Ferien!«
»Darauf trinken wir!«
Ein Stuhl war noch frei. Fonseca warf einen Blick auf die Uhr. »Wo bleibt Ana denn?«
»Die hat bestimmt was Besseres vor!«
»Was? Als mit mir essen zu gehen?«, sagte Pinto. »Was kann eine Frau denn Besseres vorhaben?«
»Ah, der fällt schon was ein, keine Sorge!«
Einige lachten.
»Achtung, Leute.« Dinis deutete mit dem Kopf auf die offenen Glastüren des Restaurants. »Da kommt sie.«
Ein Kellner wies ihr lächelnd den Weg, und schon trat sie aus dem Innenraum ins Freie: Ana Cristina, die jüngste Inspektorin der Mordkommission und in Fonsecas Abteilung auch die einzige. Sie winkte ihnen zu und kam herüber, schlank und zierlich, in Sandalen mit hohen Korksohlen. Ihr langes dunkles Haar trug sie offen und zu den engen Jeans ein grell orangefarbenes Top mit Spaghettiträgern. Die Nägel ihrer Hände und Füße waren in dem gleichen leuchtenden Orange lackiert, sodass perfekt zur Geltung kam, wie sommerlich braun sie war. Auch die Kellner und die Leute an den Nachbartischen sahen sie unwillkürlich an.
»Olá! Bin ich etwa zu spät?«
»Ach was, wir haben doch frei!«
»Komm, setz dich zu uns!«
Einer der Kellner war ihr gefolgt, und Fonseca nickte ihm zu. »Wir sind dann vollzählig.«
Die Vorspeise wurde serviert: Amêijoas à Bulhão Pato – Venusmuscheln, gegart mit etwas Knoblauch und frischem Koriandergrün. »Mmm …« Fonseca schloss die Augen, um den Duft zu genießen. »Einfach göttlich. Und wir haben sogar den idealen Wein dazu!« Zur Feier des Tages hatten sie einen guten Alvarinho aus Melgaço bestellt. Die Flaschen standen in Eismanschetten auf dem Tisch, und der kühle Weißwein ließ die Gläser beschlagen.
Beim Essen plauderten sie darüber, was sie alle so vorhatten. Ana erzählte, dass sie mit ihrem Freund an die Algarve wollte, und der eine oder andere sah sie an, als ob er diesen Freund im Stillen beneidete. »Zwei Wochen. Am siebten sind wir wieder hier, da heiratet seine Schwester.«
»Am siebten?«, sagte Pinto. »Da habe ich Stadionkarten für den Supercup.« Er ballte die Faust. »Wir gegen den Erzfeind!« Der Klassiker stand an: FC Porto gegen Benfica.
»Und Sie, Chef? Was machen Sie?«
»Ich fahr nach Ponte de Lima. Kümmere mich mal um mein Haus und meine Weinreben.«
Fonseca hatte sich nun doch entschlossen, sein Elternhaus im Minho zu behalten und ließ es nach und nach renovieren. Er freute sich auf ein paar unbeschwerte Wochen auf dem Lande, in seinem alten Dorf, wo er noch praktisch jeden kannte und wo er nicht der Chefinspektor war, sondern einfach Zé Manel.
»Na denn! Auf schöne Sommertage!«
Es war Samstag, der vierundzwanzigste Juli. Nur wenige Stunden, bevor es begann.
Der Anruf kam am nächsten Morgen um Viertel nach fünf, und Fonseca wusste sofort, dass sich all ihre Pläne erledigt hatten.
Im Halbschlaf hob er das Telefon ans Ohr. »Ja …?«, brummte er.
Erst schien überhaupt niemand dran zu sein. Im Hintergrund hörte er andere klingelnde Telefone. Dann, plötzlich, sagte eine laute Stimme: »Chef? Ein Vorfall in Ramalde. In der Zona Industrial sind Schüsse gefallen. Es gibt einen Toten.«
2
»Ich sagte: kein Kommentar! Sie sehen doch, dass ich gerade erst ankomme!«
»Wir wollen ja nur, dass Sie uns ganz kurz …«
»Wenn Sie mich bitte durchlassen würden!«
»Ist es wahr, dass das Opfer Brasilianer ist?«
Einer der Schutzpolizisten hob das Absperrband für ihn hoch, Fonseca zog den Kopf ein und ging darunter hindurch. »Meu Deus, wo kommen die bloß schon alle her um diese Zeit? Und das am Sonntag!«
Es war jetzt sechs Uhr morgens, in einer nüchternen Straße im Gewerbegebiet. Der Himmel über den Lager- und Fabrikhallen wurde gerade erst blassblau und rosa.
Fonseca hatte ein Stück entfernt parken müssen, und beim Aussteigen hatte er noch die Vögel in den Straßenbäumen zwitschern hören. Hier drängten sich die Reporter und Schaulustigen, aufgeregte Stimmen und der schnarrende Polizeifunk schwirrten durcheinander. Drei Streifenwagen standen am Straßenrand.
»Bom dia.« Rui Pinto kam auf ihn zu, gut gekleidet wie immer, in einem hellen Sommeranzug. »Ist das nicht eine Gemeinheit? Am letzten Tag der Bereitschaft?«
»Tja, unseren Urlaub können wir wohl vergessen. Das hört sich ja gar nicht gut an.«
»Sieht auch nicht gut aus.« Pinto deutete in die Richtung des Tatorts. Tavares und Andrade standen bei der Leiche.
»Bom dia.«
Der Tote lag seitlich verrenkt auf dem Gehweg, in einer großen Blutlache. Es war ein jüngerer Mann, in Jeans und T-Shirt, auffällig muskulös, mit kahl geschorenem Kopf.
»Und? Ist er nun Brasilianer?«
Andrade hielt wortlos einen Klarsichtbeutel hoch. Ein Pass war darin, dunkelblau mit goldener Schrift: ›República Federativa do Brasil‹.
Tavares las aus seinem Notizbuch ab: »Nilton de Souza Wanderley, dreiunddreißig Jahre alt, geboren in … Itapetininga Schrägstrich SP. Also ›SP‹ für São Paulo.«
»Was wissen wir sonst noch über ihn?«
»Das da ist sein Wagen.« Andrade zeigte auf einen Audi TT, der ein paar Meter weiter stand, innerhalb der Absperrung. »Und die hier lagen ebenfalls im Handschuhfach.« Er reichte Fonseca einen anderen Klarsichtbeutel. Visitenkarten waren darin, mit dem Namen des Toten und dem Logo einer Firma darauf: ›Imocon, Mediação Imobiliária, Lda.‹
»Ein Immobilienmakler? Ist der Job jetzt schon so gefährlich?«
»Sieht so aus«, sagte Pinto. »In dem Handschuhfach lag auch eine Schusswaffe.«
»Mm-hm?« Fonseca sah sich den Toten noch einmal näher an. »Ich hätte ihn ja auch eher für eine Art Gorilla gehalten. Privater Sicherheitsdienst oder so was.«
»Stimmt, ich auch. Solche Muskeln kriegt man nicht von selbst. Der hat jahrelang Krafttraining gemacht, vielleicht auch Steroide geschluckt.«
»Was meint ihr, liegt er noch so da, wie er hingefallen ist?«
»Wahrscheinlich schon. Da hat bestimmt keiner versucht, Erste Hilfe zu leisten.«
»Wie viele Einschüsse sind es?«
»Sieben, soweit man zählen kann, ohne ihn umzudrehen. Sieht nach Maschinenpistole aus. Ich würde sagen: klare Tötungsabsicht, ohne Wenn und Aber.«
Fonseca nickte. Eine glatte Hinrichtung, geplant und ausgeführt. Er blickte auf. »Und was hat der hier gemacht, mitten in der Nacht?« Er drehte sich um und betrachtete die Menge hinter der Absperrung. Was machten überhaupt all diese Leute hier? Die Journalisten, gut. Aber ein Dutzend junger Mädchen in Hotpants und bauchfreien Tops?
Pinto folgte seinem Blick und lächelte. »Hinter der Kurve da ist die Diskothek Flash, da kommen die alle her. Unser Mann vermutlich auch.«
»Ach so. Das erklärt ja schon mal einiges. Brauchbare Zeugen dabei?«
»Bis jetzt nicht. Ist ja klar, in so was will keiner hineingezogen werden.«
»Was lässt sich zum Tathergang sagen?«
»Was die Leute hier erzählen, stimmt weitgehend überein. Demnach ist er gegen halb fünf aus dem Flash gekommen, allein, und war wohl auf dem Weg zu seinem Wagen. Dann ist ein dunkler Mercedes aufgetaucht und langsam in dieselbe Richtung gefahren. Und dann sind auch schon die Schüsse gefallen; einige sagen, sehr schnell hintereinander, andere meinen, wie ein Geknatter, sie haben es erst für Feuerwerkskörper gehalten. Der Mercedes hat beschleunigt und war weg. Das ist alles.«
Fonseca seufzte. »Uma bela merda …«
»Das kann man wohl sagen.« Pinto blickte nachdenklich auf den Toten hinab. »Ich weiß nicht, ich werde das Gefühl nicht los, dass ich den schon mal irgendwo gesehen habe.«
»Gibt viele, die so aussehen.«
»Schon, aber … Na, vielleicht fällt es mir ja noch ein.«
Es fiel ihm sofort ein, als er hörte, wo Nilton Wanderley gewohnt hatte: an der Douro-Mündung, in Foz Velha. Pinto selbst wohnte nur ein paar Querstraßen weiter. Niltons Adresse endete mit ›5. Stock links‹, seine Wohnung lag also ebenfalls in einem der Apartmenthäuser, die sich hier und da über die Dächer des alten Viertels erhoben.
Pinto liebte Foz Velha: das Meer direkt vor der Tür, die prächtige Palmenallee am Ufer, wo der Rio Douro breit in den Atlantik strömte, die Strandcafés, die in den Sommernächten zu leuchtenden Bars wurden. Die Mädchen in den Geschäften des Viertels trugen das halbe Jahr einen Bikini unter ihren Sachen, und wenn sie Pause hatten, gingen sie einfach über die Straße an den Strand. Pinto fand, hier ließ es sich leben.
Er sorgte dafür, dass er dabei war, als am frühen Nachmittag Niltons Wohnung durchsucht wurde. Bis dahin hatte er noch niemandem erzählt, woran er sich erinnert hatte. Er wollte sich erst einmal ungestört umsehen. Nach etwas ganz Bestimmtem.
Sie waren zu dritt. Auf dem Korridor zogen sie sich Latexhandschuhe an und schlossen dann die Wohnungstür auf. Schon beim ersten Rundgang sahen sie sich immer wieder zweifelnd an. Das Apartment wirkte so steril, als ob es zum Verkauf stünde und der Bewohner seine persönlichen Dinge schon weggeschafft hätte. Keine Familienfotos, kein Hinweis auf eine Freundin, nichts.
»Vielleicht ist er nicht oft zu Hause gewesen. Es gibt Leute, die können jahrelang so wohnen. Kommen nur mal zum Schlafen vorbei und sind dann gleich wieder weg.«
»Eine Schande bei der Aussicht«, sagte Tavares.
Pinto trat an seine Seite. Aus dem fünften Stock ging der Blick über die ziegelroten, verschachtelten Dächer hinweg, über einzelne hohe Palmen und hinaus auf den blauen Atlantik. Immerhin: Auf dem großen Balkon standen zwei Sonnenliegen nebeneinander.
Sie fingen an, alle Schubladen aufzuziehen, die Schränke zu öffnen. Die Gewissheit kam, als sie ein kleines Zimmer betraten, in dem ein Schreibtisch stand. Das Anschlusskabel war noch da, aber der Computer nicht mehr.
»Da ist jemand vor uns hier gewesen.«
»Exactamente.« Pinto presste die Lippen aufeinander. Sie mussten trotzdem weitermachen. Er nahm sich die nächste Schublade vor.
Nilton Wanderley … Es gab tatsächlich viele, die so aussahen, und Nilton allein wäre ihm sicher nie aufgefallen. Aber er hatte ihn auch nie allein gesehen, sondern immer mit zwei, drei anderen Männern zusammen, alle genauso breit und kräftig, mit den gleichen kahl geschorenen Schädeln. Er hatte sie mehrfach in einer der Strandbars beobachtet und einmal in einem brasilianischen Grillrestaurant – ein paar Typen, die vielleicht im selben Fitnessstudio trainierten. Auch das wäre nicht weiter bemerkenswert gewesen. Was einfach nicht dazu gepasst hatte, war die junge Frau gewesen, die sie bei sich gehabt hatten. Jedes Mal.
Sie war es, die Rui Pinto ins Auge gefallen war: eine Schönheit, schmal und zierlich und den Mandelaugen nach mit asiatischem Einschlag. Ihr pechschwarzes, volles Haar war auf Kinnlänge geschnitten, wodurch ihr schlanker Hals noch betont wurde. Ganz allein in der Runde mit diesen Männern hatte sie um so verletzlicher gewirkt. Und immer auch irgendwie traurig und in sich gekehrt. Sie hatte kaum gesprochen, und wenn die Männer an ihrem Tisch auflachten, hatte sie nur scheu gelächelt. Hatte sie Angst vor ihnen? Schon beim ersten Mal hatte Pinto nicht aufhören können, heimlich hinüberzusehen. Beim zweiten Mal war er dann schon ganz sicher gewesen, dass da etwas nicht stimmte. War sie freiwillig mit diesen Typen zusammen? War sie in ihrer Gewalt? Zwangen sie sie zur Prostitution? Sollte er etwas tun? Eingreifen? Sie retten?
Seine Freundin hatte ihn schließlich in die Seite geknufft. »He, glaubst du, ich sehe nicht, wen du die ganze Zeit anstarrst?«
Er hatte gehofft, hier in der Wohnung einen Hinweis zu finden. Wer war sie? Und wo war sie jetzt? Brauchte sie Hilfe? Einer ihrer Begleiter war gerade auf offener Straße erschossen worden. Pinto schüttelte still den Kopf. Hier war nichts mehr zu holen.
Blieben die Telefone. Nilton hatte zwei Mobiltelefone dabeigehabt. Er musste wissen, was darauf gespeichert war.
Aber die Telefone waren schon weg. »Die sind längst in der Auswertung«, hieß es. Pinto musste dann noch am Tatort bleiben. Die Zeugenermittlung ging vor.
Am späten Nachmittag standen er und Andrade an der Bar des Flash und tranken einen Kaffee. Die verlassene Diskothek war taghell erleuchtet, die Klimaanlage summte in dem kahlen Raum, ab und zu übertönt vom Zischen der Espressomaschine. Es war angenehm kühl hier drinnen nach den fünfunddreißig Grad auf der Straße.
»Das ist alles, hm?« Pinto sah sich um, den Kopf in den Nacken gelegt. »Du nimmst eine Lagerhalle, stellst einen Tresen und ein Mischpult rein und fertig. Dann brauchst du nur noch die Musik aufzudrehen und die bunten Lichter anzuknipsen. Die perfekte Maschine zum Gelddrucken.«
Er hörte das schnelle, harte Klacken von Absätzen, und schon kam Ana Cristina über die Tanzfläche auf sie zu, in Jeans und weißer Bluse, das Haar zum Pferdeschwanz gebunden. »Sag mal, ist die andere Barfrau hier noch irgendwo? Die mit der blauen Strähne im Haar?«
»Keine Ahnung. Ich hab nur die gesehen, die uns den Kaffee gemacht hat. Möchtest du auch einen?«
»Ja, gern. Und ein Wasser.« Ana blickte zum Eingang zurück. »Que chatice! Ist die mir doch entwischt.«
»Was ist denn mit ihr?«
»Ich bin sicher, die hat unseren Mann auf dem Foto erkannt. Hier drinnen wollte sie nur nichts sagen.«
»Ihre Personalien hast du?«
»Ja, ja, das schon.«
»Und sonst? Wie sieht’s aus?«
»Sonst hat den hier angeblich keiner gekannt. Wir haben wirklich jedem sein Foto gezeigt. Alle haben nur den Kopf geschüttelt.«
»Was ist mit dem Türsteher? Der muss ihn doch reingelassen haben.«
»Der sagt auch nur: ›Kann sein, kann auch nicht sein.‹ Er kennt doch nicht jeden.«
Andrade lachte kurz auf. »Weißt du, wer das ist, der Türsteher? Tony Maluco!«
»Was, ehrlich? Hat Puga hier die Finger im Spiel?« Vítor Puga war eine bekannte Halbweltgröße, und Tony Maluco – der ›verrückte Tony‹ – einer seiner Handlanger. »Gehört dem jetzt auch schon das Flash?«
»Nein, nein. Hab ich schon überprüft. Der Besitzer scheint sauber zu sein. Keine Vorstrafen, nichts.«
»Na, wenn er Tony als Türsteher hat, dann kassiert Puga auf jeden Fall kräftig mit.«
»Kann schon sein.«
Pinto gab der Bedienung ein Zeichen. »Zwei Kaffee noch, bitte. Und ein Wasser.«
Niltons Mobiltelefone sah er erst am Abend wieder, auf der Dienststelle der Polícia Judiciária. Jedes in einem beschrifteten Klarsichtbeutel, lagen sie bei Dinis auf dem Schreibtisch.
»Wie weit seid ihr mit der Auswertung?«
Dinis fuhr sich müde über die Halbglatze, sah auf die Uhr. »Im Moment warten wir auf die Verbindungsdaten.«
»Braucht ihr die Telefone noch? Sonst sehe ich sie mir mal an.«
»Nur zu. Wir wissen ohnehin nicht, wo uns der Kopf steht.«
»Wozu hatte er denn zwei dabei? Privat und geschäftlich?«
»Haben wir auch erst gedacht. Aber so einfach ist das wohl nicht. Hier, das Smartphone, das ist eindeutig sein Haupttelefon. Da ist tonnenweise Zeug drauf. Die Leute speichern ja ihr halbes Leben auf den Dingern. Tja, und das andere hier, das ist ein etwas schlichteres Modell, mit Prepaid-Karte und nicht registriert. Das ist seltsam, da ist überhaupt nichts drauf.«
»Was heißt ›überhaupt nichts‹?«
»Nicht mal eine Kontaktliste.«
»Na, ich nehm sie mal beide mit. Komme ich da einfach so rein?«
»Ja, ja, Sperrcode war nur Standard. Ein paar Ordner auf dem Smartphone sind noch passwortgeschützt, aber Bilder und Kontakte sind frei.«
Pinto nickte und nahm die beiden Telefone vom Schreibtisch. Bilder und Kontakte: Das war genau das, was er suchte. Aber davon sagte er nichts.
Das anonyme Telefon steckte er recht schnell in den Klarsichtbeutel zurück und schob es beiseite. Es war nichts damit anzufangen. Alles war auf dem Smartphone. Dinis hatte nicht übertrieben. Tausende Fotos. Nilton hatte offenbar auch alte Bilder importiert, noch aus Brasilien. Sein halbes Leben – es sah wirklich so aus, als hätte er das immer bei sich haben wollen. Sie wussten inzwischen, dass er seit dreieinhalb Jahren in Portugal lebte. Legal. Aufenthaltsgenehmigung, Arbeitserlaubnis: alles in Ordnung.
Als Erstes sah Pinto sich die Kontaktliste an. Keine Profilbilder. Und jede Menge weibliche Namen: Dayana, Janete, Etiene, Jamila, Mayara … Pinto seufzte. Na, schwul war er jedenfalls nicht gewesen.
Er nahm sich die Fotos vor. Ein Ordner hieß ›Ita‹, anscheinend Niltons Geburtsstadt Itapetininga. Sah nach Familienbildern aus. Er machte sich nicht die Mühe, sie zu vergrößern. Dann die Ordner ›SP‹ eins bis fünf, São Paulo. Auch damit hielt er sich nicht auf. Er suchte die neueren Fotos: Hinweise auf diese junge Frau … was war sie? Halbasiatin?
Er saß allein in seinem Büro. Hin und wieder klingelte ein Telefon auf einem der anderen Schreibtische, aber er kümmerte sich nicht darum. Die Tür zum Korridor stand einen Spalt offen, er hörte die Gespräche am Kaffeeautomaten. Die Kollegen fragten sich natürlich, was hinter dem Mord steckte. Womit hatte Nilton sich solche Feinde gemacht? Die meisten tippten auf Drogengeschäfte. »Ist doch klar«, sagte einer, »der Immobilienmarkt ist praktisch zusammengebrochen. Ein Maklerbüro nach dem anderen macht dicht. Er hat versucht, sein Gehalt etwas aufzubessern, und dabei ist er den falschen Leuten in die Quere gekommen.«
Nach und nach wurde es auf dem Flur ruhiger. Pinto sah weiter die Fotos durch, meistens die Miniaturansichten. Inzwischen hatte er die neuesten gefunden und ging jetzt zeitlich zurück. Nur manchmal vergrößerte er ein Bild, betrachtete es, wischte es zur Seite.
Und dann hatte er sie. Ja, das war sie, ganz eindeutig.
Sie lag auf einer Sonnenliege, die Augen geschlossen, nur mit einem Bikini-Unterteil bekleidet. Offenbar hörte sie Musik, die kleinen weißen Kopfhörerstöpsel waren zu sehen, und ein dünnes weißes Kabel lief über ihre braune Haut. Sie ahnte bestimmt nicht, dass sie fotografiert wurde. Die Liege stand auf einem großen Balkon mit Blick über das blaue Meer. Nilton hatte hinter ihr im Wohnzimmer gestanden und sie heimlich durch die offene Glastür aufgenommen, der Rahmen war mit im Bild. Fünfmal hatte er abgedrückt, und es war klar, auf welche Stelle er zum Scharfstellen getippt hatte: auf ihre hübschen kleinen Brüste.
Du hast dich ganz sicher gefühlt, hm? Du wusstest ja, dass sie das Klicken nicht hört.
Die feine Art war das nicht. Aber, na ja … Pinto atmete einmal tief durch und rief die ›Details‹ auf. Die Fotos waren vom zweiundzwanzigsten Juni, 16:13 Uhr bis 16:14 Uhr. Leider war kein Standort angegeben. Wo hatte Nilton diese Bilder aufgenommen? Bei sich zu Hause jedenfalls nicht. Das hier war ein anderer Balkon als der heute Nachmittag.
Nilton Wanderley … Der lag jetzt in einer Kühlkammer im Rechtsmedizinischen Institut. Aber wo war das Mädchen? Wieder sah Pinto das Bild an. War sie wirklich entspannt gewesen, da auf diesem Balkon? Oder hatte sie nur eine Pause gehabt? War sie hereingerufen worden, wenn der nächste Kunde an der Tür geklingelt hatte?
Pinto schloss die Augen, kniff sich in die Nasenwurzel. Hör auf damit, das bringt doch nichts. Er brauchte einen Anhaltspunkt. Er musste sie finden. Vielleicht gab es noch andere Fotos von ihr. Er ging jetzt langsamer vor, vergrößerte jedes Bild, auf dem er mehrere Personen sah. Nur die eine, die er suchte, war nirgends dabei.
Über alldem vergaß er völlig die Zeit. Es wurde immer ruhiger um ihn her. Da, plötzlich, schreckte ihn ein Signalton auf. Ein leises Ping-ping, ganz nahe, hier auf dem Schreibtisch. Er sah noch, wie ein Lichtschein erlosch. Das zweite Telefon, in dem Klarsichtbeutel! Die Anzeige hatte kurz aufgeleuchtet und war jetzt schon wieder dunkel.
Eine Nachricht für Nilton Wanderley.
Vorsichtig nahm er das Telefon aus dem Beutel und entsperrte es. Eine Videonachricht war gekommen. Er tippte auf ›Start‹ und sah sie sich an.
Das Video war nur dreiunddreißig Sekunden lang.
Danach stand er auf, ging den Korridor entlang und in Fonsecas Büro. Der Chef war noch da und sah ihn müde an.
Pinto hielt das Telefon hoch und sagte: »Ich fürchte, die Sache ist noch viel übler, als wir gedacht haben.«
3
»Gesehen nicht, nein.« Doktor Xavier lächelte milde und gab Fonseca das Telefon zurück. »Aber ich habe mal so etwas gehört.« Er trug schon den hellblauen Kittel und die grüne Haube: Nilton wurde an diesem Morgen obduziert.
Fonseca war gleich als Erstes zum Rechtsmedizinischen Institut gefahren, um vorher mit dem Doktor sprechen zu können.
»In manchen Favelas in Rio wird das angeblich so gemacht«, sagte Xavier mit seinem sanften brasilianischen Akzent.
»Die Bestrafung eines Spitzels durch die örtlichen Drogenbosse. Der Mann verschwindet, seine Ohren und seine Zunge werden öffentlich angenagelt, als Warnung für andere. Niemand von den Nachbarn darf sie abnehmen, sie hängen dort, bis sie verwest sind und abfallen. Eine klare Symbolik, nicht wahr? Er hat gelauscht, und er hat geredet.«
»Hm, ja«, sagte Fonseca. »So gesehen, klar genug.«
Das fand man auch bei der Dienstbesprechung der Mordkommission. Überall in der Runde wurde zustimmend genickt. »Die Bestrafung eines Spitzels … Ja, klingt einleuchtend.«
Inspektor Dinis sagte: »Das Video ist von einem nicht registrierten Mobiltelefon versandt worden. Das ist im Moment alles, was wir wissen. Die Verbindungsdaten haben wir noch nicht.«
Dann war Pinto dran. Er hatte Fotos, die er auf Niltons Smartphone gefunden hatte, auf den Computer übertragen. Eins davon erschien jetzt groß auf dem Monitor. Vier Männer in graublauen Uniformen, mit Stiefeln und schusssicheren Westen, Pistolenholster am Gürtel, die offenbar in einer Revierwache standen. Alle vier waren breit und kräftig, mit kahl geschorenen Schädeln. Einer von ihnen hatte einen kurz gehaltenen schwarzen Vollbart. Sie alle grinsten selbstsicher in die Kamera.
Pinto zeigte mit dem Kugelschreiber: »Das hier ist unser Nilton. Und die beiden hab ich hier auch schon gesehen, mit ihm zusammen in Foz. Den mit dem schwarzen Bart sogar mehrfach. Kann sein, dass der andere auch mal dabei war.« Er klickte weiter. »Und hier habe ich das Emblem vergrößert, das sie auf der Brust haben.« Die Schrift war unscharf, aber gut zu lesen: ›Polícia Militar, São Paulo‹.
Gemurmel erhob sich. »Nilton war mal Polizist …?«
Sie alle waren einigermaßen im Bilde, was die Polizeikräfte des ›Bruderlandes‹ Brasilien anging. Die Polícia Militar war die uniformierte Schutzpolizei, militärisch organisiert und mit massiver Präsenz auf den Straßen. Ihr Ruf war nicht der allerbeste. Kritische Stimmen warfen ihr vor, sich allzu gern wie eine Besatzungsarmee aufzuführen, besonders in den ärmeren Stadtvierteln.
»Ich hab mir schon mal einen Überblick verschafft«, sagte Pinto. »Danach ist die Polícia Militar von São Paulo besonders berüchtigt. Ihre Einsätze fordern pro Jahr bis zu eintausend Todesopfer, die meisten davon in den Favelas. Gut, wir reden hier von völlig anderen Dimensionen. Allein die Stadt São Paulo hat schon mehr Einwohner als ganz Portugal, der Großraum doppelt, der Bundesstaat viermal so viele. Trotzdem, wenn man es umrechnet, wäre das so, als ob unsere GNR hier jedes Jahr zweihundertfünfzig Leute erschießen würde.«
Ungläubiges Auflachen, Kopfschütteln.
Pinto fuhr fort: »Wir haben also drei, vier ehemalige Angehörige dieser Truppe, die hier bei uns in Porto leben. Einer von ihnen ist gerade gewaltsam ums Leben gekommen. Das Ganze sieht aus wie ein Auftragsmord im Halbweltmilieu. Und das Opfer sieht auch danach aus, hat aber in einem Maklerbüro gearbeitet. Dann haben wir noch dieses Video. Die Frage ist: Was steckt dahinter? Dunkle Geschäfte, die die Gruppe hier in Portugal gemacht hat, oder etwas, das in Brasilien passiert ist?«
»Das mit den Ohren und der Zunge …«, sagte Fonseca. »Ich hab den Doktor gefragt, ob man das womöglich post mortem gemacht hat. Er hat gesagt, das würde er dem Opfer wünschen, aber sehr wahrscheinlich sei es nicht. Also ein Foltermord an einem ›Spitzel‹, was immer das heißen mag. Vielleicht sind diese Leute überhaupt deshalb in Portugal. Weil sie aus Brasilien verschwinden mussten.«
»Und jetzt hat sie hier jemand aufgespürt?«
»Gut möglich«, sagte Pinto. »Sie können drüben in alles Mögliche verwickelt gewesen sein. Die Polícia Militar gilt als weithin korrupt. Schutzgelderpressung und Zusammenarbeit mit den Drogenkartellen sind angeblich an der Tagesordnung.«
Fonseca nickte bedächtig. »Da kommt er also her, unser Nilton Wanderley. Das ist seine Vergangenheit.« Er blickte in die Runde. »Wir müssen jetzt schnellstens diese anderen Typen finden, mit denen Rui ihn gesehen hat. Wenn jemand weiß, worum es hier geht, dann die. Então, vamos!«
Alle standen auf.
Tavares klopfte Pinto auf den Rücken. »Also, ich glaub ja, die haben ein paar hübsche Brasilianerinnen dabeigehabt. Oder, Rui, seit wann guckst du solchen Kerlen hinterher?«
Pinto lachte nur und wandte sich ab. Da fiel sein Blick auf Ana Cristina.
Sie sah ihn an, als hätte sie sich das auch schon gefragt.
Während der Fahrt telefonierte er praktisch die ganze Zeit und gab Ana keine Gelegenheit, ihn darauf anzusprechen. Wortlos blickte sie hinaus auf die Avenida da Boavista. Sie fuhren Richtung Meer, vorbei an Apartmentblocks und Hoteltürmen, an alten Stadtvillen und hohen Palmen. Sie waren auf dem Weg zu Niltons Maklerbüro.
»Du, ich muss Schluss machen, ich melde mich nachher noch mal!« Pinto schaltete den Blinker ein und ging vom Gas. »Das da vorne müsste es sein.«
Er parkte mitten im Halteverbot, und sie stiegen aus. Vor ihnen ragte ein graues Büro- und Geschäftshaus empor, die Betonfassade gespickt von den Ventilatorkästen der Klimaanlagen. Schön, wenn man eine hatte: Schon jetzt am Vormittag waren es wieder über dreißig Grad.
Sie mussten in den ersten Stock und nahmen die Treppe. Oben gingen sie einen spärlich erleuchteten Korridor bis zum Ende entlang. Rechts stand auf einer Glastür: ›Imocon, Mediação Imobiliária, Lda.‹. Die Tür und auch das große Fenster zum Gang waren von innen weiß abgeklebt.
»Nicht sehr einladend, was?« Pinto zeigte auf das Fenster. »Sollten hier nicht die Angebote hängen?«
»Würde ich auch sagen.« Daran erkannte man eigentlich ein Maklerbüro: an den Fotos von Häusern mit Preisen und Quadratmeterzahlen.
Sie sahen sich beide noch einmal um. Gegenüber gab es eine weitere Tür, recht edel aus dunklem Holz, mit einem Messingschild: ›Pedra Furada Investments S. A.‹
Quer über den Boden verlief eine Metallschiene. Dieses Ende des Korridors konnte man nachts durch ein Scherengitter absperren. Beide Büros gemeinsam.
»Na denn.« Pinto klopfte bei Imocon und öffnete die Tür. Ana trat hinter ihm ein.
An einem Schreibtisch standen eine Frau im Business-Kostüm und ein Mann ohne Jackett, aber mit Krawatte, die jetzt sofort ihr Gespräch abbrachen und sie ansahen. Sonst war niemand zu sehen.
»Bom dia.« Pinto zeigte seine Dienstmarke. »Polícia Judiciária, Mordkommission.«
»Bom dia.« Die Frau, um die dreißig, setzte ein routiniertes Lächeln auf. »Ja … wir haben Sie natürlich erwartet. Wir können es noch gar nicht fassen. Ein Kollege von uns …« Sie war eindeutig Portugiesin, hier aus der Gegend.
Der Mann, etwa im selben Alter, nickte ihnen zu und fragte geschäftsmäßig: »Wie können wir Ihnen behilflich sein?« Ebenfalls Portugiese.
»Sie können ein paar Fragen beantworten«, sagte Pinto.
»Ja. Selbstverständlich.«
Die Antworten waren ziemlich vorhersehbar. Nilton sei ein sehr netter und geschätzter Kollege gewesen, immer gut aufgelegt. »Wie die Brasilianer so sind, nicht wahr?« Nein, es sei ihnen überhaupt nichts an ihm aufgefallen, sie wüssten auch von keinen Schwierigkeiten, in denen er gesteckt hätte. Nein, nein, nein, dass es etwas mit seiner Arbeit zu tun haben könnte, hielten sie für völlig ausgeschlossen. Er müsse mit jemandem verwechselt worden sein, das sei die einzig mögliche Erklärung.
Fonseca hatte strikte Anweisung gegeben, nichts von dem Video zu sagen. Pinto und Ana gingen also anders vor.
»Wie hat sie denn ausgesehen, seine Arbeit?«
Der Mann sagte: »Er war Immobilienberater. Ganz normal, wie ich.«
»Und wen hat er beraten?«
»Nun … die Kundschaft natürlich.«
»Die Kundschaft.« Pinto ließ einen prüfenden Blick umherwandern. »Sehr auf Publikumsverkehr sind Sie hier aber nicht eingestellt, oder?« Auch hier drinnen waren nirgendwo Fotos von Objekten zu sehen. Nur Regale mit Aktenordnern, Schreibtische, Computer, alles kahl und nüchtern.
Die Frau lächelte wieder. »Das meiste läuft ja heute übers Internet. Hier kommt nur noch selten ein Kunde vorbei.«
»Und Nilton hat ja auch mehr die brasilianischen Immobilien betreut«, sagte der Mann.
Die Frau warf ihm einen scharfen Seitenblick zu. Das war wohl nicht abgesprochen gewesen.
»Sie vermitteln auch brasilianische Immobilien?«
Die Frau übernahm rasch die Antwort. »Hauptsächlich Ferienapartments in Fortaleza und Umgebung. Mein Kollege wollte nur sagen, eine Vor-Ort-Besichtigung führen wir in dem Fall natürlich nicht selbst durch.«
»Natürlich nicht. Arbeiten hier noch mehr Brasilianer?«
Sie zögerte. »… Ja. Wieso?«
»Wie viele?«
»Warum wollen Sie das wissen?«
»Suchen Sie mir bitte mal die Personalakten raus. Wir brauchen Namen, Adressen, alles. Ich nehme an, da sind auch Fotos drin, oder?«
Sie atmete einmal tief durch. »Es tut mir leid, aber ich bin nicht befugt, Ihnen Akteneinsicht zu gewähren.«
»Haben Sie nicht gesagt, Sie leiten hier den Innendienst?«
»Das sind Dinge, die nur die Geschäftsführung – «
Hinter ihnen ging die Tür auf. Jemand sagte: »Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht stören«, und zog die Tür wieder zu.
Pinto und Ana sahen sich an. Die wenigen Worte hatten gereicht. Brasilianischer Akzent.
Ana war sofort an der Tür, trat hinaus in den Korridor. »Einen Moment bitte, ja?«
»So, hier haben wir sie endlich«, sagte Dinis, die Ausdrucke in der Hand.
»Ah, sehr gut.« Fonseca saß an seinem Schreibtisch und hatte schon darauf gewartet. Die Verbindungsdaten des anonymen Telefons, mit dem das Video verschickt worden war. Er streckte die Hand danach aus. Erst jetzt fiel ihm auf, was Dinis für ein Gesicht machte. »Ist was damit?«
»Das kann man wohl sagen.«
Fonseca sah sich den Ausdruck an. »Moment … Sehe ich das richtig?«
Dinis nickte bedeutungsschwer. »Ja. Dieses Video ist gleichzeitig an acht Empfänger geschickt worden.«
»Acht.«
»Ja. An Nilton Wanderley und an sieben andere. Auch alles Nummern von Mobiltelefonen. Wir versuchen gerade, sie zu orten. Bis jetzt ohne Erfolg.«
Als er wieder allein war, sah Fonseca noch immer die Nummern auf der Liste an. Sieben andere. Das durfte einfach nicht wahr sein … Er hatte das Gefühl, nicht genug Luft zu bekommen, zog eine Schublade auf und nahm sein Asthmaspray heraus.
Dieser Brasilianer sah ganz anders aus als Nilton und seine Kumpane. Er gefiel ihr sofort. Er war groß und schlank, mit vollem schwarzen Haar, und bestimmt nicht viel älter als sie. Er schien eine Art Geschäftsmann zu sein mit seinen schwarzen Lederschuhen, der Anzughose und dem blau-weiß gestreiften, langärmeligen Hemd, das er zugeknöpft, aber ohne Krawatte trug.
Es gefiel ihr auch, wie er sie anlächelte.
»Mordkommission. Darf ich fragen, wer Sie sind?«
Sein Lächeln verschwand. Schade, aber das Wort ›Mordkommission‹ hatte nun mal diese Wirkung.
»Ja, ich … arbeite hier.« Er zeigte auf die dunkle Tür mit dem Messingschild. »Ich bin gerade gekommen, und ich dachte, ich frage mal, ob es was Neues gibt.«
»Sie haben Nilton Wanderley gekannt?«
»Ja und nein. Was heißt ›gekannt‹. Wir sind halt beide Brasilianer, da unterhält man sich schon mal.«
Er hatte eine schöne Stimme, und die weiche brasilianische Aussprache war das Tüpfelchen auf dem i. Wenn sie sich irgendwo anders begegnet wären, auf einer Party vielleicht … Ana hätte für nichts garantieren können.
»Hatten Sie auch privaten Kontakt?«
»Nein, nein, nur hier bei der Arbeit. Genauer gesagt in der Mittagspause.«
»Ach, Sie sind zusammen essen gegangen?«
»Ab und zu mal, ja.«
»Und worüber haben Sie sich dann unterhalten?«
»Nur so, über dies und das.«
»Worüber Männer so reden, was? Fußball.«
Er lächelte schwach. »Ja, zum Beispiel.«
Sie lächelte ebenfalls. »Und Frauen.«
»Nein … das eher nicht.«
»Sind Sie sicher? Brasilianerinnen, Portugiesinnen … Die vergleicht man doch gern mal.«
»Wirklich nicht, nein.«
»Wissen Sie, ob Nilton eine Beziehung hatte?«
»Nein, wie gesagt, wir kannten uns nur flüchtig. Über persönliche Dinge haben wir nie gesprochen. Sagen Sie, gibt es denn etwas Neues? Haben Sie einen Anhaltspunkt?«
»Wir tun, was wir können. Mehr darf ich dazu leider nicht sagen.«
»Sie wissen noch gar nichts, oder?« Einen Moment lang sah er sie eindringlich an. Dann blinzelte er, schüttelte den Kopf. »Entschuldigung, es ist nur … Ich bin selbst aus São Paulo, und wenn man dann so etwas hört – auf offener Straße erschossen, aus einem fahrenden Wagen heraus – , dann denkt man: Hier doch nicht! In Brasilien, ja, da würde es niemanden wundern, aber das hier ist Portugal, Europa, hier gibt es das nicht. Ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können, wie groß dieser Unterschied ist. Wie sicher man sich hier fühlt. Ich habe das vorher gar nicht gekannt.«
»Tut mir leid, wirklich.« Es fehlte nicht viel, und sie hätte sich noch für den Mord entschuldigt. »Hat Nilton mal so etwas gesagt? Dass er sich weniger sicher fühlte?«
»Nein, nie.«
»Ist Ihnen irgendwas an ihm aufgefallen? Eine Veränderung in der letzten Zeit?«
»Nein, gar nichts.« Er schien bereits zu bereuen, was er gesagt hatte.
Aber zum Nachhaken kam sie nicht mehr. Hinter ihr ging die Tür auf. Sie drehte sich um. »Schon fertig?«
»Wir müssen los«, sagte Pinto. »Der Chef hat angerufen.«
Ana wandte sich wieder dem Brasilianer zu. »Wir werden Ihnen in den nächsten Tagen noch ein paar Fragen stellen müssen. Haben Sie vielleicht eine Karte für mich?«
»Ja … sicher.« Er zog eine Visitenkarte aus seiner Brusttasche und reichte sie ihr.
»Gut, vielen Dank. Até amanhã.«
»Kommst du?«, sagte Pinto.
»Ja!« Sie lächelte dem Brasilianer noch einmal zu, dann ging sie mit Pinto den Korridor entlang.
Pinto sah sie im Gehen von der Seite an. »Na! Wenn man dich mal fünf Minuten aus den Augen lässt …«
»Was denn? Ich hab überhaupt nichts gemacht.«
»Aber du hast daran gedacht.«
»Tut ihr das nicht ständig?«
Die Glastür schob sich beiseite, und sie gingen die Stufen hinab, wieder hinaus in die flirrende Hitze.
»Wie war das überhaupt mit den hübschen Brasilianerinnen? Glaub bloß nicht, dass ich das vergessen habe!«
Pinto lächelte. »Frag mich lieber mal, was der Chef gesagt hat.«
»Na, was war es?«
»Sie wissen jetzt, wem der Laden hier gehört.«
»Und wem?« Sie ging herum auf die Beifahrerseite.
Pinto öffnete die Fahrertür. »Rate mal!«
»Keine Ahnung.« Bevor sie einstieg, warf sie noch einen Blick auf die Visitenkarte in ihrer Hand:
›Alessandro Garcia Vicente, Assistant Managing Director, Pedra Furada Investments S. A.‹
Fonseca war noch im Besprechungsraum. Zusammen mit Tavares stand er hinten an der Pinnwand.
»Wieso sollten wir denn abbrechen?«, fragte Pinto gleich beim Eintreten. Beide einen Plastikbecher Kaffee in der Hand, gingen sie an der Reihe der leeren grauen Tische vorbei. »Wir hätten den Laden lieber dichtmachen und versiegeln sollen.«
»Keine Schnellschüsse«, sagte Fonseca. »Wir müssen uns gut überlegen, wie wir jetzt vorgehen.«
An der Pinnwand hing ein neues Foto: das eines dicklichen, selbstzufriedenen Mannes mit Stirnglatze, weit offenem Hemdkragen und Goldkette auf der Brust.
Pinto sah es sich an und schüttelte den Kopf. »Und das ist amtlich, ja?«
»Steht so im Handelsregister«, sagte Tavares. »Eingetragen als Hauptgesellschafter der Firma Imocon.«
»Unser alter Freund Vítor Puga … Gestern haben wir noch von ihm gesprochen. Zufälle gibt’s, was?«
Fonseca schnaufte kurz durch die Nase.
Auch Ana Cristina war der Name ein Begriff, sie kannte das Gesicht von Pressefotos und aus der einen oder anderen Polizeiakte.
Vítor Puga musste jetzt Ende vierzig sein. Sein erstaunlicher Aufstieg war zwar beobachtet worden, aber die PJ hatte offenbar nie etwas Brauchbares gegen ihn in der Hand gehabt. Angefangen hatte er selbst als Türsteher einiger Nachtlokale und Diskotheken, aus dieser Zeit stammten auch seine Kontakte zur Unterwelt. Als sich dann in den Neunzigern die privaten Sicherheitsfirmen überall breitgemacht hatten, von den Popkonzerten und Fußballspielen bis zu den großen studentischen Abschlussfeiern, hatte Puga kräftig mitverdient. Sein Trupp Gorillas war damals noch ein ziemlich wilder Haufen gewesen, immer wieder war es zu gewalttätigen Zwischenfällen gekommen. Aber verurteilt wurden bestenfalls einzelne Schlägertypen, dem Mann im Hintergrund hatte man nie etwas anhaben können. Noch schwerer nachzuweisen waren später die Schutzgelderpressungen gewesen, da die Besitzer der betroffenen Lokale keine Aussagen machten. Mehrere Bars und Restaurants waren schließlich ganz in Pugas Besitz übergegangen, und diesen legalen Geschäftszweig hatte er zügig weiter ausgebaut. Die Gerüchte über Drogenhandel und Prostitution wollten zwar nie ganz verstummen, aber zur feierlichen Eröffnung seines Spa-Hotels Vista Mar war dann auch schon der Bürgermeister von Matosinhos erschienen. Inzwischen war der ›angesehene Unternehmer‹ und ›wichtige Arbeitgeber in der Region‹ so unentwirrbar mit der lokalen Politik verbandelt, dass er von der Justiz nicht mehr viel zu befürchten hatte.
»Wir müssen auf jeden Fall aufpassen«, sagte Fonseca. »Nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen.«
»Ich weiß, ich weiß!« Pinto hob beide Hände. »Er spielt jetzt Golf mit dem Staatsanwalt.«
»Wie war’s denn da, in dem Maklerbüro?«
Pinto berichtete, und Ana sah sich noch einmal das Foto von diesem Puga an. Seine Vergangenheit als Türsteher ließ sich gerade noch erahnen. Er hatte etwas von einem Ex-Boxer, der mit den Jahren fett geworden war. Seine Nase sah jedenfalls aus, als hätte sie einiges eingesteckt und wäre etwas schief und platt gedrückt wieder zusammengewachsen.
Sein Name stand auch schon auf der weißen Schreibtafel, und rote Verbindungslinien führten zu zwei anderen Namen: zu ›Nilton‹ und ›Tony Maluco‹. Eine dritte Linie, zwischen Nilton und Tony, war von einem Fragezeichen unterbrochen.
Tavares beugte sich etwas zu Ana herab und sagte leise: »Da kann man doch stutzig werden, oder? Tony sagt, er weiß nicht, wer Nilton war. Und jetzt stellt sich heraus: Sie haben beide denselben Chef gehabt.«
4
An diesem Abend schlug Pinto ganz harmlos vor, doch mal wieder zum Brasilianer zu gehen. »Was hältst du davon?«
Seine Freundin Vânia sah ihn misstrauisch an. »Und zu welchem?«
»Na, zu Careca, dachte ich.«
»Und woher wusste ich, dass du das sagen würdest?«
»Ist doch klar: Die Picanha ist einfach die beste!«
Sie gingen zu Fuß durch die Gassen des alten Viertels. Es war immer noch sehr heiß, selbst vom Meer kam kaum eine Brise. Und dann standen sie vor verschlossener Tür: ›Montags Ruhetag‹.
»Hmm.« Pinto blickte unwillig an der Fassade hinauf. Das Schild war nicht erleuchtet – ›Churrascaria Carioca‹ – , und auch hinter den Fenstern im ersten Stock regte sich nichts.
»Die haben ge-schlos-sen«, sagte Vânia.
»Ja, ja, das sehe ich.« Pinto trat an den Schaukasten mit der Speisekarte. Dann nahm er sein Mobiltelefon und tippte die Nummer ein, die auf der Karte stand.
»Was soll denn das jetzt? Glaubst du, die machen extra für dich ihr Restaurant auf?«
»Nein, natürlich nicht.« Er wartete, sein Telefon am Ohr. »Ich will ja nur …«
»Was?«
»Kurz mit Hermano reden.«
»Aha? Und worüber?«
»Ist egal. Er geht eh nicht ran.« Er steckte sein Telefon ein. »Komm«, sagte er lächelnd und hakte Vânia unter, »suchen wir uns was anderes! Worauf hast du Lust?«
Ein paar Kilometer stadteinwärts, in der Rua Barbosa Du Bocage, stand um diese Zeit eine junge Frau in ihrer Wohnung und lauschte an einer Zimmertür. Sie war barfuß, im Sommerkleid, und eine Hand hatte sie unwillkürlich auf ihren Bauch gelegt. Sie war im siebten Monat schwanger. Ihr Name war Sara, sie war Portugiesin aus Gaia, und hinter der Tür telefonierte ihr brasilianischer Mann mit São Paulo.
Sie wusste, es war wieder das Spezialtelefon. Es sah aus wie ein normales Mobiltelefon, aber das war es nicht. Sie nahm an, dass es ›abhörsicher‹ war oder so was. Er bewahrte es in einer Kassette im Schreibtisch auf, und immer wenn er es auflud, hielt er sich in der Nähe auf und schloss es hinterher sofort wieder weg. Bis vor Kurzem hatte er nur ganz selten damit telefoniert, und jedes Mal war er dafür in sein Arbeitszimmer gegangen, wie jetzt, und hatte die Tür hinter sich zugemacht. Sara hatte schon öfter gelauscht, aber sie hatte nichts damit anfangen können, was er sagte. Sie wusste nur: Es war immer derselbe, mit dem er da sprach. Jemand, vor dem er offenbar größten Respekt hatte. Sie kannte diesen ehrerbietigen Ton sonst gar nicht an ihm, und er gefiel ihr auch nicht.
Heute war er nervös, er schien hin und her zu gehen, einiges konnte sie nicht verstehen. Er hatte schlechte Nachrichten überbracht, so viel war sicher. »Es ist so, wie ich befürchtet habe«, hatte sie ihn sagen hören. »Es tut mir ungeheuer leid.« Und: »Nein … kein Zweifel. Nein.« Dann eine Weile nur: »Ja. – Ja. – Ja, sicher.« Einmal war er der Tür so nahe gekommen, dass sie glaubte, ihn tief durchatmen zu hören. »Ich weiß. Und ob ich das weiß …«
Ihre Straße war eigentlich ruhig, ohne Durchgangsverkehr. Aber dann war ein Auto gekommen, das ganz langsam fuhr und natürlich mit heruntergelassenen Scheiben: Die Musik dröhnte herauf, die Bässe wummerten.
Vai pa puta, pá! dachte sie.
Endlich konnte sie wieder verstehen, was er sagte: »… ganz klar eine Drohung! Die haben mich auch auf der Liste. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Meine Frau erwartet ein Kind! In ein paar Wochen ist es so weit.«
Sara hielt den Atem an.
»Ein Sohn. Wir wollen ihn nach mir nennen: Alessandro.«
Erst mal war nichts mehr zu hören. Der andere schien ungewöhnlich lange zu reden. Dann endlich: »Ja, das ist gut. – Ja, so werde ich es machen. Ich danke Ihnen vielmals. – Ja, ich melde mich, selbstverständlich. Ich weiß jetzt noch nicht, wo wir hinkönnen. Mit der Schwangerschaft und allem … Auf jeden Fall raus hier, solange noch Zeit ist.«
Saras Herz klopfte bis zum Hals. Einen Moment lang hatte sie Angst, dass ihr schwindlig wurde. Sie lehnte sich an den Türrahmen, hielt sich fest.
»Wenn diese … Leute rüberkommen: Brauchen die noch Informationen von mir? – Ja, ich denke auch, es müsste alles in meinen Berichten stehen. Und wir bleiben ja auch in Verbindung. – Genau so mache ich es. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll.«
Sie hörte mit an, wie er sich wortreich verabschiedete, bis zum letzten »Com licença.« Aber sie rührte sich nicht von der Stelle. Sie wartete einfach, dass er herauskam.
Es dauerte und dauerte. Er kam nicht. Schließlich drückte sie die Klinke herunter, machte die Tür auf.
Alessandro stand am Schreibtisch, den Kopf gesenkt. Er blickte auf und sagte leise: »Hast du gehört? Wir müssen hier weg. Heute noch.«
»Was soll das heißen?«
»Wir sind hier nicht mehr sicher. Das meine ich ernst.« Erst jetzt sah sie, dass er Tränen in den Augen hatte.
»Sandro! Was ist denn los?«
»Je weniger du weißt, desto besser. Komm, schnell, wir müssen packen!«
Pinto war unruhig an diesem Abend. Den Sonnenuntergang auf dem Atlantik hatten sie eigentlich entspannt im Praia da Luz genießen wollen, mit einer Caipirinha in den Deckchair gelehnt, aber heute hatte er keinen Sinn dafür. Kaum war die Sonne verschwunden, trank er aus und sagte: »Was ist, bummeln wir noch ein bisschen?«
Vânia seufzte leise. Sie hatte ihre Schuhe abgestreift und wirkte, als hätte sie es gut noch ein Weilchen hier aushalten können. »Darf ich wenigstens noch austrinken?«
Rastlos zogen sie von einer Strandbar zur nächsten, und wo immer sie hinkamen, sah er sich die halbe Zeit um und musterte die anderen Gäste.
Irgendwann sagte Vânia langsam und deutlich: »Hier ist sie auch nicht.«
»Wer ist nicht hier?«
»Diese kleine Asiatin. Nach der du schon den ganzen Abend Ausschau hältst.«
»Was? Wovon redest du denn?«
Vânia verdrehte die Augen. »Oh, Mann …!«
Sara fand sehr wohl, dass sie wissen sollte, was los war. Und es reichte ihr ganz und gar nicht, wenn er sagte: »Glaub mir, ich verstehe es auch nicht!«
Die meisten Sachen packte sie selbst zusammen. Er war so planlos und hektisch, dass sie es nicht mit ansehen konnte. »Gib her, lass mich das machen! Du verknüllst mir bloß alles!«
Er versuchte, sie abzulenken. »Stell dir einfach vor, wir würden verreisen, ja?«
»Wo sollen wir denn hin? Und für wie lange? Ich muss Freitag zum Ultraschall! Was stellst du dir eigentlich vor, wie das weitergehen soll?«
»Ich weiß es nicht! Ich weiß nur, dass wir hier wegmüssen! So schnell wie möglich, egal wohin!«
»Sandro! Was ist mit deiner Arbeit? Mit deiner Chefin?«
»Ich hab da niemanden, dem ich noch trauen kann. Niemanden!«
»Dieser Nilton war doch gar nicht in deiner Firma! Was hast du denn damit zu tun?«
Sie bekam keine Antwort. Nur: »Ich kann nichts dafür!« Und: »Ich will dich doch nur schützen. Dich. Euch …«
Zwischendurch erledigte er noch schnell etwas im Internet, dann klappte er seinen Laptop zu und packte ihn ebenfalls ein.
Es war schon weit nach Mitternacht. Sara saß erschöpft auf der Bettkante, eine Hand im Kreuz. Ihr Rücken tat weh. »Also, Koffer schleppen kann ich jetzt nicht auch noch.«
»Natürlich nicht! Ruh dich aus.« Er ging vor ihr in die Hocke, nahm ihre Hände. »Es wird alles wieder gut. Rechtzeitig. Ich verspreche es dir. Die schicken jemanden rüber. Eine Delegation. Das sind Profis, die bringen alles wieder in Ordnung.«
»Sandro … Ich habe Angst.«
»Ja. Ich auch. Aber jetzt müssen wir los.« Er stand auf, nahm den ersten Koffer und die Reisetasche. An der Tür drehte er sich noch einmal um. »Es ist das Einzige, was wir tun können. Vertrau mir.« Dann zog er leise die Wohnungstür hinter sich zu.
Als er aus dem Haus trat, blieb er kurz stehen und horchte. Fernes Autohupen, von irgendwo leise Musik, sonst war alles ruhig. Die Straße lag menschenleer da, im Licht der wenigen Laternen.