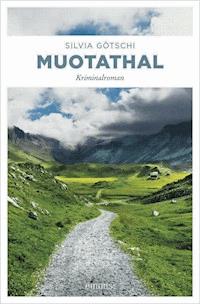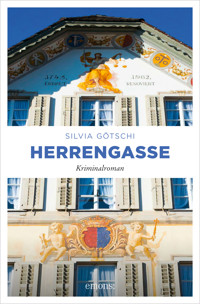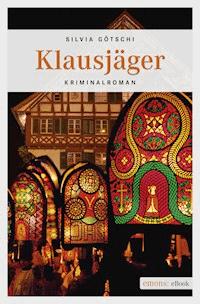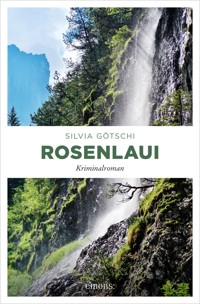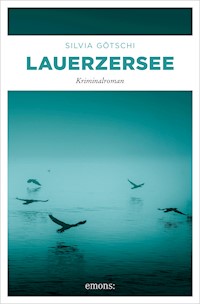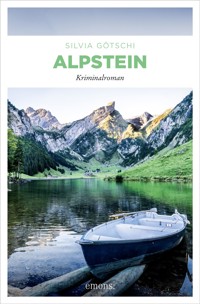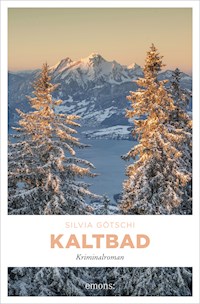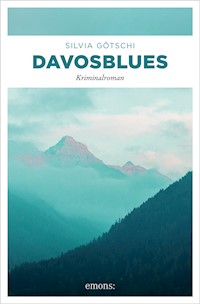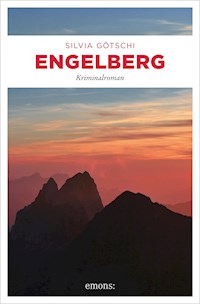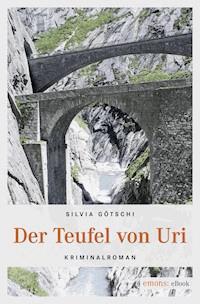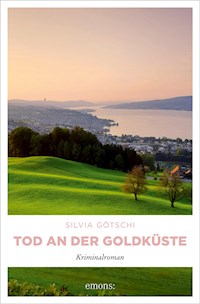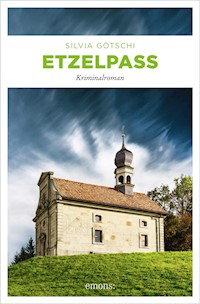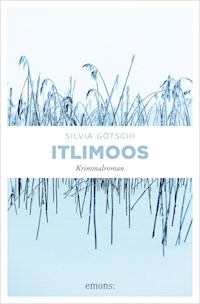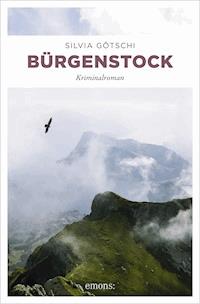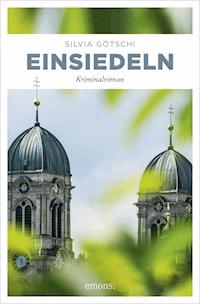Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Allegra Cadisch
- Sprache: Deutsch
Kurz vor Beginn des Weltwirtschaftsforums in Davos geht bei der Polizei eine Bombendrohung ein. Fast zur gleichen Zeit verschwindet der Sohn eines Konsuls aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, wenig später wird er tot aufgefunden. Allegra Cadisch ist eien der Letzten, die ihn lebend gesehen hat - jetzt muss sie alle Kräfte aufbringe, um ihre Unschuld zu beweisen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Silvia Götschi, geboren 1958 in Stans, lebte und arbeitete von 1979 bis 1998 in Davos. Seit der Jugend widmet sie sich dem literarischen Schaffen und der Psychologie. Sie hat sich vor allem in der Zentralschweiz mit der Kramer-Krimi-Reihe und im Kanton Graubünden mit den Davoser Krimis einen Namen gemacht. Seit 1998 ist sie freischaffende Schriftstellerin und Mitarbeiterin in einer Werbeagentur. Sie hat drei Söhne und zwei Töchter und lebt heute mit ihrem Mann in der Nähe von Luzern.www.silvia-goetschi.ch
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
©2016 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: age fotostock/LOOK-foto Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-954-7 Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Das Böse triumphiert allein dadurch,
dass gute Menschen nichts unternehmen.
Edmund Burke
Sie wollte nicht daran denken, dass ihr Leben furchtbar enden könnte. Dazu war sie viel zu jung. Im Augenblick des erlöschenden Tages dachte sie an nichts anderes.
Schon als Kind hatte sie das Unglück angezogen, mit acht ihre Mutter verloren, ein halbes Jahr später ihren Vater. Er war im Suff und mit gebrochenem Herzen gegen einen Baum gefahren. Alles hätte so schön werden können. Doch ihr Leben war vorbestimmt, kein gutes zu werden.
Auch jetzt, einige Jahre später, als sie am zugefrorenen Davosersee stand und über die schneebedeckte Eisfläche starrte, waren ihre Gefühle, was ihr Wohlbefinden betraf, nicht besser geworden. Im Gegenteil. Seit dem Tod ihrer Mutter war alles bachab gegangen. Mama hatte sie wenigstens verstanden, im Gegensatz zu allen andern, die nach ihrem Tod in ihr Leben getreten waren. Papa war feige gewesen, hatte nur sich selbst gesehen und seine verlorene Frau, aber nicht daran gedacht, dass er auch eine Tochter hatte.
Nach diesen beiden Schicksalsschlägen hatte man sie in ein Kinderheim in Saland gesteckt.
Zweieinhalb lange Jahre war sie dortgeblieben und hatte auf Ersatzeltern gewartet, auf ein neues Zuhause. Zweieinhalb Jahre, in denen sie fast jede Nacht ins Kissen geweint und gebetet hatte, es möge irgendwann die Tür aufgehen und Mama unter dem Rahmen stehen.
Eines Tages hatte sie dagestanden. Eine schlanke, modische Frau im edlen Kostüm. Sie war mit ihrem Mann aus Davos hergefahren, in einem schicken Wagen.
Sie erinnerte sich noch immer an den Jungen, dessen Gesicht an der Fensterscheibe klebte. Mit grossen Augen hatte er sie vom Rücksitz aus angestarrt. Diesen Blick hatte sie nie vergessen.
Dieser Junge war ihr Bruder geworden, der einzige Mensch, dem sie vom Tag ihrer Ankunft in Davos an je hatte vertrauen können. Der auf sie aufpasste und sie vor Ungemach schützte.
Sie liebte.
Er ging weg. Und sie war allein mit seinen Eltern. Mit der Mutter, die sie nie für ihre eigene Tochter gehalten hatte, und Vater hatte keine Zeit gehabt.
Sie hätte ebenso gut im Heim bleiben können.
Mit siebzehn hatte sie Davos verlassen und sich in Zürich mit verschiedenen Jobs über Wasser gehalten: mal als Buffetangestellte in einem Migros-Restaurant, mal als Aushilfskraft in einem Schuhgeschäft, zuletzt als Kioskverkäuferin an einer Tankstelle. Die Pflegeeltern hatten eine Tochter gewollt, aber ein aufmüpfiges und sensibles Kind bekommen. Bevor eine Liebe gewachsen war, hatte der Hass sie bereits eingeholt.
Die Dämmerung tauchte den zugefrorenen See in ein silbernes Licht. Himmel und Berge verschmolzen ineinander wie sich auflösende Körper.
Sie kam sich verloren vor. Ihre Schenkel brannten. Der gesamte Unterleib fühlte sich an, als hätte ihr jemand ein Messer hineingerammt. Da war noch mehr gewesen. Viel mehr.
Sie wollte nicht darüber nachdenken. Sie hätte letzte Nacht gern ausradiert.
Wenn der See doch ein Loch gehabt hätte. Eine undichte Stelle, an der das Eis nicht fest genug gefroren war. Sie kniete nieder und bewegte sich auf allen vieren vorwärts.
Der Schnee lag überall. Die Kälte spürte sie nicht. Ihr Herz war kälter als alles, was unter dem Winterfrost schlief.
Sie wollte sterben. Wusste jedoch nicht, wie.
Vielleicht sollte sie sich hinlegen und auf den Tod warten. Wenn sie schlief, kam er über sie, deckte sie mit dem gefrorenen Laken zu. Über ihr würde sie die Sterne zählen, bis es keine mehr gab. Sie würde zählen und einschlafen. Der Morgen würde kommen– aber ohne sie.
EINS
So fühlte es sich also an. Der Himmel hing nicht nur voller Geigen, er war auch blauer, der Schnee weisser, die Sonne schien heller, die ganze Welt gehörte mir. Und da war diese Leichtigkeit, die ich seit einem Jahr nicht mehr gespürt hatte.
Ich schraubte die Musik auf. «Prologue-Birth» aus Epica von Audiomachine. Etwas zwischen klassisch und Filmmusik. Ein Feuerwerk. Inspiration für diesen Tag, den ich zu meinem schönsten machen wollte.
Ich fuhr auf der Autobahn. Links und rechts zog eine tote Landschaft vorbei. Baumskelette, braungraue Wiesen, stellenweise erstarrter Reif. Januar war’s und die Zeit wie angehalten. Die längste Nacht vorbei, doch die Tage ruhten noch im Winterschlaf. Ich mochte diese Tage, an denen man kein schlechtes Gewissen haben musste, später aufzustehen und die frische Luft bloss durch die Fensterritze einzuatmen.
Vor mir tauchten Bremslichter auf, zwei Warnblinker. Einen Kilometer vor der Ausfahrt Landquart stand ich im Stau. Doppelspurig und kein Ende in Sicht.
Vermaledeiter Mist!
Um zwei wollte ich in Davos sein.
Mam hatte mir wider Erwarten ihren Fiat Punto geliehen, der eine bessere Falle in einem Museum gemacht hätte. Ich war mit hundertzwanzig Stundenkilometern über die Autobahn gerast. Mehr war nicht aus dem Wagen zu holen. Geduldig fuhr ich nun in der Kolonne, die sich wie eine gefrässige Schlange ins Churer Rheintal wand.
«The New Earth» tönte aus den Lautsprechern. Vielleicht würde der Tag doch nicht so toll werden, überlegte ich mir.
Ich hatte endlich den Master geschafft– nach dem zweiten Anlauf. Danach würde später niemand fragen. Ich durfte mich von nun an Allegra Cadisch mit Master in Law nennen. Es war mir, als hätte ich begriffen, worum es in meiner Ausbildung gegangen war. Ich hatte einen Meilenstein gelegt, um nicht als Dauerstudentin zu enden. Ich hatte einen Abschluss. Der erste Schritt in mein Berufsleben. Mein eigenes Geld verdienen. Frei sein.
Ich hatte alles auswendig gelernt, um die Prüfungen zu bestehen. Bis zu dem Tag, als ich von den Professoren wie von Blutegeln ausgesaugt wurde. Ich war Juristin, dennoch hatte diese Tatsache mein Gehirn noch nicht ganz erreicht.
Nach dem Master hatte es nicht schnell genug gehen können, sämtliche Ordner in den Bücherschrank zu stopfen. Ich hatte einfach genug von Paragrafen und seitenlangen Fallstudien. Von Kapiteln und Textquellen, die meine eigene Logik zunichtemachten. Phantasie hatte an der Fakultät für Rechtswissenschaften keinen Platz, nicht einmal eine kleine Abweichung, bedingt durch mein Bauchgefühl.
Es stand mir zu, jetzt mein Leben zu geniessen, wie es andere Frauen in meinem Alter taten.
Ich fühlte mich frei. Frei nach diesem Jahr in der Gefangenschaft des Lernens.
Und nun dieser Stau. Ungewohnt zu dieser Zeit.
Es sei ein Winter wie im Bilderbuch, hatte mir Dario in seiner letzten Mail mitgeteilt. Beste Schneeverhältnisse und fast täglich blauer Himmel. Oben in Davos, tausendfünfhundert Meter über dem Meer. Der Nebel sass in den Städten im Unterland und liess die Menschen grau erscheinen.
Über mir spannte sich ein wolkenloser Himmel. Er wirkte kitschig.
Nur langsam rollte der Verkehr weiter. Zu meiner Linken lag die Bündner Herrschaft in erdigen Tönen. Jenins und Malans vor den sanft geschwungenen Hügeln am Fusse des Vilan. Unterhalb der Waldgrenze standen wie nackte Männchen die Rebstöcke, von denen man im Herbst den köstlichen Maienfelder Riesling ernten konnte.
Bei der Ausfahrt Landquart verliess ich die Autobahn und tuckerte hinter einem weissen Previa her.
Eine weisse Kelle mit rotem Rand tauchte aus dem Nichts auf. Die Verlängerung eines Armes, der einem Polizisten gehörte. Einem Mann in voller Montur: dunkler Anzug, Kampfstiefel und Pistole im Holster. Der Gedanke an eine Filmkulisse. Ich stoppte, liess das Fenster runter. Gleich traf mich ein Schwall kalter Luft. Das Thermometer hatte heute Morgen minus vier Grad angezeigt.
«Guten Tag.» Der Polizist hatte ein jungenhaftes Gesicht, das er mit einem Dreitagebart männlicher machen wollte. Allerdings gelang ihm das nicht. Auch seine ernste Miene machte ihn kaum respekteinflössender. «Drehen Sie bitte die Musik leiser», sagte er.
Hatte er mich etwa deswegen angehalten? Wenn ich Musik hörte, zerschmetterte es mir einstweilen fast das Trommelfell. Ich mochte laute Musik, wenn sie meine Stimmung untermalte. Und das hatte sie bis anhin getan. Heute, an diesem Prachtstag. Widerwillig stellte ich leiser. «Eternal Flame» verschwand im Mikrokosmos des Wagens.
«Kantonspolizei Graubünden, mein Name ist Peter Giovanoli. Ich würde gern Ihre Ausweispapiere sehen.»
Ausweispapiere!
Wo hatte ich diese bloss hingetan? Auf meinem Führerausweis konnte man lesen, dass ich die Fahrprüfung schon vor sieben Jahren bestanden hatte. «Worum geht es?» Ich entnahm meinem Portemonnaie die Karte und reichte sie durch die Fensteröffnung. Ich war nicht die Einzige, die man aus dem Verkehr geholt hatte. Vor mir musste eine ganze Familie das gleiche Prozedere über sich ergehen lassen. Die Familie im Previa.
Giovanoli ging nicht darauf ein. «Wohin fahren Sie?»
Was ging es ihn an? «Nach Davos.»
«Würden Sie so gut sein und rechts auf den Parkplatz fahren?»
Sich niemals einer Polizeikontrolle widersetzen. Ich betätigte den Blinker und scherte auf den Parkplatz aus. Der «Socka-Hitsch» sass vor seiner Baracke. Seit ich mich erinnern konnte, sass er dort und wartete auf Kundschaft. Ein bärtiger Alter mit von Kälte und Sonne gegerbtem Gesicht. Seit Jahren vermittelte er den Eindruck, unbeteiligt einfach dazusitzen, eingemummt in die alte Daunenjacke und die Kapuze mit dem speckigen Fellbesatz. Heute allerdings schaute er dem Spektakel zu, welches sich vor ihm abspielte. Ich parkte neben einer Kleiderstange, an der farbige Shirts hingen. «Ilike Davos» war auf einem gedruckt, unterhalb eines roten gezackten Herzens. Ich stellte den Motor ab. Gleich war mein Wagen umzingelt von weiteren Polizisten. Weiter hinten standen Soldaten und hielten die Aktion im Auge. Eine Übung, dachte ich. An einem ganz gewöhnlichen Montag.
Ich entsann mich, dass in den nächsten Tagen in Davos das World Economic Forum stattfand. Allerdings kam mir die Aktion hier übertrieben vor.
«Guten Tag.» Der zweite Mann neben meinem Fenster hatte einen hohen Dienstgrad, was ich am Emblem auf seinem Ärmel erkannte. Er stellte sich mit seinem Namen vor, den ich sofort wieder vergass. «Würden Sie so gut sein und aussteigen? Und bitte öffnen Sie den Kofferraum.»
Ich stieg aus, ging nach hinten und schloss den Deckel zum Laderaum auf. Ich begehrte nicht auf, liess es einfach geschehen, in der Hoffnung, dass es bald überstanden war. Eine Kontrolle wegen des WEF. Ich schlotterte.
Der Polizist besah sich meine Wagenladung. «Was befindet sich in der Tasche?»
Zum ersten Mal, seit ich gezwungen worden war anzuhalten, beschlich mich ein ungutes Gefühl. Offenbar suchte man hier etwas. Nach einer normalen Kontrolle sah das nicht mehr aus. Ich erinnerte mich an einen Freund, dessen Auto man in Südspanien auseinandergenommen hatte. Man hatte Drogen bei ihm gefunden. Seither sass er im Knast in Cádiz, obwohl er seine Unschuld beteuerte. Hatte mir jemand etwas in den Wagen gepackt, was ich nicht bemerkt hatte? Kokain oder Amphetamine? Auch in Davos würde es Abnehmer für solche Drogen geben. War ich unfreiwillig zu einem Kurier geworden? Ich zügelte meine Phantasie und musterte den Polizisten, als hätte er mir soeben etwas Obszönes gesagt.
«Meine Kleider. Ich werde ein paar Tage Ferien machen.»
Er bat mich, den Reissverschluss zu öffnen.
Ich zögerte. «Sorry, darf ich wenigstens erfahren, was Sie suchen?»
«Tun Sie einfach, was man Ihnen sagt.» Sein Ton hatte sich verschärft. Er hatte gewiss einen schlechten Tag erwischt.
Ich zog den Zipper auf. Ein Bund Strings rutschte mir entgegen. «Tut mir leid, da habe ich wohl falsch gepackt.» Es ärgerte mich, dass alle Welt meine Unterwäsche sah.
Der Polizist verzog keine Miene, hatte aber die Frechheit, in meinen Sachen zu wühlen. Er drang bis auf den Boden der Tasche vor; die Kleider lagen nun zerstreut im Kofferraum. «Was ist das?» Er zog ein pinkfarbenes Etui hervor.
«Mein iPad.»
Der Polizist mit dem hohen Dienstgrad rief Giovanoli zu sich, der sich entfernt hatte. «Hier haben wir etwas. Würdest du das prüfen?» Er wandte sich wieder an mich. «Was befindet sich in dieser Mappe dort?»
«Mein MacBook.»
Er griff nach der Mappe und überreichte auch diese Giovanoli. «Prüft auch das MacBook.»
«Jetzt mal halblang. Da sind alle meine privaten Daten drauf. Und die gehen Sie nichts an.» Ich versuchte vergeblich, Giovanoli das MacBook zu entreissen.
Plötzlich stand ein Soldat mit einer Maschinenpistole an meiner Seite. Bildete ich es mir nur ein, oder zielte er auf meine Füsse? «Folgen Sie mir bitte ins Zelt.» Seine freundliche Stimme passte nicht zu seinem forschen Auftreten.
Ich mochte manchmal etwas abgebrüht sein. Das jedenfalls behaupteten meine ehemaligen Kommilitonen. Heute verspürte ich Unbehagen. Mein freches Mundwerk diente zu nichts anderem als zum Verstecken meiner Angst. Das hier war kein Fernsehkrimi, sondern Realität.
Ich drehte mich um. Hinter Socka-Hitschs Krämerladen erblickte ich ein Armeezelt. Ich tat ein paar Schritte, wandte mich wieder um. In der Zwischenzeit machten sich zwei Polizisten an Mams Auto zu schaffen. Offenbar war der Jahrgang des Wagens ausschlaggebend, dass man ihn einer gründlichen Inspektion unterzog. Vielleicht hatte jemand heimlich die Türeninnenseiten aufgeschraubt und etwas versteckt. Und ich würde nun als Kriminelle überführt.
Der Soldat mit der Maschinenpistole bat mich, weiterzugehen.
Ich gelangte ins Innere des Zelts, das zu einer Art Kommandozentrale umfunktioniert worden war. Überall standen Tische mit Computern und flimmernden Monitoren.
«Bitte setzen Sie sich auf den Stuhl dort», hörte ich jemanden sagen.
Ich landete vor einem langen Tisch, an dem nicht nur Polizisten, sondern auch Privatpersonen sassen. Leute in Skianzügen und dick wattierten Jacken. Ich konnte mir keinen Reim darauf machen. So etwas hatte ich noch nie erlebt.
«Suchen Sie jemanden?», wagte ich einen neuen Vorstoss.
Ich bekam keine Antwort. Stattdessen studierte der Polizist hinter dem Tisch meinen Ausweis. «Haben Sie einen Pass dabei?»
Ich suchte nach meiner Identitätskarte. «Den Pass habe ich nicht, jedoch dieID.» Ich legte sie auf den Tisch. Der Beamte sah lange auf die Karte, dann in mein Gesicht. «Da sind Sie um einiges jünger. Ihre Haare sind kürzer. In einem Monat läuft die Karte ab. Sie müssen sie erneuern.» Sein Gesicht blieb ernst. Neben seiner Knollennase spross ein gelber Pickel. Ich hätte gern laut herausgelacht, die Situation war auch zu komisch, doch ich ahnte, dass das hier eine ernste Angelegenheit war. Etwas musste geschehen sein, und ich steckte unfreiwillig mittendrin. Der Beamte tippte den Zahlencode derID auf die Tastatur. Lange starrte er auf den Bildschirm, dann auf mich.
Ein Kollege überreichte ihm einen Zettel. Der Polizist las. «Wo wohnen Sie in Davos? Haben Sie eine Adresse dort?»
«Ja, habe ich. Ich werde im Appartement meines Bruders Valerio Cadisch wohnen.» Ich nannte die Adresse.
Der Polizist notierte und reichte den Zettel seinem Kollegen weiter. «Prüf das mal.»
«Darf ich endlich erfahren, worum es bei dieser… Razzia geht?» Ich malte Anführungs- und Schlusszeichen in die Luft und verkniff mir dabei ein Schmunzeln.
Der Polizist lächelte mich zum ersten Mal an. Sein Pickel glänzte im Schein einer Halogenleuchte, die behelfsmässig aufgestellt war. «Wir machen nur eine Kontrolle.»
«Hören Sie, ich kenne meine Rechte. Das, was Sie hier tun, das dürfen Sie gar nicht.»
«Sie würden sich noch wundern, was wir in diesem Zusammenhang alles dürfen.»
Ich sah mein Gegenüber mit offenem Mund an. «Was ist denn passiert?»
Er schob mein MacBook in die Tischmitte. «Wie lautet Ihr Passwort?»
Ich zögerte.
«Wie lautet es?»
«Tomasz», sagte ich.
«Wie bitte? Buchstabieren Sie.»
«T-o-m-a-s-z.» Ich sah dem Beamten zu, wie er den Namen auf die Tastatur drückte. Es verging eine kleine Ewigkeit, bis er etwas kontrolliert hatte. Mir allerdings war es schleierhaft, wonach er suchte.
«Warum tun Sie das?» Ein erneuter Versuch, um zu erfahren, weshalb man ausgerechnet mich hierher zitiert hatte.
Das Pickelgesicht sah weiterhin auf den Bildschirm. «In Davos findet in den nächsten Tagen das WEF statt. Wir sind befugt, alle Reisenden nach Davos zu überprüfen.»
«Das weiss ich. Aber deswegen können Sie mich nicht wie einen Schwerverbrecher behandeln. Das ist die absolute Höhe.»
Er warf einen Blick auf meinen Ausweis. «Frau Cadisch, wenn es um die Sicherheit unserer Bundesräte und der geladenen Staatsoberhäupter geht, sind uns keine Grenzen gesetzt.»
«Ich habe das WEF nicht nach Davos bestellt», sagte ich genervt. «Ich finde es anmassend, dass wegen der paar Politiker ein solcher Aufstand gemacht wird. Die sollen dortbleiben, wo sie herkommen, wenn sie sich dermassen fürchten.»
Der Polizist blieb ruhig. «Sie können jetzt weiterfahren.» Er klappte das MacBook zu.
Ich erhob mich, nachdem ich meine Ausweise in das Portemonnaie zurückgelegt hatte. Gern hätte ich ein paar Fragen im Zusammenhang mit dem WEF gestellt. Bilder von geschniegelten Staatsmännern gingen mir durch den Kopf, von aufgetakelten Begleiterinnen. Aber hinter mir wartete bereits der nächste Verdächtige. Ich ging zurück zum Wagen, dessen Tür offen stand. Ich vergewisserte mich, ob nichts fehlte. Die Reisetasche war da. Der iPad nicht.
Der Polizist neben mir schenkte mir ein Lächeln. «Den werden Sie gleich wiederbekommen.»
«Ihr sucht etwas?», fragte ich.
Der Polizist wollte mir keine Auskunft geben. Über mir vernahm ich das Geknatter eines Helikopters, der den Weg Richtung Prättigau einschlug. Ich schaute ihm nach. Ein Superpuma der Schweizer Luftwaffe. Noch mehr erstaunte mich der Konvoi auf der Prättigauer Strasse. Eine Staatslimousine, eskortiert von Streifenwagen, fuhr Richtung Klus.
Ich wartete eine geraume Zeit, bis man mir mein Gerät zurückbrachte. Ich prüfte, ob nichts gelöscht war, und packte es ein. Beruhigt war ich allerdings nicht.
Ich startete den Motor, fuhr auf die Hauptstrasse und drückte meinen rechten Fuss aufs Gaspedal. Im Rückspiegel sah ich, wie die Aktion weiterging.
Was geschah hier?
ZWEI
Nach der Klus öffnete sich das Prättigau, als würde man ein Buch aufschlagen. Hier lag mehr Schnee als vor dem Tunnel. Es sah aus, als hätte den Schnee jemand ins Tal geschaufelt. Eine rote Zugskomposition kam mir auf der Höhe von Schiers entgegen. Später passierte ich Küblis, das wie immer über die Wintermonate im Schatten lag und düster wirkte. Eiskristalle überzogen die Tannen wie erstarrte Tränen. Ich drehte die Musik wieder lauter. Noch einmal lauschte ich der Tristesse von «Eternal Flame».
Vor mir entdeckte ich eine weitere Schikane. Kurz vor Klosters hatte man eine Absperrung aufgestellt. Polizisten winkten zwei Autofahrer vor mir auf die Seite. Mich liessen sie passieren. Ich sah auf die Uhr. Es war halb fünf. Bereits krochen lange Schatten ins Dorf. Die Berggipfel glänzten in den letzten Sonnenstrahlen. Es ärgerte mich, dass ich so viel Zeit verloren hatte. Nach dem Viadukt tauchte ich in den Gotschnatunnel ein, fuhr viel zu langsam hinter einem silbergrauen Volvo her und gelangte erst auf der Höhe der Einfahrt zum Vereinatunnel wieder ans Tageslicht. Auch hier stand eine Patrouille.
Die letzte Kontrolle passierte ich auf dem Wolfgangpass. Ich wartete eine halbe Stunde in der Kolonne, ehe ich weiterfahren durfte. Der Davosersee zu meiner Linken hatte sich abgesenkt unter dem Eis. Schneehaufen formten eine bizarre Landschaft. Tannen säumten das Ufer wie mystische Gestalten. Alles hätte so schön sein können. Ich war in Davos. Doch die Freude war mir vergangen.
Wenige Skisportler kehrten von den Pisten zurück, verteilten sich über die Promenade. Es erinnerte mich ein wenig an die Weihnachtstage vor einem Jahr, als ich zum letzten Mal im Landwassertal gewesen war. Ich versuchte, die Bilder aus meinem Kopf zu verdrängen, die der Fall Lara Vetsch hervorrief. Ich hatte damals Davos verlassen, ohne die Geschichte zu einem Ende gebracht zu haben. Den Mann, der mich damals verfolgt hatte, hatte ich aus dem Gedächtnis gestrichen. Vielleicht hatte man ihn bereits gefasst. Meinen Vorsatz, ihn selbst zur Strecke zu bringen, hatte ich nicht eingehalten. Jetzt war es wohl zu spät. Ich wusste nicht, ob es ihn überhaupt noch gab.
Etwas war anders.
Einige Hotels lagen hinter Einzäunungen. Auf der Höhe des Kongresszentrums bildeten Pflöcke mit Stacheldraht eine Balustrade. Auch hier formierte sich die halbe Schweizer Armee. Es hätte mich nicht gewundert, unter einer Abdeckplane einen Panzer zu entdecken. Das hier erinnerte an Krieg, an die bedrückenden Bilder der Tagesschau.
Ich fuhr im Schritttempo an Soldaten und Polizisten vorbei. Wohl war mir nicht. Ich wusste, dass während des WEF ein Grossaufgebot an Sicherheitskräften eingesetzt wurde. Doch in diesem Ausmass hatte ich es noch nie zuvor erlebt.
In Valerios Wohnung roch es nach Junggesellenmoder. Nach ungewaschenen Socken und billiger Seife.
Mein Bruder hatte vergessen, vor seinem Weggehen den Abfallkübel zu leeren. Das war drei Wochen her, seit er für ein paar Tage in Davos gewesen war. Der Geschirrspüler war halb voll und noch nicht in Betrieb gewesen. Bevor ich mich hier einnistete, beseitigte ich den Schmutz. Ich zog die eine Scheibe des Panoramafensters auf. Die kalte Luft drang ungehindert herein. Trotzdem hatte ich das Gefühl, endlich wieder richtig durchatmen zu können. Der Blick zum Jakobshorn liess mein Herz schneller schlagen. Bald schon würde ich dort oben in den Spuren der anderen fahren. Ich schloss das Fenster, ging ins Schlafzimmer und packte meinen Koffer aus. Einige Winterkleider hingen noch von meinem letzten Aufenthalt im Schrank. Valerio hatte für mich zudem zwei Tablare reserviert, auf denen sich meine Pullover stapelten. Ein Zettel lag obenauf. «Willkommen, Schwesterherz» hatte er mit seiner unleserlichen Schrift hingekritzelt. Manchmal vergass ich, welch grosszügigen Bruder ich hatte. Nicht selbstverständlich, dass er mich hier wohnen liess. Er hätte die Wohnung auch anderweitig vermieten können.
Ich bezog das Bett neu, als der Summton meines iPhones mich aus den Gedanken riss. Ich sah auf das Display und erkannte Darios Namen. Er hatte sicher die Tage bis zu meiner Ankunft gezählt. Ich fuhr über den Touchscreen und kündigte mich an.
«Allegra, endlich!» Darios Stimme klang euphorisch, als wäre mein Besuch in Davos eine für ihn lebensrettende Massnahme. «Du, ich habe die ganze letzte Nacht nicht geschlafen, so aufgeregt war ich», bestätigte er meine Vermutung. «Bist du schon lange hier?»
«Eben erst angekommen.» Ich lächelte in mich hinein.
Dario– ehemaliger Schulkollege, guter Freund, Davoser Polizist und beinahe Liebhaber: Ich hatte im letzten Winter die Notbremse gezogen. Ich wollte ihn als Freund behalten. Mehr lag da nicht drin.
Er hing sehr an mir, war verliebt und entsprechend eifersüchtig. Schliesslich hatte er sich im letzten Jahr unverhältnismässig fest um mich bemüht. Dario vereinigte alles in sich, was ich so mochte: Herzensgüte, Charme, eine wilde Entschlossenheit. Mit Dario hatte ich die Freude an meinem Geburtsort wiederentdeckt. Das Zurückkommen war wie ein Heimkommen. Mit Dario erreichte ich den Punkt, um den meine Vorstellungen lange Zeit nur als Möglichkeit gekreist hatten: wieder ins Landwassertal zu ziehen. «Wenn du willst, können wir uns heute Abend treffen. Und morgen würde ich gern mit dir aufs Jakobshorn fahren.»
Lange hörte ich nichts mehr.
«Dario?»
Endlich ein Räuspern. «Geht leider nicht. Wir sind im Moment rund um die Uhr auf Bereitschaft. Übermorgen beginnt das WEF.»
«Die Präsenz von Polizei und Armee nimmt in jedem Jahr drastischere Formen an», provozierte ich enttäuscht. «Es kann doch nicht sein, dass wegen ein paar Politikern Davos Kopf steht.»
«Es ist nicht wegen ein paar Politikern. Es sind immerhin namhafte Staatsvertreter unter ihnen sowie Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, die zu uns in die Alpenstadt kommen. Davos gilt als sicher.»
«Kommen die mit der Idee, die Welt verändern zu können?», spottete ich.
«Du hörst mir nicht zu. Es geht darum, dass Davos genug Schutz bietet. Sollte hier jemand ein Attentat planen, hätte er ein Problem mit dem Fluchtweg.»
Warum beharrte er darauf? «Bist du so naiv, oder trägst du Scheuklappen? Sollte jemand wirklich Ernst machen, halten ihn auch die Berge nicht davon ab.»
«Das ist nicht witzig.» Darios Stimme klang angespannt.
«Das ganze WEF ist ein Witz», sagte ich lauter als gewollt.
«Warum auf einmal so gehässig?» Dario schniefte durchs Telefon. «Ich kenne dich gar nicht von dieser Seite. Wir hatten oft darüber diskutiert, welchen Nutzen Davos und die Schweiz im Allgemeinen aus dem WEF ziehen. Du hast dich nie negativ dazu geäussert. Im Gegenteil.»
Ich erzählte ihm von der aggressiven Vorgehensweise seiner Kollegen in Landquart und von den Kontrollposten unterwegs. «Ich habe grosse Mühe damit, wenn man die Touristen ohne ersichtlichen Grund schikaniert. Wir befinden uns in einem freien Land. Mit dieser Aktion vertreibt ihr die Feriengäste. Wenn man die Zahlen der letzten Jahre anschaut, hätte Davos allen Grund, sich Mühe zu geben.»
«Wir befinden uns im Ausnahmezustand. Es geht auch um die Sicherheit unserer Wintergäste. Vor zwei Tagen…» Er hielt inne.
«Was war vor zwei Tagen?»
«Ich kann es dir nicht sagen. Dies fällt unter meine Schweigepflicht.»
«Sei nicht albern. Wie lange kennen wir uns schon?» Meine Neugierde war geweckt. «Was für ein Ausnahmezustand? Worum geht es? Ist das der Grund, weshalb jeder Automobilist in Landquart auf den Parkplatz zitiert wird?»
«Wir kommen nicht darum herum…», er zögerte, «Stichproben zu machen.»
«Ha, das sah aber nicht nach Stichproben aus. Das war gezieltes Vorgehen. Wenn iPads und Laptops überprüft werden, ist Feuer im Dach.»
«Ich kann es dir nicht sagen. In den nächsten Tagen werden wir unterwegs sein. Wir haben bereits Verstärkung aus den Kantonen Sankt Gallen, Zürich und Luzern bekommen.»
«Den Steuerzahler wird es freuen», sagte ich in einem Sarkasmus, den ich mir in der Regel für nervtötendere Dialoge aufhob. «Da kommen reiche Typen nach Davos und verlangen Personenschutz rund um die Uhr. Hätten sie ein reines Gewissen, müsste man keinen solchen Auflauf an Schutzpatrouillen aufbieten.»
«Bist du fertig?»
«Nein, nicht bevor du mir sagst, was los ist.»
Wieder hörte ich nichts von Dario. Endlich ein erneutes Räuspern. «Wir bekamen vor… verdammt, Allegra. Du machst es mir nicht einfach…»
Die Türglocke schrillte durch das halbe Wohnzimmer. Dario musste den Klang gehört haben, denn er hielt abrupt inne. Ich schritt mit dem iPhone in der Hand zur Wohnungstür, stand dort eine Weile und lauschte. Unter normalen Umständen hätte ich spontan aufgemacht. Das Gespräch mit Dario mahnte mich zur Vorsicht. In Davos geschah gerade etwas, auf das ich keinen Einfluss hatte.
Wieder klingelte es.
Ich sah durch den Spion. Draussen standen zwei junge Frauen. Ich hatte sie noch nie gesehen. Offenbar hatte jemand sie unten beim Haupteingang hereingelassen.
Sollte ich die Tür öffnen?
Lächerlich! Seit wann fürchtete ich mich vor jungen Frauen?
Sie läuteten ein drittes Mal, jetzt länger.
Dario fragte mich, ob ich Besuch habe. Ich musste mich entscheiden.
«Du, ich muss auflegen», sagte ich und wartete seine Erwiderung erst gar nicht ab. Wenn ihm an der Fortsetzung des Gesprächs etwas lag, würde er sich bestimmt wieder melden. Ich steckte das iPhone in die Gesässtasche meiner Jeans und öffnete die Tür.
«Hey. Ich hoffe, dass wir Sie nicht stören.» Sie war blond und höchstens fünfundzwanzig. Eine Brille verkleinerte ein wasserblaues Augenpaar. Starke Korrektur, ging mir durch den Kopf.
Die andere sah wohlgenährt aus. Sie trug eine Wollmütze. Schwarze Stirnfransen lugten keck darunter hervor. «Können wir Sie einen Moment sprechen?»
«Worum geht es denn?» Ich sah auf ein Dokument, das die Blonde in der Hand hielt.
«Wir sammeln Unterschriften gegen die Absurdität des WEF.»
«Nicht gegen das WEF?»
«Natürlich gegen das WEF. Dürfen wir reinkommen?»
«Sie ziehen also von Tür zu Tür, um Ihr Anliegen kundzutun?», fragte ich und liess die beiden Frauen eintreten. Ich war ja nett. «Ich gehe davon aus, dass Sie da ziemlich auf Widerstand stossen.»
«Wir dürfen nichts unversucht lassen.» Die Blonde streckte ihre rechte Hand aus. «Ich heisse Maja Accola, und das ist meine Kollegin Nina Barbüda. Wir sind aus Davos Dorf.»
Studentinnen, nahm ich an.
Nina setzte sich unaufgefordert an den Küchentisch. «In diesem Jahr wird es eine ungeheuer grosse Teilnehmerzahl geben. Mehr als zweitausendfünfhundert Teilnehmer aus hundertvierzig Ländern kommen ans Weltwirtschaftsforum. The new global context… mit diesen Schlagwörtern lockten die Verantwortlichen hochrangige Delegationen aus den Vereinigten Staaten, China, Japan, Russland und aller Herren Länder an. Sie sollen Lösungen für wirtschaftliche und politische Krisen und Konflikte finden–»
«Das ist alles eine Farce», ereiferte sich Maja. «Es geht auch an diesem Forum den Beteiligten nur darum, Profit für sich und ihre Länder zu schlagen und diesen auf den Buckel der armen Weltbevölkerung, vor allem der Drittweltländer, abzuwälzen.»
«Oder erinnern Sie sich an nachhaltige Lösungen, die das WEF hervorgebracht hat?», fragte Nina.
«Das Schlimme daran ist», fuhr Maja fort, «dass einige Davoser an diesem Kuchen partizipieren. Wir wissen von den Hoteliers, dass das WEF ihr Jahresbudget für Kost und Logis positiv beeinflusst. Die Zahlen der normalen Touristen sind eher rückläufig. Mit dem WEF werden sie ausgeglichen.»
«Das ist nichts Neues», unterbrach ich, «dass dort geholt wird, wo es etwas zu holen gibt. Das ist nur menschlich… und vom wirtschaftlichen Standpunkt aus gesehen klug.»
«Es profitieren aber nicht alle», sagte Maja.
«Vor allem gibt es im Durchschnitt mehr Immissionen, was Lärm und Schmutz angeht», sagte Nina. «Gehen Sie mal auf den Parkplatz vor dem Kongresszentrum, während die Mächtigen dieser Welt sich für den Umweltschutz starkmachen. Es ist eine Lüge. Draussen warten die Busse mit laufenden Motoren, damit die Kongressteilnehmer sich in ein geheiztes Inneres setzen können. Und wir in Davos müssen diesen Dreck einatmen. Es ist genauso ein Verhältnisblödsinn, wie wenn die Gäste mit Privatjets und Helikoptern anreisen und von den Flugplätzen mit Taxis abgeholt werden…»
«Dagegen kämpfen wir mit aller Vehemenz», ereiferte sich Maja. «Wir wollen den Menschen die Augen öffnen, sie dazu zwingen, hinzusehen, und die Verlogenheit hinter dem WEF aufdecken. Unter dem Deckmäntelchen von Problemlösungen der Beteiligten ist das WEF nichts anderes als ein exhibitionistisches Gebaren jener Leute, die daran teilnehmen.»
Ich entschärfte den Monolog, indem ich den beiden Frauen einen Kaffee anbot. Sie lehnten ab.
«Es ist uns verboten worden, eine friedliche Demo durchzuführen», fuhr Nina fort. «Die Fraktionen verbieten sie. Sie fürchten sich davor, dass das WEF dann nicht mehr in Davos durchgeführt würde. Sie wollen die WEF-Teilnehmer nicht brüskieren, so ihre Ausrede. Die kuschen vor diesen Leuten. Das ist feige gegenüber der einheimischen Bevölkerung.»
«Und jetzt glauben Sie, mit Ihren Unterschriften etwas bezwecken zu können?», fragte ich und verbiss mir ein Schmunzeln.
«Wir wollen die Bevölkerung für unser Anliegen sensibilisieren», sagte Maja.
«Immerhin dauerte das Forum in den letzten Jahren nur noch vier statt sieben Tage», sagte ich.
Nina und Maja warfen sich Blicke zu. «Das reicht uns nicht. Wir wollen das WEF nicht. Am besten, es wird abgeschafft. Ist das so schwer zu verstehen?»
«Sie werden eine Minderheit bleiben», sagte ich. «Das Kosten-Nutzen-Verhältnis überwiegt die emotionalen Gründe.»
«Sie bringen es auf den Punkt!» Nina sah mich mit zusammengekniffenen Augen an. «Es geht nur ums Geld. Das Problem ist, dass die Bevölkerung nicht weiss, was hinter dem WEF steckt. Die Leute sind denkfaul geworden. Solange es ihr Leben nicht tangiert, müssen sie sich keine Gedanken darüber machen. Wir werden zum Narren gehalten. Unsere Anliegen werden mit Füssen getreten, ebenso jene der armen Länder. Es geht hier nur um Macht und Geld», wiederholte sie sich. «Der, der hat, wird sich bereichern… auf Kosten derer, die sich nicht wehren können.»
«Ich glaube, Sie schiessen komplett am Ziel vorbei», stichelte ich. Ich hatte keine Lust, den Rest des Abends mit den fanatischen jungen Damen zu verbringen. Solange solche Emotionen im Spiel waren, konnte man nicht sachlich diskutieren. Ich ging davon aus, dass es persönliche Gründe gab, die sie zu dieser Aktion mobilisierten. Entweder stammten sie aus dem linken Lager, oder sie gehörten zu den Alternativen. Ich hatte noch nie etwas gegen Gegenbewegungen gehabt, wenn sie rational begründbar waren. Aber Majas und Ninas Argumentationen schienen vom subjektiven Blickpunkt geprägt zu sein, von einer beschränkten Denkweise.
Nina erhob sich auf einmal. Sie ging zügig durch die Küche ins Wohnzimmer und von dort Richtung Schlafzimmer, wo sie die Tür aufstiess. Ich reagierte zu spät. Sie stand im Badezimmer, bevor ich Valerios Bett erreichte.
«Aha», sagte sie mit dem Ton der Überzeugung. «Sie gehören auch zu diesen Obergestopften, denen es am Arsch vorbeigeht, wenn das WEF weiterhin besteht. Maja, hast du diesen Luxus gesehen? Jetzt ist mir alles klar. Sie sind genauso eine Profiteurin wie alle…» Sie sah auf ihre Armbanduhr. «… wie alle, die im Kongresszentrum gerade Champagner schlürfen und Kaviarbrötchen schlemmen.»
Im Moment blieb mir die Sprache weg. Was fiel dieser Person eigentlich ein? Ich ging ins Badezimmer und packte Nina an den Schultern. «Verlassen Sie sofort meine Wohnung!»
«Nina, das hat keinen Sinn», hörte ich Maja jammern. «So kommen wir nie zum Ziel.» Sie wandte sich an mich und entschuldigte sich für ihre Kollegin, die offensichtlich die Nerven verloren hatte.
Nina wurde sich ihres Fehlverhaltens bewusst und verliess mit gesenktem Haupt das Badezimmer. Sie würdigte mich keines Blickes mehr. Ich begleitete sie zum Ausgang. «Vielleicht sollten Sie Ihre Sache emotionsloser angehen», riet ich ihnen. «Sammeln Sie Fakten, überzeugen Sie Ihre Gegner mit handfesten Argumenten, falls Sie beabsichtigen, etwas in Bewegung zu setzen.»
Maja und Nina verschwanden, wie sie gekommen waren– sang- und klanglos. Nur ihr Geruch blieb zurück– ein Fluidum von Holz.
DREI
Die Nacht hatte sich in einem monochromen Licht über die Landschaft gelegt. Überall gingen die Lichter an und reflektierten im Schnee.
Halb acht. Ich nahm mir vor, die Gegend zu inspizieren, nachdem ich den gestrigen Abend und den heutigen Tag in Valerios Wohnung verbracht hatte. Mich nahm wunder, welche Strassen bereits gesperrt, welche Zufahrten zu den Hotels bewacht waren. Ob die Sternekästen umzäunt waren, ob die Armee jeden einzelnen Passanten ins Visier nahm. Davos als Hochsicherheitsburg für Politiker und Wirtschaftsbosse, die einander viel und doch nichts zu sagen hatten. Vorne schüttelten sie sich die Hände, küssten einander die Wange, umarmten sich. Hinter der Kulisse drohten sie mit Sanktionen, zogen am Abzug der Maschinengewehre oder warfen Bomben.
Diplomatie funktioniere wie ein Medikament gegen den Schmerz, hatte mir Tomasz erklärt. Es täusche dem Gehirn Besserung vor, die Ursache aber bliebe bestehen. Zudem wiege man sich durch Diplomatie in falscher Sicherheit. Nur Tomasz konnte solche spitzfindigen Sprüche von sich geben.
Tomasz, der seit einem halben Jahr in Boston wohnte und dort einen Nachdiplomstudiengang absolvierte. Erst noch hatte er mir mitgeteilt, dass er nach den zwei Semestern des LL.M. –des Nachdiplomstudiengangs– noch bleiben wolle. Ich konnte mir nicht vorstellen, noch länger eine Fernbeziehung zu pflegen. Und Tomasz’ Liebesbeteuerungen beeindruckten mich nicht mehr so leicht.
Ich hatte mich verändert. In den letzten Monaten hatte ich gespürt, dass mir die Distanz zu meinem Freund Raum schaffte, dass ich noch nicht bereit war, mein Leben unwiderruflich mit einem Mann zu teilen. Dass Tomasz mich für sich eingenommen hatte, wurde mir erst jetzt bewusst. Jetzt, als ich allein war.
Seine Abschiedsworte auf dem Flughafen am zweiten Neujahrstag hatten genau das thematisiert, was ich selbst schon lange spürte. Wir hatten uns ein halbes Jahr nicht mehr gesehen. Der Blitzbesuch über die Festtage hatte dem Wiedersehen von Familie und Freunden gegolten, die ihren persönlichen Anspruch an Tomasz geltend machten. Er war knappe zwei Wochen da gewesen. Ein wenig auch für mich. Sollten wir füreinander bestimmt sein, würden sich unsere Wege wieder kreuzen, hatte er gesagt. Andernfalls würden wir uns nie mehr sehen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich seinen Abschied einfach so einstecken konnte. Ich hatte zwar geheult, aber mehr aus dem Grund, weil ich mich nicht selbst ins Flugzeug setzen und verreisen konnte. Meine Gefühle für Tomasz waren erkaltet. Es hätte mich beunruhigen müssen. Stattdessen fühlte ich einen Druck weniger.
Ich ging den Rathausstutz hoch. Links und rechts säumten Häuser den Weg. Durch zugezogene Vorhänge flimmerten blau die Fernsehgeräte. Unter meinen Schuhen knirschten Eiskristalle.
Ich bog auf die Promenade ein. An der Ecke zum Rätia-Center lehnten drei Jugendliche und kifften. Ich sah es daran, wie sie die Joints hielten. Auf dem gegenüberliegenden Trottoir diskutierte eine Gruppe schwarz gekleideter Männer über etwas, das ich nicht hören sollte. Als ich an ihnen vorüberging, flüsterten sie plötzlich, sahen mich jedoch alle gleichzeitig an. Ein Kontrollposten, nahm ich an.
Die Tür zum Postillon stand offen. Warmes Licht flutete über die Treppe, die zum Eingang führte. Aus dem Innern vernahm ich Klaviermusik. Ich trat in den Vorraum, der zur Rezeption führte. Linksseitig stand ein Flügel. Ein Pianist sass davor. Seine Hände huschten über die Tasten. Die Melodie stammte aus dem Repertoire Udo Jürgens’. Nicht mein Geschmack. Es war auch der Grund, weshalb ich mich entschloss, in den Club zu gehen. Ich mochte keine Schlager.
Mam hätte ihre Freude daran gehabt.
Meine Mam. Ich hatte sie noch nicht angerufen. Hätte sie sich nach meinem Befinden erkundigt, hätte ich lügen müssen. Ich wollte sie nicht unnötig in Sorge um mich versetzen. Sie hatte mich gebeten, mit ihr eine Woche nach Gstaad zu fahren. Wegen Schneemangels hatte ich davon abgesehen. Zudem liess sich Mam lieber mit einer Massage verwöhnen oder las Bücher, anstatt mit mir Ski zu fahren.
Ich grüsste den Kellner, den ich vom letzten Winter kannte. Er arbeitete seit Jahren hier, gehörte sozusagen zum Inventar des Hotels. An seinen Namen erinnerte ich mich nicht. Ich stieg die Treppe zum Club hinunter und überreichte meinen Mantel dem Garderobier.
Die Tür zum Tanzlokal war nur angelehnt. Ich stiess sie auf und landete in einem grün schimmernden Lichtspiel, wo mich Nebel umwaberte. Jemand hatte eine Trockeneismaschine aktiviert. Mir war nur nicht klar, für wen. An der Bar sassen drei Männer mittleren Alters, vor sich eine Stange, und glotzten gelangweilt in meine Richtung. Ein Tisch war mit einer Männerrunde besetzt. Musik lief in moderater Lautstärke. Ich suchte mir einen Platz an der Bar und bestellte einen Hugo. Ich beobachtete den Barman, wie er ein Glas bereitstellte. Er holte eine Limette aus dem Kühlregal, zerkleinerte sie und warf sie ins Glas. Dazu gab er Holundersirup, zerstöpselte die Limettenstücke zusammen mit Minzeblättern und gab Sekt, Mineralwasser und Eiswürfel dazu. Er rührte das Ganze mit einem Löffel um, bevor er das Glas mit einem Strohhalm vor mich hinstellte.
«Heute zum ersten Mal hier?» Er wollte offensichtlich nett sein, ein belangloses Gespräch beginnen. Mir war nicht danach. Ich hatte bis in den späten Nachmittag hinein geschlafen und deswegen die Einkäufe vergessen. Ich war im Moment ziemlich müde. Ich nippte am Glas, trank in kleinen Schlucken. Der Inhalt prickelte auf meiner Zunge, schmeckte nach Ferien und Fernweh.
Ich hätte auch in die Karibik fliegen können. Zwei Wochen Martinique, Dominikanische Republik oder die ABC-Inseln. So, wie ich es früher oft mit Vater getan hatte. Doch dazu fehlte mir das Geld. Vater hatte uns Kindern nichts vermacht. Das wurmte mich noch immer. Auch seine Witwe Letícia war leer ausgegangen. Anfänglich hatte sie noch in Vaters Appartement wohnen können, seit einem halben Jahr lebte sie in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in der Schatzalpstrasse. Seit dem Besuch beim Notar hatten wir erst einmal miteinander telefoniert.
Ich sass an der Bar, genauso bescheuert wie die drei Männer neben mir. Ich starrte ins Glas. Während die Eiswürfel durch einen Tang aus zerquetschten Minzeblättern tanzten, glaubte ich hinter meinem Rücken etwas zu spüren. Wie ein Windhauch fühlte es sich an. Eine kurze Berührung meiner Haare.
«Beautiful Lady», vernahm ich. Neben mir schwang sich ein Mann auf den Barhocker.
Meinte er mich? Da ich weit und breit das einzige weibliche Wesen war, musste ich davon ausgehen.
«I would like to invite you for a drink.» Er sprach mit Akzent. Dunkle Augen sahen mich erwartungsvoll an. Glühende dunkle Augen. Geheimnisvoll, fremdländisch. Schwarze Haare umrahmten ein markantes Gesicht, das aufgrund des schummrigen Lichts noch dunkler wirkte. Ein Orientale, ging es mir durch den Kopf. Er bestätigte meine Vermutung, als er sich mir vorstellte. «My name is Khalid Abu Salama. Iwas born in Dubai.» Seine Stimme klang sonor, warm, mit einem merkwürdigen Timbre.
WEF, WEF, wuff, bellte es in meinen Ohren. Womöglich ein Politiker aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, obwohl sein Alter diesen Schluss nicht unbedingt unterstützte. Ich verabscheute solche Anmache. Ich liess mich nicht gern einladen, wenn ich eine Absicht dahinter erkannte. Als mein Vater noch gelebt hatte, war ich mit ihm in Dubai gewesen, dieser auf Hochglanz polierten Stadt am Persischen Golf mit den futuristischen Wolkenkratzern. Noch nie zuvor hatte ich so viele teure Autos nebeneinanderfahren, noch nie so viel Goldschmuck an Armen und Hälsen funkeln sehen. In Dubai gehörte Luxus zur Tagesordnung. Dort war alles Gold, was glänzte. Auf den ersten Blick.
In den klimatisierten Hotels und Palästen herrschte Glückseligkeit, wenngleich dies für mich als Europäerin nicht ganz nachvollziehbar war. Stolzierte der Mann in der weissen Dischdascha voraus, folgten ihm bis auf das Gesicht bedeckte Frauen in der traditionellen Abaya.
Ich verabscheute dieses Missverhältnis zwischen den Geschlechtern.
Sobald man sich vom Stadtkern entfernte, traf man auf Märkte des einfachen Volkes, auf Skelette angefangener Bauten, auf Geisterstädte in der Wüste, auf Hitze und Staub. Auf klammernde Kinderhände und traurige Augen.
Khalid begutachtete mich von oben bis unten. Ich trug meine Lieblingsjeans und einen schwarzen Pullover, der etwas eng anlag. Khalid schämte sich nicht seines begehrlichen Blickes. Ich wandte mich dem Barman zu, der eine Flûte mit Champagner füllte. Er servierte sie Khalid. Dieser verlangte nach einem Glas Wasser und schob mir den Champagner zu.
«Ich trinke keinen Alkohol», sagte er auf Englisch.
«Dann hättest du ihn nicht bestellen sollen.»
«Der ist für dich.»
Ich erinnerte mich an den Burj al Khalifa, den grössten Wohnturm in Dubai. Damals hatten wir im Park davor die Wasserspiele bewundert, die farbigen Fontänen, die im Rhythmus zu klassischer Musik in die Höhe schossen. Wir hatten uns in einem sündhaft teuren Restaurant ein orientalisches Menü bestellt, Vater dazu eine Flasche Wein. Wir hatten ihn nicht bekommen, weil in den arabischen Staaten Alkohol grundsätzlich verboten ist, auch für Touristen auf den öffentlichen Plätzen.
Dubai. In Khalids schwarzen Augen meinte ich jenes Geheimnis zu erkennen, das die Stadt am Persischen Golf in sich trägt.
«What’s your name?» Khalid lächelte mich an. Dabei entblösste er ein schneeweisses, kräftiges Gebiss, das seine Lippen fast sprengte.
Wenn ich ihm meinen Namen verriet, würde er nichts damit anfangen können. Allegra ist kein geläufiger Name. Es ist ein rätoromanischer Gruss. Er kommt dort zur Anwendung, wo sich sozial gleichgestellte Personen begegnen. Allegra ist die übrig gebliebene Kurzformel des ursprünglichen «Cha Dieu ans allegra!– Möge uns Gott erfreuen!» Ich weiss bis heute nicht, weshalb meine Eltern mir bei der Geburt diesen Namen gegeben haben.
«Allegra», sagte ich. «Mein Name ist Allegra.»
«Alegria», sagte Khalid, «steht für Freude», womit er mir eine gewisse Intelligenz bekunden wollte oder die Tatsache, dass er ausser Englisch noch andere Sprachen beherrschte. Es konnte auch Zufall sein, dass er das wusste. Oder Bluff.
Seine Hände waren lang und schmal. Am linken kleinen Finger steckte ein Klunker von hohem Wert. Das Licht der Bar reflektierte im facettenreichen Stein. Die Fingernägel glänzten, schienen sehr gepflegt. Er hatte seine Hemdsärmel nach hinten gekrempelt. Kein Haar auf den Armen. Er hatte eine Haut wie Messing.
Ich hätte mich dumm stellen können. Ihm sagen, dass ich nur wenig Englisch verstand. Oder ehrlich sein und sagen, dass ich kein Interesse an ihm hatte. Für gewöhnlich setzte ich mich nicht gern allein an eine Bar, weil ich dauernd angebaggert wurde. Es gab Männer, die uns Frauen noch immer als Freiwild betrachteten. Mir war überhaupt nicht nach Flirten zumute.
Warum war er nach Davos gereist?
Bloss wegen des WEF?
Noch bevor ich diese Fragen ausgesprochen hatte, ging die Tür auf, und eine Horde junger Frauen und Männer schoss über die Schwelle. Lachen und Geschrei erfüllten den Club. Für einen Augenblick war Khalid abgelenkt. Ich legte Geld auf den Tresen, weit mehr, als es kostete. Ich fing den Blick des Barmans ein. «Gut so», sagte ich und rutschte vom Hocker. Es gibt Momente im Leben, da spürt man, dass etwas nicht so ist, wie es sein sollte. Es ist, als hätte man einen sechsten Sinn oder den magischen Blick. Ich hatte noch nichts gegessen, wollte das jetzt nachholen, oben im Restaurant, schlimmstenfalls von Schlagern begleitet. Mir war nicht danach, an der Bar sitzen zu bleiben. Solche Abende endeten in der Regel nicht gut.
Jemand packte mich am Arm.
Warme Hände hielten mich in eisernem Griff. Ich drehte mich um. Khalids Augen waren jetzt ganz nah. Ich konnte seinen Atem riechen. Ein Gemisch aus herben Kräutern und Pfefferminze. Der Duft eines Gartens.
«Alegria, wollen wir tanzen?» Er lockerte den Griff, fuhr jetzt mit der andern Hand über meinen Rücken. Mich schauderte.
«Wie, du kannst tanzen?» Mir fiel nichts Gescheiteres ein. «Jive, Salsa, Hip-Hop, Rave?»
«Ich studiere in Oxford.»
«Tanz?»
Wenn Khalid lachte, wirkte er sympathisch. «Nein, Politikwissenschaften…»
Ja klar. Einen Grund musste es geben, dass er am World Economic Forum teilnahm. Morgen begann es.
«… und Chemie», fügte Khalid an. «Mein Vater ist Attaché der Vereinigten Arabischen Emirate. Er arbeitet seit vier Jahren im Konsulat in London. Ich bin mit ihm dorthin gezogen…»
«Hey, das ist ja Allegra», tönte es aus der Richtung der Frauen.
Ich warf meinen Kopf zurück. Ein Reflex. Sie klangen aufgedreht und fröhlich.
«Was tust du denn hier?», fragte die eine, die ich ob des Rummels nicht wirklich sah.
«Schon lange nicht mehr gesehen», sagte eine andere.
Ich wartete, bis sich die Leute gesetzt hatten, und löste mich von meinem Traumtänzer. Im Moment hatte ich keine Lust, über ein Studium zu sprechen. Überhaupt wollte ich mich nicht auf Khalid einlassen. Ich mochte manchmal etwas Rührseliges an mir haben, das den Beschützerinstinkt der Männer aktivierte. Das lag aber weniger an meinem Charakter als an meinem Aussehen.
Ich wandte mich den Frauen zu, erkannte Sidonia und Ursina. Sie trugen durchsichtige Tuniken– also fast nichts. Auffallen um jeden Preis. In diesen Dingen hatte sich weder bei Ursina noch bei Sidonia etwas verändert. Die andern Frauen kannte ich nicht sehr gut. Auch sie geizten nicht mit ihren Reizen, während ihre Begleiter mit ärmellosen Leibchen und Tattoos auf den Oberarmen die Aufmerksamkeit auf sich zogen.
«Wo hast du denn den aufgegabelt?», fragte Sidonia mit schriller Stimme. Sie, die uns alle überragte. Sie hatte schon in der Schule zu den grössten Mädchen gezählt, zu den lautesten sowieso. Sie begutachtete Khalid ungeniert. «Bei dem würde ich es mir nicht zweimal überlegen. Der ist ja megasüss.»
Zum Glück verstand er ihre Sprache nicht. Ich hätte mich sonst schämen müssen.
«Stellst du uns deinen süssen Typen vor? Soviel ich weiss, bist du schon vergeben.»
«Ob er süss ist, habe ich noch nicht ausprobiert.» Am liebsten hätte ich mir die Zunge abgebissen. Jetzt redete ich schon wie diese Frauen. Ich mochte Sidonia nicht besonders. Ausser ihren sehr ausgefallenen Klamotten hatte sie beinahe nichts zu bieten. Vielleicht ein lockeres Mundwerk, das sie durchschaubar machte und ihre Naivität zeigte. Sie war nie wirklich von Davos weggekommen. Selbst ihre Verkäuferlehre hatte sie im Landwassertal absolviert, und die Berufsfachschule hatte sie hier besucht. Diese hatte sie zwar mit einer guten Note abgeschlossen, aber ihr fehlte das grenzüberschreitende Denken: die Idee, dass ausserhalb von Davos auch noch etwas anderes existieren könnte.
«Mensch, Allegra. Lass den ja nicht laufen. So wie der ausschaut, hat er etwas auf der hohen Kante. Hast du seinen Schmuck gesehen? Ein wandelnder Weihnachtsbaum im Luxussegment.»
Khalid musste gemerkt haben, dass über ihn gesprochen wurde. Er machte ein verdriessliches Gesicht, bevor er mich von Sidonia wegzog.
«I would like to dance.» Seine Stimme kam mir gröber vor als vorhin. Er führte mich zum Tanzrondell, das vor der Bühne lag.
Ich hatte also die Wahl: Sidonia oder Khalid. Im Grunde hätte ich auf beide verzichten können.
Trotz der nun lauten Musik hörte ich das Kichern meiner Kolleginnen. DerDJ –ein Halbwüchsiger mit Beatlesfrisur– legte gerade «Thinking Out Loud» von Ed Sheeran auf. Keine Chance mehr, mich aus Khalids Armen zu befreien. Er drückte mich so heftig an seine Brust, dass ich kaum mehr zu atmen imstande war. Ich war in diesem Augenblick sein Besitz. Er umklammerte mich. Er führte mich nicht sehr sicher. Seine Bewegungen fühlten sich wie ein Stakkato an, als hätte er ein Stück Holz in den Kniegelenken.
Der Mann gab mir Rätsel auf. Ich sah in sein Gesicht, versuchte, sein Alter zu schätzen. Es war schwierig. Er konnte fünfundzwanzig sein oder über dreissig. Beidseitig seiner Nasenflügel zogen markante Furchen Richtung Mund, der wie gemeisselt schien. Die Lippen schimmerten dunkel. Ich hatte noch nie bei einem Mann so schön geformte Lippen gesehen.
Allmählich füllte sich die Tanzfläche. Ursina schleppte einen Hockeyspieler an, an den ich mich von letztem Winter erinnerte. Andrea Adank war es nicht.
«Das ist Remo», stellte sie mir ihren neuen Freund vor. «Mein Lebensabschnittspartner.» Sie boxte Remo kichernd in die Seite. «Er spielt im HCD… und liebend gern an mir herum. Nicht wahr, Darling?»
Remo grinste nur und liess sich von Ursina herumkommandieren. Zum Entsetzen von Khalid zelebrierten sie einen erotischen Tanz. Sein Körper versteifte sich augenblicklich. Er bugsierte mich zur Bar zurück. Irgendwie ungehalten. Auch andere Paare verliessen das Parkett.
Die Tanzfläche gehörte Ursina und ihrem Lover, der mich ein wenig an einen aufmüpfigen Teenager erinnerte. Typ nicht ganz reif.
Doch da täuschte ich mich.
Es war wie ein Ballett, das sie vollführten. Ein Berühren und Wiederauseinandergehen. Ein Küssen und Abstossen unter dem Applaus ihrer Freunde. Ein Auf und ein Ab– ein Liebesrhythmus, der in mir ungeahnte Sehnsüchte entfachte, ein plötzliches Verlangen.
Was vergab ich mir dabei? Ich lehnte mich an Khalids Schultern. Ich genoss diese Unverbindlichkeit, denn er würde wieder abreisen und mich vergessen, so wie ich ihn vergessen würde. Jetzt wollte ich mein niederstes Bedürfnis stillen, von dem Tomasz behauptete, dass ich es gar nicht hatte.