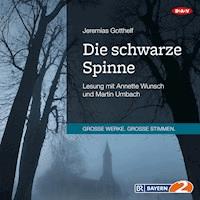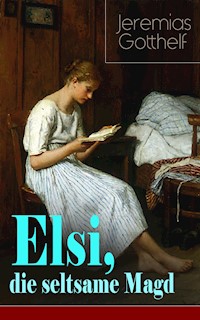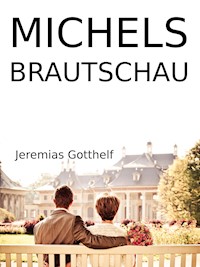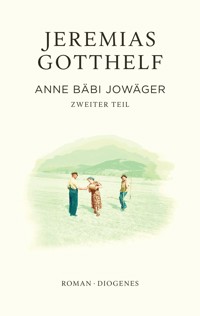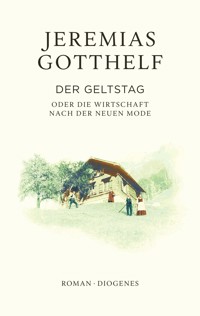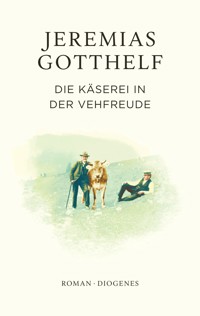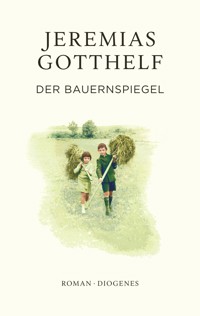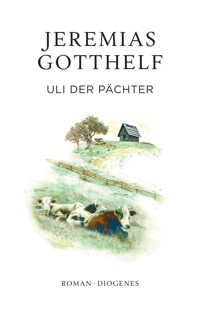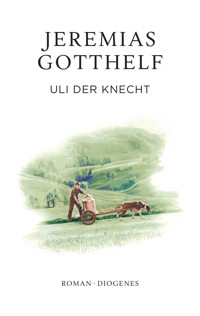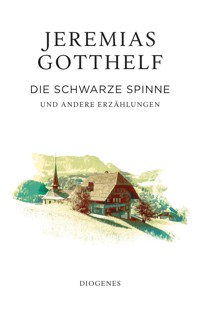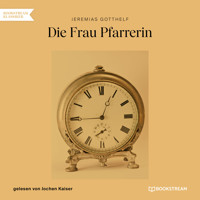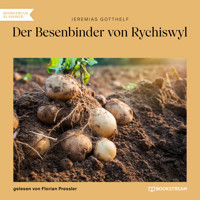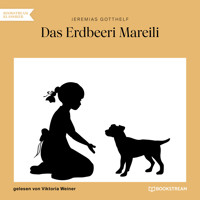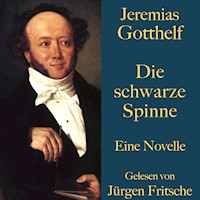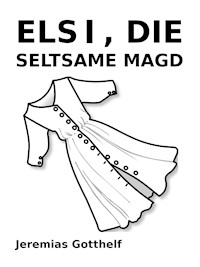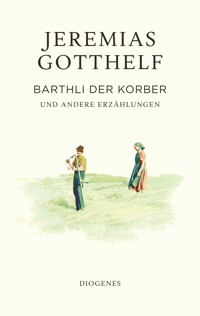
32,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Gotthelf Zürcher Ausgabe
- Sprache: Deutsch
Im Emmental wohnt Barthli der Korber mit seiner Tochter Züseli in einem windschiefen Häuschen. Barthli hat alle Hände voll damit zu tun, die heiratslustigen Männer von seiner hübschen Tochter fernzuhalten. Doch Benz, der Lausbub, lässt sich nicht so leicht beirren. In diesem Band sind die späten Erzählungen Jeremias Gotthelfs versammelt und bieten einen einmaligen Einblick in die Entwicklung dieses vielfältigen Autors.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1056
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Jeremias Gotthelf
Barthli der Korber
und andere Erzählungen
zürcher ausgabe
Herausgegeben von Philipp TheisohnMit einem Nachwort von Christian Haller
Diogenes
Hans Joggeli der Erbvetter
Ein lieblicher Frühlingsabend dämmerte über die Erde herein. Fröhlich eilten die Arbeiter von den Äckern heim, einem nahrhaften Abendbrote zu; rasch liefen Kinder mit Milchtöpfen den bekannten Ställen zu, gleich von der Kuh weg gute Milch zu fassen und eine sorgliche Hausfrau vor der Versuchung zu bewahren, zu erproben, wie Wasser in der Milch sich mache. Mit königlicher Stimme rief der Hahn seine Weiber ins Nachtquartier, und ängstlich trippelte seine Lieblingssultanin herbei, damit ihr ja der Sitz an ihres Herrn Seite nicht fehle. Einem Bache entlang kam ein alt, klein Männchen, auf dem Kopfe eine weiße, baumwollene Kappe, ein sogenannt Wasserschäufelchen auf der Achsel, kurze Hosen ohne Schnallen an den Beinen, von Halblein Rock und Hosen. Derselbe schritt gemächlich einem großen Hause zu, an welchem ein Schild baumelte. Auf dem Schilde waren die Reste eines Bären sichtbar. Dort stellte er sein Schäufelchen hinter die Haustür, öffnete eine andere schwarz angelaufene Tür, trat mit dem Wunsche »Guten Abend miteinander« in eine große Stube und setzte sich stillschweigend in die Ecke neben den Ofen.
In der Stube war die Dämmerung bereits ziemlich dick, das Gespräch sehr laut, doch bemerkte die Wirtin den neuen Gast alsbald und schenkte ihm besondere Aufmerksamkeit. »Ei guten Abend, guten Abend, Vetter Hans Joggi, Ihr seid ein seltener Gast bei uns, womit kann ich aufwarten?«, rief die Wirtin, auf ihn zutrippelnd, wischte die Hand an der Schürze ab und reichte sie ihm. »Guten Abend, Anne Bäbi!«, sagte der Alte, »bringe mir einen Schoppen, aber guten und ungemischten; den Mischmasch mag ich nicht mehr vertragen; und wenn es gemischt sein muss, so mache ich es lieber selbst.«
»Ei bewahre, Vetter, welch bös Zutrauen habt Ihr zu uns. Meint Ihr, wir hätten solchen Wein im Keller, und, wenn wir ihn auch hätten, denn man wird gar oft angeführt von dem Zeug, den Weinhändlern, wir würden Euch von solcher Sorte aufstellen?« – »Nein, nein, Base, nicht express, aber du weißt, man versieht sich so leicht, besonders eine Wirtin am Abend, ist am unrechten Fass, man weiß nicht, wie«, entgegnete das Männchen.
»Ihr seid immer der Gleiche«, antwortete die Wirtin einlenkend. »Schon oft habe ich es gesagt, es gebe keinen wie Vetter Hans Joggi im Nidleboden, der könne immer spaßen und vexieren: Es kämen ihm Sachen in den Sinn, an die sonst kein Mensch dächte. Doch damit ihr wegen dem Versehen nicht im Kummer seiet, will ich express ein Licht anzünden.«
Lauter war unterdessen das Gespräch geworden, nach Abgang der Wirtin wandte der Alte demselben seine Aufmerksamkeit zu und begriff alsbald, worum es sich handle.
Ein junger Stadtmetzger stritt mit mehreren Bauern. Der Metzger hatte ein gut Stück Stadtstolz im Leibe und einen noch größern Schluck Wein; er war in dem Zustande, welchen die Bauern am geeignetsten fanden, um ein eigentümlich Spiel mit ihm zu treiben, welches sie in angestammter Kaltblütigkeit gar trefflich verstehen. Dieses Spiel besteht darin, jemand, den man sich auserwählt, durch Reden, Rühmen oder Tadeln oder beides zusammen in Hitze zu bringen und entweder zum Wetten oder zum Schimpfen und Schelten zu verleiten; in beiden Fällen kömmt er in eine stattliche Weinzeche, er weiß nicht, wie. Der Metzger war in das Gehäge des Bramarbasierens mit seinem Reichtume getrieben worden. Einer der Bauern hatte geäußert, er hätte wohl auch fettes Vieh, verkaufe es aber keinem Stadtmetzger, diese hätten Geld, aber nur, um die Herren zu spielen, und nicht, die Bauern zu bezahlen. Sehe man sie auf dem Lande, so glaube man, es seien alles Engländer, gehe man aber in die Stadt dem Gelde nach, so finde man sie so arm wie Kirchenmäuse. Der Metzger ließ sich andrehen, schimpfte über die Bauern, die bei all ihrem Hochmut oft nicht sechs Kreuzer zu Hause hätten, um Salz zu kaufen, daher kein fettes Vieh mehr zu finden sei, und wenn einmal einer drei Batzen zahlen solle, so müsse er im ganzen Dorfe vergeblich herumlaufen. So spann sich der Handel an, stieg zu immer größerer Hitze, bis sich endlich der Metzger vermaß, er trüge mehr Geld bei sich als sie alle zusammen, ja mehr, als sie alle zusammen zu Hause hätten, die Sparbüchsen der Weiber und Kinder eingerechnet. Er werde meinen, sie hätten es mit solchen Sparbüchsen wie die Herren. Diese hätten es nämlich damit wie die Weiber mit den Hühnernestern, welche sie immer über den andern Tag leerten. Zornig bot der Metzger eine Wette von zwei Maß Wein an, er trüge mehr Geld bei sich, als sie in einer Stunde zusammenbringen könnten. Kaltblütig spotteten sie ihn aus, ob er denn meine, wegen zwei Maß lohne es sich ihnen der Mühe, mit der Hand in die Tasche zu fahren, geschweige gar nach Hause zu laufen, das wäre allfällig eben gut für Kirchenmäuse. Der Metzger sah begreiflich dieses für einen versteckten Rückzug an, fuhr umso hitziger hintendrein, steigerte seine Wette bis zu sechs Maß hinauf vom Allerbesten. Ja, sagte einer, es wäre doch eine Schande für sie, wenn sie alle zusammen so gegen ein Metzgerlein stünden; verspiele er auch, so würde er doch sich rühmen, wie viele Bauern hätten zusammenstehen müssen, um ihn aufzuwiegen. Er hülfe wetten, jenes alte Männchen hinter dem Ofen hätte mehr Geld in der Tasche als der Metzger. Das sei ihnen recht, riefen die anderen Bauern. Der Metzger, welcher dieses für eine neue rückgängige Bewegung ansah, war in hohem Grade erbost, redete von Hudel- und Fötzelbauern, von denen er sich nicht zum Besten wolle halten lassen. Was er mit dem alten Lump da solle. Nur nicht so aufbegehren solle er, kriegte er zur Antwort. Ihnen sei es ernst, er aber scheine es nicht einmal mit einem alten Lump aufnehmen zu dürfen. Das wolle er ihnen zeigen, brüllte der Metzger, warf sechs Gulden auf den Tisch, so viel sollten sie, wenn sie es hätten nämlich, hervormachen. Bei der Wirtin wollten sie das Geld niederlegen, wer gewinne, dem gebe sie seine Einlage wieder, die Einlage der Verlierenden werde in Wein verwandelt. Zögernd, einredend, es werde wohl früh genug sein, zum Gelde zu greifen, wenn die Wette entschieden sei, für sechs Gulden seien sie doch wohl noch lange gut genug, legten sie endlich die sechs Gulden unter Drohen und Fluchen des Metzgers, der zum Stock griff und dem Hund pfiff, zusammen. Die Wirtin sollte es zuhanden nehmen, sagte aber, sie wollte lieber überhaupt nichts mit der Sache zu tun haben, und erst, als der Metzger gebrüllt hatte: »Willst, oder willst nicht!«, strich sie das Geld zusammen und sagte: »Enfin, wenn Ihr’s haben wollt!« Jetzt strahlte der Metzger im Siegerglanz, trat an des Alten Tisch und rief: »Seh jetzt, du altes Kudermännchen, lies deine Kreuzer zusammen und zeige, wie viel du hast!«
Der Alte hatte zum ganzen Handel kein Wort gesagt, nun aber angeredet, meinte er: Ihn hätte niemand gefragt, ob er wolle oder nicht, und zwingen könnte ihn eigentlich niemand, sein Beutelchen hervorzunehmen. Indessen lenkte er, da der Metzger zum Stock griff und dem Hunde pfiff, ein, es sei ihm am Ende recht, wenn er mittrinken könne, müsse er doch nicht mitzahlen; doch der Metzger müsse zuerst zeigen, wie viel er habe. Dieser zögerte nicht, schnallte den Gurt ab, schüttete die Taler heraus, dass sie in der ganzen Stube herumfuhren; es fand sich, dass 150 Gulden sein Vorrat betrug. »Nun, du alter Stöffeler, zeige, was du hast!«, sagte der Metzger und stellte sich triumphierend vor denselben hin; hinter dem Metzger stellten die Bauern sich auf, zogen an ihren Pfeifchen und machten einen Rauch, dass sie selbst fast erstickten. Der Alte griff in die Busentasche der Weste, zog eine kleine zusammengedrehte Schweinsblase hervor, wickelte sie auf und sagte, während der Metzger lachte und siegestrunkene Bemerkungen machte über das kleine Beutelchen: Es wäre ihm lieber gewesen, man hätte ihn in Ruhe gelassen. Indessen, wenn man es gehabt haben wolle, so habe man es, aber wer verliere, solle es ihm nicht nachtragen, und allweg werde es dem Metzger nichts schaden, wenn er wüsste, dass auch noch außerhalb der Stadt Leute seien. Während er dieses sagte, ließ er den Inhalt der Blase über die Hand laufen, und er funkelte schön. Es waren lauter Louisd’ors, doppelte und einfache, wenigstens 60 an der Zahl. Es war eine Zeit im Kanton Bern, wo der Bauer, wenn er den Pflug ins Feld führte oder mit der Schaufel in die Wiesen ging, der Wässerung nach, in einer Rinderblase wenigstens seine 100 Taler bei sich trug, wo man, der Überlieferung zufolge, auf großen Höfen bei Erbteilungen das vorgefundene bare Geld nicht teilte, sondern mit dem Kornmaß es den verschiedenen Erben zumaß. Der erzählte Vorfall geschah nicht zu jener Zeit, aber Hans Joggi gehörte noch der alten Zeit an und war bekannt deshalb. Der Metzger jedoch in jugendlich städtischem Übermute, der ungeheuer beschränkt ist und alle Tage, aller Bildung zum Hohn und Spott, beschränkter wird, hatte von solchem Besitztum keine Ahnung, obgleich er oft genug aufs Land kam. Aber er hatte eben leider nicht Augen für alles, sondern nur für die Häuser, wo man guten Wein fand oder willige Mädchen. Der Metzger wurde nun mörderlich zornig, denn die Augen gingen ihm auf, er sah ins angelegte Spiel. Er fing an, sich grimmig aufzublasen, mit Schelmen und Spitzbuben um sich zu werfen, und wer weiß, wie tief in den Schlamm er noch geraten wäre, wenn der Alte ihm nicht vernünftig zugesprochen, Wirt und Wirtin nicht rechts und links an seiner Seite gestanden wären, zwei zahmen Elefanten gleich, zwischen welche man einen wilden eingefangenen knebelt und bindet. Er ließ sich besänftigen, trank einige Gläser des Wettweines mit, allein es brannte ein solch Raketenfeuer verblümten und unverblümten Witzes auf ihn ein, welches er nicht erwidern konnte, dass er es nicht aushielt; teils stob er, teils stolperte er von dannen.
Die Bauern lachten zusammen über den glücklich vollführten Streich und ließen den gewonnenen Wein sich wohlschmecken. Hans Joggeli, von den Bauern Kirchmeier tituliert, musste mithalten und seinen Schoppen stehenlassen, den die Wirtin zurücknahm und für das nächste Mal aufzuheben versprach. Als der Kirchmeier die gewohnte Anzahl von Gläsern getrunken hatte, welche er selten und höchstens um eins überstieg, brach er allen Nötigens ungeachtet auf. Er war gewohnt, wie selten jemand, in allem, Zeit, Speise und Trank, ein bestimmtes Maß zu halten. Dabei sei er wohl, und etwas zu tun, was ihm nicht wohlmache, wäre ja dumm, sagte der Alte nach seiner alten, daher auch bewährten Weisheit. Als Hans Joggeli sein Schäufelchen hinter der Haustüre hervorgenommen hatte und von der ihm leuchtenden Wirtin Abschied nehmen wollte, reichte dieselbe ihm ein klein Säcklein. »Vettermann«, sprach sie, »hier hätte ich ein paar Dreizinke (die Wirtin war nämlich in der Bereitung dieses Backwerkes berühmt), wenn Ihr sie etwas schätzet. Sie sind mürbe, und wer mit dem Beißen nicht mehr recht fortkömmt, hat sie zu einem Glase guten Weines lieber als Brot. Wenn Brot noch so weiß ist, so ist es doch immer härter.« – »Ei danke schönstens, Base!«, sagte der Alte, »daran hätte ich nicht gedacht. Was sollen sie kosten?« – »Was denkt Ihr, Vetter«, sagte die Wirtin. »Wenn ich was dafür wollte, ich hätte sie nicht anbieten dürfen. Es ist ein klein Zeichen, um den guten Willen zu zeigen und wie man es meint.« – »Das, Base, weiß man ja, wie du es meinst; Kosten zu haben deretwegen wäre nicht nötig. Aber wenn du bald kommen willst, dass ich es wiedergutmachen kann, so will ich es mit großem, mächtigem Danke annehmen. Gute Nacht gebe dir Gott, Anne Bäbi!« – »Was ich noch sagen will, Vetter Kirchmeier: Dem Hauptmanne zu Waschliwyl, der noch so von Weitem in der Verwandtschaft ist, aber gar weit, es mag sich eigentlich niemand besinnen, wie weit, dem trauet doch recht nicht. Er macht den Herrn, ist aber ein Lumpenhund. Es weiß kein Mensch, wie geldnötig er ist, sieht er von Weitem einen Kreuzer, so schießt er danach wie ein hungriger Hund nach einem Stücke Fleisch.«
»Was du mir nicht sagst, Base«, entgegnete Hans Joggeli. »Erst in voriger Woche war er bei mir, konnte nicht genug rühmen, wie er und seine Familie im Glanze sei: Ratsherr zu werden fehle ihm nicht und wahrscheinlich auch seinem Bruder nicht, sie hätten aber dafür getan und dem Fuchse gerichtet. Es seie ihnen eigentlich nicht wegen ihnen, sondern wegen der Familie, in der noch kein Ratsherr gewesen sei, geschweige zwei. Das sei allweg eine Ehre, daneben sei die Familie sehr groß, und vielleicht könne man dann desto besser einander helfen. Da dachte ich bei mir selbst, wenn es so sei, so sei es doch zuerst an mir, etwas nachzuhelfen, ein Ratsherr ist immer Ratsherr und eine Ehre für eine Familie, wenn er schon daneben ein Lumpenhund ist.«
»O nein, Vetter Kirchmeier, o nein, das tut doch recht nicht, dem helfet nicht, ein jeder Kreuzer, den Ihr ihm anhängen würdet, wäre eine Sünde. Daneben möchte ich Euch nicht befehlen, begreiflich natürlich, aber ein Lumpenhund ist ein Lumpenhund, mache man ihn zum Ratsherrn oder nicht, und je weiter so einer kommt, desto mehr Schande macht er der Familie, und je mehr Geld er hat, desto wüster tut er. Daneben könnt Ihr immer machen, Vetter, was Euch gut dünket, begreiflich natürlich. Aber, was mir in Sinn kömmt, im Küchenschranke habe ich noch von einer Pastete, einer bsonderbar guten, die Gerichtsmänner konnten gestern die Beine nicht unter dem Tische stillehalten, während sie davon aßen. Sie ist besonders mürbe, Teig und Fleisch, beides vergeht einem auf der Zunge, die will ich Euch holen.« – »Sei nur ruhig, Base«, antwortete der Alte, »du hast dich schon viel zu viel verköstigt wegen mir.« Aber ehe er ausgeredet, hatte die Wirtin das Säcklein erhascht und kam alsbald mit dem eingepackten Pastetenreste wieder, hing es ihm an die Hand und sagte: »Keinem Menschen rede ich sonst zum Bösen, und in Eure Sache möchte ich mich nicht mischen, bewahre! Aber im Grabe noch würde ich mich umkehren, wenn ich dort vernehmen sollte, der Hauptmann von Waschliwyl mache mit Vetter Hans Joggelis schönem Geld jetzt erst recht den Lumpenhund und sei Ratsherr obendrein. Ich glaube, verzeih mir Gott meine Sünde, ich käme wieder und drehte ihm den Hals um in einer schönen Nacht.« – »Selb wird wohl nicht nötig sein, Base«, sagte Vetter Hans Joggeli, »und wegen dem zu Waschliwyl habe nicht Kummer. Daneben kann man nichts sagen, was einer wird, was einer kriegt, das steht in Gottes Hand, daran kann der Mensch nichts machen. Aber jetzt, Base, muss ich fort, sie werden zu Hause nicht wissen, wo ich bleibe. Vergelts Gott, Base, was du an mir tust, ich glaube nicht, dass ein Mensch in der Welt so an mich denkt wie du. Aber hörst, komm bald, und ziehe es ein. Gute Nacht.« – »Vetter Hans Joggeli, kommt glücklich heim und bald wieder zu uns. Nehmt Euch in Acht, dort steht ein Wagen halb im Weg. Es ist doch so finster, soll der Knecht Euch begleiten?«, so sprach die Wirtin, mit hochgehaltenem Lichte dem Vetter nachtrappend, bis derselbe nicht mehr zu sehen und zu hören war.
Zurückkehrend brummte sie vor sich hin: »Das ist mir ein wunderlicher Heiliger, mit dem weiß man nie, wie man daran ist. Ein zäh Ketzers Mannli, der schlägt noch mit unsern Beinen Nüsse von den Bäumen. Aber geizige Leute (und ein wüsterer Kümmelspalter als der läuft nicht auf dem Erdboden herum) haben es alle so, sie können nicht sterben. Drei Tage nach dem Jüngsten wird man sie noch totschlagen müssen. Man ist doch eigentlich nur ein Narr, dass man dem so viel anhängt; wie hat er gesagt: Was einer wird, was einer kriegt, das steht in Gottes Hand? Der alte Schelm! Zuletzt hat man Speckseiten nach einer Wurst geworfen oder kriegt gar nichts als eine lange Nase! Das wäre der Teufel! Wohl, da würde mein Mann mir den Marsch machen!«
Unterdessen war der Alte bedächtig seines Weges gegangen, sorgfältig die Mitte der Straße haltend, zu seinem Säcklein Sorge tragend, damit das so gerühmte mürbe Backwerk nicht Schaden nehme. Trotz seiner Vorsicht stieß er sich und stolperte. Als er untersuchte, was ihn fast zu Falle gebracht, fand er einige hingeworfene Zaunstecken. Er brummte über die mutwillige Jugend, welche so die Arbeit der Alten zerstöre, steckte dieselben unter den Arm und trug sie heim, weil er, wie er sagte, es für nützlicher hielt, wenn er daheim damit einen Kaffee machen ließe, als wenn wilde Buben sie fänden und mit denselben sich die Köpfe zerschlügen.
Schwer bepackt also mit Pasteten und Stecken, wandte er sich einem großen Hause zu, welches etwas seitwärts vom Wege in einem prächtigen Baumgarten stand. Es war des Alten selbsteigenes Haus, denn der Vetter Hans Joggeli und Kirchmeier seines Titels war der reiche Bauer im Nidleboden, ein alter Knabe, welcher größern Hof hatte und mehr Liebhaber als manches schöne Mädchen ohne Hof und ohne Geld.
In seinem Testamente obenan zu stehen hätten so viele von ganzem Herzen sich selbst gegönnt. Es lohnte sich aber auch der Mühe zu erben, denn das Erbe bestand nicht bloß in einigem zerbrochenen Geschirre, etlichen alten Strümpfen und mehreren alten Schuhen ohne Sohlen oder sonstigem Gerümpel, sondern aus einem der schönsten Höfe, nicht umsonst der Nidleboden (Nidle bedeutet fette Milch) genannt, und aus Kapitalen, deren Betrag niemand kannte, welcher aber sehr hoch sich belaufen musste, denn wenn irgendwo ein Hausvater starb, dessen Nachlass gerichtlich untersucht wurde, so fand es sich zumeist, dass er dem Kirchmeier im Nidleboden schuldig war. Ob der Kirchmeier bereits ein Testament gemacht habe oder nicht, darüber wurde viel disputiert, aber nie sicher ausgemacht; diese Ungewissheit eben unterhielt die Hoffnung der Liebhaber und mehrte den Eifer in ihren Bewerbungen. Zudem hatte er weder Brüder noch Schwestern, keine ganz nahen Verwandten. Daher die Konkurrenz umso freier, die Verwandtschaft aber umso größer. Vettern und Basen hatte er unzählige, wie Sand am Meer. Es war sich aber nicht zu verwundern, denn wenn auch nicht ganz bis zu Adam hinauf, so doch bis zu Noah wusste man ihm die Verwandtschaft herzuleiten, dass er oft ganz darüber erstaunen musste.
Der Nidleboden gewann daher fast das Ansehen eines berühmten Wallfahrtsortes, wohin es Hunderte zieht, bei einem Wundertäter ihr Heil zu suchen. Vetter Hans Joggeli war der wunderliche Heilige, um dessen Gunst man buhlte und nie umsonst, denn hoffnungslos entließ er nimmer eine Kreatur. Aber was dann so ein Wallfahrer, der sich erhört glaubte und freudigst heimzog, für saure Augen machte und hässliche Gesichter schnitt, wenn ihm, Wegziehenden, Dahinziehende begegneten, welche ihn um die gewonnene Gunst und Gnade bringen konnten möglicherweise. Zwischen Gottes Gunst und Gnade und eines Menschen Gunst und Gnade ist nämlich ein gar mächtiger Unterschied. Unendlich ist die Gnade Gottes und groß genug für alle, endlich und gar klein eines Menschen Gunst, und gar wenige vermögen daran sich zu ersättigen. Vetter Kirchmeier ließ kaltblütig das Ding sich gefallen, gab kein böses Wort von sich, nahm, was man ihm brachte, tat daneben, was ihm wohlgefiel.
Mit vielem Behagen legte der Alte, welcher, beiläufig gesagt, aus seinen Waldungen jährlich für einige hundert Gulden Holz verkaufte, in der Küche seine erbeuteten Stecken ab und sagte: »Sieh, Mareili, was ich dir gekramet habe, mit denen ist morgen gut Kaffee kochen.« Wenn es Kram hätte sein müssen, so wäre ihm gar manche Sache anständiger gewesen als solche unflätige Knebel, antwortete die angesprochene Person, ein großes, stattliches Mädchen mit breitem Gesicht, unangenehmem Ausdruck, aber schön farbicht und sonst überall schön nach selbsteigenem Urteile.
Um diese Staatsperson herum schoss eine andere Maid, die war nicht viel kleiner, aber um die Hälfte dünner, spärlich angetan, während die andere es staatsmäßig war, hatte ein viel weniger gefärbtes Gesicht, keinen Schild, breit wie eine Kuchenschüssel, Amors Pfeile herausfordernd, sondern bloß ein lebendiges, freundliches, zu welchem man alsbald das Zutrauen hatte, es könne mit andern fühlen und für andere denken, so eine schoss um die andere herum, nahm dem Alten seine Beute ab und legte sie, wo man am folgenden Morgen zuerst nach Feuerung griff.
Entlastet wandte sich der Alte der Stube zu, setzte sich hinter den Tisch und packte sein Säcklein aus. Ihm nach brauste Mareili, in der einen Hand die Kaffeekanne, in der andern den Milchhafen, herrschte über die Achsel: »Bäbi, bring die Röste!« Als Mareili sah, dass der Vetter für sich was anders gekramet als hölzerne Knebel, zog es ein noch schieferes Gesicht, meinte: »Oder soll ich es draußen lassen? Der Vetter hat mürbern Kram für sich, als er mir gebracht, solcher könnte mich auch gelüsten.« – »Nimm, wenn du willst«, antwortete der Kirchmeier ruhig, »sie sind von der Base beim ›Bären‹; wie die macht sie keine und meint es so gut mit einem, nimm doch, nimm!« – »Wer wollte von dieser was mögen, kein rechter Mensch sieht die ja mehr an, das ist die falscheste Frau, welche auf zwei Beinen läuft! Aber wenn es nur geschmeichelt ist, so ist’s vielen recht«, schnauzte Mareili und schoss zur Tür hinaus.
Der alte Kirchmeier blinzte dem davonfahrenden Mädchen nach, ließ die Dreizinke und den Kaffee sich wohlschmecken, frug Bäbeli, welches Mareili nachwollte, allerlei über den Verlauf des Nachmittags. Plötzlich fuhr Mareili wieder herein und Bäbeli an: ob es denn nichts mehr zu tun wüsste, als dazustehen und Maulaffen feilzuhalten, und wenn er nicht mehr möge, so wolle es die Kanne und den Topf hinaustragen, um endlich fertig zu werden mit Abwaschen, das Feuer brenne bereits lange genug unnötigerweise, und Zeit wäre es auch, dass man an die Ruhe könnte. Am Ende sei man kein Hund, ein Mensch aber müsse geschlafen haben. »Nimm«, sagte der Alte, »ich kann es machen. Und wegen dem Schlafen, denke ich, könntest du es ebenfalls machen, wenn du nämlich die Zeit, welche du dazu hast, auch zum Schlafen brauchst.«
Pung, fuhr die Tür zu, dass die Fenster klirrten und bellend der Hund unter dem Ofen hervorfuhr. »Es ist wieder bös Wetter«, sagte der Alte gelassen und ergeben vor sich hin. »Der Liebeshandel mit dem Halunk verdreht dem Mädchen den Kopf; es ist Zeit, dass man dem Ding ein Ende macht, ehe es ein Unglück gibt.«
Dieser Halunk war nämlich ebenfalls ein Vetter, welchen der Alte lange im Hause gehabt, ja eigentlich erzogen hatte und am Ende genötigt war, ihn fortzujagen. Derselbe hatte sich in den Glauben verlaufen, er sei des Vetters unwiderruflicher Erbe, war stolz, ungehorsam, verschwenderisch geworden, trieb den dummen Übermut, der fast unerklärlich ist, wenn man nicht an die Verstockung denkt, an die Ohren, welche nicht hören, die Augen, welche nicht sehen, so weit, dass er die Ermahnungen des Alten nicht bloß in den Wind schlug, sondern ihnen förmlich Trotz bot. Wenn es aber nicht anders zu machen war, so wusste der Kirchmeier sich ernstlich und gründlich zu helfen; so hatte er den Jungen aus dem Hause gejagt, aber aus dem Kopfe konnte er ihm den Traum, Nidlebodenbauer zu werden, nicht jagen. Durch Mareili, ebenfalls eine ins Haus passierte Base, welche Erbin zu werden hoffte, meinte er, seinen Traum in Erfüllung zu bringen. Er unterhielt mit Mareili einen Liebeshandel, welcher dem Alten äußerst zuwider war. Aber Mareili hatte ebenfalls keine Ohren für des Alten Warnungen, es stand auf der Kulturstufe, wo man durch Vorgänge sich nicht warnen lässt, sondern sich berufen glaubt, sich selbständig in der Welt seine Geschichte zu machen, nach ganz neuen Grundsätzen und Regeln.
Die guten Kinder begreifen nicht, dass es wohl alle Jahre neue Kinder gibt, die Welt aber die alte bleibt, dass die Kinder nagelneue Träume kriegen, die alte Welt dagegen im alten Trappe und Gange bleibt.
Nicht lange nach jenem Abend, an welchem Vetter Hans Joggeli in stillem Selbstgespräch uns seinen Entschluss verkündet hatte, sah man eine lange Frau auf das Haus zukommen. Sie hatte eine spitze Nase im Gesicht, ein Säcklein in der Hand. Noch war sie lange nicht beim Hause, als Mareili rasch ihr entgegenfuhr und sich bei ihr stellte und so lange bei ihr stand, dass man fast hätte glauben sollen, unser Herrgott hätte ein neu Wunder verrichtet und die beiden Weiber zu zwei Türlistöcken werden lassen. Süßes hatten sie nicht zu verhandeln, wie man von Weitem merken konnte, denn sie machten Gesichter, als ob sie angestellt wären, um Pfefferkörner zu kauen. Endlich wurden beide wieder flott und bewegten sich langsam dem Hause zu. Mareili verwarf schrecklich die Hände, die Nase der Frau aber schien um ein sehr Bedenkliches länger und spitzer geworden zu sein.
Vetter Hans Joggeli wartete den Besuch gelassen in der Stube ab. »Gott grüße Euch, Vetter Kirchmeier«, sagte die eintretende Frau und reichte ihm die Hand. »Immer wohlauf, ganz jung noch«, fuhr sie fort, »das freut mich.« – »Ja, ja, Gott Lob und Dank, wohlauf bin ich, und wenn es unseres Herrgotts Wille ist, so habe ich noch ein Weilchen zu leben und kann Gottes Güte genießen. Meine Großmutter wurde 97 Jahre alt, und ich habe manchmal gehört, man schlage den Großeltern nach.« – »He ja, ja«, sagte die Frau, »ein schönes Alter, ich möchte es Euch gönnen. Mir wäre es nur zu lang, kriegte Langeweile. Euer Großvater, wenn mir recht ist, der starb sehr jung.« – »Ja«, sagte der Kirchmeier, »er fiel von einem Kirschbaume, aber die Leute, welche ihn gekannt, haben immer gesagt, wenn das nicht gewesen wäre, so hätte er hundertjährig werden können.«
Da machte die Base wieder ein Pfefferangesicht, sagte jedoch so freundlich als möglich, sie hätte gedacht, sie müsse doch mal sehen, was der Vetter mache, es stürben so viele Leute ungesinnet, man vergrabe fast alle Tage zwei bis drei Personen, dass es einem angst werde um seine Bekannten, besonders wenn sie so alt seien. Auch müsse sie einmal fragen, wie sich Mareili stelle, und ob es ihm noch immer anständig sei? »Danke, Base, meinetwegen brauchst du nicht Kummer zu haben, ich bin wohl, und Mareili geht es auch nicht bös, es dünkt mich, es werde alle Tage munterer und hübscher.«
Ein schlecht Aussehen habe es nicht, sagte die Mutter, doch werde das kaum vom Guthaben kommen, aber es sei von Art so, dass alle Speisen noch einmal so wohl anschlügen bei ihm als bei andern, während die Arbeit ihm nichts schade. »Das wird sein«, sagte der Vetter, hieß Mareili Wein bringen und zu essen, was es Gutes habe. Unterdessen packte die Base eine Züpfe aus (ein Backwerk aus weißem Mehl, Eiern und Butter, welches manchmal mehrere Pfund schwer und 2–3 Fuß lang, größer als ein kleines Kind, gebacken wird) und legte sie auf den Tisch, es war aber eine kleine, magere, so ein Ding, welches was vorstellen sollte, und zu dessen Herstellung das Kleinste einen gereut. Sie habe dem Vetter, sagte die Base, ein Zeichen ihrer Gutmeinenheit bringen wollen, so was recht Mürbes, welches so alten Leuten sonst am anständigsten sei. Jetzt müsse sie sich schämen, aber der Schelm, der Bäcker, sei schuld. Sie habe ihm 2 Maß Korn gegeben, 2 Pfund Butter und 2 Dutzend Eier, und jetzt mache er ihr so ein klein, erbärmlich Ding, welches ein Huhn im Schnabel forttrüge. Der Vetter müsse den guten Willen für die Tat nehmen. Das wäre gar nicht nötig gewesen, sagte der Alte, er hätte ja längst Ursache zu wissen, wie gut sie es meine. Und man solle ihn nur nicht verderben und ihm zu viel Gutes bringen. Da sei auch die Wirtin beim Bären zu Zinggiwyl, die meine auch, wenn sie was Gutes backe, so müsse er davon haben. Selb sei doch nicht nötig, am Ende könnte er noch essen, was die andern, der Magen sei gut, und das sei die Hauptsache. Auch mit dem Beißen gehe es nicht so bös, es sei mancher Junge, welchem mehr Zähne fehlten als ihm, sie solle nur sehen. Es war fast, als ob über die gut erhaltenen Zähne des Vetters der Base das Beißen verginge. Indessen erholte sie sich bald und ließ sich, was da war, wohlschmecken. Die Base war eine von den höchst interessanten Personen, welche die Kunst verstehn, Essen und Reden so zu vermitteln, dass nicht nur keins dem andern Eintrag tut, sondern das Reden Essen und Trinken gleichsam verdeckt. Essen und Trinken der Rede nach helfen ihr den gehörigen Nachdruck geben, gleichsam die wahre Interpunktion. Während die Zähne schwere Pflichten erfüllten, stieß sie mit ihrer spitzigen Zunge, welche noch spitziger als die Nase war, in der ganzen Verwandtschaft herum, spießte ein Glied nach dem andern, hielt es kürzer oder länger über das heiße Feuer ihrer Bemerkungen, und wem sie recht wohlwollte, dem pfefferte sie noch mit dem früher gekauten Pfeffer. Mit besonderer Sorgfalt wurde geschmort und gepfeffert die Bärenwirtin, dass sie zusammenschmorte, nicht größer ward als ein Bein auf einem Schindanger und einen Geruch von sich gab wie eine Katze, welche seit acht Tagen im Speicher ein elend Ende gefunden. Dann musste über das Feuer der Vetter zu Waschliwyl, wirklicher Hauptmann und Ratsherr in Hoffnung. Diesen zerrte sie auseinander und zerschnäfelte ihn, dass man mit einer Leber, welche man zu einer sauern machen will, nicht ärger umgehen kann. Sie wusste alles, was er als Hauptmann getan, und noch viel mehr, was er als Ratsherr tun werde. Hinter alles, so gleichsam als Ausrufungszeichen, setzte sie zentnerschwere Seufzer, sagte endlich: Sie wüsste noch was, aber sagen werde sie es nicht; über das Herz könnte sie es nicht bringen, geschweige über die Zunge. Vetter Kirchmeier musste die Hebeamme machen, das Schreckliche erst über das Herz, dann über die Zunge befördern, endlich, nachdem die Base noch einige wenigstens zwei Zentner schwere Seufzer losgelassen, sagte sie: Ja, sie wolle es sagen, aber der Vetter solle doch nicht meinen, sie habe es erdacht, sie könne zwanzig Zeugen stellen für einen, dass der Lumpenhund es gesagt habe. Wenn derselbe nämlich sich festgetrunken, mit den Talern um sich werfe, als ob es Kieselsteine wären, dass die Leute die Hände über dem Kopfe zusammenschlügen, prahle er, wie das nichts sei und noch ganz anders gehen müsse, wenn einmal der Alte im Nidleboden die Nase unter der Erde hätte. Dort sei er Haupterbe, der Alte halte viel auf der Familie, und werde er zum Hauptmann noch Ratsherr, so fehle es ihm nicht, dem wolle er dann die grauen Taler sonnen. Das Herz wolle es ihr abdrücken, wenn sie so was vernehmen und wenn sie das schöne Gut in solchen Händen sehen müsste, sie glaube nicht, dass sie es überlebte. Und ernst war’s der Base, denn sie nahm das Nastuch und wischte die Augen, dass es eine strenge Sache war. »Habe deretwegen nicht Kummer, Base«, sagte der Alte, mit dem linken Auge blinzend, aber nur ganz leise; »unser Herrgott wird schon sorgen, dass alles an den rechten Ort kömmt, und was er tut, ist wohlgetan. Übrigens wird auch nicht alles wahr sein, was man über den Hauptmann sagt, die Leute reden gar viel, besonders in den langen Tagen. Und wäre es auch, denk, o Base, so kann er sich ja bekehren, unser Herrgott hat schon größere Sünder bekehrt, als der Hauptmann einer ist. Bei Gott seien alle Dinge möglich, steht geschrieben.«
Die Base wurde blass und antwortete mit verhaltenem Grimme: es werde noch manches geschrieben stehen, wo es gut wäre, dass man daran dächte. Dass aber der liebe Gott mit einem Unflat wie dem Hauptmann sich werde abgeben wollen, selb zweifle sie. So viel sie wisse, stehe nirgends geschrieben, dass er das Wüsteste alles austrappen wolle. »Aber, was ich eigentlich sagen wollte«, lenkte sie ein, »ich hoffe, Ihr habet es nicht ungerne, das ist wegen Mareilis Kleidern. Wie bräuchlich und anständig ist das Mädchen nicht versehen, jede Herrenköchin geht besser. Denkt, es hat nur vier Mieder, das neueste schon drei Jahre alt, und nicht mehr als drei Dutzend Hemden, denkt, o Vetter. Vom Übrigen will ich nur nicht reden. Ich zürne es nicht an Euch, ich weiß, dass das Mannevolk in solchen Sachen keinen Verstand hat, aber da dachte ich, wofür unsereiner eigentlich auf der Welt sei, als für Verstand zu machen, wo er fehlt.«
»Da, Base«, sagte der Alte, »habt Ihr ganz recht, man sinnet nicht an solche Dinge, aber wenn man uns den Verstand macht mit Manier und nicht mit dem Holzschlegel, so sind wir dankbar. Ja freilich, Mareili muss Kleider haben, wie es sich gehört. Lasst ihm machen, was Ihr nötig findet, und was es kostet, zahle ich.« – »He nun, das wäre eins, und Ihr sollt Dank haben, habe ich doch gleich gedacht, es fehle Euch nur am Verstand und nicht am guten Willen, und wo der Wille ist, da kann man dem Verstand immer nachhelfen, mit Manier, versteht sich. Nun ist aber noch eins, was anders sein muss, mein Mädchen kann ich nicht so dabeilassen. Das andere Mädchen, Babi, oder wie es heißt, welches Ihr da ins Haus genommen, ohne Mareili zu fragen, ob es ihm anständig sei und ob es dasselbe auch brauchen könne, das ist ihm grausam zuwider, und das muss fort, sonst geht Mareili. Es hat gar keine Hülfe von ihm, es kann nichts, will sich nicht berichten lassen, weiß nichts, als Streit und Klatschereien anzustellen, alles hintereinanderzutreiben. Es ist das schlechteste Mensch, welches unter der Sonne herumläuft, Vetter, und das ist es, Ihr mögt es immer glauben oder nicht, Vetter.«
»Da kömmst du mir gerade auf den rechten Punkt, Base«, antwortete der Alte, »gerade von dem habe ich dir anfangen wollen, es ist dann doch nicht, dass unsereinen gar nichts sinnet.« Der Base ward doch etwas bange, sie hatte zu tief gegriffen, indessen ließ sie sichs nicht merken. »Sieh, Base«, fuhr der Alte fort, »ich habe gedacht, Mareili versaure, bringe hier seine besten Jahre zu, ohne etwas zu lernen.« – »Das ist wahr«, sagte die Base, »gut hat es das Mädchen nicht, es hat mich schon manchmal erbarmet, und dazu so angebunden und eingeschränkt, dass ich es fast heimgenommen hätte, wenn ich nicht gedacht, es werde einmal dafür belohnt. Verstoßen werdet Ihr es doch jetzt nicht wollen.«
Der Alte ließ sich nicht irren. »Bös hat es das Mädchen nicht, es heißt ihr niemand mehr machen, als es kann, es gibt viele Bäurinnen das Land auf, das Land ab, sie sind nicht so viel Meister als es; aber wie junge Mädchen sind, es hat es auch je besser, desto lieber. Darum dachte ich, wie es wäre, wenn Mareili noch ins Welschland ginge, die Sprache zu lernen, das Kochen, Manieren und Lebensarten und sonst noch allerlei. Dort könnte es zuerst Kellnerin sein. Ich habe drinnen einen guten Bekannten, wo das Mädchen es hätte wie eine Herrenfrau, besser wäre nichts.
Später könnte es, wenn es Lust daran fände, zur Wirtin geraten. Wirtshäuser zum Kaufen gibt es genug, und kömmt die neue Straße hier durch, wie die Rede geht, so wäre dort unten beim großen Nussbaum der schönste Platz zum Bau eines neuen.« Der Base war bei dieser Rede ein Stein von dem Herzen gefallen und ein Licht aufgegangen. »Die Sache gefiele mir so übel nicht«, sagte sie, »aber ich muss an Euch denken. Wie könnt Ihr es machen, wenn Mareili fort ist? Mit Bäbi ist ja nichts, und je eher Ihr die Dirne fortjagt, desto wohler seid Ihr. Ich werde für jemand anders sorgen müssen? Vielleicht wüsste ich jemand, wenn die Sache nämlich auch Mareili anständig ist; das ist die Hauptsache.«
»Natürlich«, sagte der Alte, »und es wird mir ungewohnt vorkommen, wenn es fort ist, aber man muss sich leiden können in der Welt. Mareili wird viel kosten, da denke ich nicht, mir neue Kosten zu machen. Ein alter Knecht hat seine Frau im Küherstöcklein, die könnte einstweilen eintreten. Wenn dann Mareili Sprache und Kochen gelernt hat, und es will einstweilen wieder zu mir, so findet es, wann es will, seinen Platz wieder, und die Frau kann wieder ins Küherstöckli.« – »Und dann das Mensch, die Bäbe, was wollt Ihr mit dem?«, frug die Base. »An dieses habe ich nicht gedacht«, sagte der Vetter, »allweg kann es nicht so bleiben, man muss sehen, was zu machen ist. Die Hauptsache ist jetzt, dass Ihr mit Mareili redet.«
Es war der Base etwas da im Wege, sie wusste aber nicht recht, was, denn der Alte machte das ehrlichste Gesicht von der Welt; überhaupt hatte sie zu viel Selbstbewusstsein, um zu fürchten, so ein alt, dumm Männchen könnte sie überlisten. Allweg wohne sie nicht weit, sagte sie, und könne immer ein Aug’ zur Sache haben, und wenn der Vetter sie nötig hätte, so könne er sie rufen lassen, sei es Tag oder Nacht, so scheue sie für ihn weder Wind noch Wetter.
Unerwartet schien Mareili ein Stein des Anstoßes, bitterlich begehrte es mit der Mutter auf, dass sie es wolle austreiben helfen; es merke den Spaß wohl, aber lebendig bringe man es hier nicht fort. Unverrichteter Sache musste die Mutter abziehen, und, wie spitz sie die Sache auch überschlug, ins Klare kam sie nicht, wer recht hatte, der Kirchmeier oder das Mareili? Aber sonderbarerweise wandte über Nacht Mareilis Sinn sich, wie die Fahne auf dem Turme sich kehrt, und wer die Ausführung des vetterlichen Vorschlages auf das Emsigste betrieb, war Mareili. Es gab Leute, welche die Umwandlung über Nacht Mareilis Liebhaber zuschrieben, welchem die Aussicht auf eine Wirtschaft die schönste Aussicht in der Welt schien.
Staatsmäßig ausgerüstet, mit Geld wohl versehen, fuhr endlich Mareili dem Welschland zu, und wenn ein Mädchen zum ersten Male in die Welt hinausfährt, so hat es bekanntlich viele Gedanken über die Glückseligkeiten alle, welche sich ihm dutzendweise aufdrängen, über den tiefen Eindruck, welchen es auf die Welt machen werde. Mareili dachte absonderlich daran, dass man nie wisse, was es geben könne, dass aber, wenn es im Welschland zu einem reichen Engländer käme, welcher es mit Teufels Gewalt zur Frau haben wollte, so früge es eigentlich dem Nidleboden nicht so viel nach und würde nicht Nein sagen. So ein Tröpflein sei es am Ende denn doch nicht, dass es meine, man könne nur an einem Orte leben und dazu noch an einem, wo man so bös haben, so schwere Arbeit verrichten, so wenig schlafen könne; am schönsten sei es doch da, wo man bei vielem Gelde essen und trinken könne, was einem gut dünke, arbeiten könne so wenig, schlafen so viel, als man wolle, und tun, was einen ankomme.
Auf solche Höhe des Weltbewusstseins erhob sich Mareilis Mutter nicht, sie hing an der Scholle, sie hing am Nidleboden mit Leib und Seele. Sie war öfters dort, als es dem alten Kirchmeier lieb war, und zeigte Gelüsten zu einem Regimente, welches höchstens der leibhaftigen Nidlebodenbäuerin zukam. Doch zügelte sie nach und nach ihren Eifer, als sie sah, dass im Nidleboden alles in gewohntem Gange blieb, und wenn auch die Bäbi nicht fortgejagt wurde, so gab sie ihr doch keine Ursache zur Bekümmernis. Der Alte ließ die Bäbi immerfort das Schwerste verrichten, hielt sie sehr knapp in den Kleidern, obgleich sie eigentlich auch Base und Patin war, gab ihr überhaupt keine Zeichen irgendeines besondern Wohlwollens, sondern jagte sie von früh bis spät ununterbrochen auf ihren armen Beinchen herum. Mit des Knechts Frau dagegen schloss die Base einen Bund. Diese ward ihre Vertraute. Und wenn sie dieselbe auch nicht zu ihrem Zerberus oder Höllenhund machen konnte, welcher außer unter gewissen Bedingungen niemand aus- und einließ, so machte sie dieselbe doch zu ihrem Wärter und Zöllner oder Berichterstatter, welcher melden sollte, wer aus und ein ging, überhaupt alles, was passierte im Nidleboden. Wie treu dieser Berichterstatter der Base war, wissen wir nicht, aber man hat Beispiele, dass solche Berichterstatter zwei Hände haben, dass beide nehmen und beide wohl wissen, was sie tun. Übrigens war dieser Posten wirklich ein wichtiger, es gab viel zu berichten, denn, wie oben gesagt worden, der Nidleboden war ein Wallfahrtsort, an welchem die Pilgrime zahlreich aus und ein gingen, manchmal auch fuhren.
So fuhr eines Tages eine Chaise vor das Haus, das war im Nidleboden ein Ereignis; Bernerwägeli sah man wohl öfters, aber Chaisen waren rare Vögel. Aus der Chaise stieg ein großer Mann oder Herr, wie man lieber will, denn man konnte ihn für das eine oder andere nehmen, je nachdem man ihn von dieser oder jener Seite ansah. Aus der Chaise nahm derselbe ein rundes Paket und frug dem Kirchmeier nach. Man lief nach demselben im Hause herum. Unterdessen ging der Herr ums Haus herum, und siehe da, der Vetter Kirchmeier war bereits zum Hintertürchen hinaus und beinelte im Geschwindschritt durch die Bäume, mit dem Wasserschäufelchen auf der Achsel.
»Der D… Schelm will entrinnen, wohl, dem will ich«, brummte der Herr, dann rief er: »Vetter, Vetter, wo aus so schnell!« Vetter Hans Joggeli, der nie die Schärfe eines Sinnes verbarg oder verleugnete (man könne sich mit so was versündigen, sagte er), kehrte alsbald sich um und sagte: »Ei der Tausend, Vetter Hansli, seid Ihr es, ein seltener Gast und so dick und so schön! Das trifft sich doch gut, fünf Minuten später, ich wäre fort gewesen, und das wäre viel zu übel gegangen.« Vetter Hansli, der nagelneue Vetter, war ein Prachtkerl, besonders für alle, welche ihn nicht näher kannten, sondern bloß reden hörten oder ihn von Weitem sahen. Er redete von allem, er handelte um alles, er erlaubte sich alles, er übertraf alles, kurz, er war eben ein Prachtkerl. »Vetter Kirchmeier«, sprach Hansli, »ich will Euch nicht aufhalten, es wäre mir leid, wenn ich Euch versäumte«, er möchte ihm nur guten Abend sagen und was abgeben. Auf einer Reise ins Oberland hätte man ihm irgendwo Käs aufgestellt, so zart und mild wie ein sechzehnjährig Mädchen. Da hätte er alsbald an den Vetter Kirchmeier gedacht, der wäre für ihn, und so ein Käschen ihm mitgebracht.
»Ihr seid doch immer der Bravste«, antwortete Vetter Hans Joggeli, »so an einen alten Vetter zu denken und noch dazu im Oberland, und wenn Euch der Käs an die milden, zarten Oberländerinnen erinnert. Kommt herein, drinnen ist’s kühler, besser lässt sich schwatzen dort.« Nach einigen Komplimenten, dass er nicht versäumen wollte, und nach scherzhaften Antworten, wie die Matten ihm nicht fortliefen, dieweil sie sehr alt seien und froh, sich stillzuhalten, brachte Vetter Hans Joggeli den Vetter Hansli in die Stube.
Als Hansli saß, sagte er: Ja, aber schuld wolle er doch wahrhaftig nicht sein, wenn er heute den Kehr habe und das Wasser nehmen könnte; jetzt sei das Wässern gut, und mit der Sache sei es nicht wie mit einer andern, welche man morgen oder übermorgen nachholen könne, wenn man sie heute versäume. »Habt deretwegen nicht Kummer«, antwortete der Alte, »was ich nicht mache, kann ein anderer machen. Witzig wäre es nicht für ein alt Männli, wie ich bin, wenn er allein da sein wollte für eine Hauptarbeit, über Nacht kann es mir ja fehlen, und dann, wenn niemand da wäre, der um die Sache wüsste, so ging es übel. Das Wässern lernt man nicht in einem Tage, und wenn man es schon auf einer Matte kann, so muss man es auf jeder neuen Matte neu studieren.« – »So, habt Ihr dann jemand, dem Ihr es anvertrauen dürft ?«, fragte Hansli halb erschrocken.
»Den Melker nehme ich mit, wenn er Zeit hat, und zeige ihm, wie die Sache gemacht sein müsse. Er ist nur ein jung Bürschchen, aber ein gutes, und hat Fleiß zur Sache. Ich bin sein Pate und soll auch noch der Vetter sein. Selb weiß ich aber nicht bestimmt, mein Kopf ist zu klein für die große Verwandtschaft, und manchmal hat es mich fast dünken wollen, es wüchsen alle Jahre neue Vettern und Basen aus dem Boden herauf wie der Naturklee in guten Äckern. Sei aber das, wie es wolle, so ist es allweg eine schöne Sache um eine so große Verwandtschaft«, setzte er blinzend hinzu.
Hansli ward krebsrot, als er von einem Melker hörte, welcher Pate und Vetter zugleich war, dem der Vetter noch obendrein das Wässern lehrte und es ihm anvertraute, es stellte ihm förmlich den Atem, und eine Weile ging es, bis sein Redwerk wieder lief.
Er wolle ihm nicht mit Kaffee aufwarten, sagte der Kirchmeier, er denke, er werde es haben wie er und mehr Liebhaber sein von einem Glase Guten. Am Morgen nehme er den Kaffee gern, aber am Abend wolle er lieber drei Gläser guten kühlen Wein als eine Tasse heißen Kaffee. Auch holte der Kirchmeier nicht bloß eine Flasche, sondern ein ganzes Maß, sodass Hansli das Herz im Leib hüpfte vor Freude und er sagte: »Potz, Vetter, Ihr habt es gut im Sinne mit mir oder meinet, mit wenigem könne ich es nicht machen!« Es sei ihm um ihn selber, er sei durstig, und wenn er trinke, so sei er gerne ruhig und laufe lieber nur einmal in den Keller statt zwei- und dreimal, sagte der Kirchmeier, schenkte fleißig ein, und je fleißiger dieses geschah, desto flüssiger ward Hanslis Rede. Das waren seine Glanzmomente, wenn er hinter einem Glase Guten schwadronieren konnte über alles Mögliche, dass die Schwarten krachten, und zu jemandem, der ihm nicht widerredete, dem er nicht so viel Verstand zutraute, ihm die Schuhriemen aufzulösen. Dann war die ganze Welt sein Gebiet, den Lappländern gab er so gut ihren Teil als den Engländern, Napoleon schien gegen ihn ein alt Weib, Metternich ein Schulbub, Peel ein veralteter Esel, und was das Geschäftemachen anbetraf, so waren die sämtlichen Gebrüder Rothschild im Vergleich zu ihm elende Grämpler und Lumpensammler, und wenn sie reicher seien als er, so komme es lediglich daher, dass sie bessere Zeiten gehabt als er. Das sei halt eine Sache, und wenn man alles könne, und wenn man noch so geschickt sei und noch so kuraschiert, eins könne man nicht, die Zeit machen könne man nicht.
Beifällig nickte dazu der alte Kirchmeier mit dem Haupte und sagte: »Ja, ja, das ist allweg eine Sache mit der Zeit, die kann kein Mensch machen; da habt Ihr ganz recht, Vetter, das ist eine ganz aparte Sache mit der Zeit.« Von Weltpolitik und Rothschildischem Handel glitt er wie ein Diplomat mit Anlagen unvermerkt weiter bis auf Kühe und Kuhhandel. Weitläuftig erzählte er dem Vetter, was das für ein Handel sei (»Ja, ja, das ist ein Handel!«, nickte der Alte), von den bösesten, er könne es einem sagen. Er sei nie sicher, dass er nicht betrogen werde, und doch werde ihn nicht mancher darin übertreffen, es würden ihm sonst nicht so viel Leute auftragen, für sie Kühe zu kaufen, wenn sie nicht wüssten, wie berühmt und glücklich er mit den Kühen sei.
In nächster Woche gehe er nach Erlenbach, so wie dort treffe man sie nirgends. Er habe schon zwar viele Aufträge, aber wenn er dem Vetter Kirchmeier etwas dienen könnte und derselbe es ihm anvertrauen wolle, so wolle er ihn versorgen, dass er selbst sagen müsse, so hätte ihn noch niemand versorget. Das glaube er, sagte Vetter Hans Joggeli und blinzete leise links.
Indessen, da er bereits für so viele sorgen müsse, so wolle er ihn nicht belästigen, auch glaube er, er könne es einstweilen machen im Stalle, ohne zu ändern.
»He«, sagte Hansli, »wann Vetter Kirchmeier was nötig hat, so geht dies allem andern vor.« Wenn er erlaube, so wollten sie miteinander ein wenig in den Stall. Es nehme ihn wunder, wie er versehen sei, vielleicht könne er ihm was raten. Er wisse wohl, dass der Vetter seinerzeit im Handel ein Tüchtiger gewesen sei, sodass weit umher ihm keiner gleichgekommen. Aber wer nicht auf allen Märkten herumkomme, kenne Kauf und Lauf nicht, und wenn man sich nicht alle Tage damit abgebe, komme man aus der Übung. »Eben«, sagte der Alte und führte den Vetter dem Stalle zu. Derselbe unterließ nicht, bei seinem Eintritt in denselben Glück in den Stall zu wünschen, ein alt, üblich Zeichen oder gleichsam eine Verwahrung, dass man in gutem Sinne ihn betrete, ihn nicht zu verhexen begehre.
Hierauf hielt derselbe über die zehn Kühe und übriges junges Vieh förmlich und staatsmäßig Heerschau, akkurat wie ein General über eine Division. Zuerst marschierte er (ein General galoppiert gewöhnlich, was aber in einem Stall nicht wohl tunlich ist) den Stall entlang, um einen allgemeinen Überblick zu gewinnen, dann schritt er zur Spezialrevue. Er trat zwischen die verschiedenen Häupter, d.h. zwischen die Kühe, denn man sagt in der Schweiz oft, »der Bauer hat 10 Häupter im Stalle«, d.h. 10 Kühe; kurios das und fast anzüglich. An diesen Häuptern und deren Leibe griff er herum, zog die Haut von den Rippen, fasste die Euter, fuhr in der Krippe herum, wischte allerlei daraus herauf, kurz, tat, wie Kenner zu tun pflegen. Das alles tat er stillschweigend, bis die Runde vollbracht war (zu Kühen kann man bekanntlich nicht reden wie zu Soldaten, begreiflich, dagegen zu Soldaten als wie zu Kühen, da liegt halt der Unterschied), und noch als er auf den erhöhten Gang herauftrat, schwieg er stille, nur schnaubte er schrecklich und machte Augen, dass man hätte glauben sollen, es seien Zwölfpfünder, welche eben im Begriffe seien, aus dem Loche zu fahren.
Der alte Kirchmeier hatte auch geschwiegen, aber ganz kaltblütig, ohne Schnauben und aparte Gebärden, und ebenso kaltblütig fragte er: »Und nun, Vetter Hansli, wie findet Ihr die Sache, nicht wahr, ich bin versorgt, oder was ratet Ihr?«
Vetter Hansli machte es wie ein diplomatischer General, vor den Kühen sagte er nichts, zuckte bloß einige Mal sehr bedenklich die Achsel, betrachtete draußen noch den Düngerhaufen, steckte die Nase ins Jaucheloch und folgte schweigend dem Kirchmeier in die Stube, welche ihm ziemlich solide Wände zu haben schien, hinter welchen ein Horcher nicht gute Geschäfte machen konnte. Drinnen schenkte, sobald man sich gesetzt, der Alte wieder ein, machte Gesundheit und frug nun neuerdings: »Nun, Vettermann, wie steht’s?« Dem guten Hansli ging es mit seiner Diplomatik fast wie einem Schauspieler, welcher eine Rolle spielen will, deren Urbild er nur vom Hörensagen kennt und daher übertreibt. Statt zu reden, schnaubte Hansli immer ärger, blies seine Augen wieder auf, dass sie wurden wie die gläsernen Kugeln, welche die Schuhmacher brauchen, sagte bloß, da sei ihm lieber, man frage ihn nicht. Zudem müsse er fort, er möchte heute noch weit. »Hä, Vetter«, sagte der Kirchmeier, »so ist es nicht gemeint. Ich sehe wohl, die Sache gefällt Euch nicht, und jetzt heraus mit der Sprache, nur so mit Zeichen und Gebärden ist mir nicht geholfen!« Er sage lieber nichts, je weniger man sage, desto weniger komme man in Verlegenheit; je besser man es meine, desto leichter mache man die Leute bös; und je böser man es antreffe, desto böser sei zu raten, antwortete Hansli.
Das geschehe oft, dawider habe er nichts, entgegnete der Alte, entweder wenn man unberufen raten wolle, oder wenn eitle, dumme Leute um Rat frügen, bloß um gerühmt zu sein. Aber jetzt sei er es, der frage, und für dumm werde der Vetter ihn doch nicht ansehen – oder?
»Nun, wenn Ihr es dann gehabt haben wollt«, brach Hansli hervor, dass es fast krachte wie ein längst geladener Schuss, und schlug zur Nachhülfe noch fast gar auf den Tisch, mäßigte sich jedoch, ehe die Faust fiel; »ich hätte nicht geglaubt, an einem solchen berühmten Orte einen solchen Stall anzutreffen, es ist ja fast kein Haupt darin, welches ich mit Freuden in meinem eigenen Stalle haben möchte. Vor allem aus müssen die beiden vordersten Kühe fort, bei diesen ist kein Aufgang mehr, sondern täglicher Abgang, jetzt löst Ihr noch was daraus. Die andern Kühe sehen bös aus, die Haut geht nicht von den Rippen, die Euter scheinen verwahrlost. Vollends bös steht es mit dem jungen Vieh, dieses hat Haare, dass man es frisieren könnte, und höchst wahrscheinlich doch Läuse darin. Begreiflich sind aber an ihrem bösen Aussehen und Zustande weder Kühe noch Kälber selbst schuld, sondern der Lausbub, welcher die Kühe zu besorgen, die Kälber zu erziehen hatte. Der treibt wahrscheinlich was anders und hat Höheres im Sinne, als zum Vieh zu sehen – der Hundejunge!
Er nimmt sich nicht Zeit zum Füttern, die Kühe sollen ein halb Klafter auf einmal fressen, in der Angst zertreten sie die Hälfte unter den Füßen, so wird das beste Futter zu Mist. Den Mist legt er nicht zurecht, die Tiere sind voll Kot, der ärgste Mist ist in der Krippe, die ganz voll ist, stinkt wie die Pest, und wie ungesund das ist, das wisst Ihr, Vetter. Düngerhaufen habt Ihr für so viel Vieh einen miserabeln, während die Jauche in den Stall läuft. Das sind die besten Zeichen, dass er zu faul ist, der Schlingel. O, man glaubt nicht, was so ein Kerl in einem Jahre in einem Stalle schaden kann! Hundert, zweihundert Taler machen es nicht wieder gut. Wenn er zu den Matten nicht besser sieht, so habt Ihr Gottes Gnade nötig.« Wenn der liebe Gott einstweilen nur seiner Seele gnädig sei, sagte der Kirchmeier, so sei er zufrieden. Indessen könne Vetter Hansli wohl recht haben, dass es im Stalle nicht sei, wie es sein sollte, er sei alt und habe ein kurz Gesicht, und wenn er es gut mit den Leuten meine, so meine er, sie sollten es auch gut mit ihm meinen, so sei es ehemals der Gebrauch gewesen.
»Keinem Menschen traut mehr, Vettermann, keinem Menschen, absonderlich all dem Lumpengesindel nicht, welchem Ihr Pate seid und obendarauf zu Vettern und Basen sich lügt, selbst von den rechten Verwandten traut nicht allen, es gibt Schelmen und Spitzbuben in den besten Familien. Aber doch dann auch solche, welche es gut meinen, auf welche man fußen kann, und die werdet Ihr wohl kennen, Vettermann, die sind gut zu kennen. Allweg sind es nicht die, welche Euch alle Tage mit dem Braten, mit dem Körbchen oder mit dem Säcklein vor dem Hause sind!« – »Ja, ja«, sagte Hans Joggeli, »gottlob gibt es noch immer einen großen Unterschied in der Welt. Aber recht habt Ihr, die Mehrheit ist böse, der ist auch hell nichts zu trauen, vor der muss man sich in Acht nehmen. Aber das kommt von der neuen Religion, wo jeder sein eigener Herrgott ist, und von der neuen Politik, wo keiner ein anderes Vaterland kennt als seinen Bauch oder seinen Geldsack, jeder säuft, so viel hinuntergeht, und, säuft er nicht, lügt, so viel hinaufmag. Doch nichts für ungut, Vetter, ich habe mich doch nicht etwa verfehlt; will’s Gott, seid Ihr nicht etwa einer von den Neuen?«
»Bewahre mich Gott davor, ich würde mich schämen, solange ich lebte«, sagte Hansli, doch mit ganz verdrückter Stimme, als ob ein Froschbein ihm im Halse steckte. »Ich will nicht sagen, dass ich nicht meine, manches könnte besser sein, aber wegen der Religion soll mir niemand was vorhalten, potz Himmelsackerment, und das Vaterland ist die Hauptsache und das Volk obendrauf, potz Hagel! Aber, um wieder auf die Kühe zu kommen, wenn ich Euch zwei oder drei schöne junge Rinder von Erlenbach bringen würde? Dort gibt es freilich auch alte Staatsrinder, aber an andern Orten tun sie nicht gut, man muss sie jung kaufen, wenn man was an ihnen verdienen will. Unterdessen könnt Ihr die zwei vordersten Kühe abstoßen, ich will Euch einen Berner Metzger zusenden, das sind die kommodsten, die sehen nicht auf den Kreuzer und daneben noch manch anderes nicht. Ich weiß nicht, wie es kömmt, aber die Städter sind gar verflucht dumm heutzutage.« – »Die Nidauer, Vetter, die Nidauer ausgenommen«, warf der Alte ein. Aber Hansli hatte Ohren wie viele, was ihm nicht gefiel, hörte er nicht. »Aber, beim Hagel«, fuhr er fort, »unter solche Hände junge Erlenbacher Rinder zu geben, wäre eine himmelschreiende Sache; der Knecht muss fort, wenn ich Euch was kaufen soll. Ich mag einkaufen, wie ich will, in vier Wochen ist das Vieh verdorben, man kennt es nicht mehr, dann muss ich schuld sein.« – »Ja, ja, Vetter, fortschicken kann man wohl einen«, antwortete Hans Joggeli, »aber wo gleich einen andern nehmen?« – »Ich weiß Euch einen«, sagte Hansli, »so ist keiner das Land auf und ab, den sende ich Euch die nächsten Tage.« – »Nur sachte, Vetter, nur sachte«, sagte der Kirchmeier, »beim ersten Anlass will ich mit Benz rechnen. Aber so mitten im Jahr mir nichts, dir nichts einen Knecht fortschicken tue ich nicht. Schelmen, Vetter, Schelmen, diese haben nichts zu fürchten, brave Leute aber scheuen der Leute Mäuler, müssen auch die Regierung fürchten, dass diese sie in Ungelegenheit bringe, Vetter!«
»Also zwei Rinder wollt Ihr, Vetter?«, sagte Hansli, ungehört lassend, was ihm nicht gefiel. »Ja«, sagte Hans Joggeli, »so ist es mir recht, und schöne möchte ich. Wenn ich Euch dreihundert Gulden mitgebe, so wird damit auszulesen sein?« – »Mehr als genug, für so viel Geld sollte es Staatsrinder geben. Geld, Vetter, ist nicht nötig, bis Ihr die Ware habt. Ich bin zwar nicht versehen damit, aber wohin ich komme, habe ich Kredit, an manchem Ort mehr als für hundert Kühe.« – »Darauf ist sich nicht zu verlassen«, antwortete der Vetter, »und oft, wenn man ihn am nötigsten hätte, so findet man die Leute nicht daheim, oder die Sache ist sonst nicht richtig.« – »Ja, wenn Ihr es wollt gehabt haben«, sagte Hansli rasch, »so ist es mir ganz recht; kommoder ist es in alle Wege, und wenn es Euch gleichgültig ist, so macht gleich 600 Gulden. Man weiß nie, welch guter Schick einen anläuft. Das nächste Mal, wenn ich komme, wollen wir abrechnen.« Der Alte stutzte, fasste sich aber und sagte: »Weil Ihr es seid, Vettermann, aber ich bin selbst fast auf dem Trocknen, jedermann glaubt, ich hätte kein Geld nötig, darum bezahlt mich niemand oder doch immer zuletzt. Also so bald als möglich, ich zähle darauf.«
»Darauf könnt Ihr Euch verlassen, wie auf Gottes Wort«, sagte Hansli und stellte sich auf, als sei er der Berg Sinai, von welchem herab Gott gedonnert und geblitzet hat. »Nit, nit«, entgegnete der Alte rasch, »mit Gott zählt sich kein Hansli zusammen, wenn er ein Christ ist. Das ist neuer Zeug, welchen ein Alter, welcher bald vor Gericht muss, nicht brauchen kann, für einen Jungen, der sein eigener Herrgott ist und die Hosentasche sein Vaterland, mag es angehen, nur höre ich es nicht gerne in meinem Hause, Vetter!« – »Ei, Vetter Kirchmeier«, sagte Hansli, »müsst mir die Worte nicht auflesen, bin ein frommer Christ, kein Neuer.« (Hier hustete er wieder, doch nicht so stark als das erste Mal.) »Aber, was ich habe fragen wollen, welche Farbe liebt Ihr, rot oder schwarz oder scheckicht? Vielen Leuten ist die Farbe die Hauptsache.« – »Nur nicht weiß, Vetter«, sagte der Kirchmeier. »Weiße Kühe sind immer schmutzig, fressen noch einmal so viel als die andern und sehen doch immer mager und elend aus, bei ihnen ist halt kein Segen. Sonst ist mir all eins, es kann halt nicht jede Kuh gleich gefärbt sei, dass sie gut sei, ist die Hauptsache, und das wäre eigentlich auch mit den Menschen meine Meinung.«
Hansli hatte abermals Ohren, welche nicht hörten. »Sapperment«, sagte er, seine Uhr betrachtend, »wie spät, muss pressieren, sollte um achte auf der Ochsenweide sein. Lebt wohl, Vetter Kirchmeier, verlasst Euch auf mich, versorgt sollt Ihr werden wie noch nie.« Er glaub’s, sagte der Alte und blinzelte leise links. Hansli polterte hinaus, gab dem Knechte, welcher ihm einspannte, einen halben Batzen Trinkgeld und fuhr, da die Diplomatik im Weine ertrunken war, denselben an: »Höre, Bürschchen, zum Vieh musst du besser sehen, wenn du dich für einen Melker ausgeben willst. Sapperment, wenn mir der meine das Vieh so verliederlichte, auf der Stelle jagte ich ihn fort, weißt, Bürschli, die Kühe kosten Geld, die kann man nicht auflesen wie die Steine auf dem Acker.« Somit fuhr er von dannen und hinterließ, wenn auch nicht einen Gestank, wie der Teufel es im Brauch haben soll, doch böse Eindrücke und namentlich bei dem aufgefahrnen Knechte.
Solche Eindrücke verarbeiten sich oft sehr langsam, namentlich im Bernbiet, und brechen so spät zutage, dass man mit großem Erstaunen die Sündeneier lebendig werden, auskriechen sieht und gar nicht begreifen kann, wie sie dahin gekommen, und wer sie gelegt hat.
Eines Morgens war der Kirchmeier, wie er es oft pflegte, beim Melken im Stalle. Als Benz die letzte Kuh gemolken, den Melkstuhl abgebunden und an seinen Ort gehängt hatte, sagte er: »Pate, möchte Euch was sagen, aber zürnt mir nicht.« – »Was hast?«, fragte dieser kurz. »Pate, ich will fort«, drückte Benz heraus. »Du fort«, schnauzte der Alte,