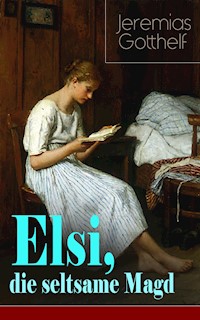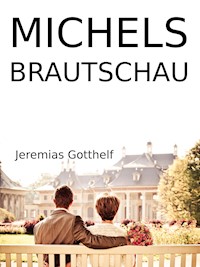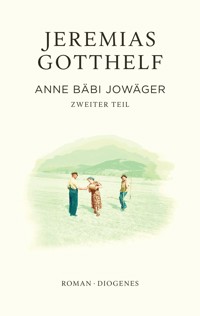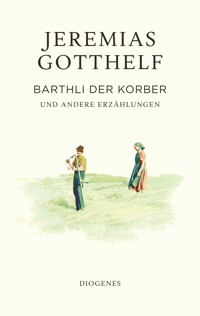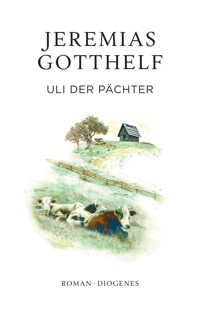27,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Gotthelf Zürcher Leseausgabe
- Sprache: Deutsch
Uli trinkt zu viel und prügelt sich mit anderen jungen Männern im Dorf. Er glaubt, als Knecht zu einem Leben in Armut verdammt zu sein. Sein Meister spricht ihm Mut zu, und bald wird aus Uli ein anderer Mann. Von den Frauen wird er umschwärmt, von den Männern zu Geschäften gedrängt. Bis Vreneli in sein Leben tritt. Aber erst muss er lernen, den eigenen Weg zu erkennen – und zu gehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 707
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Jeremias Gotthelf
Wie Uli, der Knecht, glücklich wird
Eine Gabe für Dienstboten und Meisterleute
Romanzürcher ausgabe
Herausgegeben von Philipp Theisohn Mit einem Nachwort von Monika Helfer
Diogenes
Wie Uli, der Knecht, glücklich wird
Es lag eine dunkle Nacht über der Erde; noch dunkler war der Ort, wo eine Stimme gedämpft zu wiederholten Malen »Johannes« rief: Es war ein kleines Stübchen in einem großen Baurenhause; aus dem großen Bette, welches fast den ganzen Hintergrund füllte, kam die Stimme. In demselben lag eine Bäurin samt ihrem Manne, und diesem rief die Frau: »Johannes«, bis er endlich anfing zu mugglen und zuletzt zu fragen: »Was willst, was gibt’s?« »Du wirst auf müssen und füttern. Es hat schon halb fünf geschlagen und der Uli ist erst nach den Zweien heimgekommen und noch die Steige herabgefallen, als er ins Gaden wollte. Es dünkte mich, du solltest erwachen, so hat er einen Lärm verführt. Er ist voll gewesen und wird jetzt nicht auf mögen, und es ist mir auch lieber, er gehe so gestürmt mit dem Licht nicht in den Stall.« »Es ist ein Elend heutzutag mit den Diensten«, sagte der Bauer, während er Licht machte und sich anzog, »man kann sie fast nicht bekommen, kann ihnen nicht Lohn genug geben, und zuletzt sollte man alles selbst machen und zu keiner Sache nichts sagen. Man ist nicht mehr Meister im Hause und kann nicht eben genug trappen, wenn man nicht Streit haben und verbrüllet sein will.« »Du kannst das aber nicht so gehen lassen«, sagte die Frau, »das kömmt zu oft wieder, erst in der letzten Woche hat er zweimal gehudelt, hat ja Lohn eingezogen, ehe es Fasnacht war. Es ist mir nicht nur wegen dir, sondern auch wegen Uli. Wenn man ihm nichts sagt, so meint er, er habe das Recht dazu, und tut immer wüster. Und dann müssen wir uns doch ein Gewissen daraus machen, Meisterleut sind Meisterleut, und man mag sagen, was man will, auf die neue Mode: was die Diensten neben der Arbeit machen, gehe niemand etwas an. Die Meisterleut sind doch Meister in ihrem Hause, und was sie in ihrem Hause dulden und was sie ihren Leuten nachlassen, dafür sind sie Gott und den Menschen verantwortlich. Dann ist mir noch wegen den Kindern. Du musst ihn ins Stübli nehmen, wenn sie z’Morge gegessen haben, und ihm ein Kapitel lesen.«
Es herrscht nämlich in vielen Bauernhäusern, und namentlich in solchen, die zum eigentlichen Bauernadel gehören, d.h. in solchen, wo der Besitztum lange in der Familie sich fortgeerbt hat, daher Familiensitte sich festgesetzt, Familienehre entstanden ist, die sehr schöne Sitte, durchaus keinen Zank, keinen heftigen Auftritt zu veranlassen, der irgend der Nachbaren Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnte. In stolzer Ruhe liegt das Haus mitten in den grünen Bäumen; in ruhigem, gemessenem Anstande bewegen sich um und in demselben dessen Bewohner, und über die Bäume schallt höchstens das Wiehern der Pferde, aber nicht die Stimme der Menschen. Es wird nicht viel und laut getadelt. Mann und Weib tun es gegeneinander nie, dass es andere hören; über Fehler von Dienstboten schweigen sie oft oder machen gleichsam im Vorbeigehen eine Bemerkung, lassen bloß ein Wort, eine Andeutung fallen, dass es die andern kaum merken. Wenn etwas Besonderes vorgefallen oder das Maß voll geworden ist, so rufen sie den Sünder ins Stübli, und zwar so unvermerkt als möglich, oder suchen ihn bei einsamer Arbeit auf und lesen ihm unter 4 Augen ein Kapitel, wie man zu sagen pflegt, und dazu hat der Meister gewöhnlich sich recht vorbereitet. Er liest dieses Kapitel in vollkommener Ruhe, recht väterlich, verhehlt dem Sünder nichts, auch das Herbste nicht, lässt ihm aber auch Gerechtigkeit widerfahren, stellt ihm die Folgen seines Tuns in Bezug auf sein zukünftig Schicksal vor. Und wenn der Meister fertig ist, so ist er zufrieden, und die Sache ist so weit abgetan, dass der Abkapitelte oder die andern im Betragen des Meisters durchaus nichts spüren, weder Bitterkeit noch Heftigkeit noch etwas anderes. Diese Kapitelten sind meist von guter Wirkung, wegen dem Väterlichen, das darin vorherrscht; wegen der Ruhe, mit welcher sie gehalten werden; wegen der Schonung vor andern. Von der Selbstbeherrschung und ruhigen Gemessenheit in solchen Häusern vermag man sich kaum eine Vorstellung zu machen.
Als der Meister im Stall fast fertig war, kam Uli auch nach, aber stillschweigend; sie sagten kein Wort zueinander. Als die Stimme aus der Küchetüre zum Essen rief, ging der Meister alsobald zum Brunnentrog und wusch die Hände; aber Uli drehte noch lange, ehe er kam. Er wäre vielleicht gar nicht gekommen, wenn die Meisterfrau nicht eigenmündig ihm noch einmal gerufen hätte.
Er schämte sich, sein Gesicht zu zeigen, das braun, blau und blutig war. Er wusste nicht, dass es besser ist, sich vor einer Sache zu schämen, ehe man sie tut, als hinterher über eine Sache, wenn sie getan ist: aber er sollte es erfahren.
Über Tisch fiel keine Bemerkung, keine Frage, welche ihn betroffen hätte, nicht einmal spöttische Gesichter durften die beiden Mägde machen, denn der Meister und die Meisterfrau machten ernsthafte. Als aber abgegessen war, die Mägde die Schüsseln hinaustrugen und Uli, der zuletzt fertig war, die Ellbogen ab dem Tisch hob und die Kappe wieder auf den Kopf setzte, also gebetet hatte und auch hinauswollte, sagte der Meister: »Kumm, los neuis«, ging ins Stübli und machte hinter ihnen zu. Der Meister setzte sich oben zum Tischli, Uli blieb an der Türe stehen und machte ein Schafsgesicht, das sich gleich leicht in ein trotziges oder ein reumütiges verwandeln ließ.
Uli war ein großer, schöner Bursche, noch nicht zwanzig Jahre alt, von kraftvollem Aussehen, aber mit etwas auf seinem Gesichte, das nicht auf große Unschuld und Mäßigkeit schließen ließ, das ihn im nächsten Jahre leicht zehn Jahre älter konnte aussehen lassen.
»Hör, Uli«, hob der Meister an, »so kann das nicht länger gehen, du tust mir zu wüst, dein Hudeln kömmt mir zu oft wieder, ich will meine Rosse und Kühe keinem anvertrauen, der den Kopf voll Brönz oder Wein hat, einen solchen darf ich nicht mit der Laterne in den Stall lassen und ganz besonders nicht, wenn er noch dazu tubacket wie du, es sind mir schon zu viele Häuser so verleichtsinnigt worden. Ich weiß gar nicht, was du auch sinnest und was du denkst, wo das hinaus soll.« Er hätte noch nichts verleichtsinniget, antwortete Uli, er hätte seine Arbeit immer noch gemacht, es hätte ihm sie niemand zu machen gebraucht und was er saufe, zahle ihm niemand; was er versaufe, gehe niemand an, er versaufe sein Geld. »Aber es ist mein Knecht«, antwortete der Meister, »der sein Geld versauft, und wenn du wüst tust, so geht es über mich aus und die Leute sagen, das sei aber des Bodenbauren Knecht und sie wüssten nicht, was der auch sinne, dass er ihn so machen lasse und dass er so einen haben möge. Du hast noch kein Haus verleichtsinniget, aber denk, Uli, wär es nicht an einem Mal zu viel, und hättest du noch eine ruhige Stunde, wenn du denken müsstest, du hättest mir mein Haus verleichtsinniget, und wenn wir und die Kinder noch darin bleiben müssten? Und was ist’s mit deiner Arbeit? Es wäre mir lieber, du lägest den ganzen Tag im Bett. Du schläfst ja unter den Kühen beim Melken ein, siehst, hörst, schmöckest nichts und stopfest ums Haus herum, wie wenn du sturm wärest an der Leber. Es ist ein Elend, dir zuzusehen. Da staunest du so grade aus, dass man wohl sieht, dass du an nichts als an deine Schleipfe sinnest, mit denen du des umme trollet bist.« Er sei mit keinen Schleipfe des ume trollet, sagte Uli. Solches nehme er nicht an. Und wenn er ihm nicht genug arbeiten könnte, so wolle er gehen. Aber so sei es heutzutage, man könne keinem Meister mehr genug arbeiten, wenn man schon immer mache; es sei einer wüster als der andere. Lohn wollten sie je länger, je weniger geben, und das Essen werde alle Tage schlechter. Am Ende werde man noch Erdflöh, Käfer und Heustöffel zusammenlesen müssen, wenn man Fleisch haben wolle und etwas Schmutziges ins Kraut. »Hör, Uli«, sagte der Meister, »so wollen wir nicht miteinander reden, du bist noch g’stürmt, ich hätte noch nichts zu dir sagen sollen. Aber du kannst mich dauren, du wärest sonst ein braver Bursch und könntest arbeiten. Ich habe eine Zeit lang geglaubt, es gebe etwas Rechtes aus dir, und habe mich gefreut. Aber seitdem du das Hudeln angefangen und das Nachtgeläuf, bist du ganz ein anderer geworden. Es ist dir an nichts mehr gelegen, hast einen bösen Kopf und wenn man dir, wie leicht, etwas sagt, so hängst du einem das böse Maul an oder tublest eine ganze Woche lang. Ja wohl gibst du dich mit Schleipfen ab, und zähle darauf, du wirst unglücklich. Du musst nicht glauben, ich wisse nicht, dass du zu Gnäggerlers Anne Lisi gehst, ihm alles anhängst. Und das ist ja das wüstest Meitli zentum, es geht bei ihm wie in einem Taubenhaus, es gibt sich mit jedem Halunk ab, und da bist du ihm gerade der Rechte, für dich anzugeben, wenn’s gefehlt hat, kannst Kindbett halten für andere, dein Leben lang der Gatter vor der Türe und dein Leben lang mitten in der teuren Zeit sein, wie so vieltausend andere, die es gerade machten wie du und jetzt im Elend sind und in der teuren Zeit. Denn für einen, der nichts vermag, der immer zu wenig hat, der entweder betteln oder Schulden machen oder hungern muss, währet ja die teure Zeit, wie wohlfeil es übrigens sein mag, von Jahr zu Jahr in alle Ewigkeit. Geh jetzt, besinne dich, und wenn du dich nicht ändern willst, so kannst du in Gottes Namen gehen, ich begehre dich nicht mehr. Gib mir in acht Tagen den Bescheid.«
Da hätte er sich bald ausb’sinnt und brauche nicht acht Tage dazu, brummte Uli im Herausgehen; aber der Meister tat, als hörte er es nicht.
Als der Meister auch hinauskam, fragte ihn die Meisterfrau, wie üblich: »Was hast du ihm gesagt, und was hat er wieder gesagt?« Er habe nichts mit ihm machen können, antwortete der Meister. Uli sei noch ganz aufbegehrisch gewesen, hätte den Rausch noch nicht verschlafen gehabt; es wäre besser gewesen, wenn man erst den folgenden Tag mit ihm geredet hätte oder am Abend, wenn der natürliche Katzenjammer ihn bereits mürbe gemacht hätte. Nun habe er ihm Zeit gegeben, sich zu besinnen, und wolle jetzt erwarten, was herauskomme.
Uli ging bitterbös hinaus, als ob ihm das größte Unrecht geschehen. Er schoss das Werkzeug herum, als ob alles drauf müsste an einem Tage, und die Tiere brüllte er an, dass es dem Meister in alle Glieder kam; allein er hielt ruhig an sich, sagte ein einziges Mal: Numme hübschli. Mit dem andern Gesinde verkehrte Uli nicht, machte ihm auch ein böses Gesicht. Da der Meister nicht vor den andern ihm abkapitelt hatte, so mochte er seine eigene Schande ihnen nicht auskramen; und weil er nicht mit ihnen gemeinsame Sache machte, so hielt er dafür, dass sie auf des Meisters Seite, seine Gegner seien, nach dem tief wahren Spruch: Wer nicht für mich ist, der ist wider mich. Es machte ihm also hier niemand den Kopf groß, und er hatte nicht Gelegenheit, sich zu verreden: dieser und jener solle ihn nehmen, wenn er eine Stunde länger hierbleibe, als bis seine Zeit aus sei.
Nach und nach wichen die Wein- und andern Geister aus ihm, und immer schlaffer wurden seine Glieder. Die frühere Spannung machte einer unerträglichen Mattigkeit Platz. Diese Mattigkeit blieb aber nicht nur im Leibe, sondern sie ging auch in die Seele über. Und wie dem matten Leib alles, was er tut, schwer und peinlich ist, so nimmt die matte Seele auch alles schwer, was sie getan hat und was ihr bevorsteht. Worüber sie früher gelacht, darüber möchte sie jetzt weinen, und was ihr früher Lust und Freude gemacht, das macht ihr jetzt Gram und Kummer, und in was sie früher mit beiden Beinen gesprungen, über das möchte sie sich die Haare vom Kopfe reißen, ja den ganzen Kopf ab dem Leibe. Wenn diese Stimmung über der Seele schwebt, so ist sie unwiderstehlich, und über alles, was dem Menschen in Gedanken kömmt und was ihm sonst vorkömmt, wirft sie ihren trüben Schein.
Während Uli, solang der Wein in ihm war, über den Meister sich geärgert hatte, kam ihm nun, als der Wein aus ihm war, der Ärger über sich selbsten. Er ärgerte sich nicht mehr über den Meister, der ihm das Hudeln vorgehalten, sondern über sich, dass er gehudelt. Es kamen ihm die 23 Batzen in Sinn, die er an einem Abend durchgebracht, an denen er nun fast vierzehn Tage arbeiten musste, ehe er sie wieder hatte. Er ärgerte sich über die Arbeit, die er deshalb tun musste, über den Wein, den er getrunken, den Wirt, der ihn gebracht usw. Er dachte an das, was ihm der Meister von Gnäggerlers Anne Lisi gesagt; es ergriff ihn immer mehr eine Angst, die ihm den Schweiß auf die Stirne trieb. Jetzt kam ihm manches an diesem Meitschi verdächtig vor; und musste er es wohl heiraten? Er musste ohne Unterlass daran sinnen, sich das Für und Wider denken, und wenn er es im Schweiße seines Angesichtes dahin gebracht hatte, sich zu überreden, dass alles nichts sei, keine Gefahr vorhanden; oder wenn er sich ein untrüglich Mittel ausgedacht hatte, wie er sich bei vorhandener Gefahr und wenn Anne Lisi ihn ansuche, herausleugnen wolle, und er sah auf tausend Schritte ein Weibervolk gegen das Haus kommen, so fielen alle seine Pläne und Tröstungen zusammen wie ein Haufen Stroh, in den das Feuer kömmt, die Beine schlotterten ihm vor Angst, und er floh in den Stall oder auf die Bühne. Er sah hinter jedem Fürtuch Anne Lisi, und wenn jemand an die Haustüre klopfte, so fuhr er zusammen wie Aspenlaub und meinte, Anne Lisi stehe draußen und wolle ihn herausrufen lassen. Und wie sollte er heiraten? Er hatte ja kein Geld, war Schneider und Krämer noch die letzte Bekleidung schuldig, hatte nur 3 gute Hemder und 4 böse. Und wer sollte ihm das Einzuggeld leihen, wer ihm die Hochzeitkleidung bezahlen, und wie sollte er Weib und Kind durchbringen und die Schulden bezahlen, da er sich jetzt alleine nicht helfen konnte? Ob diesen Gedanken verlor er allen Sinn, vergaß alles, machte alles verkehrt. Er war unbehaglich, unzufrieden mit sich selbsten, daher auch unzufrieden mit allen Menschen, der ganzen Welt; er gab niemand ein gutes Wort und nichts war ihm recht. Es dünkte ihn, die Meisterfrau koche express schlecht und alles, was er nicht gerne habe; der Meister plage ihn mit unnötiger Arbeit, die Pferde seien alle koldrig, und die Kühe täten ihm express alles zuleid, was sie könnten; seien die dümmsten Kühe, die auf Gottes Erdboden Gras fräßen.
Hätte er Geld gehabt oder nicht die Begegnung von Gnäggerlers Anne Lisi befürchtet, er wäre aus Trotz und Angst dem Wein nachgelaufen, um Groll, Gram, Missmut in ihm zu ertränken. Nun musste er zu Hause bleiben, zeigte sich so wenig als möglich vor den Leuten und fuhr alle Augenblicke in den Stall, wenn er ein Weibsbild von weitem sah. Wem es vielleicht auffallen mag, dass Uli solche Angst vor Anne Lisi hatte, dass seine Liebe zu demselben so schnell vergangen schien, dem muss ich bemerken, dass Uli gar keine Liebe hatte. Er gehörte unter die vielen, vielen Bursche, welche aus Großtuerei die leidige Sitte des Kiltganges treiben so früh möglich, welche dabei ohne Gewissensbisse, ich möchte fast sagen, ganz gedankenlos, alles treiben, was Lust und Gelegenheit ihnen darbieten; welche ohne Ahnung von Gefahr flattern um das Licht wie die Fliegen und auf eine, wenn man dieser Leute Gedankenlosigkeit nicht kennte, fast unglaubliche Art aufschrecken, wenn die notwendigen natürlichen Folgen eintreten, wenn ein Mädchen sie der Vaterschaft beklagt; aufschrecken wie Menschen, die man mit verbundenen Augen an einen Abgrund geführt, ihnen die Binde erst abnimmt, wenn man sie hineinstößt. Bei ihnen wird nie Liebe sichtbar, sobald ein Mädchen sie anklagt; sie fliehen die Mädchen, mit welchen sie früher so zärtlich getan, sie so oft zu Gast gehalten, nicht nur, sie hassen sie recht eigentlich. Und dies wollen die Mädchen trotz tausendfältiger Erfahrung nie begreifen, die Mädchen, welche mit ihrer lästerlichen Willfährigkeit, ja Zutäppigkeit sich Huld und Liebe zu erwerben und zu erhalten meinen.
Der Bauer und seine Frau ließen den Burschen machen; es war, als ob sie sich nicht um ihn kümmerten. Es war aber nicht so. Die Frau hatte ein paar Male zum Manne gesagt: Uli tue doch so wüst, sie hätte ihn noch nie so gesehen; ob er ihm wohl nicht zu scharf zugesprochen? Der Mann wollte das nicht glauben: Uli sei ja nicht über ihn allein böse, sondern über die ganze Welt, sagte er. Er glaube, er sei eigentlich am meisten böse über sich selbst und lasse es nun an andern aus. Am Sonntag wolle er mit ihm noch einmal reden, so könne es nicht mehr gehen, das müsse nun einmal halten oder brechen. Er solle es aber doch nicht zu grob machen, sagte die Frau. Daneben sei Uli nicht der Schlimmste, man wisse, was man an ihm habe, aber nie, was man bekomme.
Der Sonntag kam am Himmel herauf, hell, klar, wunderschön. Die dunkelgrünen Gräslein hatten mit demantenen Kränzlein ihre Stirnen geschmückt und funkelten und dufteten als süße Bräutlein in Gottes unermesslichem Tempel. Tausend Finken, tausend Amseln, tausend Lerchen sangen die Hochzeitlieder; weißbärtig, ernst und feierlich, aber mit den Rosen der Jugend auf den gefurchten Wangen, sahen die alten Berge als Zeugen auf die holden Bräutlein nieder, und als Priesterin Gottes erhob sich hoch über alle die goldene Sonne und spendete in funkelnden Strahlen ihren Hochzeitsegen. Der tausendstimmige Gesang und des Landes Herrlichkeit hatten den Bauer früh geweckt, und er wandelte andächtigen Gemütes dem Segen nach, den ihm Gott beschert hatte. Er durchging mit hochgehobenen Beinen und langen Schritten das mächtige Gras; stund am üppigen Kornacker still, an den wohlgeordneten Pflanzplätzen, dem sanft sich wiegenden Flachse; betrachtete die schwellenden Kirschen, die von kleiner Frucht starrenden Bäume mit Kernobst, band hier etwas auf und las dort etwas Schädliches ab und freute sich bei allem nicht nur des Preises, den es einsten gelten, nicht nur des Gewinnes, den er machen werde, sondern des Herren, dessen Güte die Erde voll, dessen Herrlichkeit und Weisheit neu sei jeden Morgen. Und er gedachte: Wie alles Kraut und jedes Tier jetzt den Schöpfer preise, so sollte es auch der Mensch tun, und mit dem Munde nicht nur, sondern mit seinem ganzen Wesen, wie der Baum in seiner Pracht, wie der Kornacker in seiner Fülle, so der Mensch in seinem Tun und Lassen. »Gott Lob und Dank!«, dachte er, »ich und mein Weib und meine Kinder, wir wollen dem Herren dienen, und er braucht sich unser nicht zu schämen. Wir sind wohl auch arme Sünder und haben nur einen geringen Anfang der Gottseligkeit, aber wir haben doch ein Herz zu ihm und vergessen ihn nie einen ganzen Tag lang und essen nichts, trinken nichts, dass wir ihm nicht danken, und nicht nur mit Worten, sondern von Herzensgrund.« Aber wenn er des Uli gedachte, und wie der liebe Gott ihn so fürstlich ausgestattet mit Gesundheit und Kraft, und wie Uli seines Schöpfers so ganz vergesse, so schnöde seine Gaben missbrauche, so wurde er ganz wehmütig und stund oft und lange still, sinnend, was er ihm wohl sagen solle, dass er wieder werde ein Preis seines Schöpfers. Es war ihm an seiner eigenen Seele viel gelegen, darum an den Seelen anderer auch; und wie er teilnahm, wenn ein Knecht oder eine Magd am Leibe krank war, so schmerzte es ihn auch, wenn er ihre Seelen in Gefahr sah; und wie er für kranke Diensten den Doktor kommen ließ, so suchte er auch ihre kranken Seelen zu doktern. So was ist nicht immer der Fall. Den meisten Menschen ist an den eigenen Seelen nichts gelegen, darum auch an den Seelen der andern nicht. Das ist ein Grundübel dieser Zeit.
So verweilete sich der Bauer unvermerkt, und die Mutter hatte schon lange gesagt, sie wollte zum Essen rufen, wenn der Ätti da wäre. Als er zur Küchetüre ein kam mit der freundlichen Frage: ob sie gekochet hätten?, und als ihm die freundliche Antwort wurde: man hätte schon lange essen können, wenn er da gewesen wäre; mit wem er sich wohl wieder verdampet hätte? Und als er ernsthaft sagte: »mit dem lieben Gott«, so kam seiner Frau fast das Augenwasser, und sie sah ihn gar sinnig an, während sie den Kaffee einschenkte und die Mägde die Knechte riefen und das Essen auf den Tisch stellten.
Aus tiefem Schweigen heraus frug der Bauer: »Wer geht z’Kilche?« Die Frau sagte, sie habe es im Sinne und deswegen schon züpfet, damit sie zu rechter Zeit hinkommen möge; und in ihre Stimme fielen mehrere Kinderstimmen: »Mutter, ich will mit!« Zwei Knechte aber und zwei Mägde blieben stumm. Auf die Frage: ob denn keines gehen wolle?, fehlte es dem einen an den Schuhen, dem andern an den Strümpfen. In keinem war der Trieb zu gehen; aber Ausreden dagegen in Menge. Da sagte der Bauer: So könne das nicht mehr gehen; das komme ihm doch streng vor, dass sie zu jedem Geläuf Zeit hätten, aber nie zum Kilchengehen. Am Morgen sei keins vom Hause wegzubringen, und am Nachmittag sei es, wie wenn man sie mit Kanonen davon wegschösse, und bis am späten Abend sei keins mehr zu sehen. Das sei ihm eine schlechte Sache, wenn man nur Sinn hätte für alles Narrenwerk, aber keinen für seine arme Seele. Und er wolle ihnen geradeheraus sagen, dass kein Meister einem Dienst trauen könne, der Gott aus dem Sinn geschlagen habe und Gott untreu geworden sei. Wenn ein Mensch Gott untreu sei, ob man dann erwarten könne, dass er Menschen treu sein werde? So wolle er es aber nicht, und heute hätten sie gar keinen Grund, daheimzubleiben, nur um ums Haus herumzustopfen. Zudem habe er Sachen zu verrichten. Er müsste 40 Pfund Salz haben, das könnten die beiden Mägde holen und einander ablösen. Hans Joggi (der andere Knecht) solle in die Mühle und fragen, wann man Spreuer haben könne; er wollte lieber nicht allemal auf Bern fahren, und der Müller gäbe seine eigenen Spreuer ihm selber und nicht andern Leuten. »Aber Vater«, sagte die Mutter, »wer kochet dann z’Mittag, wenn du alles fortjagst?« »He«, sagte der Vater, »z’Annebäbeli (sein zwölfjähriges Mädchen) kann dazu sehen, es muss sich auch gewöhnen, dass man ihm etwas überlässt, und hat noch Freude daran. Uli muss mit mir daheimbleiben; ich weiß nicht, was es mit dem Kleb geben kann, er fängt an einzufallen und hat vorhin so trätschet; ein Kalb ist manchmal ungesinnet da, und dann geht es bös, wenn niemand dabei ist.« Zu den Worten schaute er die Mutter gar ernsthaft an. Da fiel dieser ein, dass der Vater mit Uli allein sein wolle, um mit ihm zu reden, und dass er deswegen alles fortschicke, damit die g’wundrigen Jungfern nicht ihre spitzigen Ohren an Orten hätten, wo sie nicht sollten. Und sie musterte alsobald die beiden Mägde, die gar langsam herumdrehten und es sichtbar an den Tag legten, wie zuwider es ihnen sei, in die Kirche zu gehen und sich jetzt schon zu waschen und zu strählen, aus Furcht, nachmittags sehe man ihnen beides nur noch halb an, und die schön glatt und rot geriebene Haut sei wieder gelb und schlumpelig geworden. Und zweimal eigentliche Toilette zu machen, ist bei Baurenmägden doch noch nicht Brauch, gottlob! sie sehen höchstens im Spiegel nach, sooft es sich schickt, wie das Ding noch hält und ob das Trädeli vorn an der Stirne noch schön kruslet sei. Dem Knecht war es auch nicht recht: Er hätte noch nicht bartet, sagte er, und sein Messer haue nichts; er hätte gedacht, diesen Sonntag überzuspringen und es dann während der Woche schleifen zu lassen. Allein der Meister sagte: Er könne diesmal seine Rustig nehmen und hier in der Stube barten, er selbst könne es nachher machen. Diese Befehle waren unwiderruflich, aber ihnen zu folgen, ging hart. Die Mutter musste zehnmal mahnen. Bald wusste eine den Waschlumpen nicht, die andere hatte einen ihrer Sonntag-Strümpfe vernistet, und als sie den endlich fand zwischen dem Strohsack und der Bettstatt, sah sie zu ihrem Schrecken, dass sie ihren bessern Lumpen nicht hätte, und der war nirgends zu finden. Sie hätte fast Mut gehabt, dem Bauer zu trotzen und nicht zur Kirche zu gehen; allein die andere, mit der sie zufällig heute einig war, warnte sie und versprach ihr, den ihren ihr zu leihen, wenn etwa Not an Mann kommen sollte, da man in der Kirche nicht wohl weder in die Finger noch in das Fürtuch die Nase stecken dürfe.
Die Bäurin war schon lange fertig, hatte ihrem Johannes B’hüti Gott! gesagt und: »Machs nit z’ruch«; dem Annebäbeli anbefohlen, nicht zu viel Holz anzulegen, das Fleisch sei von einer jungen Kuh, und der Pfarrer mache zuweilen wohl lang, besonders wenn zu taufen sei; und stund mit zweien Kindern, von denen das eine, ein Bube, das Psalmenbuch trug, vor dem Hause, und immer waren die Mägde noch nicht da: der einen wollte sich das Mänteli nicht recht schicken, und die andere ribsete noch an einem Schuh, der halt nicht glänzender werden wollte, als es seine Art war. »Meieli«, sagte die Bäurin, »geh und sage ihnen, ich gehe voran, und sie sollten nachkommen und machen, dass sie in der Kirche seien, ehe es verläutet habe, und nicht so hintendrein in die Kirche schießen wie aus einer Büchse.« Und sie wandelte stattlich voraus, den hübschen Buben an der einen Hand, das hübsche Mädchen an der andern; in des Buben Kappe ein Pfingstnägeli, um dessen Hals ein rotseidenes Halstuch; das Mädchen unter einem schönen Schaubhütli ein schönes Meieli im Corset, während in der Mutter stattlichem Brustlatz ein schöner Rosmarinstengel sich wiegte und in ihrem Gesichte wohlerlaubte Mutterfreude. Eine Viertelstunde nachher schossen den gleichen Weg zwei Mädchen mit Gesichtern wie angelaufene Krebse. Plötzlich stand das größere still und fragte: »Hast du das Salzsäckli?« – »Nein«, sagte das andere, »ich habe gedacht, du hättest es.« – »Das verfluchte Salzsäckli!«, sagte das erste, »ich wollte, der Meister müsste es unküchelt fresse. Du musst gehn und es holen. Aber lauf, was du magst, sonst balget die Meisterfrau, wenn wir so hintendrein kommen.« Es ging hier auch wie allenthalben in der Welt, die Meisterjungfere hatte es vergessen, die untergebene Magd musste die Mühe haben, es zu holen, und das ist eben in der ganzen Welt so: Wenn der Obere etwas Dummes macht, so soll der Untergebene daran schuld sein oder es wiedergutmachen.
Unterdessen war der Meister mit Barten fertig geworden, hatte im Stall sich umgesehen, stund im Schopf, eine Pfeife stopfend und Sinns, auf das Bänkli vor dem Stalle sich zu setzen und hier dem Uli, der noch im Stall war, ans Herz zu greifen. Während er so da stund und stopfte und über das Kapitel sann, sah er ein Wägeli von der Straße ablenken, ein stattlich Ross davor mit schön beschlagenem Geschirr, Leute darauf, große und kleine. Bald erkannte er seine Schwester, die mit seinem Schwager kam und drei Kindern, eines noch an der Brust. Mit herzlichem Gottwillche trat er ihnen entgegen, konnte sich aber nicht enthalten zu denken, es sei doch z’Tütschels Sach, dass seine Frau heute hätte z’Kilche gehen müssen. Nachdem mit Mühe das Weib den schweren Weg vom hohen Wägeli auf den Boden gefunden, die Kinder ebenfalls, wurde gefragt: wo er seine Alte habe? Es sei alles z’Kilche, sagte er, aber sie sollten nur hineinkommen, sie werde bald wieder da sein. Er führte sie zum Hause; doch brachte es der Schwager nicht übers Herz, dem Uli, der das Ross abgenommen hatte, nicht in den Stall nachzugehen, zu sehen, wo er das Ross hinstelle, wie er es abschirre und anbinde, und zu hören, wie Uli es rühme. Das Letztere tat Uli auch. Es war ihm offenbar ein Stein vom Herzen gefallen, denn er hatte des Meisters Absicht wohl gemerket, und dass diese jetzt vereitelt war, machte ihn freundlicher, als er die ganze Woche gewesen. Drinnen hatte der Bauer seinem Meitschi befohlen, ein Kaffee zu machen. Er selbst ging in den Keller, nahm Nidle ab, hieb Käse ab und brachte alles nebst einem tüchtigen Laib Brot herauf und stellte es dem Mädchen zur Verfügung, das sich gar emsig rührte und für ein ganzes Königreich diese Gelegenheit, der Mutter und der Gotte zu zeigen, was es schon verrichten könne, nicht gegeben hätte. Bald war in der Tat die Sache z’weg, und die Gotte ermangelte nicht, das Annebäbeli zu rühmen, wie g’leitig es sei und wie guten Kaffee es gemacht habe. Einmal ihr Lisabethli wäre das nicht im Stande gewesen und sei doch 27 Wochen älter. »Trini«, sagte später der Bauer seiner Schwester, »d’Predig ist aber lange nicht aus und du tätest mir ein Gefallen, wenn du kücheln wolltest. Meine Alte wird froh sein, wenn sie heimkömmt und das g’macht ist. Es ist Anken im Keller, ich will ihn dir hinaufholen.« »Nein, Johannes, das tue ich nicht«, sagte Trini. »Das manglet sich gar nicht z’küchle, und dann küchle ich nicht in einer fremden Pfanne und mit fremdem Anken. Ich hätte es auch nicht gern, wenn mir jemand über meine Ankenkübel ginge.« »Du machst dich eigelicher als unsere Frau Pfarreri«, sagte Johannes. »Warum, was hat denn die gemacht?«, fragte Trini. »Z’Pfarrers sind letzthin hier gewesen, und da war meine Alte auch nicht daheim. Sie geht manchmal so lange nicht von Haus, aber allemal, wenn sie fort ist, dünkt mich, es komme jemand. Da habe ich z’Pfarrers gesagt, es sei mir gar leid, meine Alte sei nicht daheim, sonst hätte die ihnen eins küchlen müssen. Ich wisse wohl, Küchleni seien den Herrenleuten seltsam. O, sie wolle schon küchlen, sagte z’Pfarrers Frau, ich solle ihr nur Anken geben, das Mehl wolle sie schon finden. Und ist sie nicht gegangen und hat geküchelt, dass man es im ganzen Dorf g’schmöckt hat, und hat noch geglaubt, was sie verrichte. Wohl, da hat meine Alte etwas gesagt, als sie heimgekommen ist. So uverschant, meinte sie, sei sie doch nie gewesen, wenn sie schon nie im Welschland gewesen und Gumpernantlis gelernt habe.« Während Trini lachte, ging der Bauer hinaus und sagte Annebäbeli: Es müsse noch mehr Fleisch in den Hafen und ein stattliches Hammeli und dann solle es der Mutter alles z’weg machen zum Küchlen. Annebäbeli wäre im Zuge gewesen und hätte gerne selbst geküchelt, um zu zeigen, dass es das auch könne. Wer weiß, was Annebäbeli noch unterfangen hätte, wenn nicht glücklicherweise die Mutter dazwischengekommen wäre. Sie kam im Schweiß ihres Angesichts. Sie hatte von weitem das Wägeli vor dem Hause stehen sehen, und alsobald stund vor ihren Augen alles, was sie noch zu tun hatte, um am Mittagessen mit Ehren bestehen zu können. Das trieb zur Eile, und unterwegs dachte sie immer: Wenn sie nur daran gedacht haben, noch mehr Fleisch über zu tun; wenn ich jetzt schon wollte, so wird es nicht mehr lind; aber das kommt meinem Mann nicht in Sinn und Annebäbeli ist einmal noch z’jungs. Und ehe sie in die Stube kam, sah sie noch über die Häfen, und als sie das hinzugekommene Fleisch und die Hamme sah, war sie ganz verwundert und sagte: Das hätte sie nicht geglaubt, dass das eim z’Sinn käme. Als drinnen schön gegrüßt worden war, sagte Trini: »Was hättest du gesagt, Eisi, wenn ich es gemacht hätte wie eure Frau Pfarrerin und dir über die Ankenkübel geraten wäre? Der Johannes hat mich wollen dahinterreisen.« »Ja das wär mir ganz recht gewesen«, sagte Eisi, »wärest du nur dahintergegangen!« Aber im Herzen dachte Eisi doch, es sei besser, Trini habe das nicht gemacht; es hätte saure Augen gegeben und der Johannes sei hie und da noch immer so dumm, wie wo es ihn bekommen. Z’Mannevolk sei gar nicht zu erbrichten. Mit Schwitzen und Essen und Brummen über die Mägde, welche mit ihrem Salzsäcklein gar nicht heimkommen wollten, ging der Mittag vorüber; der Nachmittag wurde mit anderem zugebracht. Die Kinder handelten mit Küngelenen. Des Johannes Bube verkaufte dem andern eine aschgraue Mähre um 3 Batzen. Als derselbe ein schönes ledernes Säckeli hervorzog und die drei Batzen hervorblechen wollte mit fröhlichem Herzen (denn er hatte einen ganzen Batzen abgemärtet und glaubte einen sehr guten Kauf gemacht zu haben), sah es Eisi und fuhr dazwischen und wollte es absolut nicht tun, dass er die aschgraue Mähre bezahle: Sie hätten ja deren Küngeli mehr als genug, sie hätten des Jahres Junge, es wisse kein Mensch, wie oft, und er solle ihm nicht z’Hergetts sein und einen Kreuzer abnehmen, das hätte ja keine Gattig. Das Bübli, das aufrecht und ehrlich gehandelt hatte und von Küngeliverehren nichts wusste (denn es hatte den Vater auch nie Kühe und Pferde verehren sehen, sondern verkaufen), machte ein sehr verblüfftes Gesicht und das Weinen war ihm nahe. Trini nahm des Buben Partie, wollte es lange nicht tun und sagte: Gehandelt sei gehandelt und es wäre uverschant, wenn sein Bub das Küngeli umsonst nähmte. Als aber Eisi standhaft blieb (ging es doch nicht über seine Kasse aus), gab endlich Trini nach unter dem Beding, wenn sie ihm versprechen wollten, bald zu ihnen zu kommen; so könne ihr Bub die aschgraue Mähre nehmen, er müsse aber dann dem Johannesli einen hasengrauen Bock geben, ein Fotzelküngeli, sie hätten deren Böcke zwei, die plagten einander nur. Als das Johannesli hörte, vergaß er das Weinen, und der hasengraue Fotzelbock kam ihm so lange im Traum vor, bis er ihn wirklich in Händen hatte. Auf dem Wege aus dem Garten nach den Pflanzplätzen waren Trini und Eisi zufällig zu diesem Handel gekommen. Eisi machte diesen Spaziergang diesmal nicht ganz so freudig wie sonst. Die Erdflöhe waren hinter dem Flachs gewesen, und das Werch war etwas ungleich. Trini rühmte aber alles gar sehr, während Eisi es ausmachte. Trini dachte freilich bei sich, während es rühmte, zur Zeit, wo es daheim gewesen wäre, hätten sie viel schönere Sachen gehabt als jetzt, und Kabislöcher, wie es sie daheim habe, seien hier auch keine. Als es den Flachs sah, dachte es bei sich: Gottlob!, der ist noch viel schlechter als der meine! Indessen sagte es dieses nicht, sondern: Es sei gar schade, dass die Erdflöhe so viel g’schändet hätten; es wäre sonst der schönste Flachs, den es in diesem Jahre noch gesehen; der seine sei viel leider. Aber Eisi sagte, das würde kaum möglich sein. Gar schöne Rübli bewegten Trini etwas zum Neid und es rühmte dieselben besonders und sagte: Bei ihnen herum hätte es nie solche gesehen und wenn es von dieser Art Samen bekommen könnte, so wollte es dafür zahlen, so viel man wollte; aber es wüsste nirgends welchen zu bekommen. Eisi musste sagen, es wolle ihm schon geben, der nichts kosten solle. Trini sagte, es wolle gerne zahlen; aber Eisi sagte: Was es doch denke! Bei sich dachte es: Es werde es niemand merken, wenn es schon andern Samen dareinmische. Endlich ließ sich Trini bewegen, vom Bezahlen abzustehen; dagegen versprach es, es wolle, wenn sie zu ihnen kämen, Eisi Bohnen geben, wie es sicher auch noch nie gehabt. Die Kifel würden über einen halben Schuh lang, seien breit wie ein Daumen und doch so zart, dass sie einem im Maul ganz vergingen wie Zucker. Eisi dankte gar schön, dachte aber bei sich: Da werde wohl etwas abzumärten sein; es könnte nicht begreifen, wie Trini zu Bohnen käme, von denen es noch nichts gehört.
Unterdessen war Johannes mit dem Schwager im Stall gewesen und hatte ihm alle Herrlichkeit gezeigt. Es war mehr als ein Pferd herausgenommen worden, und Johannes hatte gesagt, er hätte so und so viel lösen können, aber er gebe es nicht, es müsse ihm wenigstens zwei Dublone mehr gelten. Dann war der Schwager ringsum gegangen, hatte es billig gerühmt, sich aber nicht enthalten können, so mit einigen Winken zu verstehen zu geben, dass er auch Augen im Kopfe habe. Etwas mehr Kuttlen würden ihm nichts schaden, sagte er; wenn das Zeichen etwas kleiner wäre, so würde es ihm wohl anstehen, und wenn es die Ohren etwas näher beieinanderhätte, so glaube er, er würde lösen, was er wollte. Von da waren sie zu den Kühen gekommen. Johannes erzählte, wie lange jede trage und wie viel Milch jede gebe und was die und jene ihn gekostet und wie b’sunderbar glücklich mit dieser und jener er gewesen. Unterdessen waren des Schwagers Blicke durch einen jungen schönen Schwarzkleb gefesselt worden. Von diesem zog er, wie im Vergess, die genaueste Erkundigung ein und frug endlich um den Preis desselben. Johannes sagte, der sei ihm eigentlich gar nicht feil, und wenn er ihm nicht so und so viel gelte, so gebe er ihn nicht fort. Der Schwager sagte, das sei viel zu viel. Es sei wohl ein braves Rind, aber er hätte noch viel brävere gesehen; es sei wohl schwer im Kopf und habe kein schönes viereckiges Uter, aber es kalbere ihm gar anständig. Es gingen ihm zur selben Zeit gerade zwei Kühe gust, und da müsse er etwas Frisches einstellen, das Milch gebe, sonst gäbte es Lärm im Hause. Sie märteten lange miteinander, märteten bis an einen Neuentaler Unterschied, aber da wollte keiner mehr nachgeben und der Handel zerschlug sich. Hingegen bestellte der Schwager das Kalb davon, wenn es ein Kuhkalb sein sollte, und Johannes versprach, das sollte er nicht zu teuer haben, sondern ungefähr so, wie es Kauf und Lauf sei.
So war der Nachmittag vergangen, und Trini suchte den Mann, um ihn an die Abreise zu mahnen. Man redete ein, wie früh es sei, und sie sollten noch in die Stube kommen. Als Eisi immer nötlicher pressierte, verstund man sich dazu. Drinnen stund wieder die stattliche Kaffeekanne, eine mächtige Ankenballe, Küchli, schön weißes Brot, Honigwaben, Kirschmus, Käse, Hamme und süßer Zieger. Trini schlug fast die Hände über dem Kopf zusammen und fragte: was Eisi doch auch sinne; sie hätten ja erst zu Mittag gegessen, es duechs, es möchte es noch mit dem Finger erlängen und könnte es machen bis morndrist z’Abe. Wenn sie zu ihnen kämten, so könnte es ihnen einmal nicht so aufwarten; es wüsste nicht, wo es dasselbe nehmen sollte. Aber Eisi sagte, es wolle ihns nur ausführen, denn das Aufwarten hätte es bei ihm gelernt; wenn man bei ihnen wäre, so käme man ja den ganzen Tag nicht vom Essen weg. Nachdem sich in der Tat noch hie und da ein Plätzchen für ein Küchli oder eine Ankenschnitte gefunden, nachdem die Kaffeekanne der Weinflasche Platz gemacht, auch dieser trotz vielem Weigern zugesprochen und noch Gesundheit gemacht worden war, bestieg man das schon lange bereitstehende Wägeli. Trini musste dreimal ansetzen und Johannes den Sitz auf der andern Seite halten, ehe es oben war; dann wurden die Kinder aufgepackt, aus deren Säcken noch Stücke Brot sahen, und endlich stieg der Schwager nach. Wohin der eigentlich sollte, begriff niemand, bis er mitten in die andern hineinplumpte. Es war fast, als ob ein Kindlifresser da hinaufgefahren; denn hinter seiner breiten Gestalt verschwanden die Kindlein, nur hie und da streckten sich Ärmchen hervor, die fast aussahen, als ob sie direkt aus seinem Bauche kämen. Es gab viel Wegräumens und später wurde zu Nacht gegessen, als sonst der Brauch war. Während demselben sagte Johannes: »Mutter, du musst uns die Laterne rüsten; Uli und ich müssen diese Nacht dem Kleb wachen, es gibt ein Kalb, ehe es Morgen ist.« Uli sagte, z’Michels Hans hätte ihm versprochen, diese Nacht wachen zu helfen, und wenn es bös gehen sollte, so sei es immer noch früh genug, den Meister zu wecken. Der Meister aber sagte, er solle dem Hans nur absagen; er hätte nicht gerne, wenn man fremde Knechte unnötigerweise und ungefragt brauche. Michel habe morgen Hans nötig, und man erfahre es alle Tage, was ein Knecht, der nicht geschlafen habe, wert sei. Uli meinte, so könnte ja sein Nebenknecht wachen helfen. Diesmal sei er lieber von Anfang an selbst dabei, sagte der Meister. Es sei das letzte Mal bös gegangen, er möchte diesmal davor sein. Uli musste den Meister haben.
Nachdem sie draußen im Stalle die Laterne aufgehängt hatten, den Pferden über Nacht gegeben, streute der Meister selbst dem Kleb noch, der unruhig hin und her trappete und in seiner Unruhe nicht liegen konnte; und sagte: Es gehe wohl noch eine Stunde oder zwei, sie wollten hinaus auf das Bänkli sitzen und noch ein Pfeifchen rauchen, der Kleb werde sich schon künden, wenn es Zeit sei.
Es war eine lauwarme Nacht, halb dem Frühling, halb dem Sommer angehörend. Wenige Sterne glitzerten im blauen Himmelsmeer, ein helles Jauchzen, ein fernes Fahren unterbrach zuweilen die stille Nacht.
»Hast du dich nun ausbesonnen, Uli?«, fragte der Meister, als sie auf dem Bänklein vor dem Stalle saßen. Es sei ihm noch so nebeneinander, sagte Uli, doch nicht in einem bösen Ton. Alles annehmen, das wolle er nicht, aber zuletzt sei es ihm graglych zu bleiben. Er hatte halt auch schon den allgemein angenommenen Grundsatz, dass man es nie zeigen dürfe, wenn einem an etwas gelegen sei, indem sonst der Gegner Vorteil daraus ziehe. Daher die merkwürdige Ruhe und Kaltblütigkeit, die Diplomaten an Bauren bewundern müssten. Es ist aber in seiner Ausdehnung und Anwendung ein heilloser Grundsatz, der unsäglich viel Böses stiftet, unzählige Menschen auseinanderbringt, sie gegenseitig als Feinde gegenüberstellt und wiederum Kaltblütigkeit da erzeuget, wo heiliger Eifer brennen sollte, und aus der Kaltblütigkeit eine Gleichgültigkeit macht, welche jedem Freund des Guten unwillkürlich Gänsehaut den ganzen Rücken aufschnadern lässt. Glücklicherweise war der Meister auch kaltblütig und nahm die Sache nicht so übel, sondern sagte: Ihm sei’s auch gerade so. Er hätte nichts wider Uli, aber so dabei sein wolle er auch nicht. Es nähmte ihn wunder, wer gefehlt hätte und ob er in seinem Hause nichts mehr sagen dürfe, wenn er nicht eine ganze Woche kein gutes Wort hören und ein Gesicht sehen wolle, mit dem man ganz Amerika vergiften könnte. Er könne nicht helfen, sagte Uli. Sauer sehn sei seine Freundlichkeit, und wenn er ein apartig Gesicht gemacht habe, so sei es nicht seinetwegen gewesen, er hätte apartig über ihn nicht zu klagen und über niemand sonst. Aber er sei halt auch ein armes Knechtlein und sollte nirgends sein und keine Freude haben; er sollte nur auf der Welt sein, um bös zu haben, und wenn er einmal sein Elend vergessen wolle und sich lustig machen, so käme alles auf ihn los und suche ihn untern zu drücken. Wer ihn ins Unglück sprengen könne, der tue es. Da könne man nicht immer süß dareinsehen.
Er sollte doch sehen, dass er ihn nicht begehre ins Unglück zu sprengen. Z’gunteräri, sagte der Meister. Wenn ihn jemand ins Unglück sprenge, so sei er es selbst. Wenn ein Bursche sich mit schlechten Mädchen abgebe, so sei er sein eigener Unglücksstifter und niemand anders. Er wisse wohl, es tröste sich jeder damit, es treffe nicht ihn, sondern einen andern; aber einen treffe es immer, und wenn einer auch 7 Mal entronnen sei, und ein anderer statt seiner im Lätsch geblieben, so gebe es ihn zum 8ten Male, er solle nur darauf zählen. Aber solang er noch nicht darin sei, lache er alle aus und sage allen wüst, die ihn davor warnen; und wenn er einmal darin sei, so sollen alle daran schuld sein, und er sage wiederum allen wüst, dass sie ihm nicht davor gewesen seien. »Aber gell, Uli«, sagte der Meister, »es ist dir diese Woche schon angst genug gewesen, es hätte dich im Lätsch. Ich habe wohl gesehen, wie du vor jedem Weibervolk geflohen bist und hinter allen Zäunen Anne Lisi gesehen hast. Und deine Angst hast du dann uns und unser Vieh entgelten lassen, nach Art so vieler Diensten, die allen Zorn und alles Ungerade, das ihnen über den Weg läuft, an den Meisterleuten oder an ihren Sachen, an Kühen oder Kacheln auslassen. Deine Angst war in dieser Woche dein Böshaben und an der war niemand schuld als du. Du hättest es ohne die Angst so gut haben können als wir selbst. Nein, Uli, du musst von deinem Lumpenleben lassen, du machst dich unglücklich, und solchen Ärger wie diese Woche will ich deinetwegen nicht mehr haben.«
Er hätte noch nichts Schlechts gemacht, sagte Uli. He, das nehme ihn doch wunder, sagte der Meister; ob voll sein etwas Bravs sei, und was er mit Anne Lisi getrieben habe, werde auch nicht das Sauberste gewesen sein und wohl auch im siebenten Gebot vernamset. O, es seien noch viel schlechtere Leute als er, sagte Uli, und es gebe viele Bauren, mit denen er sich dann noch lange nicht zusammenzählen lasse. Da habe er nichts darwider, antwortete der Meister, aber ein schlechter Mensch mache den andern nicht gut, und wenn schon mancher Bauer ein Trunkenbold sei oder gar ein Schelm, so sei es deswegen um nichts bräver, wenn Uli ein Hudel sei und noch anderes mehr. Es werde doch wohl erlaubt sein, eine Freude zu haben, sagte Uli, wer möchte dabei sein, wenn man keine Freude mehr haben dürfte? »Aber, Uli, was ist das für eine Freude, wenn man darauf eine ganze Woche nirgends sein darf, es einem nirgends wohl ist? Was ist das für eine Freude, die einem für das ganze Leben elend und unglücklich machen kann? Solche Freuden sind des Teufels Lockvögel. Ja, freilich kannst du dich freuen, es darf jeder Mensch Freude haben, aber an guten und erlaubten Dingen. Das ist eben ein Zeichen, ob ein Mensch gut oder schlecht ist, je nachdem er an guten oder schlechten Dingen seine Freude hat.« »Ja, du hast gut krähen«, sagte Uli, »du hast den schönsten Hof weit und breit, hast die Ställe voll schöner Ware, den Spycher voll Sachen, eine gute Frau, von den besten eine, schöne Kinder; du kannst dich wohl freuen, du hast Sachen, woran du Freude haben kannst; wenn ich sie hätte, es käme mir auch kein Sinn ans Hudeln, an Anne Lisi. Aber was habe ich? Ich bin ein armes Bürschli, habe keinen Menschen auf der Welt, der’s gut mit mir meint; der Vater ist gestorben, die Mutter auch und von den Schwestern sieht jedes für sich. Bös haben ist mein Teil in der Welt; werde ich krank, so will mich niemand haben, und sterbe ich, so tut man mich untern wie einen Hund, und kein Mensch pläret mir nach. O, dass man unsereinen nicht z’tod schlägt, wenn wir auf die Welt kommen!« Und damit fing der große, starke Uli an, gar bitterlich zu weinen. »Nit, nit, Uli«, sagte der Meister, »du bist gar nicht so bös daran, wenn du es nur glauben wolltest. Lass dein wüstes Leben sein, so kannst du noch ein Mann werden. Es hat mancher nicht mehr gehabt als du und hat jetzt Haus und Hof und Ställ voll War.« Ja, sagte Uli, solches geschehe nicht mehr und dann müsse man mehr Glück haben dazu, als er habe. »Das ist eine dumme Red«, sagte der Meister; »wie kann einer von Glück reden, wenn er alles fortwirft und vertut, was ihm in die Hände kömmt? Ich habe noch kein Geldstück gesehen, das nicht aus der Hand wollte, wenn man es fortgab. Aber das ist eben der Fehler, dass du den Glauben nicht hast, dass du noch ein Mann werden könntest. Du hast den Glauben, du seiest arm und bleibest arm und an dir sei nichts gelegen, und darum bleibst du auch arm. Hättest du einen andern Glauben, so würde es auch anders gehen. Denn es kommt noch immer alles auf den Glauben an.« »Aber um tusig Gottswillen, Meister«, sagte Uli, »wie sollte ich auch reich werden? Wie geringen Lohn habe ich! Wie viel Kleider brauche ich! Dazu habe ich noch Schulden! Was hilft da husen? Und sollt’ ich dann kein Freudeli haben?« »Aber d’r tusig Gottswillen, wo soll das mit dir hin, wenn du jetzt schon Schulden hast, bei gesundem Leib, und hast für niemand zu sorgen? So musst du einen Fötzel geben, und dann mag dich niemand mehr; du verdienst immer weniger und hättest doch immer mehr nötig. Nein, Uli, sinn doch ein wenig nach, so kann das nicht mehr gehen. Jetzt ist’s noch Zeit und ich sage es dir aufrichtig, es wäre schade um dich.« »Es trägt nichts ab; was hilft mir das, wenn ich schinde und mir nichts mehr gönne? Ich bringe es doch zu nichts; so ein arm Bürschli, wie ich bin, bleibt ein arm Bürschli«, sagte Uli.
»Sieh doch, was der Kleb macht«, sagte der Meister. Und als Uli mit dem Bescheid kam, er verdrehe sich noch, das Kalb komme noch nicht gleich, sagte der Meister: »Ich denke mein Lebtag daran, wie unser Pfarrer uns das Dienen ausgelegt hat in der Unterweisung und wie er die Sache so deutlich gemacht hat; man hat ihm müssen glauben, und es ist mancher glücklich geworden, der ihm geglaubt hat. Er hat gesagt: Alle Menschen empfingen von Gott zwei große Kapitale, die man zinsbar zu machen habe, nämlich Kräfte und Zeit. Durch gute Anwendung derselben müssten wir das zeitliche und ewige Leben gewinnen. Nun hätte mancher nichts, woran er seine Kräfte üben, seine Zeit nützlich und abträglich gebrauchen könnte; er verleihe daher seine Kräfte, seine Zeit jemandem, der zu viel Arbeit, aber zu wenig Zeit und Kräfte habe, um einen bestimmten Lohn; das heiße dienen. Nun sei das eine gar unglückliche Sache, dass die meisten Diensten dieses Dienen als ein Unglück betrachteten und ihre Meisterleute als ihre Feinde oder wenigstens als ihre Unterdrücker; dass sie es als einen Vorteil betrachteten, im Dienst so wenig als möglich zu machen, so viel Zeit als möglich verklappern, verlaufen, verschlafen zu können; dass sie untreu würden, denn sie entzögen auf diese Weise dem Meister das, was sie verliehen, verkauft hätten, die Zeit. Wie aber jede Untreue sich selbst strafe, so führe auch diese Untreue gar fürchterliche Folgen mit sich, denn so, wie man untreu sei gegen den Meister, sei man auch untreu an sich. Es gebe jede Ausübung unvermerkt eine Gewohnheit, welcher man nicht mehr loswerde. Wenn so ein Jungfräuli oder ein Knechtlein jahrelang so wenig als möglich getan, so langsam als möglich an einer Sache gemacht, allemal gebrummt hätte, wenn man ihm etwas zugemutet, entweder auf und davon gemacht hätte, unbekümmert, wie es komme, oder darob geklappert, dass ihm das Gras unter den Füßen gewachsen sei, zu nichts Sorge getragen, so viel als möglich g’schändet, nie Angst gehabt, sondern für alles gleichgültig gewesen sei, so gebe das erstlich eine Gewohnheit, und die könne es später nicht mehr ablegen. Zu allen Meistern bringe es diese Gewohnheit mit und wenn es am Ende für sich selbst sei, sich heirate, wer müsse diese Gewohnheiten, diese Trägheit, Schläfrigkeit, Schmäderfräßigkeit, Unzufriedenheit haben als es selbst? Es müsse sie tragen und alle ihre Folgen, Not und Jammer bis ins Grab, durch das Grab, bis vor Gottes Richterstuhl. Man solle doch nur sehen, wie viele tausend Menschen den Menschen zur Last seien und Gott zum Ärgernis und sich als widerwärtige Geschöpfe herumschleppten, den Denkenden als sichtbare Zeugnisse, wie die Untreue sich selbsten strafe. Aber so, wie man durch sein Tun sich inwendig eine Gewohnheit bereite, so mache man sich auswendig einen Namen. An diesem Namen, an dem Ruf, der Geltung unter den Menschen arbeite ein jeder von Kindsbeinen an bis zum Grabe, jede kleine Ausübung, ja jedes einzelne Wort trage zu diesem Namen bei. Dieser Name öffnet oder versperrt uns Herzen, macht uns wert oder unwert, gesucht oder verstoßen. Wie gering ein Mensch sein mag, so hat er doch einen Namen, auch ihn betrachten die Augen seiner Mitmenschen und urteilen, was er ihnen wert sei. So macht auch jedes Knechtlein und jedes Jungfräulein an seinem Namen unwillkürlich und nach diesem Namen kriegen sie Lohn, dieser Name bricht ihnen Bahn oder verschließt sie ihnen. Da kann eins lange reden und über frühere Meisterleute schimpfen, es macht damit seinen Namen nicht gut, sein Tun hat ihn längst gemacht. Ein solcher Name werde stundenweit bekannt, man könne nicht begreifen, wie. Es sei eine wunderbare Sache um diesen Namen, und doch beachteten ihn die Menschen viel zu wenig und namentlich die, welchen er das zweite Gut sei, mit dem sie, verbunden mit der inwendigen Gewohnheit, ein drittes, ein gutes Auskommen in der Welt, Vermögen, ein viertes, den Himmel und seine Schätze, erwerben wollten. Er frage nun: wie ein elender Tropf einer sei, wenn er schlechte Gewohnheit habe, einen schlechten Namen und um Himmel und Erde komme!«
»Daher soll«, sagte der Meister, habe der Pfarrer gesagt, »jeder, der in Dienst trete, den Dienst nicht betrachten als eine Sklavenzeit, den Meister als den Feind, sondern als eine Lehrzeit und den Meister als eine Wohltat Gottes: denn was sollten die Armen, d.h. die, welche nur Zeit und Kräfte, also doch eigentlich viel hätten, anfangen, wenn ihnen niemand Arbeit und Lohn gäbte? Sie sollten die Dienstzeit betrachten als eine Gelegenheit, sich an Arbeit und Emsigkeit zu gewöhnen und sich einen recht guten Namen zu machen unter den Menschen. In dem Maße, als sie dem Meister treu wären, wären sie es auch an ihnen, und wie der Meister an ihnen gewinne, gewönnen sie selbst auch. Sie sollten ja nie meinen, dass nur der Meister Nutzen zöge aus ihrem Fleiß; sie gewönnen wenigstens ebenso viel dabei. Wenn sie daher auch zu einem schlechten Meister kämen, sie sollten ja nie meinen, ihn zu strafen durch schlechte Aufführung; sie täten damit sich nur selbst ein Leid an und schadeten sich innerlich und äußerlich. Wenn nun so ein Dienstbote immer besser arbeite, immer treuer und geschickter sei, so sei das sein Eigentum und das könne niemand von ihm nehmen und dazu besäße er einen guten Namen, die Leute hätten ihn gerne, vertrauten ihm viel an und die Welt stehe ihm offen. Er möchte vornehmen, was er wollte, so fände er gute Leute, die ihm hülfen, weil sein guter Name der beste Bürge für ihn sei. Man solle doch nur achten, welche Dienstboten man rühme: die treuen oder die untreuen? Solle sich achten, welche unter ihnen zu Eigentum und Ansehen kämen. Dann hat der Pfarrer noch ein Drittes gesagt, und das geht dich besonders an. Er hat gesagt, der Mensch wolle Freude haben und müsse Freude haben, besonders in der Jugendzeit. Hasse nun ein Dienst seinen Dienst und sei ihm die Arbeit zuwider, so müsse er eine apartige Freude suchen und er fange daher an zu laufen, zu hudeln, mit schlechten Sachen sich abzugeben und habe daran seine Freude und sinne daran Tag und Nacht. Sei aber einem Knecht oder einer Magd das Licht aufgegangen, dass sie etwas werden möchten, und der Glaube gekommen, dass sie etwas werden könnten, so liebten sie die Arbeit, hätten Freude daran, etwas zu lernen, etwas recht zu machen; Freude, wenn ihnen etwas gelinge, wachse, was sie gesäet, fett werde, was sie gefüttert; sie sagten nie: Was frage ich dem nach, was geht mich das an? Ich habe so nichts davon. Ja, sie hätten eine eigentliche Lust daran, etwas Ungewohntes zu verrichten, etwas Schweres zu unternehmen; dadurch wüchsen ihre Kräfte am besten, dadurch machten sie sich den besten Namen. So haben sie auch Freude an des Meisters Sache, seinen Pferden, seinen Kühen, seinem Korn, seinem Gras, als ob es ihnen gehöre. ›Woran man Freude hat, daran sinnet man auch; wo man den Schatz hat, da hat man auch das Herz‹, sagte der Pfarrer. ›Hat nun der Knecht seinen Dienst im Kopf, erfüllt ihn der Trieb, so ein vor Gott und Menschen recht tüchtiger Mensch zu werden, so hat der Teufel wenig Macht über ihn, kann ihm nicht böse Sachen eingeben, wüste Sachen, an die er Tag und Nacht denkt, so dass er keinen Sinn für seine Arbeit hat, und die ihn noch von einem Laster zum andern ziehen und innerlich und äußerlich verderben.‹ Das hat der Pfarrer gesagt«, sagte der Meister; »es ist mir, als ob es noch heute wäre, als er uns das sagte, und ich habe schon hundertmal gesehen, dass er Recht hatte. Ich habe gedacht, ich wolle es dir sagen, es passet gerade auf dich. Und wenn du nur glauben wolltest, so könntest du einen von den brävsten Burschen abgeben und es einst haben, wie du nur wolltest.«
Des Ulis Antwort schnitt der Kleb ab, der seine Nöten deutlicher kündete. Es gab nun Arbeit, das Gespräch konnte nicht mehr fortgesetzt werden. Es ging alles gut und endlich war ein schönes, brandschwarzes Kälbchen da mit einem weißen Stern, wie beide noch nie eins gesehen, und das abzubrechen erkannt wurde. Uli war bei dem Geschäft noch einmal so tätig und aufmerksam gewesen als sonst, und das Kälbchen behandelte er ganz sanft, fast zärtlich, und betrachtete es mit einer eigentlichen Zuneigung.
Als sie fertig waren mit dem Kleb und derselbe seine Zwiebelnsuppe hatte, dämmerte der Morgen herauf und ließ keine Zeit zur Fortsetzung ihres Gesprächs.
Die anbrechenden Werktage nahmen sie mit ihren Arbeiten hart in Anspruch, auch war der Meister in Gemeindsgeschäften abwesend, so dass sie nicht miteinander weiters redeten. Aber es schien von beiden angenommen, dass Uli bleibe, und wenn der Meister heimkam, konnte die Frau nicht genug rühmen, wie Uli sich zu der Sache gehalten und wie sie nicht gebraucht hätte, ihn etwas zu heißen; es sei ihm alles von selbst in den Sinn gekommen, und wenn sie daran gedacht habe, so sei es schon gemacht gewesen. Das freute natürlich den Meister gar wohl und machte, dass er dem Uli immer bessere Worte gab, ihm immer mehr Zutrauen zeigte. Es ist nichts verdrießlicher für einen Meister, als wenn er abends müde oder schläfrig heimkommt und er findet alles im Ungreis und sein Weib voll Klagens; sieht nicht die halbe Arbeit getan, die hätte abgefertigt werden sollen; vieles verpfuscht und schlecht gemacht, dass es besser wäre, es wäre gar nichts getan worden, und muss über das aus die halbe Nacht sein Weib jammern hören, wie die Diensten sich gegen ihns unbehrdig eingestellt, unverschämten Bescheid gegeben und jedes gemacht habe, was ihm gefallen, und wie es ihr erleidet sei, so dabei zu sein, und wenn er ein andermal fortgehe, so laufe sie auch fort. Es ist grässlich für einen Mann, der fortmuss (und das muss der Mann), wenn ihm auf dem Heimwege, sobald er sein Haus von weitem sieht, die schweren Seufzer kommen: Was hat es wohl aber gegeben, was muss ich sehen, was muss ich hören?, und er so fast nicht zum Hause herzu darf; wenn er mit Liebe und Freude heimkommen möchte und mit Donner und Blitz einziehen muss in sein aufrührerisch gewordenes Reich.
Bei Uli war etwas Neues erwacht und in die Glieder gefahren, ohne dass er es selbst noch recht wusste. Er musste der Rede des Meisters je länger, je mehr nachsinnen, und es dünkte ihn immer mehr, der Meister hätte doch etwas recht. Es tat ihm wohl, zu denken, er sei nicht dazu erschaffen, ein arm, verachtet Bürschli zu bleiben, sondern er könnte noch ein Mann werden. Er sah ein, dass man dieses nicht mit Wüsttun werde und dass, je mehr man wüst tue, man um so mehr Boden verliere unter den Füßen. Es dünkte ihn gar seltsam, was der Meister gesagt von der Gewohnheit und dem guten Namen, die man neben dem Lohn sich erarbeiten könne, und so auch immer mehr für sich verdiene, je treuer man einem Meister sei, und wie man nicht besser für sich selber sehen könne, als wenn man recht treu zu des Meisters Sache luege.
Er konnte je länger, je weniger ableugnen, dass es also sei. Es kamen ihm immer mehr Beispiele in den Sinn von schlechten Diensten, die unglücklich geworden, arm geblieben, und hinwiederum wie er andere von ihren alten Meisterleuten habe rühmen hören, wie sie einen guten Knecht, eine gute Magd gehabt und die jetzt recht wohl z’weg und gut im Stande seien.
Nur eines konnte er nicht begreifen: wie er, Uli, je zu Geld, zu Vermögen kommen sollte; das dünkte ihn rein unmöglich. Er hatte 30 Kronen, also 75 Pfund, bar, zwei Hemden und ein Paar Schuhe zu Lohn. Nun hatte er noch fast vier Kronen Schulden, bereits viel eingezogen. Er hatte es bisher nicht machen können mit seinem Einkommen, nun sollte er Schulden zahlen, vorschlagen: das kam ihm unmöglich vor. Dem natürlichen Gang der Dinge nach war er darauf gefasst, seine Schuld jährlich größer zu machen. Von den 30 Kronen brauchte er doch wenigstens 10