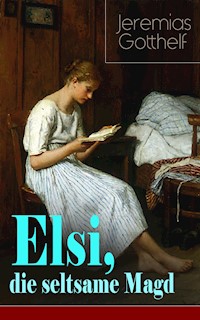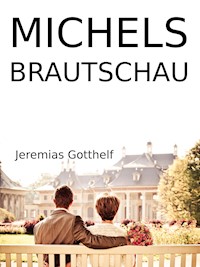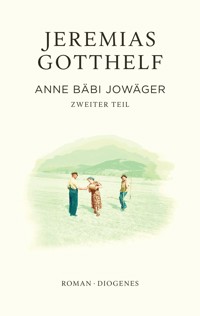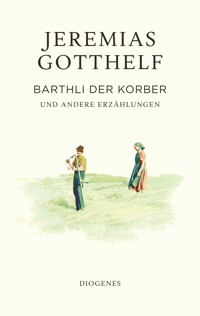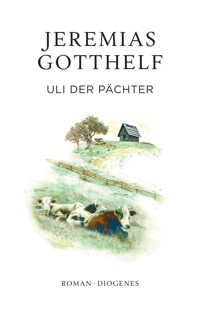27,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Gotthelf Zürcher Ausgabe
- Sprache: Deutsch
Mit dem ›Bauernspiegel‹ wurde aus dem Pfarrer Albert Bitzius der Schriftsteller Jeremias Gotthelf. Mit Zorn und Humor erzählt er in seinem ersten Roman das Leben eines »Verdingkindes«, dessen Weg aus der Knechtschaft es bis ins Paris der Julirevolution führt. Die Schonungslosigkeit, mit der Gotthelf der eigenen Welt – den Bauernfamilien, aber auch den Schulmeistern und Politikern – den Spiegel vorhält, sorgte schon zu Zeiten der Erstveröffentlichung für Aufruhr und hat bis heute nichts an Brisanz und Aktualität verloren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 663
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Jeremias Gotthelf
Der Bauernspiegel
oder Lebensgeschichte des Jeremias Gotthelf, von ihm selbst beschrieben
roman zürcher ausgabe
Herausgegeben von Philipp TheisohnMit einem Nachwort von Lukas Bärfuss.
Diogenes
Vorrede
Grüß Gott, liebe Leute, und zürnet nüt! Eine Gabe bringe ich euch dar, nehmt sie auf, wie sie gegeben ist, treuherzig. Ein Spiegel ist’s, doch nicht ein gemeiner, in dem ein jeder ein schönes Gesicht zu sehen glaubt, weil er das eigene erblickt. Mein Spiegel zeigt euch die Schatt- und nicht die Sonnseite eures Lebens, zeigt also, was man gewöhnlich nicht sieht, nicht sehen will. Er zeigt euch die-ses nicht zum Spott, sondern zur Weisheit. Man hat euch g’wundrig gemacht, und von Engländern und Russen, hohen und gemeinen Leuten in allen Ländern könnet ihr lesen, wie sie sind, was sie treiben. Von euch selbst aber könnt ihr nichts lesen als einzelne Scheltungen, einzelne Schmeichelreden; noch niemand hat in Liebe und Treue euch euer Bild vorgehalten und noch viel weniger ein Bild, das die trüben Schatten eures Lebens enthält. Das ist schlimm; denn kennt ihr diese Schatten nicht, so könnt ihr sie auch nicht verwischen und tilgen. Von Jugend auf habe ich unter dem Volk gelebt und es geliebt, darum entstund auch sein Bild treu und wahr in meinem Herzen; jetzt schien die Zeit es mir zur Pflicht zu machen, dieses Bild aus meinem Herzen zu nehmen und es vor eure Augen zu stellen, denn der Zeiten Ruf: weiser und besser zu werden, habt ihr vernommen, er dringt in alle Hütten. Diesmal zeige ich euch nur eine Seite des Bildes, das Ganze auf einmal würde euch verblenden, und zwar zeige ich euch die Schattseite zum Zeichen meiner aufrichtigen Treue und damit ihr ob dem Schönen, das ich von euch zu zeichnen wüsste, das Schlimme nicht vergesset, welches dennoch auch da ist.
In diesem Lebensbilde werdet ihr auch bemerken den Widerschein, den verschiedene andere Stände in euer Leben werfen, dasselbe auch trübend und verwirrend. Dieser Widerschein muss angemerkt sein, sonst würden Lücken im Bilde erscheinen, die niemand begreifen könnte. Dies ist die Erklärung, warum manches da ist, das nicht hieher zu gehören oder aus besonderer Absicht oder aus besonderer Bosheit da zu sein scheint. Male ich dann einmal die Sonnseite, so will ich auch freundliche Strahlen hineinziehen von jedem Stande, der mit dem Volksleben in Berührung kömmt.
Treuherzig bringe ich euch, liebe Bauersleute, meine Gabe, und treuherzig will ich bleiben, mag man mich auch misskennen und schmähen oder verspotten und auslachen. Sollte einer zarten Seele dieses Buch zur Hand kommen, so wird sie Gänsehaut bekommen ob seiner Derbheit; warte nur, liebe Seele, vielleicht komm’ ich auch einmal express für dich in zarter Zärtlichkeit; dieses ist aber auch nicht für dich geschrieben; darum lege es weg.
Mancher Schulmeister wird die Achseln zucken und meinen: Es sei Gott versucht, bei einer solchen Sprachunkunde, bei der er keinen zum Schulmeister machen würde, ein Buch zu schreiben. Primar- und Sekundarlehrer werden mich bemitleiden und bedauern, dass ich nicht bei ihnen in die Schule gegangen, es hätte vielleicht etwas aus mir werden können. Ihr habt recht, hochgeehrte und liebe Leute, wie und wo ich schreiben gelernt, werdet ihr lesen. Ich weiß nichts von den Aussagewörtern, nichts von den Dingwörtern, am allerwenigsten von dem Prädikat und seiner sonderbaren Ehe mit der Kopula. Aber deswegen bin ich ja auch weder Schulkommissär noch Schulmeister, sondern eben nur der ehrliche Jeremias Gotthelf, dem Gott geholfen, und der in wahren christlichen Treuen auch andern helfen möchte. Ich hätte meine Schrift einem Gelehrten geben können, sie zu polieren; aber ihre Hecheln sind oft so spitzig und scharf, dass meine Arbeit, die ich so lange in stiller Brust getragen sorgfaltiglich, mich dauerte, und mich tröstete der Gedanke: dass doch besser zu dem Herzen dringen werde, was aus dem Herzen als was aus den Hecheln kömmt.
So gehe denn in Gottesnamen, liebes Büchlein, aus dem Herzen zu den Herzen, und wo du ein bieder Herz findest, dem bringe einen biedern Gruß vom gutmeinenden schweizerblütigen
Jeremias Gotthelf
Kapitel 1Meine Kindheit
Ich bin geboren in der Gemeinde Unverstand, in einem Jahre, welches man nicht zählte nach Christus. Mein Vater war der älteste Sohn eines Bauern, der einen ziemlich großen Hof besaß, und hatte vier Brüder und drei Schwestern. Großvater und Großmutter waren von altem Schrot und Korn; beide viereckicht und rüstig früh und spät. Er war Meister in Feld und Stall. Das Erstere bebaute er mit großem Fleiße, aber nach alter Mode, nahm lieber ein Klafter Naturgras, dessen Same ihn nichts kostete, als drei Klafter Pflanzengras, zu dem er den Samen hätte kaufen müssen. Aus dem Stalle zog er die Zinsen der schuldigen Kapitale; er mästete alle Jahre etwas, aber dazu brauchte er lieber das Korn aus dem Speicher, als dass er mehr Erdäpfel gepflanzt hätte als sein Vater. Im Hause schaltete und rumorte die Großmutter, und alles musste sich da vor ihr ducken, auch der Großvater. Sie kochte alles selbst für die Menschen und die Schweine, besorgte den Garten und die Plätze so viel möglich allein und spann dabei Kuder fast zu Tode. Das Geld hatten sie im Genterli und die Großmutter immer so viel Recht dazu als der Großvater. Ich erinnere mich noch gar wohl, dass, als einmal der Großvater sehr munter von einem Märit heimkam, ich die Großmutter in der Nacht aufstehen, dem Großvater die Hosen erlesen und das Geld zählen sah und sie brummeln hörte: »Dä het afa g’hudlet; es hätt es stifs Säuli gäh, was er versoffe het, dem will ig morn d’s Kapitel lese.« Richtig waren sie am Morgen über eine Stunde lang im Stübli. Niemand wusste, was sie verhandelt hatten, aber der Großvater kam nie mehr so lustig heim. Beide konnten Gedrucktes lesen, und besonders der Großvater las oft laut aus dem Schatzkästlein und dem wahren Christentum; schreiben und Geschriebenes lesen konnten sie nicht, wie auch nicht rechnen; doch machte der Großvater wackere Bauernfünfe, und kein Anken-, kein Garnhändler, obgleich die letztern besonders durchtriebene Schälke sind, konnte die Großmutter um einen Vierer belügen. Daher hielten beide auf dem Lernen eben nicht viel, wenn eins ihrer Kinder nur notdürftig lesen und beten konnte, so glaubten sie es überflüssig geschickt. Nur der jüngste Sohn, der nicht gern arbeitete und doch der Augapfel war, konnte ein wenig schreiben und rechnen. Mein Vater schien von allen das vernachlässigtste Kind zu sein. Er konnte dem Großvater am frühesten in der Arbeit helfen und wurde nun von fast der ersten Jugend weg als Knecht gebraucht, wie ich ihn oft klagen hörte. Füttern, handeln, Pflug halten und säen tat der Großvater selbst, aber bei jeder wüsten und schweren Arbeit musste mein Vater an der Spitze sein, und was die andern Brüder nicht tun mochten, das kam an ihn, und wenn etwas misslang oder krumm gemacht wurde, so ging es über ihn aus. Als Beispiel erzählte er manchmal, wenn Steuerholz zu fällen gewesen sei, bei schlechtem Wetter oder an wüsten Orten, so hätte er der Erste und Letzte dabei sein müssen. An die Fuhrungen seien dann seine Brüder gefahren. Ich erinnere mich noch wohl, dass sie gewöhnlich bei ihrer Heimkunft nicht stehen konnten und lebendige Feuerspritzen vorstellten. Darüber schmälte der Großvater niemals; es ging nicht aus seinem Gelde, und er hielt es für Gewohnheit und Recht, dass bei solchen Gelegenheiten jeder so viel zu sich nehme, als er vermöge; ja, ich glaube, er hätte sie ausgelacht oder gar abgeputzt, wenn sie anders heimgekommen wären. Man kann sich bei solcher Erziehung und solchen Verhältnissen meinen Vater gar gut vorstellen. Er war ein guter Arbeiter, dem aber befohlen werden musste; er war roh, aber nicht ohne Gefühl; er sprach nicht viel, nur im Zorn, der aber selten ausbrach, konnte er nicht schweigen, sondern tobte fürchterlich. Ich glaube, er habe seine Hintansetzung gefühlt, sich aber damit getröstet, dass der Großvater für seine viele Arbeit ihm später ein Einsehen tun werde. Übrigens war er nicht gewohnt, viel zu denken, auch nicht an die Zukunft, er ließ die Dinge gehen, wie sie mochten, und nahm sie, wie sie kamen. So kam er auch zu einer Frau, sicher wie viele andere, ohne recht zu wissen, wie, und ganz bestimmt, ohne eigentlich eine Frau zu wollen. Meinen Großeltern soll die Heirat gar nicht recht gewesen sein; nicht dass sie den Vater nicht gern heiraten gesehen hätten; zu essen hatten sie vollauf, aber nie genug Hände zur Arbeit, nur die Person war ihnen nicht recht. Meine Mutter war eine Krämerstochter, sie soll hübsch, aber auch gefallsüchtig gewesen sein, in der Haushaltung und auf dem Felde nichts getan, sondern dem Laden abgewartet und auf dem grünen Bank vor demselben getan haben, als ob sie nähe oder lisme, was sie beides bös genug konnte. Niemand konnte begreifen, wie mein Vater und sie zusammenkamen; aber Wein und Tanz, Nacht und Lust wirken unbegreifliche Dinge. Meinen Großeltern hatte sie viel zu glattgestrählte Haare und tat viel zu zimpfer nach Art der Krämertöchter. Sie wollten sie nicht ins Haus, ein unehlich Großkind wollten sie aber auch nicht. Darum drangen sie auf die Heirat, zu welcher eigentlich weder Vater noch Mutter von Herzensgrund Lust hatten, wie sie sich oft genug vorhielten, wenn die Not sie gegenseitig offenherzig machte. Das Geld zu dieser Hochzeit gab der Krämer, meine Großeltern nahmen Schneider und Schuster auf die Stör, ließen die Hochzeitkleider dem Sohn machen, ob er aber auch Geld habe? Darum bekümmerten sie sich nicht, und Geld zu fordern ließ sich nicht leicht eins ihrer Kinder einfallen. Hie und da gab es ein Trinkgeld von einem Stück Vieh oder einer Fuhr, oder sie konnten sich zuweilen einen kleinen Vorteil machen; allein das ging natürlich schnell darauf. Meine Tanten sollen z.B., wenn sie auf einen Märit gingen, immer ein Stück Brot und einige dürre Birnen im Sack gehabt haben, damit, wenn sie niemand zu Gast hielt, sie nicht Hungers sterben müssten. Die aßen sie dann freilich nicht in der Tanzstube.
Diese Tanten (ich sage dieses hier, weil später nichts mehr von ihnen vorkömmt) wurden alle schlechte Hausmütter so gut als meines Vaters Frau, obgleich meine Großmutter nicht Rühmens genug machen konnte, wie sie dieselben werchen lasse. Ja, dreinschlagen und spinnen mussten sie tüchtig, auch fegen und putzen Haus und Stube; aber von der Haushaltung lernten sie nichts, die machte die Großmutter und begehrte auf, wenn sich eines ihrer Meitschenen in der Küche aufhalten wollte. Ob sie gewaschen seien, gab niemand acht, und wenn eine mehr als einmal in der Woche strählen wollte, so machte Großmutter die Faust und nahm die Züpfen selbst in die Hand. Es ging bei ihnen wie in einem Taubenhaus, denn die Großmutter war berühmt, und ihr Rühmen machte, dass man meinte, welche Wunderwerke sie aus ihren Töchtern erziehe. Alle drei erhielten Bauernsöhne, wurden aber die unverständigsten und unsäuberlichsten und bei allem Geiz die kostbarsten Hausfrauen, weil sie nichts zu Ehren ziehen konnten. Der Mann der Ältesten schlug von Haus, wurde ein Trunkenbold und fiel im Rausche tot. Der Mann der Zweiten starb vor Verdruss, als er einst den ganzen Fleischvorrat wegen Mangel Salzens und Räucherns von den Würmern zerfressen sah. Die Dritte starb glücklicherweise schon in der ersten Kindbette, weil sie in dummem Stolz, um zu zeigen, wie sie eine sei, gleich am zweiten Tage mit ihrem Volk Erdäpfelstock und saures Mus aß. Die meisten Leute konnten dieses nicht begreifen; ich habe es aber seither oft erlebt, dass die berühmtesten Weiber die Töchter am schlechtesten erziehen, eben darum, weil sie allein berühmt sein und nichts an die Töchter lassen wollen, diese bloß für Maschinen gebrauchen und sie nie zu der wichtigen Haushaltungskunst vernünftig anleiten.
Meine Mutter blieb also in ihrem elterlichen Hause, der Vater in dem seinigen; denn der Großvater hätte ihn ungern verloren, und meinem Vater kam es nicht in den Sinn, etwas für sich anzufangen. Freilich erhielt er noch immer keinen Lohn und musste von meiner Mutter später oft Vorwürfe hören, wie wenig er ihr und den Kindern gekramt und dass er in drei Jahren zwei einzige Male mit ihr im Wirtshause gewesen. Alles, was die Großeltern taten, war, dass sie ihrer Sohnsfrau in die Kindbette jedes Mal ein Ankenbälli sandten, worüber aber die Großmutter jedes Mal dem Ankenträger geklagt haben soll, wenn sie ihm nicht die gewohnte Portion abliefern konnte. Meine Mutter hatte bereits drei Kinder, als ihr Vater starb und die Herrlichkeit zu Ende ging. Ihr Vater war früher Schuhmacher oder Schneider gewesen, ich erinnere mich nicht mehr, welches, hatte sich ein hübsches Stück Geld erworben. Nun fuhr der Hoffartsteufel ihm in den Leib, er schämte sich, zu Fuß zu gehen, stellte ein Bernerwägeli, dann ein Sitzwägeli und endlich einen Charabanc an. Sein Häuschen war ihm zu schlecht, er baute ein großes, schönes Haus; Weib und Kind wurden auch angesteckt, schämten sich der Arbeit, wollten alles am schönsten haben. Die Frau tat es den Bäuerinnen zuvor und wollte die beste Frau in der ganzen Gemeinde sein, und das kostet auf dem Lande viel. Die Kinder suchten in Pracht und Großtun alle andern zu übertreffen. Jedes nahm Geld aus der Losung, so viel ihm beliebte, ordentliche Buchhaltung wurde keine geführt, kein Inventari gemacht. So minderte sich das bare Geld immer mehr, verlegene Waren waren ganze Haufen da, daher auch zunehmende Verlegenheit, wenn etwas bezahlt werden sollte. Nun nahm der Kredit ab, die Waren mussten teuer gekauft werden, und als endlich der Krämer, wahrscheinlich aus innerm Gram, der ihn in der letzten Zeit noch zum Trinken brachte, starb, war viel zu wenig da und nun Not und Elend, wo früher Übermut und Überfluss war.
Jetzt wäre der Zeitpunkt da gewesen, wo mein Vater noch etwas für sich mit Nutzen hätte anfangen und seine erschrockene und lind gewordene Frau zur Arbeit und zur Haushaltung gewöhnen können, aber er hätte darüber sinnen müssen, und dieses war ihm, als ob man ihm Feuer unter die Nase hielt. Er wusste daher nichts anzufangen, als Frau und Kinder zu sich zu nehmen, und dieses tat er auch erst am Tage, als sie ihr Haus räumen mussten. Es war ihm zuwider, die Großeltern um ein leeres Stübchen im Küherstöckli zu fragen, sie gönnten ihm auch das Wort nicht, und wer weiß, wie es gegangen wäre, wenn nicht mein Vater dem Großvater einen Trämel hätte müssen zur Sage führen helfen. Nach vollbrachtem Werk tranken sie unterwegs eine Halbe und dann noch eine, weil der aufgestellte Wein meinen Großvater gar gut dünkte. Der Wein tat ihnen die Herzen und auch die Mäuler auf. Sie hatten einander lange nie so liebgehabt; wer zuerst von dem Stübli zu reden anfing, weiß ich nicht, aber als sie nach Hause kamen, war die Sache abgemacht. Den folgenden Tag zog meine Mutter ein, und obgleich es im Säet war, hatte doch der Großvater ein Pferd erlaubt, um ihren Grümpel zu führen. Natürlich ward nicht eine doppelte Haushaltung geführt, dazu hatte der Vater kein Geld, meine Mutter und die Kinder mussten hinüber ins große Haus zum Essen. Wie es hierbei meiner Mutter zumute war, kann man sich leicht vorstellen und ebenso, welche Augen ihr von der ganzen übrigen Familie gemacht wurden. Als sie noch im Flor war, kam sie ein oder zwei Mal zu Großvaters im höchsten Staat. Meines Vaters Brüder und Schwestern sahen sie scheu und neidisch von der Seite an, sie war eben auch nicht am freundlichsten mit ihnen, und keins kam ins Hinterstübli, wohin die Großmutter den Kaffee getragen hatte, sooft man ihnen auch rief, und keins hätte je in ihrem Krämerladen etwas gekauft.
Man kann sich nun die Schadenfreude denken, mit welcher sie ihre Schwäger und Schwägerinnen ansahen, nachdem ihr Vater geldstaget hatte; sie hatten immer etwas zu zäpflen beim Essen und bei der Arbeit. Großvaters waren nach ihrer Art nicht böse mit ihr, allein sie konnten sich, und besonders die Großmutter, nicht enthalten, ihr alle Augenblicke zu sagen: Es wird di ungwans düeche; dann folgte gerne eine Nutzanwendung, dass man es nicht besser vermöge, wenn man bei Ehre und Gut bleiben wolle. Allerdings tat meiner Mutter Essen und Arbeit sehr ungewohnt. Es wollte sie fast zerreißen, dass sie in der Küche nicht mehr bröseln konnte, wann sie wollte, dass Erdäpfelsuppe und schlecht gekochtes Kraut am Morgen den Kaffee ersetzen sollte, dass manches Kaffee getrunken wurde, von dem sie nichts bekam. Sie brachte es nie dahin, Erdäpfel und Milch zusammen zu essen, ohne zu verschütten, besonders, seit sie merkte, dass man ihr aufpasse, um sie auszulachen. Im Stöckli schickte es sich nicht wohl, etwas besonders zu machen, man hätte es bemerkt, wenn sie gefeuert hätte. Doch die Not macht erfinderisch; im Winter wurde manches Kaffee beim Heizen gemacht, und die Milch, welche die Mutter für die Kinder erhielt, dazu gebraucht, und im Sommer soll sie, wie man ihr nachredet, um Mitternacht aufgestanden sein, um etwas für den Tag z’weg z’mache, in der Hoffnung, man merke um diese Zeit das Feuer nicht. An Geld fehlte es der Mutter lange nicht, sie hatte sich Sackgeld gemacht und später viel überflüssigen Flitterstaat verkauft. Bei der Arbeit auf dem Felde ging es ihr nicht besser, sie konnte dieselbe kaum aushalten, bei aller Mühe arbeitete sie immer weniger und schlechter als die andern; je mehr sie schwitzte, desto mehr sah sie die andern sich Blicke zuwerfen und spotten. Sie musste alle Tage hören: Das sei was angers, als vor em Lade hocke u g’fätterle. Meine Mutter war im Grunde nicht böse, und wenn man sie mit Liebe und Nachsicht behandelt hätte, so wäre sie verständig genug gewesen, sich nach und nach in ihre Lage zu schicken, und ganz sicher eine bessere Hausfrau geworden als ihre Schwägerinnen alle, denn sie war weit gescheuter als diese. Auf diese Weise wurde sie mutlos und bitter, sie bemühte sich nicht mehr, die Sachen besser zu machen, sondern ihre Zunge kam auch in Gang und wurde so scharf und schneidend, dass die Übrigen am Ende froh waren zu schweigen. Zu diesem allem sagte mein Vater wenig oder nichts, er wusste nie recht, mit wem er es eigentlich halten sollte. Am Tage schämte er sich seiner Frau bei der Arbeit, beim Essen ärgerte sie ihn, und er nahm sich vor, ihr nachts hinter dem Umhang abzukapiteln; aber dazu kam es nie, sondern die Frau fing an zu jammern und zu schimpfen über das Betragen ihrer Verwandten und wusste es in ein solches Licht zu stellen, dass der Vater sich fest vornahm, es nicht mehr zu dulden, sondern gleich am folgenden Tag mit Eltern, Brüdern und Schwestern tüchtig aufzubegehren, aber dazu kam es wieder nie. Sobald es Tag war, hielt er es im Herzen wieder mit seinen Verwandten, des Nachts dann wieder mit seiner Frau. Das ging so lange, bis sie sich trennten.
Nachdem meine Mutter ungefähr ein Jahr in dieser Lage gewesen war, wurde ich geboren. Nun wird sich mancher wundern, woher ich das alles wissen könne, was ich bis dahin erzählt, da ich doch nicht dabei gewesen bin? Nur Geduld, er wird es schon erfahren! Aber wundern wird man sich nicht, dass meine Mutter bei ihrer Gemütsbeschaffenheit in der Kindbette ernstlich krank wurde, sodass sie nicht im Stande war, weder mich zu säugen noch mir abzuwarten.
Die Großmutter hätte es nie zugelassen, eine Hebamme zu rufen, sie glaubte noch einmal so geschickt als eine solche zu sein. Sie stund auch meiner Mutter in der schweren Stunde getreulich bei und förderte mich glücklich ans Licht der Welt, welches ich mit ungewöhnlichem Klagegeschrei erblickt haben soll. Sie nahm mich, als sie die Schwäche meiner Mutter sah, sofort zu sich, machte dem Korbe, worin ich lag, Platz auf dem Ofentritt in ihrem Stübli und betrachtete mich nicht nur als ihr Kind, sondern erwies mir auch mehr Zärtlichkeit als früher ihren acht Kindern zusammengenommen. Während den ersten Tagen meines Lebens glaubte man, ich würde sterben. Die gute Großmutter wird mich wahrscheinlich schon von Anfang an mit lauter Nidle getränkt und diese mein Magen nicht vertragen haben. Solange ich im großelterlichen Hause war, hatte ich immer mein besonderes Näpfchen bei Tische, worein Großmutter aus den großen Kachlen, welche für die Übrigen hingestellt waren, das Bessere obenabgeblasen hatte. Meine Kränklichkeit erregte große Angst, ich möchte vor der Taufe sterben, dann wären die Eltern schuld, wenn mir durch diese Versäumnis die Seligkeit fehlen würde. Im ganzen Hause hingen alle fest an dem Vorurteil, ohne Taufe könne man nicht selig werden; dabei glaubten sie doch an einen gütigen Gott, an einen Vater im Himmel. Aber in unserm Hause war es halt auch so wie in hundert andern, man glaubte gar vieles, aber zweierlei tat man nicht; man untersuchte erstlich nicht, woher man das hätte, was man glaubte; ob es in der Bibel seinen Grund hätte, oder ob es käme, ohne dass man wusste, woher, wie die Schaben ins wollene Zeug. Daher kam es, dass man die Leidensgeschichte Jesu und seine Auferstehung gleich fest glaubte als irgendeine erlogene Teufelserscheinung oder eine Hexengeschichte und auch gleich als ungläubig verdammte, wer an der evangelischen Wahrheit und wer an den dummen Märlein zweifelte.
Zweitens stellte man dasjenige, was man von allen vier Winden her glaubte, nie zusammen, untersuchte nie, ob es auch zusammenpasse. So glaubte man an Gottes Allmacht und doch, dass ein altes Weib das Vieh verhexen und Kapuziner sogar Menschen töten mit bloßem Worte, gerade wie Gott die Welt, Adam und Eva erschaffen. Der Großvater konnte gar trostlich vor dem Schlafengehen das »Unser Vater« und »Vater vergib mir meine Schulden, wie ich meinen Schuldnern auch vergebe«, beten und handkehrum zu der Großmutter sagen: »Ig hoffe doch, dass Niggis Joggi einist e fürige Ma werdi, wenn e gerechte Gott im Himmel isch, dä Donners Schelm het mer hütt wieder e ganzi Furen abg’fahre, u der Marchstei lyt ganz blutt und krumm.« Dass ich getauft werde alsbald, darüber war man also einig, auch darüber, dass Großvater und Vater Göttene, Großmutter Gotte sein sollten; dem Vater war das Tschämele zuwider, er war nie ein großer Redner und bei solcher Gelegenheit vollends nicht. Die früheren Male soll er immer in seiner Herzensangst seinen Hut ganz verdrückt und verdreht haben; auch konnte man so die Kindbette ersparen, und das zürnte niemand als vielleicht meine Mutter, welche im Herzen schon lange auf die Züpfen der Gevattersleute gerechnet hatte. Über meinen Namen aber entstund gewaltiger Streit. Meine Mutter hätte gern einen hoffärtigen gehabt, und Fritz gefiel ihr gar wohl, vielleicht dass ein alter Schatz so geheißen. Meine Großeltern wollten von diesem nichts hören, der sei ihnen zu herrschelig; sie bestanden auf Christi, das sei ein Name, der im Leben und im Sterben etwas zu bedeuten habe. Allen zum Erstaunen hatte hier mein Vater eine eigene Meinung, er verwarf die beiden vorgeschlagenen Namen und beharrte auf Jeremias. Gründe für eine Sache konnte mein Vater nie angeben, also auch hier nicht, um so hartnäckiger blieb er bei seiner Meinung. Das habe ich in meinem Leben immer gelesen, dass Leute von der Bildung oder vielmehr Unbildung meines Vaters um so eigensinniger bei ihrem Willen beharren, je weniger sie dafür zu sagen wissen. Entweder hatten ihn meine Klagelieder, die ich bei meinem Eintritt in die Welt sang oder brüllte, oder eine unerklärliche Ahnung meiner traurigen Schicksale zu diesem Namen bestimmt. Zuerst gab ihm meine Mutter nach, weil Jeremias doch vornehmer klang als Christen und nicht jeder Bettelbub so hieß; dann auch die Großeltern, weil Jeremias ein biblischer Prophetenname sei und sie keinen Jeremias kannten, der bei Spiel und Tanz der Erste war, wie es wohl irgendein Fritz sein mochte, den sie gekannt.
Es soll furchtbar gewittert, die Großmutter die Schuhe mehr als einmal verloren und ihren Hochzeitskittel übel zugerichtet haben, als man mich zur Taufe trug. Doch schlug es mir nicht übel, sondern gut zu, wogegen sicher manches Kind an dem zu frühen unvernünftigen Taufgang sterben mag. Meine Krankheit verlor sich, wahrscheinlich hatten die raschen Bewegungen der Großmutter, die mich absolut tragen wollte und doch immer mit ihren Schuhen zu tun hatte, meinem Magen die Nidle verdauen helfen, oder er war derselben mehr gewohnt geworden; kurz, ich wurde gesund. Dass aber dieses Gesundwerden nicht natürlichen Ursachen, sondern der wunderbaren Kraft der Taufe zugeschrieben, die Vorurteile vermehrt und verstärkt wurden, kann man sich leicht denken. Die Taufe eines Enkels, welcher der Großvater zum ersten Male beiwohnte, stimmte ihn weich, und gutmütiger als vernünftig kramte er der Mutter allerlei. Dieses schmeckte ihr natürlich besser als das Doktorzeug und beförderte ihre Genesung nicht. Es ist merkwürdig, dass die Menschen nie am rechten Ort und in der rechten Zeit entweder vernünftig oder gutmütig sein können.
Ich war also ein sehr wertes Kind und wurde natürlich ein sehr fettes, denn darin zeigt sich bei gar vielen Leuten, die nicht gelernt, wann sie gutmütig, wann sie vernünftig sein sollen, die Liebe, dass sie den Kindern so viele und so gute Speisen einschoppen, als zum Mund hinein mag; an die Folgen denken sie nicht. Es war früher der Großmutter Stolz gewesen, im Sommer ihre Pflanz- und Flachsplätze, im Winter ihre Schweine und ihren Kuder an der Stange zeigen zu können und rühmen zu hören; jetzt musste ich gezeigt und gerühmt sein Sommer und Winter. Wer etwas von ihr wollte, der musste mir nur recht flattieren, dann konnte er der Gewährung seiner Bitte sicher sein. Sie ferggete mich überall mit sich herum, in der Küche, in dem Garten, und wenn sie spann, so trieb der eine Fuß das Rad, der andere die Wiege. Der Großvater hatte mich fast ebenso lieb, obgleich ihm anfangs das Geschrei des Nachts zuwider gewesen war. Als ich mich nach und nach entwickelte und das innere Leben durch Zeichen und Töne kundgeben konnte, da soll der Großvater nie vom Felde oder einem Gange heimgekommen sein, ohne zuerst nach mir zu sehen. Großmutter behauptete steif und fest, es gebe nicht nur kein so schweres, sondern auch kein so witziges und frommes Kind als ihren Miaßli auf der ganzen Welt; derselbe könne schon beten, behauptete sie, als ich kaum ein halb Jahr alt war, weil ich zuweilen zufällig die Händchen zusammenlegte.
Man sollte diesem nach glauben, ich sei den andern Hausgenossen umso unwerter geworden, je werter mich die Großeltern hielten, denn man sieht sonst meist, dass, wenn Menschen oder Tiere von den einen mit besonderer Liebe behandelt werden, die andern sie hassen und insgeheim verfolgen. Es ist auch natürlich, indem die meisten Menschen nur ein bestimmtes Maß von Liebe haben. Erhalten die einen zu viel davon, so zieht es den andern zu wenig. Auch müssen gar oft unter der Meisterlosigkeit eines Hausgenossen, eines Kindes oder einer Katze alle leiden und Verdruss ausstehen; das macht nicht gutes Blut, und die Meisterlosigen müssen es entgelten, wenn sie sich schon dessen nicht vermögen; denn an ihrer Meisterlosigkeit sind andere schuld. Überhaupt sind die Menschen zum Neid geneigt, und wenn es einem gutgeht, so hassen ihn viele schon deswegen, auch wenn er ihnen nie in den Weg gekommen. Schlug ja doch Kain den Abel aus Neid tot, obgleich Abel nichts dafürkonnte, dass des Kains Opfer Gott nicht angenehm war. So ging es mir aber nicht, denn ich war nicht nur allen lieb, sondern ich war zum Teil Ursache, dass sich die einen auch mehr liebten, und oft den andern ein Ableiter großelterlicher Scheltungen. Ich war gar ein freundliches Kind, auch neugierig, fragte viel und hieß daher gar kurzweilig. Meines Vaters Brüder waren sonst die unfreundlichsten Menschen und gaben um einen Kreuzer, so nötig sie ihn hatten, kein gutes Wort, mir aber konnten sie nicht widerstehen. Es kam ihnen nicht in den Sinn, den Großeltern zulieb mir zu flattieren; dazu waren sie zu holzböckisch; waren überhaupt nicht gewohnt, jemand Liebe zu zeigen oder etwas zulieb zu tun. Man war in unserm Hause nicht gewohnt zu zanken, aber gute Worte gab man sich eben auch nicht. Die Großeltern hatten die Kinder wohl lieb, aber beide ein raues Äußere, und daher wurden sie streng gehalten im Allgemeinen.
So waren die Kinder sauertöpfig geworden, und wenn man aus sauern Gesichtern Essig ziehen könnte, so hätten wir nie zu kaufen gebraucht. Mir aber lachten sie von Weitem entgegen, jeder wollte mich haben, und welchen ich beim Bein nahm, der hub mich auf den Arm und trug mich in den Stall zu den Pferden und Kühen. Die Großmutter wunderte sich oft darüber, dass sie mit mir so freundlich seien, sie wusste nicht, dass eigentlich jeder Mensch Liebe in der Brust hat, auch wenn sie hart wie Felsen scheint; dass in der Tat viele Menschen die Liebe nicht zeigen können, gewöhnlich, weil sie in der Jugend zurückgedrängt worden. Niemand aber wird Liebe nach außen ziehen und sie hervorlocken können wie ein unschuldig Kind.
Meine Tanten durften sich zuweilen mit mir versäumen, dafür erhielt ich von ihnen als Kram immer alle Birnenschnitze, die ihnen an den Märiten übrigblieben. Am glücklichsten wurden durch mich meine Geschwister, zwei Mädchen und ein Knabe. Bis dahin hätten sie nirgends sein sollen, sie waren allenthalben im Wege, am Tisch, im Haus und ums Haus. Alles fuhr über die Bursche aus: War etwas zerbrochen, sie hatten es getan; verloren, sie hatten es verschleipft; zertreten, sie hatten da gegürtet. Jedes klagte, sie seien einem immer unter den Füßen und doch nichts zu brauchen, und wie viel Haarrüpfe, Stöße, Ohreten es da absetzte, kann niemand zählen. Natürlich wurden sie auf diese Weise nicht die Besten, und weil sie doch alles getan haben sollten, so taten sie, was sie konnten; und weil sie niemand liebte, so liebten sie wieder niemanden. Mein Vater nahm sie so wenig in Schutz, als er meine Mutter beschirmte. Er hatte es ungern, wenn es um ihretwillen Verdruss gab, und hielt daher immer die Kinder im Fehler; zwar prügelte und schimpfte er sie selten aus, aber gute Worte gab er ihnen noch weniger. Meine Mutter nahm sich ihrer oft an, allein nicht aus eigentlicher Teilnahme und Mitleiden, sondern aus Widerspruchsgeist und weil sie nicht dulden wollte, dass man ihnen befehle, weil es ihre Kinder seien. Sie war ihnen daneben aber nichts weniger als eine zärtliche Mutter, dazu war ihre Selbstsucht zu groß; sie machten ihr zu wenig und gaben ihr zu viel zu tun, und wenn sie zu keiner Arbeit zur rechten Zeit kam, so sollten immer die Kinder schuld sein. Es gibt gar viele Leute dieser Art, die ihre Obliegenheiten nicht erfüllen mögen und die Ursache davon nie bei sich selbst, sondern bei andern suchen und es diese entgelten lassen. Dabei waren sie immer schlecht gekleidet. Die Großeltern nahmen zweimal im Jahr Schneider und Schuhmacher und im Herbst eine Lismerin auf die Stör, so erhielten die Geschwister an Kleidern und Schuhen auch ihren Teil. Ihre alten Kleider aber wollte die Großmutter nicht durch den Schneider plätzen lassen, das solle die Mutter tun, sie verrichte sonst nicht viel, und ihr bisschen Nähen trage nichts ab. Die Mutter erhielt auf gleiche Weise die Wolle zu den Winterstrümpfen für ihren Mann und die Kinder; man konnte aber darauf zählen, dass diese Strümpfe um Weihnacht nie fertig waren und die Kinder entweder mit blauen Beinen herumliefen oder die Fetzen der letztjährigen ihnen zu den Schuhen heraushingen. Die Großeltern konnten sich dann nicht enthalten, nach den Strümpfen zu fragen und zu sticheln, und jedes Mal, wenn die Mutter um ihrer Saumseligkeit willen oder weil sie sich lieber eine neue Blegi an ein altes Gloschli nähte, als für die Kinder lismete, einen Stich erhalten, fand sie eine Ursache, die Kinder zu prügeln.
So wie ich heranwuchs, änderte sich das Verhältnis meiner Geschwister zu Hause. Kinder werden immer zu Kindern hingezogen, denn in ihnen liegt ja auch der Trieb, sich mitzuteilen, sich anzuschließen; so hing ich mit Leib und Seele an meinem Bruder und meinen Schwestern. Je seltener ich anfänglich zu ihnen kommen konnte, desto stärker wurde diese Liebe, desto glücklicher war ich, wenn ich einmal eine Stunde mit ihnen g’fätterlen konnte. Meine Geschwister kamen nämlich, außer um zu essen, selten ins großväterliche Haus, man duldete sie ungern, und sie kamen ungern, weil sie entweder auf Schläge oder auf Tadel zählen konnten. So wie ich eines ansichtig wurde, ruhete ich nicht, bis es bei mir war, und solange es bei mir war, durfte ihm niemand etwas tun. Was ich hatte, jeden Leckerbissen, teilte ich mit ihnen. Die Großmutter machte in ihrer Schwäche gegen mich den Großvater manchmal lachen, und doch war er nicht stärker. Im Speicher waren die Vorräte von dürrem Zeug: Äpfel, Birnen, Kirschen und Zwetschen lagen da ganze Kasten voll; in den Speicher zu kommen war meine Seligkeit, denn alle Mal trug ich alle Säcke voll hinaus. Nun war es recht lächerlich, wie die Großmutter, wenn sie in den Speicher gehen wollte, nicht ruhte, bis ich es bemerkte, oder, wenn ich nicht in der Stube war, mit dem Speicherschlüssel im ganzen Hause herumlief, bis sie mich ansichtig wurde, und ich den Speicherschlüssel sah. Natürlich hängte ich mich alsobald an ihre Schürze und wollte mit. Sie aber stellte sich dann immer, als wollte sie mich durchaus nicht mitlassen, schalt mich aus, dass ich alles sehen müsse, was ich nicht solle; drohte, sie wolle mich dem Großvater verklagen, der gewöhnlich aus irgendeinem Stalle dem Spiel lachend zusah. Nach und nach erlaubte sie mir mitzugehen, aber versicherte bestimmt, sie werde mir durchaus nichts geben, und das Ende vom Lied war immer, dass ich mit gefüllten Säcken unter vielem Balgen der Großmutter herauskam, die aber doch, wenn ich einen Sack zu füllen vergessen hatte, mich selbst darauf aufmerksam gemacht hätte. Mit den eroberten Schätzen eilte ich zu meinen Geschwistern, teilte redlich mit ihnen und machte dadurch auch sie, die nie zu dergleichen Herrlichkeiten gekommen waren, glücklich. Daher liebten sie mich und trugen alle mögliche Sorgfalt für mich, und wenn sie in Feld oder Wald etwas fanden, von dem sie glaubten, es freue mich, so brachten sie es mir. So wurden meine Geschwister dem ganzen Hause befreundeter, den Großeltern lieber, und als Folge davon zeigten sie sich gefälliger, betrugen sich besser und wurden ihres Lebens ordentlich froh, weil sie allenthalben sein durften, ohne verschüpft und mit Schlägen bedroht zu werden. Selbst meine Mutter hatte die Liebe der andern zu mir zu genießen, wurde als meine Mutter mehr als Sohnsfrau gehalten und darauf gesehen, dass ihr das Nötige nicht fehle. Ich glaube zwar, sie habe mich beneidet, obgleich sie mich an sich zu locken suchte, wahrscheinlich, um mich auszufragen, was im Hause getrieben, was, besonders über sie, geredet werde? Ich hatte sie auch lieb, doch war ich nicht gern bei ihr in ihrer Stube, es war mir zu enge dort und unwohl. Die Mutter war, was hoffärtigen Mädchen gerne geschieht, eine Hotsch geworden; das Stübchen lüftete sie nicht, räumte sie nicht auf, sie selbst war entweder unvernünftig geputzt oder eine Schlampe, das Erstere immer seltener, das Letztere alle Tage.
Man kann sich denken, wie glücklich mir auf diese Weise die ersten Tage meines Lebens verflossen! Ich war der Mittelpunkt einer großen Haushaltung und nicht nur ein gesegnetes Kind, sondern auch der Segen anderer, denn von mir aus kam die Liebe in die verschiedenen Glieder, und ein heiteres Lebenslos schien mir bestimmt, aber der Vater im Himmel hatte es anders beschlossen.
Kapitel 2Wie ein Vater Kinder prellt
So war ich über fünf Jahre alt geworden, als wir einmal an einem Sonntage Dorf bekamen, was eine sehr seltene Sache in unserm Hause war. Auf einem Wägeli kam ein großer, dicker Bauer und ein mächtiges, vierschrötiges Mädchen mit plumpen Gesichtszügen, kleinen Augen und gewaltigen Händen. Ihr Staat zeugte von Reichtum, aber sie hatte ihn angezogen, als ob ein Küherknecht ihre Kammerjungfer gewesen wäre (so äußerte sich meine Mutter); ihr ganzes Betragen trug das Gepräge bäurischen Stolzes und Hochmutes. Der jüngste Sohn nahm das Ross ab, das einen halbzentnerschweren Kommet anhatte und in demselben dahertrampelte fast wie die Tochter in ihrem Putz. Die Großeltern empfingen die Gäste mit sichtbarer Freude, auf meine übrigen Onkeln und Tanten hingegen wirkte die Erscheinung dieser Leute wie das Erblicken eines Habichts auf eine Truppe Tauben, sie schossen nach allen vier Winden hin. Einige Zeit lang sah man noch bald das eine, bald das andere hinter einer Ecke oder aus einem Türspalt hervorgucken; bald aber verschwanden sie alle, und keines zeigte sich mehr bis am späten Abend, ja zwei der Onkel kamen erst am Morgen wieder zum Vorschein. Die Gäste wurden in die Hinterstube geführt, welche in jedem Bauernhause eine sehr wichtige Rolle spielt und noch oft vorkommen wird; die Großmutter ging alsobald wieder in die Küche, nachdem sie mit der Schürze die weißgefegten Bänke abgewischt hatte, ich, an ihrem Kittel hängend, natürlich mit. Großmutter wollte in der Ordnung aufwarten und vor allem mit einem Kaffee, weißes Brot gehörte dazu, nachher aber mit allem, was Sitte ist. Nun war viel zu tun: Kaffee musste geröstet, gemahlen, Brot, Wein geholt, Nidle gewellt, Fleisch herabgeschnitten, Schnitze gewaschen, Küchliteig angemacht und vor allem ein tüchtiges Feuer angeblasen und unterhalten werden. Sie war eine rüstige Frau, aber zehn Beine und zwanzig Hände hatte sie doch nicht, sie rief daher: »Stüdeli, Lisabethli, Bäbeli«, dann »Stüdi, Lisabeth, Bäbi!«, aber niemand gab Bescheid; sie rief: »Hansli, Joggeli, Christi, Peterli«, und wieder »Hans, Joggi, Christen, Peter!«, aber niemand kam. Man kann sich denken, welchen Zorn die gute Großmutter verwerchete, sogar ich bekam einen Mupf, dazu durfte sie ihn nicht laut werden lassen, und alles musste doch gemacht werden, wenn sie nicht mit Schanden bestehen sollte, ob welchem Gedanken es ihr fast g’schmuchten wollte. Trotz meinem erhaltenen Mupf tröstete ich die Großmutter und versicherte sie: Ich und meine Geschwister wollten ihr so gut und besser helfen als die andern; und so geschah es auch. Wir vier armen Kinder halfen mit Jubel und Lust die Mahlzeit bereiten, die uns aus dem Hause, in die Wüste, ins Elend trieb. Kätheli holte das Brot und wusch die Schnitze, Benzli holte den Wein, und Anneli röstete, mahlte, erwellte, und alle machten der Großmutter es zum Dank, vor allem ich, der zum Feuer sah und ihr das Leiterli hielt, als sie Speck und Fleisch herunterschnitt. Der Kaffee war bald gemacht, und, nachdem ein schön gelöchert Tischlachen gebreitet war, aufgetragen, aus dem Buffert mit Glasfenstern die geblümten Kacheli herausgenommen, mit der Schürze der Staub ausgewischt und eingeschenkt. Was beim Kaffee weiter vorging, weiß ich nicht, ich musste heraus zu meinem Feuer, dorthin vergaß Großmutter nicht mir meinen Teil zu bringen.
Nachdem Großmutter den Nidlehafen noch einmal zugefüllt hatte, denn sie machte heute den Kaffee recht weiß, wurden sie damit fertig, und Großvater führte die Gäste hinaus, ihnen seine Herrlichkeit zu zeigen: Sami, der jüngste Sohn, stolperte einige Schritte hintendrein, kam aber nicht recht mit Reden z’weg und blieb im Stall beim Ross zurück und musterte das Pferdgeschirr, als ob er ein Sattler werden wollte. Wenn ich Scheiter holte, so sah ich den Großvater, wie er neben dem Bauern herwanderte durch Wald und Felder, sah hintendrein die Tochter marschieren und dachte dabei nichts anders, als es geschähe darum, damit die Großmutter, die ärger schwitzte als eine arme Seele im Fegfeuer, mit allen ihren Gerichten fertig werden könnte. Großvater stand oft stille und verwarf die Hände, dann verwarf sie der Bauer auch, und die Tochter glaubte ich einige Male sogar zu hören. Unterdessen war das Fleisch lind geworden, die Küchli standen an der Wärme, ein Teil des Weines bereits in einer schönen Flasche auf dem Tische, da musste Sami die Spazierenden rufen, welche endlich so langsam daherkamen als möglich, damit man ja nicht glaube, sie hätten etwa Lust zu Speis und Trank. Meine Geschwister wurden, jedes mit einer Küchelschnitte, fortgeschickt, ich durfte mit der Großmutter in die Stube, wohin man endlich gelangte, nachdem sie unzählige Male »göt doch yche« hatte sagen müssen. In meinem Leben kommen mir nicht viele Dinge wieder so wunderlich und seltsam vor als dieses Essen und was sich dabei zutrug. Ich war gewohnt, dass man beim Essen sonst nicht viel sprach, jedes aß wacker und ohne Unterbrechung fort, sei es Erdäpfel oder Kraut, bis es fertig war; dann wischte es den Mund mit dem Ärmel, den Löffel mit dem Tischtuch ab, pflanzte die Ellbogen auf den Tisch, hielt die Kappe vors Gesicht und ging dann seiner Wege.
Hie und da gab der Vater einem Sohne einen Schnauz oder klagte über ein Missgeschick oder die schlechten Zeiten etc., oder die Großmutter sprach zu einem der Kinder: »Hest no nit gnue? Es düecht mi, du chönntisch’s afe mache.«
Wie ging das jetzt anders zu! Da bot die Großmutter die Schüsseln herum und legte den Gästen gar wohl aufs Teller, als ob sie keine Arme hätten; sie sagte in einem fort: »Nät doch! Äßit doch!« Dann entschuldigte sie sich, dass man es so schlecht bei ihnen habe, dass sie nicht besser aufwarten könne, und rief dann wieder: »Sami, schänk doch y, und mach G’sundheit!« Obgleich alles so gut war, aßen der Bauer und seine Tochter doch, als ob ihnen das Essen zuwider sei, sie gabelten auf dem Teller herum, als ob sie Spreuer in demselben hätten, und doch rühmten sie die Großmutter und ihr Essen, und mit dem Trinken machten sie es ebenso, nur der Bauer nahm zuweilen im Vergess einen großen Schluck. Zwischendurch wurde viel geredet und gerühmt, ich kannte den Großvater gar nicht wieder ob dem Gerühmsel, das er anbrachte über seine Habe, ja, über seine Kinder. Dass die Großmutter eine Welle Tuch nach der andern zu zeigen brachte und nicht ruhte, bis sie das Vreneli, so hieß nämlich das große Mensch, in den Speicher geführt und ihm dort ihre Schätze gezeigt hatte, wunderte mich weniger. Hinwiederum rühmten auch der Bauer und seine Tochter, so viel sie z’Platz kommen konnten. Der Erstere, wie viel Heu er dem Küher gebe, wie viel Korngarben er gemacht, und von Ausgeliehenem ließ er mehr als ein Wort fallen. Die Letztere, wie frühe sie aufstehe, für wie viel Schweine und wie viele Menschen sie koche, wie viel sie zwischendurch spinne etc. Das Reden schien ihnen Hunger zu machen, je länger sie aßen und tranken, desto geschwinder wurden sie mit ihren Gläsern fertig und desto geschwinder räumten sie ihre Teller ab. Ja, als es zu dunkeln anfing und von der Heimreise die Rede war, konnte Sami mit Einschenken nicht fertig werden, sodass es der Großmutter Angst machte, sie hätte nicht Wein genug holen lassen, und sie nach und nach mit Pressieren nachließ; aber sie nahmen unpressiert, mit den Küchlene und dem Fleisch ging es ebenso, es war, als ob sie alles reue, was sie übrig lassen müssten. Ich saß da ganz voll Verwunderung, hatte längst genug und konnte mich endlich nicht enthalten zu sagen: »Großmutter, es düecht mi, si chöntis afe mache!« Ich erhielt die erste Ohrfeige in meinem Leben, ohne zu wissen, was ich eigentlich gefehlt, und wurde zur Stube hinausgeschickt. Diese Behandlung schmerzte mich tief, ich weinte bitterlich, bis Sami das Ross einspannte, die Gäste aufbrachen und aufsaßen unter vielen Danksagungen und Entschuldigungen von allen Seiten. Großvater hieß den Sami mitgehen, weil es bös sei durch den Wald zu fahren, wenn man nicht recht bekannt sei. Sami ging und kam den Abend nicht wieder. Es war ein trauriger Abend, nichts als Schelten und Brummen im Hause. Die weggelaufenen Söhne und Töchter stellten sich nach und nach wieder ein, wurden furchtbar ausgescholten, und wenn nicht allzu viel Versäumtes nachzuholen gewesen wäre, sodass die Großmutter keine Zeit zum Prügeln hatte, die Töchter keine, sich prügeln zu lassen, sie hätte eine nach der andern in die Finger genommen. Unter all dem Lärmen schlief ich betrübt ein und erwachte erst am andern Morgen wieder, als die Großmutter mit der alten Liebe mich aufweckte und ich wie gewohnt zum Großvater ins Bett konnte.
Alles sah am Morgen noch zerstört aus, wo man hinsah, steckten einige die Köpfe zusammen und flüsterten miteinander. Ich glaubte, sie klagten sich ihre gestern erhaltenen Scheltungen, bis ich von der Mutter die Wahrheit vernahm. Sie lockte mich beiseits, um mich auszufragen, wie in der Stube alles zu- und hergegangen, was geredet, was gegessen worden und wie man einander angesehen usw. Hier hörte ich, die Gäste seien der reiche Bauer Niegenug zu Unsegen samt seiner Tochter gewesen, welche der Onkel Sami heiraten solle. Nun zog die Mutter los zuerst über den Bauern und seine Tochter, dann über Großvaters. Über die Ersten wusste sie hundert Geschichten von ihrem Geiz und Stolz und dem gewöhnlich damit verbundenen Unverstand. So behauptete sie, der Bauer stehle seinen Knechten die Knöpfe von den Kleidern; von seiner Frau und Tochter, dass sie immer beim Spinnen auf dem bloßen Hemde säßen, um die Kittel nicht zu verribsen. Großvaters seien aber um nichts besser, sonst würden sie einen solchen Geizhund nicht ins Haus begehren, aber es wäre ihnen recht, wenn ihre Söhne des Teufels Großmutter heirateten, sobald sie nur goldene Hörner und einen silbernen Schwanz hätte usw. Die Heirat war allerdings richtig geworden, das vernahmen die Hausgenossen, aber erst dadurch, dass zu ungewohnter Zeit Schneider und Schuhmacher, sogar eine Nätherin auf die Stör kamen, um an der Ausstattung von Sami zu arbeiten, bei welcher die Großeltern ungewohnte Freigebigkeit zeigten. Der Großvater hatte zur Kleidung Tuch erlaubt, welches einen Taler die Elle kostete, die Großmutter gab vom schönsten flächsernen Tuch für zwei Hemder her; nur der Schuster konnte lange nicht zur Arbeit kommen, weil Sami Stiefel wollte, der Großvater aber nur Schuhe bewilligte, doch gab er am Ende auch nach. Dass dieses den Neid der Übrigen erweckte, kann man sich denken, dass niemand dem Sami das Pferd füttern und anspannen wollte am Hochzeittag ebenfalls, doch ließ man sich weiter keine grauen Haare wachsen, man hatte Ahnung von dem, was nachkam. Dass am Abend die junge Frau heimkam, fiel noch nicht auf, aber allgemeine Bestürzung verbreitete sich unter den jungen Leuten, als am folgenden Morgen ein Knabe mit einer großen, aber magern Kuh anlangte, welche einen Meyen aufgebunden hatte, als der Kuh zwei mächtige Schweine folgten und diesen endlich ein Wagen mit Schaft, Trögli, Bett, Spinnrad, Wiegle usw.
Nun erst erfuhr man, dass die junge Frau bei uns, statt, wie man erwartet hatte, bei ihren Eltern bleiben solle. Das erschreckte alle, erstlich weil sie nicht gefiel und man so viel Böses von ihr gehört hatte und weil man überhaupt nicht gern den gewohnten Trab durch eine Fremde mochte unterbrochen sehen. Doch fand man bald Ursache zum Lachen und vergaß für den Augenblick die Bestürzung. Als der Trossel abgepackt werden sollte, fand man Trog und Schaft sehr schwer und fürchtete sie zu verletzen; daher packte man sie auf dem Wagen aus. Zum Vorschein kam nun das sämtliche Zeug der jungen Frau; aber alles ungewaschen. Wahrscheinlich hatte sie die Seife zu Hause gereut und das Holz und gefunden, Großvaters könnten wohl beides liefern. Stück für Stück wurde nun herausgenommen, denn nichts war ordentlich eingepackt, und alle, die damit zu tun hatten, sorgten dafür, dass kein Fleck, kein Schmutz unbemerkt blieb; alles ließ man, wie Fahnen, im Winde flattern. Und merkwürdig war’s, wie die junge Frau mit der größten Schamlosigkeit zusah und mit aller Gleichgültigkeit diese Lüfteten geschehen ließ.
Den ganzen Tag stand die junge Frau in der Küche herum, wenn die Großmutter in derselben wirtschaftete; beguckte alles; sprach zuerst davon, wie sie es zu Hause gemacht, dann hatte sie nach und nach an dem, was die Großmutter machte, etwas auszusetzen; fand zu viel Anken in der Pfanne, als jene die Suppe machte, und blies noch mehr von den Milchkacheln oben ab in den Nidelkübel, welche die Großmutter auf den Tisch stellen wollte. Überall war ich ihr im Wege; sie hatte meinen Ausruf noch nicht vergessen; sie hatte immer ein böses Wort für mich, und nur, dass ich mich fest an der Großmutter hielt, sicherte mich vor Misshandlungen. Meine Geschwister jagte sie mehr als einmal zur Küche hinaus.
Am zweiten Tag griff sie schon mehr ein, und so alle Tage mehr, bis sie die Großmutter ganz aus ihrem Regiment verdrängt hatte. Man fühlte auch alsobald die Änderung. Das Essen wurde spärlicher, schlechter. Alle murrten, nur meine Mutter stichelte: Es scheine, man fange an, den Schweinen zu geben, was den Menschen gehöre, und den Menschen, was den Schweinen zukommen sollte. Sie erhielt aber alsobald zur Antwort: Für eine verhungerte Krämerstochter sei das noch lange viel zu gut. Niemand konnte das Benehmen der Großmutter sich erklären. Sie, die sonst so resolute Frau, ließ sich alles gefallen; nur hie und da hörte man einen Seufzer von ihr, wenn sie noch fleißiger als früher hinter ihrem Kuder saß. Man vergaß, dass die Großmutter auf Erden Reichtum am höchsten hielt, dass sie natürlich auch vor reichen Leuten den größten Respekt hatte. Sie war es gewohnt, alle Leute, die minder reich waren als sie, nach ihrer Weise von oben herab zu behandeln; selbst den Pfarrer, auf dem sie übrigens viel hielt, ließ sie es immer fühlen, dass er keinen Hof habe wie sie; dagegen sah sie jedem Reicheren mit ordentlicher Andacht nach. Nun war ihre Schwiegertochter reich, daher hatte sie Respekt vor ihr und durfte ihr Recht gegen sie nicht behaupten. Noch lag eine andere Ursache ihres Benehmens im Hintergrunde, die niemand kannte, die aber bald auf eine furchtbare Weise an Tag kommen sollte.
An einem Samstag vor einem heiligen Sonntag ging mein Großvater fort an das Gericht zu Unverstand, weil er Gerichtsäß war. Man pflegt an vielen Orten Gemeinden, Gerichte, Steigerungen an einem Samstage abzuhalten. Solche Versammlungen sind Gelegenheiten, wo man ein Gläschen über den Durst trinken und einige Stunden in die Nacht hinein verweilen kann, ohne dass die Weiber darüber räsonieren dürfen, besonders wenn man selbst Gerichtsäß ist; denn die Weiber halten auf den Titeln ihrer Männer meist mehr als diese selbst, obgleich sie dann doch beständig balgen, wenn der Mann die Geschäfte seines Amtes ordentlich abtun will und dazu Zeit brauchen muss. Auf den Samstag folgt dann kein Werktag, sondern der Sonntag; an diesem kann man, ohne etwas zu versäumen, ordentlich ausschlafen, und ein schwerer Kopf hindert an keiner Arbeit. Ob aber der liebe Gott an seinem Tage an solchen schweren Köpfen ein besonderes Wohlgefallen habe, daran denkt man nicht; und ob solche schwere Köpfe an den lieben Gott und ihre unsterbliche Seele ordentlich denken könnten, darum bekümmert man sich wieder nicht, und doch bin ich überzeugt, sind die meisten, die also tun, nicht gottlos, aber sie denken halt zuerst an ihren Nutzen, dann an ihre Bequemlichkeit, und dann erst, wenn sie nichts mehr anderes zu denken wissen, an den lieben Gott. Dass also mein Großvater an das Gericht ging, den ganzen Tag wegblieb, fiel niemand auf; ebenso nicht, dass die Großmutter den Sami am Abend fortsandte, mit dem Bedeuten: Er solle den Großvater heimbegleiten, weil es gar finster werde und der Alte nicht mehr so viel erleiden möge. Spät kamen sie zusammen heim, aber niemand achtete sich ihrer. Am Sonntag war es schön Wetter; viele aus unserm Hause gingen zur Kirche, auch mein Vater, nur meine Mutter nicht. Seit ihrem Unglück musste man sie fast zwingen, in den Gottesdienst zu gehen, und später, als die Kleider ihr zu fehlen anfingen, ging sie gar nicht mehr hin.
Nach und nach kamen sie alle zurück, bis an meinen Vater, den niemand seit der Kirche gesehen haben wollte. Man setzte sich zu Tische, brummte über die schlechte, verdünnte Suppe, sah sich verdrießlich an, der kleinen Stücke Fleisch wegen, die aufgestellt wurden, ärgerte sich, dass kein frischgewaschenes Tischlachen aufgelegt war, aber niemand sprach ein Wort. Da wurde plötzlich die Türe aufgerissen, mein Vater stürzte herein mit rollenden Augen, wie ihn niemand gesehen hatte, auf den Großvater zu und brüllte: »Ist’s wahr, hest de dem Donner Schnuderbub da d’r Hof ums halb Geld verkauft?«
Und eine Stille ward, als ob der Donner eingeschlagen hätte; mehrere Minuten lang sprach keiner ein Wort. Meinen Vater hatte Wut und Hast sprachlos gemacht. Großvaters und die jungen Eheleute waren erschrocken über den so schnell an den Tag gekommenen Kauf, der ein Geheimnis bleiben sollte noch eine Zeit lang, teils, weil man die andern Brüder noch zu Gunsten Samis als Knechte ohne Lohn benutzen, teils, weil man das Unangenehme, welches natürlich das Ruchtbarwerden dieser unväterlichen Handlung nach sich ziehen musste, verschieben wollte. Großvater hatte sich bei der Fertigung einige Maß Wein mehr nicht reuen lassen, um sich bei seinen Kollegen Stillschweigen zu erkaufen, und einen ganzen Kloben an den Schreiber, dass er spät abends eine Fertigung noch vornehme, nachdem alle Leute verlaufen waren, und dennoch am folgenden Morgen wussten die Kirchenleute alles. Wie war das möglich? Das hätte der gute Großvater gar gut wissen können; allein die Menschen wissen oft gar nicht, was sie selbst tun, und können es sich daher nicht erklären, wenn andere das Gleiche tun. Wenn Hausväter um Mitternacht oder erst gegen Morgen nach Hause kommen, so sagt ihnen ihr Gewissen, dass sie gefehlt, ihre Erfahrung, dass die Weiber sie tüchtig abputzen oder mit ihnen kuzen werden. Nun sinnen die meisten Männer, auf welche Weise sie das Wetter abwenden können: Die einen kramen Wein, ein Brötli, die meisten aber, instinktmäßig die schwache Seite der Weiber auffindend, bringen nicht etwas für den Hunger oder den Durst, sondern etwas für den G’wunder nach Hause. Sie wissen, sobald sie eine ordentliche Neuigkeit vorwerfen können, so vergisst die Frau die Sünden des Mannes und beißt sich fest in die Sünden des Nachbars.
Gar manche Frau branzt auch mit dem Manne gar nicht, weil er spät heimkommt, sondern nur, um Neuigkeiten und Geheimnisse herauszupressen, wie man einen Schwamm drückt, damit das Wasser herausläuft. So ging es bei Großvater und so auch bei andern Gerichtsäßen; und sicher nicht nur zu Unverstand, sondern an andern Orten mehr, und sicher nicht nur bei den Gerichtsäßen, sondern auch bei den Sittenrichtern. Ja, man sagt, diese erwarteten nicht einmal die Nacht, um zu plaudern, sondern schon des Mittags bei der Fleischsuppe fingen sie an, und ehe man mit dem Fleische fertig sei, wisse man über den Tisch weg die ganze Verhandlung, von welcher sie eben kamen. So war es diesmal gegangen wie andere Male, und doch konnte es der Großvater nicht begreifen und behauptete steif und fest, es müsse jemand unter dem Bett versteckt oder am offenen Fenster gewesen sein. Des Vaters Brüder waren auch verstummt; an so etwas hatten sie nie gedacht, überhaupt nie daran gedacht, dass das bestehende Verhältnis ändern könnte; sie brauchten lange Zeit, die Sache zu fassen, und dann noch länger Zeit, bis die bei ihnen von unten aufkochende Wut Worte gebildet und zum Mund herausgetrieben hatte. Es lohnte sich wohl der Mühe, in Zorn zu kommen über diesen Kauf. Großvater hatte den Hof von seinem Vater auch gekauft, und zwar um die gleiche Summe, welche jetzt Sami zahlen sollte: Allein die Kaufsumme war wohl gleich, nur der Preis nicht. Der Großvater hatte den Hof 6000 Pfund teurer übernommen, als er geferget wurde vor Gericht. Diese 6000 Pfund betrugen sein Weibergut, welches er gleich bar an den Hof zahlte, ohne dass dessen im Kaufbrief erwähnt wurde, um von so viel tausend Pfund den Ehrschatz zu ersparen oder den Staat drum zu beluxen. Ein Kniff, den nicht nur Gerichtsäße, sondern noch ganz andere Leute treiben. Dann war noch eine bedeutende Matte gekauft, der Hof durch bessere Bearbeitung gar sehr verbessert worden, und doch gab er alles das dem Sami um den früheren geschriebenen Kaufschilling.
War denn Großvater ein so schlechter Mann, dass er seine sieben übrigen Kinder auf eine so schändliche Weise betrog? O nein, er war nur wie hundert andere Bauern! Sein Lebtag hatte er wenig anderes gesinnet und getrachtet, als einen großen Haufen zusammenzubringen; seine Kinder sah er wie Ameisen an, welche zu diesem Haufen immer noch mehr zusammenkräzen sollten. Dass dieser zusammengescharrte Haufen zusammenbliebe auch nach seinem Tode, das war sein Lieblingsgedanke; ob darüber seine andern Kinder Bettler würden, daran dachte er gar nicht, oder dachte vielleicht, es wäre am besten, wenn keiner mehr heiratete, sondern die unbezahlten Leibeigenen ihres Bruders blieben. Zu solcher grenzenlosen Herzlosigkeit und unnatürlicher Härte wird der Mensch gebracht, wenn er im Leben und im Tode Abgötterei treibt mit Geld und Gut.
Ein Unbefangener hatte füglich Zeit, diese Betrachtungen zu machen, während sie alle sich stumm, aber auf der einen Seite mit wachsender Wut, auf der andern mit steigender Verlegenheit gegenüberstunden. Auf der sündigen Partei war allein Samis Frau nicht verlegen; die hatte kein Gefühl für Recht und Unrecht. Sie brach daher auch zuerst das Stillschweigen und sagte meinem Vater, das gehe ihn am allerwenigsten an; er selbst sei nichts wert, und seine Schlange und vier andern Fressmäuler habe man ihm lange genug umsonst gefüttert. Wie oft ein Kanonenschuss das Zeichen der Schlacht ist, und, wenn er nach langer Stille abgefeuert wird, auf einmal alle Kanonen brüllen, das Gewehrfeuer dazwischen prasselt und das friedliche Feld zum Schlachtfeld wird, so war hier die Rede Vrenis der Kanonenschuss, der alle Mäuler öffnete und die Fäuste ballte. Alles brach los, meine Mutter vor allem mit schneidenden Worten, die Tanten schimpften und die Onkels brüllten geradeheraus. Als Großvater und Großmutter schlichten wollten, erhielten sie auch ihren Teil; man stund auf, man trat einander näher, hielt sich die Fäuste vors Gesicht, die Kinder schrien, eine allgemeine Prügleten drohte. Mein Vater hatte bereits den Sami in eine Ecke geschleudert, wollte Vreni beim Göller nehmen, die warf ihm eine Kachle Milch ins Gesicht, dass er schopsen musste; andere Hände streckten nach Vreni sich aus, Sami drängte sich wieder hinzu, Großvater wollte auch fassen, da fuhr auf einmal unser Ringgi, der gewöhnlich meinen Vater begleitete, dem Vreni an die Beine, weil es sich an meinem Vater vergriffen hatte, und biss tüchtig zu. Über diesen neuen Feind brüllte es laut auf, wehrte sich mit Händen und Füßen, aber Ringgi wurde immer wilder, riss ihm das Fürtuch vom Leibe, den halben Kittel, biss auch Sami, der helfen wollte. Man sah deutlich, dass der Ringgi einen eigenen Trieb hatte, an Vreni sich zu rächen, das ihm weit schlechter und weniger zu fressen gab als früher die Großmutter. Die andern zogen ihre ausgestreckten Hände zurück, machten dem Ringgi Platz, der für sie alle den Streit übernommen und vielleicht auch den Großvater vor Schlägen gerettet hatte, jubelten, brüllten bei jedem neuen Fetzen, der davonflog; ihre Wut verflog, und als es endlich der Großmutter gelang, den Ringgi aus der Stube zu bringen, da hatten sie ob der Schadenfreude und der wilden Lust den Handel und den Hof fast vergessen und konnten nicht satt werden, zu erzählen, wie wütend und zerrissen Vreni endlich das Schlachtfeld hätte verlassen müssen. Nur mein Vater vergaß den Handel nicht. Er hatte Weib und Kinder und wahrscheinlich um seiner treuen Arbeit und vielleicht auch um meinetwillen Teil am Hof zu erhalten gehofft. Er war nun 45 Jahre alt, hatte keine 10 Batzen Geld im Sack, nichts angeschafft, keine Ehesteuer, keinen Trossel erhalten; nichts besaß er als die Kleider und sehr wenig Hausrat, den seine Frau aus ihrem Schiffbruch gerettet. Das rüttelte sein ganzes Wesen auf; er verschwor sich, keinen Streich mehr auf diesem Hofe zu arbeiten, und verschwand einige Tage ganz, ohne dass man wusste, wohin er gegangen.
Das waren traurige Tage, denn aller Friede war gewichen. Keins gab dem andern ein gutes Wort; nur wenn ich an der Schürze der Großmutter hing, war ich vor Schlägen sicher, aber nirgends vor bösen Worten. Großvaters waren auch still und mürrisch; wahrscheinlich schlug das begangene Unrecht ihr Gewissen, und sie fingen an zu fühlen, was ihrer warte, wenn Vreni vollends Meisterfrau geworden sei. Auch machte ihnen das Ausbleiben meines Vaters Angst; sie fürchteten nach und nach, er möchte sich ein Leid angetan haben. Das wäre das Schrecklichste gewesen, was ihnen hätte widerfahren können; nicht bloß, weil sie sich als die Ursache seiner Verzweiflung hätten betrachten müssen, sondern wegen der Schande, die dadurch über ihre ehrbare Familie kam, und weil sie ganz bestimmt glaubten, er müsse als Gespenst wiederkommen, hätte keine Ruhe und ließ auch andern keine. Schon durfte des Nachts Großmutter nicht mehr allein ums Haus, und wenn abends jemand an der Türe klopfte, so hätte sie um keinen Preis mehr geöffnet oder gefragt: Wer da sei?, aus Furcht, den Benz zu sehen oder zu hören.
Meine Mutter kannte die Ursache der Abwesenheit des Vaters, aber sie war boshaft genug, sie nicht nur nicht merken zu lassen, sondern noch durch verstellte Betrübnis und Stichelreden über beraubte und getötete Kinder die Herzensangst zu vergrößern und sogar Vreni zum Schweigen zu bringen. Diese hätte meinem Vater den Tod herzlich gegönnt und der Mutter dazu, aber das Wiederkommen desselben fürchtete gerade sie am meisten, weil zu erwarten war, das Gespenst täte sich am Ersten an ihr vergreifen.