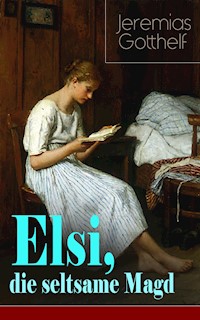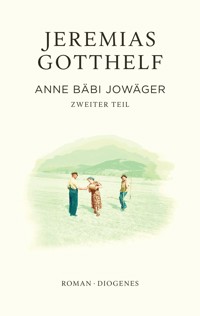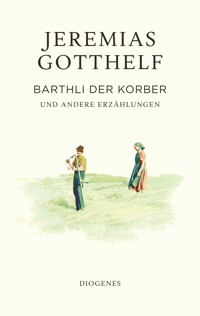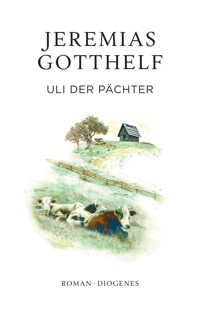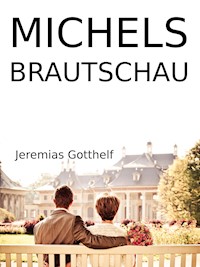
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Michels Brautschau ist eine Erzählung vom Schweizer Autor Jeremias Gotthelf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michels Brautschau
Michels BrautschauAnmerkungen zu dieser AusgabeImpressumMichels Brautschau
Ein klarer Himmel lag über der Erde, und über dieselbe strich von Osten her ein frischer Wind. Der Ostertag war da, der schöne und hehre, der alle Jahre uns das Zeugnis bringt, dass aufersteht, was begraben worden, dass an die Sonne soll, was im Verborgenen liegt. Er bringt als Frühlingsengel Freude allen Kreaturen, auch denen, welche weder Jahre noch Tage zählen können, welche keine Ahnung haben von des Tages hoher Bedeutung als des immer wiederkehrenden Boten, der das Dasein einer andern Welt verkündet. Die Amseln schlagen im Busche, vielleicht dass bereits ein früherwachter Kuckuck ruft; munter gackeln die Hühner, verkünden es der Welt, wie sie ein Ei gelegt, aus dem was werden kann, was noch im verborgenen liegt, ein verschlossenes Grab, in welches ein Leben geschlossen sei. Darum haben die Eier am Ostertage ihre wahre, hohe Bedeutung, sie sind gleichsam Wappen und Sinnbild dieses Tages. Man hat viel über der Ostereier Ursprung und Bedeutung gedacht, wenigstens geschrieben, und ist die Sache doch so einfach. Das Ei ist eine geheimnisvolle Kapsel, welche ein Werdendes birgt, ein rauhes Grab, aus welchem, wenn die Schale bricht, ein neues, feineres Leben zutage tritt. Darum freut sich der absonderlich der Ostereier, dessen eigentlich Leben in der Zukunft ist, dessen eigentlich Wesen noch verhüllt und verborgen liegt. Darum ist Ostern der Kinder Freudentag, darum lieben sie so sehr die Ostereier. Der Kinder Leben liegt in der Zukunft, das Beste in ihm, Zeitliches und Ewiges ist noch verhüllt im Kinde, muss erst auferstehen. Darum lieben Mädchen, in denen so viel steckt, was werden möchte, die Ostereier so sehr, lieben das Eierspiel, welches wir Düpfen heissen, in welchem Schalen zerbrochen, Eier gewonnen und verloren werden, so sehr, laufen stundenweit auf einen Platz, wo das Düpfen munter geht, lassen unverdrossen die Eier sich von Buben zerschlagen, rauben, und verschenken holdselig, was ihnen nicht geraubt, nicht zerschlagen wird.
Für dieses Düpfen am Ostertag ist weit und breit kein Platz berühmter als Kirchberg mit der langen Brücke über die wilde Emme. Nach Kirchberg strömt weit umher das junge Volk, füllt die Brücke, füllt die weiten Plätze diesseits und jenseits der Emme, füllt die Wirtshäuser, düpft und brüllt, trinkt und zankt unverdrossen bis tief in die Nacht hinein, dass der ganze Himmel voll Getöse und es dem Pfarrer auf dem Berge oft ganz übel wird und derselbe jedes Ohr mit einem Baumwollenballen verpallisadieren muss, um bei Gehör und Verstand zu bleiben. Viel tausend Eier, hart gesotten, bunt gefärbt, oft mit schönen Sprüchen verziert, werden hergetragen und verdüpft. Doch auch in die harmlose Freude mischt sich der Betrug. Lose Buben fabrizieren hölzerne, ja steinerne Eier, füllen ausgehöhlte Eier mit Harz, wodurch die Spitzen stärker werden als die Spitzen der natürlichen Eier, diese einschlagen und somit gewinnen; denn wer mit der Spitze seines Eies die Spitze von des Gegners Ei bricht, hat dasselbe gewonnen. Starke Eier werden gesucht und gefürchtet, vor den künstlichen sucht man sich zu hüten, besichtigt des Gegners Ei, handelt darum, es in die Hand nehmen zu dürfen. Ein Hauptwitz besteht darin, dass ein Bursche, der von einem Mädchen ein Ei zum Besichtigen in die Hand bekommt, damit davonläuft. Natürlich das Mädchen in vollen Sprüngen auf und nach, und wie dann dies schreit, sich zerrt und sich reisst und doch nicht beisst! Wer alle Witze und Streiche erzählen wollte, welche an einem solchen Tage verübt werden, der müsste viel Zeit und Papier zu seiner Verfügung haben.
An den Ostertagen, von welchen wir reden wollen, ging es zu Kirchberg ganz besonders laut und lustig zu. Ein Eieraufleset sollte stattfinden, die Hühner hatten mit Legen nicht gekargt, besonders da, wo man den Haber nicht sparte. Der schöne Himmel und der trockene Weg erlaubten auch den Mädchen mit minder guten Schuhen und Strümpfen, an der Fröhlichkeit teilzunehmen. So zottelte es von allen Seiten her Kirchberg zu, noch ganz anders als die eidgenössischen Truppen Luzern. Die Brücke war gedrängt voll, die Verbindung zwischen beiden Ufern war äusserst mühsam geworden, und wer hinüber wollte, der musste gut mit Geduld versehen sein, denn er verbrauchte viel. Fuhr ein Fuhrwerk auf die Brücke, welcher Art es sein mochte, so war es akkurat wie ein Keil, der in hartes Holz getrieben werden soll. Kein Mensch wich einen Zoll breit, bis ihn ein Pferd mit der Nase stiess und auf die Füsse trat, dann wich er fluchend so weit, dass ihn entweder die Gabel in die Seite stiess oder die Räder seine Beine streiften und ihm alle möglichen Verwünschungen gegen Horn- und alles andere Vieh auspressten. Der Fuhrmann konnte nichts dafür, warum wich man nicht aus; und wer nicht auswich, war auch nicht schuld, denn da ist's eine Kunst, auszuweichen, wo man gepresst ineinandersteht, und zwar auf einer Brücke, welche seit Menschengedenken morsch gewesen ist und wahrscheinlich noch zu Kinder und Kindeskinder Zeiten morsch sein wird, und wo alle Augenblicke die Geländer krachen.
Es ist kurios mit dieser Brücke. Die Emme erbarmte sich schon mehrmals dieser altersschwachen Brücke, riss Fetzen weg und begrub sie. Und siehe, handkehrum stand die alte morsche Brücke wieder da, streckte sich lang und matt über die Emme hin als wie ein matter Mensch, der sich zu Bette legen will. Die Geländer krachten wohl, aber brachen nicht, ein Wunder, welches alle Jahre sich wiederholt, wohl das grösste, das je in Kirchberg sich zugetragen. Grosses Unglück wär's nicht, wenn einmal ein Geländer brechen würde; Beine würden kaum gebrochen, die Brücke liegt ja fast mehr unter als über der Emme und hat bedeutende Anlagen zu Aehnlichkeiten mit dem berühmten Tunnel zu London.
Fast wie einem schweren Schiffe mit den Wellen, ging es einem grossen und mächtig breiten Burschen, der mit gespreizten Beinen, die Arme weit vom Leibe weg, über die Brücke segeln wollte. In selbstbewusster Ruhe schob er sich vorwärts, schob beiseite, was ihm im Wege war, doch nicht buben- und boshaft, sondern ganz kaltblütig, weil es ihm eben im Wege war, und vollkommen gleichgültig, war's ein trotziger Junge oder ein hübsches Mädchen. Was leicht wich, schob er leicht; was sich schwer machte, schob er halt, bis es ging. Ein grosser, schwer mit Silber beschlagener Kübel hing ihm im Maule und rauchte bedenklich; am kleinen Finger der rechten Hand hatte er einen schweren silbernen Ring, einen sogenannten Schlagring. Solche Ringe waren ehedem sehr in der Mode und wirklich ganz besonders dienlich, Löcher in die Köpfe oder Zähne in den Hals zu schlagen; es waren so gleichsam die Siegel grosser Bauernsöhne, welche sie auf die Köpfe ihrer Nebenmenschen drückten. – Ums Düpfen kümmerte er sich nicht, Eier merkte man nicht bei ihm, bei keinem Mädchen stellte er sich. Und doch war sein Gesicht so, wie es die Mädchen gerne sehen, und er war auch im Alter, in welchem man die Mädchen am liebsten sieht. Sein Ziel, nach welchem er segelte, schien in der Ferne zu liegen. Ihm auf der Ferse war ein gewaltiger Hund, und drei muntere, aber grobe Burschen steuerten hinter ihm in gleichem Fahrwasser.
«Was ist das für ein Gusti (junges Rind)?» schrie plötzlich ein Mädchen auf. Es war eben mitten in einem interessanten Märten ums Düpfen mit einem sehr interessanten Burschen und meinte, das Recht, zu stehen wo es wolle, so gut zu haben als irgend jemand, und meinte nicht, es müsse seine Geschäfte abbrechen, um einem dicken Mannsbild Platz zu machen, ward aber um seiner freien Meinung willen gar hart und unsanft auf die Seite mehr geschleudert als geschoben.
«Nit so laut!» sagte ein anderes grosses, schönes Mädchen, aber mit kühnen, wilden Augen. «Es ist Michel auf dem Knubel, ein ungeleckt Kalb, aber es lohnte sich der Mühe, es zu lecken. Seine Eltern sind im Kirchhof, er hat einen bezahlten Hof, ausgeliehenes Geld. Wart, den will ich stellen!» Und rasch ging das Mädchen vor, ergriff den Michel bei einem seiner dicken Arme und rief: «Seh, Michel, düpfen! Oder hast keine Eier, musstest die Hühner verkaufen, weil du den Haber selbst gebrauchtest für Habermus und Haberbrei?«
Das war starker Tusch. Habermus und Haberbrei sind gegenwärtig auf einem reichen Bauerntisch, was Kutteln und Krös auf einem Herrentisch, und mit Unrecht: Haberspeisen waren unserer Väter Speisen, sind sicher nahrhafter als dünne Kaffeebrühe und blosse Kartoffeln. Michel fühlte den Tusch, doch langsam ging er ihm ins Fleisch. Langsam drehte er sich um und sagte: «Wenn dein Vater Hühner nach Solothurn fährt, so sag ihm, er solle auf dem Knubel vorbeikommen, vielleicht dass noch was für ihn zu handeln wäre, wenn er Geld hat für ein Huhn oder zwei.»
«Mein Vater hat noch nie auf sieben Höfen herumspringen müssen um Geld, wenn er den Mauser hat zahlen sollen, wie es andern begegnet sein soll,» antwortete das Mädchen.
«Wie lange ist es denn», antwortete Michel, «dass er den letzten Kreuzer wechseln liess, um Schnaps zu kaufen?»
«He», sagte das Mädchen, «das war gerade am gleichen Tage, wo du deine letzten Eier an ein kreuzerig Weggli tauschtest, aus welchem dir deine Kindermutter den letzten Milchbrocken machte, der so grausam gut gewesen, und dem du jetzt noch nachplärest.»
Dieser Schuss traf einigermassen, Michel stellte daher den Witz ein, er sagte bloss: «Selb lügst», wollte abbrechen und weiter.
«Ich wollte mich doch schämen», sagte hartnäckig das Mädchen, «der Bauer auf dem Knubel sein wollen und nicht ein einziges Ei vermögen an der Ostern.»
Zornig sagte Michel: «Wer sagt, ich hätte keine Eier?»
«He», antwortete das Mädchen, «hast welche, so zeig' sie, komm und düpf!»
«Meinst'?» sagte Michel. «Ich hätte viel zu tun, wenn ich mit allen Hagstüdene und allen Bauerntöchtern vom Gitzigrat und von Schattenhalb düpfen wollte. Wenn du düpft haben musst, so frage hinter mir die Knechte; vielleicht dass einer mit dir mag, vielleicht auch nicht.» Nach diesen Worten segelte Michel unaufhaltsam weiter vor seinem Gefolge her. Stolzer ist nie ein Sohn von Frankreich vor seinem Gefolge hergeritten, als Michel vor seinem Gefolge, dem Hunde und den drei Knechten, einherschritt. Die Knechte neckten begreiflich das Mädchen. Das Mädchen würdigte dieselben keiner Antwort, sah dem Michel nach mit stillschweigend zornigen Blicken, in welchen mit grossen Buchstaben geschrieben stand: «Wart du nur, dir will ich!»
Wie oben gesagt worden, war an diesem Tage noch ein Eieraufleset angestellt. Wir wissen nicht, ist diese Sitte bloss bernerisch oder weiter herum verbreitet. Dieses Spiel fand gewöhnlich an Ostern oder Ostermontag statt. Die Burschen eines Dorfes oder eines Bezirks teilen sich in zwei Parteien: Der einen liegt ob, Eier aufzulesen, der andern, zu laufen an einen bestimmten Ort und zurückzukehren, ehe die Eier aufgelesen sind. Begreiflich springt nicht die ganze Partei, sondern jede derselben wählt sich den bestgebauten, langatmigsten Burschen als Läufer aus. Nun wird der Ort bestimmt, wohin der Läufer einer Partei vom Platze weg, wo die Eier aufgelesen werden, zu laufen, einen Schoppen zu trinken und zurückzukehren hat. Dieser Ort ist zumeist eine halbe Stunde entfernt, doch näher und weiter nach der Lokalität. Im Verhältnis zu der bestimmten Entfernung werden nun zwei- bis dreihundert Eier in einer Entfernung von einem Fuss auseinander, zumeist in zwei Reihen nebeneinander auf die Erde gelegt. Der Läufer der zweiten Partei hat die Aufgabe, diese Eier eins nach dem andern aufzulesen und je eins nach dem andern in eine am obern Ende mit Spreue gefüllte Wanne hinzutragen. Doch ist es ihm vergönnt, sie in die Wanne zu werfen, von so weit her er will, und einer aus seiner Partei kann auch die Wanne halten, drehen und vorstrecken, doch nicht näher gehen. Indessen ist dieses Werfen nicht immer fördernd und um so weniger, je mehr der Läufer erhitzt und gespannt und somit im Werfen unsicherer wird; denn für jedes im Werfen oder sonstwie zerbrochene Ei wird ihm ein neues hingelegt, welches wiederum aufgelesen werden muss. Von der Wanne weg laufen beide miteinander ab, von der einen Partei wird der Aufleser beaufsichtigt, von der andern Partei sind einige im bestimmten Wirtshause, sehen zu, dass dem Läufer der Wein nicht entgegengetragen und von ihm ordentlich ausgetrunken werde. Darauf kommt es also an, wer mit seiner Aufgabe zuerst fertig und wieder bei der Wanne ist; fast immer gewinnt der, welcher die Eier aufliest. Es ist eine lustige Art von Wettlauf, doch waltet ein eigener Unstern darüber, denn gewöhnlich endet dieses Spiel mit blutigen Köpfen oder doch mit Streit und Zank.
Jede ordentliche Sache hat eine Spitze, das Eierlesen deren sogar zwei. Auf dem Spiel steht eine Wette, bestehend in einer Uerti. Die verlierende Partei muss eine Zeche bezahlen, das bringt Aerger und Unmut, und, je mehr Wein dazu gegossen wird, desto mächtiger gären beide Elemente. Dazu kommt noch, dass zumeist jeder Bursche ein Mädchen einladet, das Fest mit einem Ball eröffnet und beschlossen wird. Man ist auf dem Lande, in der jungen Welt nämlich, noch nicht so selbstsüchtig wie in der Stadt, so blasiert, huldigt so ganz dem Grundsatze: «Selber essen macht fett.» Bei solchen Gelegenheiten haben die Burschen gerne ihre Mädchen bei sich, machen ihnen gerne auch eine Freude und zwar gratis. Geiger und Mädchen sind aber wiederum zwei Elemente, welche nicht besonders zum Frieden dienen, wenn ohnehin das Blut kocht.
Dieses sogenannte Eiermahl, wobei die Wirtin je nach ihrer Kunst Eier verbraucht, wird jedoch einstweilen noch nicht am heiligen Tage selbst, an Ostern, gehalten, wenigstens in jener Zeit nicht, in welche unsere Erzählung fällt. Man war damals noch nicht so gebildet wie jetzt, stand noch nicht auf der heutigen Kulturstufe, liess den Geiger nicht die heiligen Töne verquiken und verquaken, hielt für nötig, ruhige Punkte zu haben im Weltgetümmel, damit der Mensch zur Besinnung komme und sich zurechtfinden könne, wo er sei, und ob er auf dem Kopf oder auf den Füssen stehe. Nun gibt es aber auch Zeiten und Regierungen, wo alles darauf ankommt, dass männiglich sturm bleibe, nicht wisse, stehe er auf dem Kopfe oder auf den Füssen; da ist's dann freilich nötig, dass man alle Töne loslässt Tag und Nacht, dass blasen und brüllen, klarinetten und kanonieren, geigen und gruchsen, posaunen und prasten, singen und springen muss, und zwar so scharf er es vermag, wenn er nicht verdächtigt werden will, wer nur immer blasen und brüllen, klarinetten und kanonieren, geigen und gruchsen, posaunen und prasten, singen und springen kann, vom Säuglinge weg bis zum Greis. Das ist einer der wichtigsten Punkte in der demagogischen Staatskunst. Begreiflich gehen die rechten Staatskünstler mit dem Beispiel voran und zwar unnachahmlich. Es ist wohl möglich, dass man einmal in den Kirchen, gegenüber der Kanzel, eine Bühne errichtet für solche Künstler, welche der Teufel angestellt hat und als Hanswurste figurieren lässt, alles Heilige dem dummen Volke wegzubugsieren.
Mit Eiermahl, Tanz und obligater Prügelei musste man warten, wenigstens bis Ostermontag, des Publikums wegen und nicht wegen der eigenen Religion. Auch damals also liess man in Kirchberg Ostern Ostern sein und tat, wozu man Lust hatte, bis ans Geigen, und die Polizei hatte keinen Sinn für Ostern, war ihr auch nicht zuzumuten, ja, man gibt ihr schuld, sie hätte Zwecke verfolgt, welche eben durchaus nicht österlich waren. Die Wirtshäuser waren überfüllt, es wurden es allgemach auch die Köpfe; und wenn es voll in den Köpfen wird, fängt es bekanntlich an, in den Fingern zu spuken, und dann Ostern hin, Ostern her!
Michel auf dem Knubel gehörte zu keiner der Parteien, er wohnte nicht in der Nähe, aber er sah solchen Dingen gern zu, und wenn er sich auch nicht ungern zeigte, wo viele Menschen zusammenkamen, so kann man es ihm nicht verübeln. Seine Vasallen hatten ihm einen grossen Begriff von seiner Majestät beigebracht, ihm eingeredet, er sei mehr als Goliath, mehr als die sieben Haimonskinder alle miteinander. An solchen Orten sah er dann, wie die Leute ihn betrachteten, als wäre er eine fremdländische Kreatur, mit Erstaunen und mit Grauen, sah, wie einer dem andern die Ellbogen freundschaftlichst in die Nieren stiess, und hörte mit der grössten Wonne: «Sieh, dort der Grosse, wo breit ist wie ein Tennstor, das ist der junge Bauer auf dem Knubel, das ist ein Grüsel, mit Geld und Kraft mag den keiner, der schwingt obenaus im Schweizerland.» Michel war ein junger Laffe, tat dümmer als er war, meinte, unter den Leuten müsse er sich so recht spienzeln, seinen Kübel im Maul, seinen Ring am Finger und dazu ein Gesicht machen, als ob er nicht bloss allen Pfeffer auf dem ganzen Erdboden gefressen hätte, sondern auch das Land, wo er wächst, mit allen Pfeffersträuchen dazu.
Darum eigentlich kam er mit Gefolge nach Kirchberg und weder des Düpfens noch des Eierauflesens wegen. Er hatte zwar des allgemeinen Gebrauchs wegen auch Eier im Sack und düpfte sogar und zwar selbst mit Mädchen. Aber sie mussten ihm bekannt sein und ihn ansprechen dafür, unbekannte Bauerntöchter vom Gitzigrat fertigte er über die Achsel ab. Ward er angesprochen, tat er es wie eine Gnade, als ob er Sultan wäre, schritt dann fürbass ebenso. Aus dem Weibervolke machte er sich durchaus nichts; tanzte er einmal und hielt das Mädchen zu Gast, so war es nur, um zu zeigen, der Bauer auf dem Knubel vermöge den Geiger zu bezahlen und eine Uerti obendrein. Wollte ihm ein anderer das Mädchen abjagen, so konnte er eine vaterländische Prügelten anstellen, aber nicht des Mädchens wegen, sondern um zu zeigen, wie stark er sei. Wollte ihm aber niemand das Mädchen abjagen, so liess er es sonst laufen. Michel war so eine rechte wahrhaftige Lümmel-Majestät, aber eine gutmütige.
Als das Eierauflesen aus war, der Aufleser, welcher sehr geschickt im Werfen der Eier nach der Wanne gewesen war, gewonnen hatte, wälzte sich die Masse den Wirtshäusern zu, um abzusitzen und zu erwarmen. Michel tat auch also, wälzte sich mächtig durch die Menge und pflanzte sich hinter einem Tische auf, als ob er hier den jüngsten Tag erwarten wolle. Zu seinen Füssen lag Bäri, der Hund, auf dem Vorstuhl sassen die Knechte, liessen sich's wohlsein, denn Michel kargte nicht beim Traktieren. Das Wirtshaus, in welchem Michel war, füllte sich zum Ersticken und zwar mit allerlei Volk von verschiedenen Dörfern. Aus allen Ecken schrie man nach Wein, mit den Mädchen ward um die letzten Eier gerungen, was mit einer radikalen Plünderung endigte. Lärm und Spektakel waren gross. Man verstand sein eigen Wort kaum, und schwer war's, sich durchs Getümmel zu drängen, schwerer als auf der Brücke. Dort nahm man's kaltblütig, hier war's, als sei alles mit Büchsenpulver angefüllt, als schwirrten böse Geister in der Luft und bliesen die Menschen mit Zanksucht an. Warf man Streitende zur Türe hinaus, kamen sie durch die Fenster wieder herein, und zehnmal wilder als vorher. Löschte man den Streit in der Stube, flammte er in den Gängen um so gewaltiger auf. Die Frühlingslust spukte in den starken Gliedern, und zumeist tut dann der Mensch am wüstesten, wenn es sich am wenigsten ziemt. Michel sass, vom Streite unberührt, hinterm Tisch in guter Ruhe und rauchte einen Kübel Tabak dazu. Nur zuweilen knurrte Bäri, der Hund, oder einer der Knechte stand auf und trieb einen Knäuel Streitender, der sie belästigte, mit einem tüchtigen Stoss ins Fahrwasser des Streites hinaus. Hinter Knechten, Hund und Tisch sass Michel in der vollständigsten Sicherheit, hätte in allem Behagen geniessen können, was ihn gelüstete.
Wahrscheinlich stach ihn der Böse, es gramselte ihm in allen Gliedern; plötzlich mitten im wildesten Lärm schrie er nach seiner Uerti und wollte fort samt Gefolge, welches vielleicht lieber länger gesessen wäre, indessen keine Einwendungen versuchte. Langsam, gsatzlich rückte Michel aus, drückte sich ins Gedränge, wollte durch Stube und Haus, wie er diesen Nachmittag über die Brücke gekommen. Aber jetzt war anderes Wetter. Damals war die Luft rein gewesen, jetzt flogen Gläser und Flaschen drin herum, als ob es Schneeflocken wären.
«Will der schon heim?» hörte Michel eine Stimme fragen. «Für den ist's hohe Zeit, um diese Zeit müssen die Kinder ins Bett, längst wird ihm die Kindermutter sein Breili zweghaben», antwortete eine andere Stimme.
Zornig sah Michel sich nach dieser Stimme, welche er heute schon einmal gehört zu haben glaubte, um; da splitterte ihm ein Glas am Backen. Nun ging das Pauken los, Michel hielt sich berechtigt, auf den Wurf hin dreinzuschlagen, ganz gleichgültig, wen er traf, und hinter ihm her hielten die Knechte sich für ebenso berechtigt als der Meister. Michels Ring schien ein wahrhafter Zauberring zu sein; von ihm berührt, beugten sich die kühnsten Häupter, und manches fiel in tiefen Schlaf. Alles schlug nun auf Michel ein, und je mehr Schläge Michel kriegte, desto munterer schien er zu werden; es schien, als erwache er eigentlich erst jetzt so recht. Es wäre eine ordentliche Freude gewesen, ihm zuzusehen, wenn dabei nicht Augen, Nasen, Zähne usw. gefährdet gewesen wären. Michel brach sich Bahn mitten durch das wildeste Getümmel, schlug sich auf gesunden Beinen ins Freie.
Draussen hielt er still, rüstete sich auf den Heimweg, zog einen sorgfältig geborgenen Kübel aus der Tasche, brachte ihn ins Gleis, stopfte frisch, achtete sich der Steine und Scheite wenig, welche um ihn herumflogen. Eben hatte er Stein und Schwamm zur Hand genommen, den Kübel ins Maul gesteckt und wollte Feuer schlagen, da traf ein Scheit hauptsächlich die Pfeife, dass sie ihm aus dem Maule flog und die Zähne wackelten. «Bäri, fass!» rief er, und wie ein Pfeil schoss Bäri in die Nacht hinein, als ob er nur auf diesen Ruf gewartet hätte. Bäri war ein ganz vortrefflicher Hund mit Löwenkraft und Menschenverstand, daher auch wie ein Zwillingsbruder von Michel geliebt. Im grössten Streit half Bäri seinem Meister nie ungeheissen, ausser wenn derselbe fiel, dann hätten wir niemanden, dem sein Leben lieb gewesen, raten mögen, Michel anzurühren. Wurde er irgendwie getroffen oder geschlagen, dann hatte er nicht das Recht, ungeheissen zuzubeissen. Sagte aber Michel: «Bäri, fass!» oder: «Bäri, nimm!», so fasste Bäri und nicht für Spass und liess nicht los, bis Michel sagte: «Bäri, gang dänne» oder: «Bäri, hintere!» Bäri hörte auf der Welt kein Wort lieber als das: «Bäri, fass!» Wie es aus Michels Mund war, schoss er fort wie ein Pfeil vom Bogen, und ungesäumt lag am Boden, was Bäri fassen sollte.
So geschah es auch jetzt. Laut fluchte es in der Nähe, dann hörte man einen dumpfen Fall, einen lauten Schrei, Bäris zornig Knurren. «Geht und luegit!» sagte Michel zu den Knechten, suchte kaltblütig seine Pfeife zusammen, richtete sie ein und ging langsam nach. Sie fanden Bäri schrittlings stehend über einer dunkeln Gestalt, die blanken Zähne knurrend dicht an deren Gesicht, und zorniger ward das Knurren, und das Maul tat sich über dem Gesichte zum Fassen auf, sobald die Gestalt einen Laut von sich geben wollte. Die Knechte fanden sich nicht berufen, den Menschen zu erlösen, auch sprangen sie denen nicht nach, welche sie in der Ferne laufen hörten. Zu g'wundrig zu sein in dunkler Nacht kann unheimlich werden. Sie hatten ihr Gespött mit dem armen Teufel, und wenn der reden wollte, sperrte Bäri das Maul auf, drückte ihm die Zähne ins Gesicht, doch ohne zu beissen. Eben eine bequeme Stellung ist dies nicht für einen Menschen, sie ist ungefähr die eines konservativen Freiburgers, mit dem Unterschiede, dass der Bäri, der auf dem Freiburger steht mit dem Maule am Gesicht, eine Regierung ist, und nicht ein Hund. Michel hielt von je Pressieren für ungesund, fand sich auch nicht bewogen, diesmal eine Ausnahme zu machen. Er kam langsam nach, und erst als seine Pfeife ordentlich brannte, sagte er: «Hintere, Bäri, hintere!» Bäri meinte ebenfalls nicht, dass besondere Eile am Platze sei, langsam zog er das Bein zurück, liess ab von den zärtlichen Berührungen und entfernte sich missmutig von dem Menschen.
Sobald dieser frei war, fluchte er schrecklich und begehrte mörderlich auf. Als er sich endlich erhoben hatte, sah man, dass es ein Landjäger war. «Du Knubelkalb, du verflucht's, habe ich dich endlich, jetzt will ich dir's zeigen, du musst mir dahin, wo du längst hingehört; morgen mache ich die Anzeige im Schloss, dein Hund muss zum Schinder, du unter die Roten. Der Bonaparte ist die rechte Kindermutter für solche Kälber, der putzt ihnen die Nase. Der Bigelpeterli wird Freud haben, wenn er dich in die Lieferung bekommt.»
Die Schweiz musste Napoleon laut Vertrag vier Regimenter oder sechzehntausend Mann stellen und vollzählig erhalten. Napoleon verbrauchte rasch seine Soldaten, plagte daher seine sogenannten Verbündeten beständig mit Befehlen zur Ergänzung. Nun war die Freiwilligkeit nicht mehr sehr gross, seitdem man vernahm, wie heiss es in Spanien zugehe, und wie kalt es in Russland sei. Die Werbung ging daher sehr schläfrig, und die Regierungen mussten zu allerlei künstlichen Mitteln die Zuflucht nehmen. Die schlausten Werber wurden angestellt, alle Listen ihnen erlaubt, bei allen Streichen durch die Finger gesehen, und wen sie einmal hatten, den hatten sie, wenn sie wollten. Unter diesen Werbern blieb Bigelpeterli berüchtigt und wegen seinem Witz berühmt bis auf den heutigen Tag. Es geschah aber auch, dass man Bursche, welche wegen Schlägereien oder anderm Frevel ins Zuchthaus oder in die Verbannung sollten, nach Frankreich spedierte, angeblich zwar mit ihrem Willen. Dieser modus procedendi wurde dann aber auch von Landjägern und Werbern zu schweren Brandschatzungen missbraucht, wenn sie einmal einen Reichen in die Hände bekommen konnten. Auch sollen die Manieren der reichen Bauernsöhne nie so fein gewesen sein als dazumal.
Es war, als Michel das begegnete, noch nicht die böste Zeit und doch erschrak er sehr. Er war tapfer auf den Strassen, aber vor dem Krieg hatte er einen heiligen Schrecken, er tauschte seinen Knubel nicht an ganz Russland. Er wollte daher begütigende Worte versuchen, der Hund habe ihn nicht gekannt und nicht gedacht, dass, wo mit Scheiten geworfen werde, ein Landjäger zugegen sei. Aber solchen Menschen manierlich zu kommen, ist gefährlich, sie werden gern um so gröber und unverschämter. Der Landjäger war vorher bloss grob gewesen, jetzt ward er fürchterlich, tat, als ob er Michel Handschellen anlegen und ihn noch in dieser Nacht nach Frankreich spedieren wolle. Da trat Sami, Michels Lieblingsknecht und gleichsam sein Milchbruder, vor und sagte: «Nur sachte, und jetzt hast Zeit, zu schweigen und dich zu streichen, du Unglücksmacher, sonst geht es mit dir dem Teufel zu; du hast den ganzen Streit angezettelt und immer wieder angeblasen, um Bussen zu ziehen oder zu brandschatzen. Anderer Unglück ist eure Ernte. Es sind Leute da, welche sagen werden, wo man will, wie du und dein Kamerad das ganze Spiel abgekartet haben. Hast du das Scheit nicht selbst geworfen, so warst du doch dabei, als es geworfen ward, und weisst, wer es getan. Ist das nicht genug, so soll dir bewiesen werden, wie du dich kaufen lassest, kurz, der schlechtest Lumpenhund bist, welcher in unserer Herren Kutte herumläuft. Morgen gehe ich ins Schloss, zähl darauf, und zeige dem Oberamtmann an, welche Lausbuben und Unglücksmacher er zu Landjägern habe. Er ist ein stolzer Herr, aber kein ungerechter, der wird mit solchem Pack sauber ausfahren, zähl darauf!»
Diese Sprache machte Eindruck auf den Landjäger, von wegen derselbe kannte den Oberamtmann, wusste wohl, was er ihnen oft gesagt, und dass er nicht Spass verstehe, am allerwenigsten von den Landjägern. Der Landjäger liess die Milch hinunter, und endlich kam ein Vergleich zustande, der ungefähr in den Worten enthalten ist: «Schweigst du mir, so schweig ich dir.»
So geht es gewöhnlich. Eine Floh, welche uns gebissen, jagt man, bis man sie hat, dann zerdrückt man sie: menschliches Ungeziefer aber schüttelt man bloss von sich ab, lässt es laufen, ja, hat noch Freude daran, wenn es von uns weg nach andern springt und beisst. «Können jetzt auch luegen, wie sie es abschütteln!» denkt man. Mit dieser Selbstsucht richtet man unsäglichen Schaden an, erhält die Macht der Schlechten, mehrt deren Trotz und Uebermut, denn sie haben ja nichts zu fürchten, als am einen oder andern Orte vergeblich anzuspringen und abgeschüttelt zu werden. Müssten sie das Zertreten fürchten, es wäre anders. Wie mancher wohl wurde durch diesen Spitzbuben von Landjäger später noch unglücklich, der sein Wesen sicherlich forttrieb, nur vorsichtiger und schlauer! Nun, unserm Michel war es nicht zuzumuten, des allgemeinen Besten wegen freiwillig einen Gang ins Schloss zu tun, dem Oberamtmann unter die Augen zu stehen und eine Anzeige zu riskieren. Versetzen doch solche, welche was ganz anderes vorstellen wollen als unser Michel, keinen Fuss, wenn es gilt, Schaden zu wenden vom ganzen Vaterlande, geschweige denn dass sie das Maul auftäten und die verzeigten und offenbar machten, welche es ins Verderben führen.
Im schönen Bewusstsein, viel verrichtet zu haben, zog Michel mit seinem Gefolge unangefochten heim. An vier solche Burschen und einen Hund traut man sich auf offener Strasse und freiem Felde nicht so leicht. Die angetrunkenen Knechte im Siegesübermut hätten gern noch ein zur Seite liegendes Dorf besucht, wo Kampf und Blut nicht gefehlt hätten. Aber Michel wollte nicht, nicht weil er sich fürchtete, aber er meinte nicht, dass alles an einem Tag getan werden müsse; er war mit dem diesmal Vollbrachten vollständig befriedigt. Es sei morgen auch noch ein Tag, sagte er. Michel hatte einige Löcher im Kopf, Beulen am Leibe, aber er achtete sie so wenig als Bremsenstiche, hatte sie vergessen, als er heimkam, legte sich zu Bette, ohne nach ihnen gesehen zu haben.
Am andern Tage schlief Michel, bis hoch am Himmel die Sonne stand. Endlich begann es zu tagen vor seinen Augen; aber Michel pflegte nicht eines Satzes aus dem Bette zu springen; selbst wenn unter ihm das Bett gebrannt, so hätte er sich noch gedreht, gestreckt, einigemal gegähnt, dann erst hätte er das Bett verlassen, in einem Satze vielleicht oder vielleicht auch langsamer. Als nun Michel mit etwelchem Geräusch seine Vorübungen zum Aufstehen mit Gähnen und Strecken machte, öffnete sich die Türe, und eine ältliche Frau trat ins Stübchen. Aber sowie sie einen Blick auf das Bett getan, schrie sie laut auf und schlug die Hände über dem Kopfe zusammen: «Ach du meine Güte, Michel, mein Micheli (ein beiläufig über zwei Zentner schwerer Micheli) wie siehst du aus, wie haben sie dich aber zugerichtet!»
«Was ist, Anni?» fragte Michel und hob das Haupt aus dem Kissen.
Da erst schrie Anni recht: «Mein Gott, mein Gott, lebst oder bist tot? Bist du denn nicht sicher, wenn du von Hause gehst? Oh, wärst daheim geblieben, ich hielt dir so dringlich an, wollte dir zweimal Küchli backen und Nidle stosse, aber es musste nicht sein, es musste erzwängt sein, und jetzt kommst du mir so heim! Und wo waren die Knechte, was taten Sami und Bäri? Was nützen die alle, wenn du so zwegkommst?»
«Was ist Aparts, dass du so machst?» fragte Michel verwundert. «Bist du denn so sturm im Kopf, dass du nichts weisst? Es ist sich aber nicht zu wundern, man muss sich nur wundern, dass du noch lebst. Sieh selbst!» sagte die Frau, nahm ein Spiegelchen von der Wand und hielt es ihm vor.
Da wäre doch Michel beinahe vor sich selbst erschrocken. Er sah aus wie ein alter Märtyrer, gepeitscht, halbgeschunden und halb von den Hunden gefressen, voll Blut und Striemen. Das blutgetränkte Haar hing ihm über das dicke Gesicht hinunter, das blutige Hemd klebte ihm am Leibe, dass man es für den blutigen geschundenen Leib selbst hätte halten können. Noch andere Leute als Anni wären über ihn erschrocken; denn man hätte wirklich meinen sollen, es sei nur eine Wunde. «Das ist wüster als bös», sagte Michel zu Anni, welche sich gebärdete wie eine gedungene hebräische Klagefrau. «Hol' Wasser, mach' das Blut ab und gib ein frisches Hemd, so ist d'Sach richtig!»
Anni, welche von vielen Berichten her einige Sachkenntnis in solchen Fällen hatte, fragte, ob es nicht besser sei, ehe es wasche, zu Männern zu schicken, um Zeugen zu haben, wie er ausgesehen, und zu einem Arzt, um ihn zu verbinden, damit man den Mördern und Schindhunden, welche ihn so zugerichtet, den Meister zeigen könne? Aber Michel meinte, es wäre gut, es wäre heute niemand übler zweg als er, und wollte nicht; Anni musste sich bequemen, laues Wasser zu holen, um seinem Micheli sein Köpfli zu waschen. Je eifriger es wusch, desto eifriger redete und jammerte es dazu. Als das Werk vollbracht war, sah Michel wieder ganz ordentlich aus, dass Anni es fast ungern hatte und tat, als ob es Michel lieber halbtot gesehen, um dann nach Herzenslust über ihn weinen und klagen, über die Täter schimpfen und lästern zu können.
Um desto brünstiger wandte es nun sein Mitleid Michels Kleidern zu. Er hatte nämlich am Ostertag all sein Bestes angezogen; da war nichts mehr sauber, das eine zerrissen, das andere mit Blut getränkt und dieses eingetrocknet. Er komme noch um all seine Sachen, jammerte Anni, wenn er sich seiner Sache so wenig achte. So kostbare Kleider und alle dahin! Hätte er ihns gestern geweckt, dass es das Blut noch feucht hätte auswaschen können, so wollte es nichts sagen, jetzt möge er zusehen, wie es werde. Wenn es ihm nicht eingefallen, so hätte es Sami in Sinn kommen sollen, dem stünde es wohl an, der Witzigere zu sein, sei er doch sieben Wochen und drei Tage älter als Michel. Aber wenn er nicht besser tue, müsse der ihm aus dem Hause. Bei allen Lumpengeschichten sei er der erste und der letzte und vielleicht der Urheber. Zu gut dazu sei er nicht.