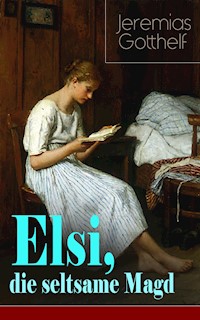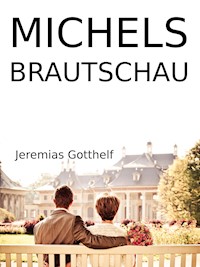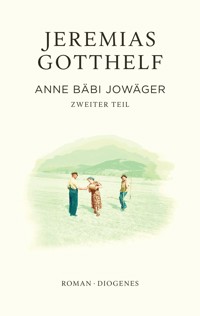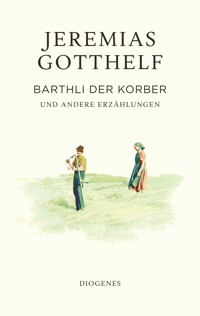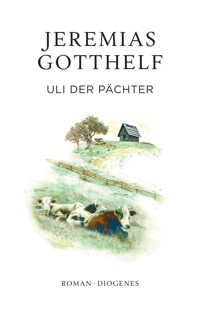
32,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Gotthelf Zürcher Leseausgabe
- Sprache: Deutsch
Uli ist kein Knecht mehr, sondern Pächter. Und Vreneli ist seine Frau. Trotzdem will er nicht richtig froh werden. Zu viel lastet auf ihm. Wie soll er seinen Hof halten können, wenn alles so schwierig und teuer ist? Verzagtheit und Missmut packen ihn, er gerät in die Fänge von Geschäftemachern, und auch dem Wein spricht er wieder zu. Vreneli hält zu ihm, trotz allem. Uli muss als Pächter von Neuem lernen, das Leben zu meistern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 784
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Jeremias Gotthelf
Uli der Pächter
Ein Volksbuch
roman zürcher ausgabe
Herausgegeben von Philipp Theisohn Mit einem Nachwort von Monika Helfer
Diogenes
Vorwort
Der erste Teil dieses Buches enthielt die Geschichte eines Knechtes, welcher durch Treue aus einem Knechte zum Meister wurde. Dieser zweite Teil enthält die Geschichte eines Meisters, welcher in den Banden der Welt lag und welchen der Geist wirklich frei machte. Der erste Teil war den einen zu weltlich; was nun dieser Teil den einen oder andern sein wird, lässt der Verfasser dahingestellt. Der Verfasser behauptet nicht, das Rechte getroffen, sondern bloß das: mit ehrlichem Willen nach dem Rechten gestrebt zu haben. Ob das Publikum billig und damit zufrieden ist, weiß der Verfasser nicht. Mag es aber nun so oder anders sein, so ist das sein Trost, dass ihm, so Gott will, nirgends ein gedankenloses oder feiles Segeln mit herrschenden Winden wird nachgewiesen werden können.
Lützelflüh, den 13. Oktober 1848
Jeremias Gotthelf
Kapitel 1
Eine Betrachtung
Drei Kämpfe warten des Menschen auf seiner Pilgerfahrt. Drei Siege muss er erkämpfen, will er dem vorgesteckten Ziele sich nahen, bei seinem Scheiden sagen können: Vater, es ist vollbracht, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ineinander hinein schlingen sich die drei Kämpfe; doch bald der eine, bald der andere drängt sich in den Vordergrund, bald nach dem Lebensalter, bald nach den Umständen. Wenn der Frühling des Lebens blüht, die Kräfte sich entfalten, das Herz von Wünschen schwellt, die Seele zum Fluge nach oben die Flügel regt, aus dem sichern Hafen des väterlichen Hauses hinaus ins Leben, hinaus auf des trügerischen Meeres Höhe das Schifflein strebt, da wenden die reinsten und edelsten Kräfte sich dem Suchen einer Seele zu, im Ringen nach ihrem Besitz erglänzt zum ersten Male des Mannes göttliche Gestaltung. Es lebt ein tief Gefühl im Manne, und Gott hat es gepflanzt in den Mann, dass er, um zu kämpfen mit des trügerischen Meeres wilden Wellen, um zu besiegen die andringende Welt, eine zweite Seele bedürfe; dass er ein Weib bedürfe, um sich in dieser Welt zu schaffen und zu gründen ein bleibend Denkmal, die schönste Ehrensäule: eine tüchtige Familie, fest gewurzelt in der Erde und kühn und fromm hoch zum Himmel auf die Häupter hebend. Hat er die Seele gefunden, mit welcher vereint er sich getraut ein Haus zu erbauen, eine feste Burg gegen die lockende, andringende Welt, dann will er diese Seele an sich fesseln durch der Ehe heilig Band, welches nur Gott lösen soll. Nur wer des Lebens Bedeutung und seinen Ernst verkennt, das Leben hält für ein Schaukeln auf den Wellen der Lust ohne Ziel und Zweck, nur der verkennt der Ehe hohe Bedeutung, verhöhnt sie als veraltet, als eine morsche Schranke gegen wahre Kultur. Der ist dann aber auch kein Sohn der Ewigkeit, sondern ein Kind des Augenblicks; wie ein Irrlicht hüpft im Moor, so ist sein Wandel durchs Leben, wie ein Irrlicht versinkt im Moor, so sein Leben im Schlamme der Welt.
Hat er das Gefundene errungen, mit sich vereint durch der Ehe heilig Band, dann hat er den ersten Sieg erkämpft. Aber wehe dem, der mit dem Siege allen Kampf zu Ende glaubt, das Wahren des Sieges ist oft schwerer als desselben Erringen, wie ein rascher, kühner Anlauf leichter ist als ein fest und standhaft Ausharren; diesen Wahn hat mancher Sieger mit Schmach und Tod gebüßt. Jetzt gilt es, die Ungleichheiten der Seelen auszugleichen, vor der Selbstsucht sich zu hüten und das innere geistige Band, die Liebe, zu wahren, die da langmütig ist und freundlich, sich nicht aufbläht, nicht ungebärdig stellt, nicht das Ihre sucht und sich nicht verbittern lässt.
Dem Ehemann beginnt so recht eigentlich der Ernst des Lebens, der Kampf mit der Welt. Wahrscheinlich hat er schon lange mit ihr gehändelt, manch Scherzspiel mit ihr getrieben, aber so recht mit Bewusstsein beginnt doch erst jetzt die ernste Schlacht.
Dem Feldherrn vor beginnender Schlacht gleicht der Hausvater am Morgen nach geschlossener Ehe. Wenn bei grauendem Morgen am Schlachttage aus seinem Zelte der Feldherr tritt, ist ernst bewegt sein Herz, prüfend schweift sein Auge durchs Gefilde, ermisst die Höhen, erforscht die Schluchten, erwägt die Kräfte, die ruhen hier und dort, schlummern vielleicht den letzten Schlaf, die bald sich messen werden in graulichem Gewühle. Er überschlägt den Anfang und denkt an das Ende. Während er sinnt und denkt, erwacht um ihn die Welt, Schildwachen rufen, Tritte rasseln, Pferde wiehern, Bajonette blitzen in der aufsteigenden Sonne, Rauch steigt auf und zum Aufsitzen ruft die Trompete die Reiter. Des Tages Getöne verbreitet sich, es erwacht aus seinen Sinnen der Feldherr. Er rafft sich zusammen, ordnet die Kräfte, ruft zur Schlacht. Über dem Gewirre wacht sein Auge, mit starker Hand lenkt er dasselbe, rollt es auf, zieht es zusammen, einem Netze gleich, in welchem der Fischer seine Fische fängt. Er beginnt den Kampf, die Kräfte messen sich, wie ein Wirbelwind wirbelt die Schlacht durch Schluchten, Felder und Berge. Der Donner der Kanonen erfüllt die Luft, blutrot färben sich die Waffen, schwarz und dunkel, ein grausig Leichentuch, legt der Rauch sich über Leichen und Lebendige, verhüllt den Augen der Gebietenden das Wogen der Schlacht. Da bedarf der Feldherr ein scharfes Auge, eine feste Seele, um mit starker sicherer Hand die Wirbel der Schlacht zu schürzen und zu lösen nach seinem Sinne, sie zu behalten in seiner Macht, dass das Ende der Sieg ist und gebunden und ohnmächtig der Feind zu seinen Füßen liegt.
Glänzt endlich auf des Siegers Haupt des Sieges Krone, so gilt es, sie zu bewahren, nicht ein Opfer seiner Siege zu werden, schmählich zu enden. Es ziehen Siege und Kronen gar zu leicht ins Herz hinein, schwellen das Herz, regieren das Herz, trüben den Blick, lähmen die Hand, jagen den Sieger in den Untergang, das Ende so vieler Sieger.
Wie der Feldherr vor die Schlacht, trittet vor die Welt der junge Hausvater. Er will ihr abringen eine sichere Stätte, Platz zu einer Ehrensäule, er prüft die Welt, misst seine Kräfte, beginnt endlich den Kampf mit den vorhandenen Kräften und im Vertrauen auf sie. Tausende werden rasch niedergerannt von der Welt, verlieren alsbald Mut und Leben; sie waren nicht befähigt zum Kampfe, ihr Dasein war und ist ein trostloses. Viele ringen immer und kommen nimmer zum Siege. Ihr Dasein ist ein mühseliges, das Schöpfen in ein durchlöchertes Fass, das Rollen des Steines, der immer wieder niederrollt, den Berg hinan, zu einem festen Sitz kommen sie nicht, die Krone der Ehre schmückt ihre Scheitel nicht, der Welt ringen sie nichts ab, eitel und voll Mühe war ihr Leben, und keine Beute ward ihnen, weder eine äußere noch eine innere. Andere dagegen scheinen glücklich, siegreich zu kämpfen mit der Welt, große Beute von allen Seiten fällt ihnen zu, aber diese Beute ist eben das trojanische Pferd, welches die Mauern ums Herz sprengt, dem verräterischen Feind den Zugang öffnet. Wie die Siege dem Sieger zieht sie ein in des Eroberers Herz, wirft dort zum Herrn sich auf, zum Knechte wird der Mensch, zu immer neuen Kämpfen hetzt sie den armen Sklaven, jagt ihn gleichsam alle Tage Spießruten, was er auch erbeuten mag von der Welt, ihren Schätzen und Genüssen, Ruhe und Genügen findet er nimmer, jeder neue Gewinn ist Öl in die alte Gier und Glut, neue Jagd durch die Wüste beginnt an jedem neuen Morgen, bis er endlich elendiglicher verendet als der, welcher der Welt nichts abgewonnen hat. Und so wird es jedem ergehen in höherem und geringerem Grade, augenscheinlicher und minder bemerklich, in welchem nicht ein dritter Kampf sich erhoben hat und siegreich, nicht zu Ende geführt, aber doch dem Ende zugeschritten ist. Er ist der höchste der Kämpfe, aber auch der schwerste, es ist der Kampf mit dem eigenen Herzen, der Kampf des neuen Menschen mit dem alten, der Kampf der Geister mit der Materie. Glücklich gefochten, bringt er aber auch den höchsten Lohn: hier ein Genügen, welches über allen Verstand geht; drüben die Krone der Gerechtigkeit, die Kampfgabe des ewigen Jerusalems.
Im Herzen steckt von Anfang an und von Natur der alte Mensch, der da böse ist und verkehrt, Gott und den Nächsten hasst, sich allein liebt, lüstern ist nach der Welt, ihren Genüssen und Schätzen, der da einen Boden hat für alles Unkraut empfänglich, nicht für die Lust allein, absonderlich auch für Neid, Zorn, Hass und Rachgierigkeit. Dieser alte Mensch, vom Fleische geboren, ist es, der von der Welt sich locken lässt und gefangen genommen wird dem Affen gleich, dem man in einer Flasche Nüsse beizt; in den engen Hals der Flasche zwingt wohl der Affe die leere Pfote, aber die mit Nüssen gefüllte bringt er nicht durch den engen Hals, die Nüsse fahren lassen will er nicht, lässt lieber Freiheit und Leben. Dieser alte Mensch ist der Zwillingsbruder der Welt draußen; je mehr derselbe der Schwester abgewinnt, desto üppiger schwillt er auf, desto üppiger wird die Welt drinnen, desto größer ihre Gewalt, desto grausiger ihre Tyrannei über die arme Seele, wenn nämlich der dritte Kampf nicht entbrannt ist um die Emanzipation der Seele oder des neuen Menschen, der Kampf um das Himmelreich. Im dritten Kampfe soll eben nämlich der Himmel gewonnen und dieser gezogen werden ins Herz hinein, dass die Welt nicht Platz habe darin, dass man sie hat, als hätte man sie nicht, sie genießt, als genösse man sie nicht, übrig haben davon und Mangel leiden kann daran und beides unbeschwert. Der alte Mensch ist der erste, der Erstgeborne, wenn man will. Es schlummert aber im gleichen Gehäuse ein zweiter Mensch, geschaffen nach dem Ebenbilde Gottes, aber gefesselt in dunkler Höhle, gefangen gehalten durch den alten Menschen, dem alten Barbarossa ähnlich, der da auch schlummern muss in dunklem Berges Schoße, bis ihn ein junger Tag zu frischem Heldentume weckt. Der neue Mensch muss eben auch geweckt werden, und zwar durch den Geist, dessen Brausen man wohl hört, aber von dem man nicht weiß, woher er kommt noch wohin er fährt. Auf ihm liegt, schwerer als der schwerste Stein auf märchenhaften Schätzen, Moder und Schutt von Welt und Sünde. Gewaltiger als das Wehen der Winde, welche das Gebirge sprengen wollen, das auf den himmelstürmenden Riesen liegen soll, muss der Hauch des Geistes sein, welcher wegfegt Moder und Schutt von Welt und Sünde, hebt den Stein vom engen Gehäuse, in welchem gefesselt liegt der neue Mensch, ihn kräftigt, dass er sich erhebt, den Kampf mit dem alten Menschen beginnt um den Besitz des Herzens, um des Lebens Ziel und Richtung.
Ohne Gott kann hier nicht gekämpft werden, am allerwenigsten glücklich, aber wo Gott mitkämpft, muss der Kampf zum Siege führen. Doch nie zum vollständigen, solange in sterblichem Gehäuse die Seele wohnt, erst im Grabe, das ist des Christen Hoffnung, versenkt er mit dem Leibe auch Sünde und Sündhaftigkeit. Der alte Mensch, wenn auch vom Throne gestoßen, ergibt sich auch in Fesseln nicht, erhebt alle Tage sich neu, gleich dem Satan, gegen Gott, wie hoffnungslos das Beginnen auch ist. Mit dem letzten Atemzuge erst legt er sich in ewige Ohnmacht. Darum bleiben fort und fort so bedeutsam die Worte: Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallet. Je schwächer der Bruder darum ist, desto mehr verliert die Schwester, die Welt draußen, ihre Macht über den Menschen, sie hat nicht mehr Platz im Herzen, sie regiert nicht mehr, sondern wird regiert. Der Kampf mit ihr nimmt in dem Maße ab, als der gegen den alten Menschen sich dem Siege nähert. Wer also kämpfet, der ist ein guter Kriegsmann Jesu Christi, darf hoffen, gekrönt zu werden; des Lebens Bestimmung hat er erfüllt, das ewige Leben ergriffen, darf befehlen seinen Geist in des Vaters Hände.
O groß und wunderbar ist des Lebens Bedeutung und eng und schwer durch das Leben der Weg, der zum Ziele führt! O und wie leichtfertig und vermessen schlendern die Menschen durchs Leben, als ob sie weder Ohren noch Augen hätten, keinen Verstand, die Tage mit Weisheit zu zählen, als ob sie hundert Leben hätten, hundertmal von vornen wieder beginnen könnten, wenn eins in Liederlichkeit, Torheit und Sünde schmählich zu Ende gelaufen, als ob der Glaube abgeschafft sei und erlaubt, nach vieltausendjähriger Erfahrung erst sich zu bekehren, durch hundert verlorne Leben endlich klug geworden.
Heil denen, welchen in diesem Leben Augen und Ohren aufgehen und das rechte Verständnis kommt, dass mitten in der Welt der Himmel errungen werden muss, wenn wir die Liebe bewahren, die Welt überwinden, den Himmel jenseits schauen wollen, dass wir Gott hienieden finden, unser Herz seine Herberge werden muss, wenn er droben uns herbergen, unser Teil werden soll in alle Ewigkeit.
Kapitel 2
Der Antritt der Pacht
Dieses alles dachte Uli nicht, als er am Morgen nach seiner Hochzeit vor das Haus trat, unwillkürlich am Brunnen vorbei, hinter das Haus schritt, von wo man einen großen Teil des Hofes übersah; aber Ähnliches regte sich doch in ihm. Ein Weib hatte er errungen, ein besseres gab es nicht, das wusste er. Aber vor ihm stund nun die Welt, an dieser besaß er so viel als nichts, das bedachte er und bange ward es ihm. Er hatte sie angefasst, diese Welt, den Kampf mit ihr begonnen, die Pacht um ein großes Gut war geschlossen, in wenig Tagen musste er sie antreten, übers Jahr mehr als achthundert Taler Zins ausrichten, und diese achthundert Taler überstiegen sein Vermögen. Woher sie nehmen, wenn das Glück nicht auf seiner Seite stund, wenn die Welt stärker war als er, ihm nichts ablassen wollte von ihren Schätzen, ihm entriss, was er bereits hatte? Bangen kam über ihn, des Bangens Unruhe fuhr ihm in die Glieder, trieb ihn durch die Ställe, trieb ihn ums Haus herum, bis er wieder stillestund hinter demselben, Acker und Wiesen rechnend übersah, rechnete und rechnete, dass ihm Hören und Sehen verging darob, dass er nicht wusste mehr, stund er auf dem Kopfe oder auf den Füßen, die Rechnungen sich verschlangen ineinander, dass er nicht mehr wusste, wo der Anfang war, geschweige dass er das Ende finden konnte. Plötzlich wurde er umschlungen, hochauf fuhr er, als ob es wirkliche Schlangen wären. Es war auch eine an Klugheit, aber eine ohne Gift und Galle, wie wir jedem Christen eine ins Haus wünschen möchten, es war Vreneli, das freundlich vor ihn trat, traulich ihm ins Auge sah, beide Hände ihm auf die Schultern legte und sagte: »Aber Uli, Uli! Hast die Ohren verloren? Das Frühstück steht auf dem Tische, dreimal rief ich dir und allemal lauter und allemal umsonst. Uli, lieber Uli, fange mir nicht schon an mit Sinnen und Rechnen, weißt nicht, wie leicht man sich erst verrechnet und dann hintersinnet? Lass uns beten und arbeiten, das andere auf Gott stellen, der soll unser Rechenmeister sein. Der wird schon rechnen, dass es gut kömmt, und der böse Kummer und das plaghafte, ängstliche Wesen, welches immer auf dem Trocknen ertrinken will und an der Sonne erfrieren, kommen nicht an uns. Uli, lieber Uli, wollen wir?«, frug Vreneli fast wehmütig und streckte ihm die Hand dar. Uli schlug ein, folgte zum Frühstück, aber heiter ward doch sein Gesicht nicht.
Wahrscheinlich wusste er auch kaum so recht, was er seinem Weibchen versprochen hatte. Es gibt gar viele Menschen, welche sich von einem Gedankenzuge, der sich ihrer bemächtigt hat, kaum mehr losmachen können. Der Gedankenzug reißt sie dahin, und wenn sie schon Rede und Antwort geben, so wissen sie doch nicht worauf und was. Sie sind wie solche, die in einem Eisenbahnzug dahinfahren, und ihre Lieben schreien ihnen nach und sie schreien den Lieben zurück, aber keines weiß, was geschrien wird.
Es ist aber wirklich dem guten Uli zu verzeihen, wenn seine Gedanken gefangen und unwillkürlich in einer Richtung dahingerissen wurden; seine Lage war auch darnach. Vor ihm stund in nächster Nähe der Tag, wo er, wie man heutzutage zu sagen pflegt, ein Geschäft übernehmen sollte, welches weit, weit über sein Vermögen, das er so schwer und langsam erworben, ging, ihn in Jahresfrist ohne Wunder und absonderliche Gräuel zugrunde richten konnte. Nun, vielen hätte dieses nichts gemacht. Hunderte springen, wenn sie nur irgendwie ein Geschäft erblicken, mit beiden Beinen hinein. Tausende gar mit dem Kopf voran, ohne sich zu kümmern, mögen die Beine nach oder nicht. Uli gehörte nicht zu dieser Rasse. Uli hatte eine der bedächtigen Berner-Naturen und war nicht demoralisiert durch den Zeitgeist, d.h. durch den Schwindelgeist der Zeit. Er besaß tausend Gulden, zirka sechshundert Taler. Vermögen legt der Berner gerne auf solides Unterpfand an, ehedem bloß auf dreifaches, jetzt nimmt man schon mit nur doppeltem vorlieb. Uli aber setzte das seine auf Regen und Sturm, auf Hagel und Dürre, auf Blitz und Seuche. Nicht bloß konnte ihm alles verloren gehen, sondern namentlich wenn Unglück in die Ställe brach, konnte er zwei-, dreimal mehr verlieren, als er besaß. Dann war nicht bloß der beste Teil seines Lebens scheinbar verloren, sondern der Rest desselben schien kaum hinreichend, sich dürftig von dem Schlage zu erholen. So ist es wohl erlaubt, dass es einem bange wird ums Herz, dass Vertrauen und Sorgen miteinander ringen. Wem es nicht so geht, der müsste wirklich sehr leichtfertig, neumodisch genaturt sein.
Die Vorbereitungen zur Übernahme wurden allmählich getroffen. Joggeli und seine Frau ließen nach und nach in den Stock schleppen, was sie behalten wollten, und Vreneli half treulich der Base einhausen, war ihr Kind nach wie vor, und wenn es auch das Eigene darob versäumen musste, verzog es doch keine Miene. Es fanden sich eine Unmasse von Dingen vor, welche Uli nicht brauchte und Joggeli nicht. Diese wurden sämtlich in eine große Kammer zusammengetragen und aufgestapelt. An einer Steigerung hätte man daraus eine Summe gelöst, welche eine herrliche Erquickung für den Baumwollenhändler gewesen wäre. Aber auf der Glungge sollte keine Steigerung abgehalten werden. Überhaupt in allen soliden Häusern liebt man das Alte mehr als das Neue, Kleider verkauft man nicht. An jedes Stück knüpfen sich Erinnerungen, und an diese Erinnerungen knüpfen sich Lehren und Erfahrungen, und gar mancher Bauer zieht aus seiner Rumpelkammer und allen Winkeln seines Hauses weit mehr Weisheit ein als englische Lords und deutsche Gelehrte aus den kostbarsten und größten Bibliotheken, angefüllt mit Büchern, gebunden in Schweinsleder oder halb oder gar ganz Franzband.
Das Inventar von dem Geräte und dem Viehstand war groß, und die Schatzung, obgleich alles äußerst billig, machte Uli die Haare zu Berge stehen. Man denke sich zum Beispiel nur acht Kühe und jede durchschnittlich zu sechzig Talern. Dieses Inventar überstieg mehr als um das Vierfache Ulis Vermögen, musste zu vier Prozent verzinset und später allfälliger Abgang ersetzt werden. Uli hatte großen Vorteil dabei, aber bedenklich war es doch in alle Wege.
Endlich kam der verhängnisvolle 15. März, an welchem, wie man zu sagen pflegt: Uli Nutzen und Schaden angingen. Es war ein schöner, heller Märztag, und doch kam er allen trüb und unheimlich vor. Es tat allen weh, die Alten ausziehen zu sehen. Als man ihr Hinterstübchen ausräumte und namentlich das große Bett hinüberschleppte, war es fast, als trage man ihnen einen großen doppelten Sarg voran. Die Base hatte den ganzen Tag das Wasser in den Augen, aber lauter heitere, aufmunternde Worte im Munde, sie hatte eine Gewalt über sich, welche allen Gebildeten zu wünschen wäre. Man sah es ihr an, sie betrachtete dieses Überziehen aus dem großen Hause in das kleine als eine Vorübung auf das Beziehen des allerkleinsten Häuschens, welches Armen und Reichen aus wenig Brettern zusammengeschlagen wird. In diesem kleinen Häuschen schläft man auch, doch wie wohl oder wie übel: das weiß Gott. Als aber das alte Ehepaar zum ersten Mal in ihrem großen Bette im Stocke schlafen wollte, da wollte der Schlaf nicht kommen, er war nicht gewohnt, sie hier in diesem Stübchen zu suchen. Ob Joggeli es zürnete, wissen wir nicht, es schien fast, als sei die Nacht ohne Schlaf ihm willkommen, um seiner Alten alle ihre Sünden bis weit in die Urwelt hinauf vorzuhalten und sie für alle Folgen derselben verantwortlich zu machen, nicht bloß bis auf Kinder und Kindeskinder, sondern bis drei Tage nach dem Jüngsten.
Die gute Alte schwieg lange, endlich lief es ihr doch über. »Ich hoffte«, sagte sie, »wenn dir die Last abgenommen werde, so werdest du einmal mit Gott, dir selbst und der Welt zufrieden. Aber wie ich leider sehen muss, bleibst du immer der gleiche Stürmi. Du hättest eigentlich zu einem armen Mannli, einem Korbmacher oder Besenbinder geraten und dreizehn oder neunzehn lebendige Kinder haben sollen, dann hättest du klagen können, vielleicht dass Gott es gehört hätte. Aber jetzt ist’s nur ein böser Geist, der dich immer klagen lässt, und der ist mit mir hinübergekommen und wird bei uns bleiben sollen. Ich muss mich versündigt haben, dass ich mich damit muss plagen lassen. In Gottes Namen, ich muss es so annehmen. Unser Herrgott wird doch hoffentlich bald finden, jetzt sei es Zeit. Warum ich nicht von dir lief, als ich noch junge Beine hatte, die laufen konnten, und so weit weg, als sie mich tragen mochten, das begreife ich noch auf die heutige Stunde nicht. Jetzt trüge Fortlaufen nicht viel mehr ab, und meine alten Beine trügen mich kaum so weit, dass mir dein Stöhnen und Klagen um nichts oder wieder nichts nicht noch zu Ohren käme, besonders wenn der Wind ein wenig ginge.« Das wollte Joggeli doch fast gemühen. »Wer laufen will, kann«, sagte er, »ich will niemand dawider sein, und mit Nachlaufen werde ich niemand plagen. Wenn ich schon wollte, täten es meine Beine nicht, wenn andere ausgestanden hätten, was sie, sie wären auch froh, an die Ruhe zu kommen.« Ihm wäre es je eher je lieber, Gutes hätte er nie viel gehabt, und was ihm noch warte, könne denken, wer Verstand habe. Jetzt vermöchte er doch noch seinen Sarg schwarz anstreichen zu lassen, gehe es länger so, sei es wohl möglich, dass man froh sei, wenn man noch so viel bei ihm finde, um die ersten besten rohen Bretter zu bezahlen. »Du bist doch immer der Wüsteste, wirst dich versündigen wollen, dass es keine Art hat«, sagte seine Frau. »Schweigen wird am besten sein, es weiß sonst kein Mensch, was du noch stürmst.« Darauf drehte die Mutter sich gegen die Wand und blieb stumm, Joggeli mochte gifteln und klönen, so stark und so lange er wollte.
Drüben im großen Hause ging es anders zu. Die Bauart des Hauses brachte es mit sich, dass die Meisterleute im Hinterstübchen wohnen mussten. Dasselbe war gleichsam des Hauses Ohr, jeder Schall aus Kammern und Ställen, von vornen und hinten, schien dort landen zu müssen; das ist kommod für einen rechten Hausmeister!
Uli und Vreneli mussten dieses Stübchen auch beziehen, aber sie taten es ungern, sie schämten sich fast, als Knecht und Magd nun zu schlafen, wo früher der Meister und die Meisterfrau. Sie kamen sich wirklich im Stübchen als so gar nichts vor, und auch bei ihnen wollte der Schlaf nicht einbrechen. »Ja, ja«, stöhnte Uli, »es wäre schön hier und im Winter b’sonderbar warm, da ließe sich sein. Wenn es nur immer währte, aber das Ändern tut weh. Wenn man am Ende doch wieder in eine kalte Kammer muss, so wäre es hundertmal besser, man hätte sich nie an ein warmes Stübchen gewöhnt.« Aber zwängt sei zwängt, und jetzt müsse man es nehmen, wie es sei. So jammerte Uli ähnlich wie Joggeli, der Unterschied war bloß der, dass sein Jammer nicht aus einem zähen, verhärteten Herzen kam, sondern aus einem jungen, warmblütigen, demütigen, welches sich in seine höhere Stellung nicht finden konnte. In einem solchen finden gute Worte noch gute Stätte. An solchen ließ es auch Vreneli nicht fehlen, tröstete, so gut es konnte. Sprach vom Werte des Hofes, von seinem guten Willen, von dem Vertrauen zu Gott, der alles wohl machen werde, dass Uli die Ruhe kam und er andächtig mit Vreneli beten konnte; darauf kam leise der Schlaf gezogen, hüllte die beiden in seinen dicksten Schleier, und als die Sonne kam, schlummerten beide noch süß und fest darin, und lange ging es, bis ihre Strahlen die Schläfer zu wecken vermochten. Hui! Wie beide auf die Füße fuhren, als vor ihren langsam sich öffnenden Augen plötzlich der helle Tag stund in vollem, sonnigem Gewande. Draußen polterte das Gesinde, prasselte das Feuer, gackelten bereits die Hennen, und Meister und Meisterfrau hatten sich noch nicht gerührt. Wohl, da schämten sie sich und durften fast nicht aus dem Stübchen. Sie hatten sich wohl schon mehr als einmal verschlafen, aber so ungern es wirklich doch nie gehabt als heute. Wie die Leute das auslegen würden, dachten sie.
Der Frühling ist eine herrliche Zeit, eine ahnungsreiche, wonnevolle. Darüber werden doch wohl die Parteien von allen Farben einig sein, wie weit sie sonst auseinandergehen mögen! Wie prosaisch und trocken ein Bauer auch sein mag, im Frühling wird ihm doch das Herz größer und er denket weiter als die Nase lang. Er hat es seinen Äckern, Wiesen und Gärten gegenüber wie ein Vater, der mitten in einem Dutzend blühender Kinder steht. »Was wird aus ihnen werden, was werden sie für Früchte tragen?«, muss er unwillkürlich denken. Wie der Kinder Gesichter blühen, Gesundheit ihre Glieder schwellt, blühen und schwellen Freude und Hoffnung in seiner Seele. So hat es auch der Landmann, besonders der junge, welcher noch nicht manchen Frühling auf eigene Rechnung erlebt hat. Jede Pflanzung wird ihm zum Kinde und je üppiger sie grünt und blüht, desto üppiger grünen und blühen seine Hoffnungen. Der Frühling, von welchem wir sprechen, war ein ganz eigen von Gott gespendeter, als wollte er die Probe machen, ob die Menschen so weit in der Aufklärung gekommen, dass sie zu begreifen im Stande seien, sie selbst könnten keinen solchen machen, auch sei es unmöglich, dass er von ungefähr käme, sondern dass er von Gottes väterlicher Hand müsse gegeben sein.
Mit Fleiß und Kunst bestellte Uli Saat und Acker, und Vreneli machte nicht bloß fast alleine seine schwere Haushaltung, sondern half doch noch draußen, dass männiglich sich wunderte, sorgte für den Garten, dass Kraut darin wuchs und Salat nebst allerlei Kräutlein, welche einer vernünftigen Suppe wohl anstehen und sonst in gesunden und kranken Tagen gut zu gebrauchen sind. Vrenelis rührigem Treiben sah die Base mit der größten Freude zu. Alle Tage war sie im Garten oder guckte wenigstens über den Zaun, besah die andern Pflanzungen, und häufig kam sie, setzte sich zu Vreneli, half ihm das Essen rüsten oder sagte: »Gehe nur, wenn du was zu machen hast, ich will dir zum Feuer sehen und sorgen, dass das Essen nicht anbrennt.« Wollte Vreneli sich wehren oder danken, so meinte sie: »Ich habe Ursache zu danken, dass du es annimmst. Was meinst, müsste die Langeweile mich nicht töten, wenn ich auf einmal von allem käme und nichts mehr anrühren dürfte?« Kam sie dann heim, hatte sie zumeist ein lachend Gesicht (denn dass es drüben so gut ging, freute sie sehr, und was sie im Herzen hatte, zu verbergen, war ihr nicht gegeben) und sagte wohl zu Joggeli: »Gottlob, es geht da drüben gut, besser noch, als ich gedacht. Wenn die es nicht zu was bringen, so gelingt es niemanden mehr. Vreneli läuft, als wenn es Räder unter den Füßen hätte, und Uli schafft, als sei er aus lauter Uhrenfedern zusammengesetzt. Es ist mir ein recht schwerer Stein ab dem Herzen, hätte mir ja mein Lebtag ein Gewissen machen müssen, wenn es nicht gut gegangen wäre.«
Joggeli, welcher wohl auch herumgetrippelt war an seinem Stocke und hinter Zäunen und Bäumen hervor dem Treiben zugesehen hatte, zog auf solche Reden sein grämliches Gesicht und meinte: »Glaub es, wie sollte es anders sein, wenn ihnen alles hilft, die Fische in das Netz zu jagen, sogar das Kraut in den Hafen. Hätte man für mich halb gearbeitet und gesorget wie für sie, ich wäre noch einmal so reich. Aber mir hat niemand helfen wollen, ja, wenn man mich hätte auf die Gasse bringen können, man hätte es getan und dazu noch den Hals voll gelacht und dazu noch die, denen es dabei am übelsten gegangen wäre, und zuletzt hätte ich denn doch an allem schuld sein sollen. Ja, die Welt ist bös. Trau, schau wem, heißt es nicht umsonst.« »Ja, da hast einmal recht«, antwortete die Base, »die Welt ist wüst und Trauen bös, aber von den Allerwüstesten bist du, und wegen Trauen solltest schweigen. Wenn das Gewissen nicht wäre und deine Frau, weiß Gott, was du für ein Unflat geworden wärest. So alt bist schon und wirst doch noch alle Tage wüster, denkst nicht an deine arme Seele und was Gott mit ihr anfangen soll.«
So verschiedene Gedanken wachsen bei gleicher Witterung in den Herzen der Menschen, es ist aber eben der Grund der Herzen verschieden. Giftkräuter wachsen auf dem einen, Heilkräuter treibt der andere. Du mein Gott, wie sollte es dem Menschen, welcher den Gärtner vorstellen sollte, in seines Herzens Garten so himmelangst werden, wenn er in seinen Garten kömmt und es weht ihm entgegen ein giftiger Hauch und gleich Schlangenaugen glitzern ihm lauter Giftkräuter entgegen! Ach Gott, nein, denen wird gar nicht himmelangst, die bleiben kaltblütig, ja, sie haben noch Freude und Spaß an den giftigen Kräutern, lassen sie nicht bloß nach Belieben wuchern, sondern pflegen sie noch sorgsamst, als ob’s die kostbarsten Pflanzen wären, und je üppiger sie aufschießen, mit desto größerem Behagen weisen sie als große Raritäten dieselben vor, allen, welche sie zum Betrachten herbeibringen können.
Fröhlich wie im Fluge rannen die Tage dem jungen Ehepaare dahin, wie es zu gehen pflegt, wenn voll Arbeit die Hände sind, voll Sinnen der Kopf, die Arbeit wie ein Uhrwerk läuft und das Erdachte zur Tat wird ohne Säumnis und Hindernis. Es war, als ob der liebe Gott erst nachsehe, was Uli meine und Vreneli sinne, ehe er das Wetter mache, regnen lasse oder die Sonne scheinen. Dachte Uli, jetzt wäre ein warmer Regen gut, so kam ein warmer Regen, man wusste gar nicht, woher; und wenn er dachte, jetzt ist’s genug, die Sonne wäre wieder gut, so ging der Regen, man wusste nicht, wohin, und die Sonne war da. Wer auf Sonne und Regen nur des Spazierens wegen achtet und nicht weiß, welche Bedeutung beide für den Landmann haben, der weiß gar nicht, welch Unterschied, wir wollen nicht sagen im Gedeihen der Pflanzen, sondern im Betrieb der Arbeit ist bei günstigem oder ungünstigem Wetter.
Es gibt Jahre, in welchen man bei gedoppelter Anstrengung und Kosten nirgends hinkömmt, immer im Rückstand ist, alles pfuschen muss, wenn man das Dringlichste machen will, ehe der Winter wieder da ist; und wiederum Jahre, wo alles geht wie auf einer Eisenbahn, nirgends ein Rückstand ist, Hasten und Jagen nie nötig sind, man Zeit zu allem hat und keinen Kummer vor dem Kommen des Winters, wo alles wohl gerät und wo es ist, als sei Meister der Mensch, seine Hand ein Zauberstab, sein Mund allmachtsvoll; er streckt die Hand aus, so springt der Schoß der Erde auf, er gebietet und es stehet da. Es sind gefährliche Jahre, diese Jahre, sie füllen wohl Spycher und Scheuren, aber sie leeren das Herz von Demut und Gottvertrauen, darum müssen dann wiederum böse Jahre kommen, wo der Mensch mit allem Fleiß und aller Kunst nichts machen kann. Sie leeren wohl Spycher und Scheuren, aber dafür füllen die Herzen sich wieder mit Demut, und die Augen gewöhnen sich wieder, nach oben zu sehen und das Gedeihen von Gott zu erwarten.
Uli wuchs sein Glück fast über das Haupt, dass er vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sah, d.h. vor lauter Hoffnungen und Erwartungen sein Glück nicht mehr berechnen konnte, weil es seine Rechenkunst zu übersteigen anfing; wie aber manchem über dem Essen der Appetit kommt und das Begehren nach immer mehrerem, so ging es auch Uli.
Uli hatte Ställe voll Pferde und Kühe übernommen, um eine sehr billige Schatzung. Bei allfälligem Abgeben der Pacht musste er wieder für die gleiche Summe Ware einliefern oder den Abgang ersetzen oder hatte den Mehrbetrag zu fordern. Er konnte also mit der übernommenen Ware ganz schalten und walten nach seinem Belieben, was bei seinem Abgang in den Ställen stund, wurde wieder geschätzt, und je nachdem es sich fand, fanden Vergütungen von der einen oder andern Seite statt.
Joggeli hatte auf dem Handeln nicht viel gehalten und selten zu rechter Zeit abstoßen können. Uli kalkulierte anders; er hatte namentlich zwei Pferde und drei Kühe übernommen, welche auf dem höchsten Punkte ihrer Reife stunden, behielt man sie länger, fielen sie stetig im Preise, verkaufte er sie, kaufte dagegen junge Tiere, so stiegen diese im Preise, bezahlten neben der Nutzung noch ihre Fütterung. Uli entschloss sich alsbald zu diesem Handel, Vreneli wehrte: »Recht hast«, sagte es, »aber merkt es Joggeli, so gibt es böses Blut, das muss man verhüten so lange als möglich; übrigens sind die Tiere so geschätzt, dass sie nach einem Jahre noch die Schatzung gelten, du also jedenfalls dazumal noch nichts daran verlierst.«
Geld hätten sie eben auch noch nicht so nötig, und im Fall es gegen Herbst rarer werden sollte, so könnte man immer noch verkaufen, nur nicht jetzt gleich, wo Joggeli es als eine absichtliche Prellerei ansehen könnte, wenn Uli vielleicht hundert Taler in Sack mache oder doch funfzig. Uli hatte recht, aber Vreneli noch rechter, und wie es geht in der Welt, das Beste geschieht am seltensten. Uli gewann ein Erkleckliches und meinte, Joggeli vernehme es nicht.
Aber die Leute, welche früher Joggeli alles zugetragen hatten, lebten noch, und wären sie gestorben gewesen, so wären aus ihrem Grabe herauf alsbald neue aufgewachsen, von wegen diese Sorte stirbt nie aus. Joggeli wusste richtig alsbald bei Heller und Pfennig, was Uli gelöst, das gab böses Blut. Die Base und Vreneli mussten viel leiden deretwegen. Uli hätte das nicht tun und den Frieden auch für etwas rechnen sollen, da Gott es so gut mit ihm meinte und er es so wenig nötig hatte. Das Frühjahr ist für den Landmann, welcher nicht Vorräte hat, sonst eine Zeit, welche Geld frisst oder zu Schulden nötigt, das war bei Uli nicht der Fall, seinen Handel nicht gerechnet. Vreneli löste aus Butter und Milch viel Geld, so dass nicht bloß die Hauskosten bestritten wurden, sondern hie und da noch ein großes Silberstück beiseite wanderte, um bei der Hand zu sein, wenn der Pachtzins gezahlt werden musste. Ferner wurde er mit einigen Prachtkälbern beschenkt. Diese mästete er, bis sie nahe an zwei Zentner wogen, half zuweilen sogar mit Eiern nach, welche er entbehrlich glaubte. Solche Kälber sind rar, gehen in die Bäder, nach Basel etc. und werden schwer bezahlt, so dass Uli wirklich Glück in allen Ecken hatte, das Geld nicht von ihm wollte, sondern immer vermehrt zurückrann, einer guten Taube gleich, welche nie ausfliegt, ohne mit einem neuen verlockten Tauber zurückzukehren.
Kapitel 3
Das Erntefest oder die Sichelten
Dennoch setzte sich Uli ein Wurm ins Herz, von wegen was er einnahm, das gehörte ihm, versteht sich; was er ausgeben musste, das verstand sich nicht von selbst, er kehrte es siebenmal um, bis er sicher war, dass er es schuldig sei. Es ist eine eigene Geschichte, wenn ein großes Bauernhaus sich umwandelt in ein bloßes Pächterhaus. Ein großes Bauernhaus, welches seit hundert und mehr Jahren im Besitz der gleichen Familie war, und absonderlich, wenn gute Bäurinnen darinnen wohnten, ist in einer Gegend fast was das Herz im Leibe; drein und draus strömt das Blut, trägt Leben und Wärme in alle Glieder; ist, was auf hoher Weide eine vielhundertjährige Schirmtanne den Kühen, unter welche sie sich flüchten, wenn es draußen nicht gut ist, wenn die Sonne zu heiß scheinet, wenn es hageln will oder sonst was im Anzuge ist, was die Kühe nicht lieben; ist der große, unerschöpfliche Krug, welcher nicht bloß einer Witwe und ihrem Söhnelein das nötige Öl spendet, sondern Hunderten und abermal Hunderten Trost und Rat, Speise und Trank, Herberge und manch warmes Kleid jahraus, jahrein. Ein solches Haus ist das Bild der größten Freigebigkeit und der sorglichsten Sparsamkeit. Da liest man die Strohhalme zusammen und zählt die Almosen nicht; da findet man die Hände, welche nie lässig sind im Schaffen und im Geben, denen zur Arbeit nie die Kraft ausgeht und nie die Gabe für den Bedrängten. So ein Haus ist ein wunderbar Haus, aber darum ist es auch eine Art heiliger Wallfahrtsort, wohin wandert, wer bedrängten Herzens ist, Not leidet am Leibe oder an der Seele. Zieht aber nun aus einem solchen Hause die Seele, d.h. die Bäurin oder der Bauer, so bleibt das Haus, und wie Kinder immer wieder zum toten Körper ihrer Eltern zurückkehren, forschen, ob die Seele nicht zurückgekehrt, so kommen die Leute immer und immer noch zum Hause, klopfen an die alte Türe, horchen, ob die alte treue Hand, die nie leer ward, nicht wieder da sei, Gaben spendend, begleitet von einem freundlichen Worte. Sind Bauer und Bäurin auch nur neben dem Hause in den Stock oder das Stöcklein gezogen, so gehen doch nur die Bekanntern oder die Bettler von Profession dahin, denn das Stöcklein ist kein Haus, es ist kein Stall daran und acht Milchkühe drinnen, sind nicht Keller, nicht Kammern, gespickt mit allen möglichen Vorräten. Zum Stöcklein gehört der Hof nicht, gehören die unzähligen Obstbäume nicht, gehören alle die reichen Quellen nicht, welche einer guten Bäurin Hand unerschöpflich machen. Es sind wohl Zuflüsse da, aber in bestimmten Grenzen und nach kleinerem Maßstabe. Zieht nun ein Pächter in das Haus ein, in die Schatzkammer des Hofes, den Wallfahrtsort der Armen und Bedrängten, so erlischt des Hauses Heiligenschein nicht alsobald, die Menge wallfahrtet noch immer zu demselben nach alter Gewohnheit, achtet nicht der geänderten Verhältnisse, macht ans Haus die nämlichen Forderungen. Die Menge nimmt an, die Guttätigkeit des Hauses sei Pflichtigkeit, welche jeder Bewohner, sei er wer er wolle, zu übernehmen habe. Geschieht dieses nicht vollständig, so spricht eine bedeutende Anzahl: »Ach Gott, da hat es auch Böses! Gottlob, dass ich so alt bin! Müsste sonst noch erleben, dass die guten Leute alle aussterben.« Eine andere Anzahl aber wird erbittert im Gemüte als wie über versagte Rechte und sagt: Das werde gehen und gehen, bis es endlich zu dem komme, wovon man immer rede, wie man auch von der Fasnacht rede, bis sie komme, dass man selbst zugreifen müsse, wenn man etwas erhalten wolle.
Ähnliches geschah in der Glungge. Vreneli war schon unter der Base Almosnerin gewesen, hatte dabei wohl auch unverschämten Bettlern einen Zuspruch gegeben, der ihnen ins Leben ging. Vreneli war jetzt seine eigene Almosnerin, machte wohl die Stücken Brot etwas kleiner als früher und Kleider oder Leinenzeug konnte es nicht austeilen, in einer neuen, jungen Haushaltung findet es sich nicht. Das ging bös an. Eine Bettlerin sagte Vreneli ins Gesicht: »Du warst von je ein Wüstes und gönntest keinem Armen was und wirst eher zehnmal schlimmer als einmal besser, von wegen es wird noch immer sein, wie es im Sprichwort heißt: Es ist keine Schere, die schärfer schiert, als wenn ein Bettler zum Herren wird.« Die meisten jedoch sagten Vreneli ihre Gedanken nicht an den Kopf heraus, aber sie verlästerten es desto jämmerlicher hinterwärts. Da sie nichts Böses wussten, ersannen sie um so Gräulicheres, namentlich machten sie geltend, wie sie den Hof fast um nichts hätten, den Kindern das Brot von dem Munde wegstöhlen, da sei es kein Wunder, wenn sie auch gegen die Armen wären wie Türken und Heiden. Schlecht sei schlecht und schlechte Leute habe es immer gegeben, aber Leute wie die, ohne Religion, seien doch noch nie erlebt oder erhört worden. Das alles tat Vreneli sehr weh, denn begreiflich wurden ihm alle diese Reden wieder hinterbracht und wahrscheinlich von denen selbst, welche sie gehalten, nur dass sie dieselben dann andern in den Mund legten. Doch sagte es davon Uli nichts, es verarbeitete das in seinem eigenen tüchtigen Sinn. Es dachte, Klagen trage nicht viel ab, warum ein zweites Herz betrüben, wenn man im Stande sei, es alleine zu verwinden; Hülfe leisten könne ihm Uli nicht, und alle Armen diese Wehtat entgelten lassen, wollte es nicht. Uli war wenig zu Hause und hatte den Kopf so voll von Geschäften und Gedanken, dass er gar keine Augen für diese Dinge hatte. Er war es gewohnt, Leute an den Türen zu sehen oder bei Vreneli in der Küche, achtete sich derselben nicht, frug nicht, was sie wollten, dachte gar nicht daran, dass es jetzt über ihn ausging und um seine Sache, ließ Vreneli also ganz gewähren nach seinem Belieben.
Der Heuet war vorbeigeflogen wie gewünscht; die Kirschen mit den Sperlingen im Frieden geteilt worden und die Ernte vor der Türe, ehe man sich dessen versah.
Die Ernte ist dem Landmann eine wichtige Zeit, eine heilige Zeit, von ihrem Ertrage hängt sein Bestehen ab oder wenigstens sein Wohlergehen. Er erkennt dieses auch an, und als Zeichen dieser Erkenntnis richtet er am Schlusse derselben eine Art von Opfermahlzeit aus; er speiset Arme, speiset und tränket Knechte, Mägde, Tagelöhner, deren Weiber und Kinder und den Fremdling, der da wohnet innerhalb seiner Tore. Solche Mahlzeiten bilden die Glanzpunkte in dem Leben so vieler; würden sie aufhören, wäre es über dem Leben gar vieler, als wenn alle Sterne erlöschen würden am Himmel. Es ist traurig, wenn über einem Leben keine andern Sterne stehen als Mahlzeiten, aber es ist dumm, wenn man ihnen Wert, Bedeutsamkeit absprechen will.
Die Ernte war prächtig, das Wetter schön, der Acker reich. Uli war glücklich, Joggeli knurrte. Er schrieb des Ackers Fülle Uli zu, der im Herbste dichter gesäet, besser hätte arbeiten lassen und im Frühjahr stark gewalzt. Einen solchen Acker voll Korn habe er sein Lebtag nie gehabt. Dicht wie die Haare einer Bürste stünden die Halme, und doch sei nicht einer gefallen. Der arme Joggeli bedachte nicht, dass säen und wässern der Mensch kann, aber nicht das Gedeihen geben. Ob dicht oder dünn das Korn auf dem Acker steht, ob aufrecht oder ob es auf dem Boden liegt, das ist Gottes Sache. Wer es zu treffen wüsste allezeit, wüsste, ob viel oder wenig säen gut sei, ein kalter Winter käme oder ein milder, der wäre eben ein Hexenmeister, aber solchen gibt es nicht, es ist ein Einziger, der dieses weiß, und der ist eben der, der kalte oder milde Winter macht, und der ist Gott.
Bei allem Segen hatte Vreneli das Herz voll Angst. Niemand besser als es wusste, was jene Opfermahlzeit, Sichelten genannt, verzehrt hatte unter Joggelis Regiment. Im ersten Teile vom Uli steht auch was darüber zu lesen. Dass sie dieselbe nicht nach dem gleichen Maße auszurichten vermöchten, das wusste Vreneli wohl, aber wie viel Uli abbrechen wolle und wie weit es das Verlästertwerden zu fürchten hätte, das wusste es nicht. Vreneli war tapfer, das wissen wir, aber es fürchtete sich doch vor böser Weiber bösen Zungen; es wusste, dass weiter, als die Blitze fahren, weiter als die Winde wehen, böser Weiber böse Töne tönen. Einige Wochen vorher hatte Vreneli Uli Milchgeld eingehändigt mit dem Bemerken, es werde eine Zeit lang nicht mehr viel geben, was es immer erübrigen könne an Milch, müsse zu Butter gemacht werden für die Sichelten. Darauf hatte Uli gesagt: »Allweg wird es was brauchen, aber den Narren wirst nicht machen wollen; ich bin nicht Joggeli und du einstweilen keine Bäuerin.«
»Weiß wohl«, sagte Vreneli. »Zu tun wie sie, kömmt mir nicht in Sinn, aber wenn man es nur gering macht, so wird es dir grauen. Du weißt gar nicht, was es braucht an solchen Tagen.« »He«, sagte Uli, »so macht man es noch geringer, bis es einem nicht mehr darüber graut. Gesetz darüber, wie viel einer ausrichten müsse, wird keines sein.« Dieses Gespräch hatte Vreneli nicht vergessen, darum war ihm so bange. Es sah voraus, dass Verdruss kommen müsse. Uli wollte es nicht gerne böse machen, abbrechen ganz und gar brachte es nicht übers Herz, auszuhausen im ersten Jahre begehrte es auch nicht, da war’s fast noch böser als anderwärts, die rechte Mitte zu treffen. Es suchte mit Sparen abzuhelfen, brach sich die Milch am Munde ab, und doch ward ihm fast schwarz vor den Augen, wenn es seine Vorräte musterte und dann dachte, wie manchen Kübel voll geschmolzener Butter ehedem an diesem Tage die Base verbacken hatte.
Eines Tages nun, als Vreneli im Schweiße seines Angesichts haushaltete und eben dachte, kommod wäre es ihm, wenn es vier Hände hätte, mit zweien könne es kaum alles beschicken zu rechter Zeit, kam die Base, setzte sich aufs Bänklein und frug: »Kann dir was helfen, so sag’s. Die Leut werden hungerig, wollen lieber früher essen als später, und eine alleine kommt fast nicht zurecht, hab’s oft erfahren.« »Wahrhaftig, Base«, sagte Vreneli, »Ihr kommt mir akkurat wie ein Engel vom Himmel, wenn ich Euch nicht hätte, ich wüsste wahrhaftig nicht, wie ich es machen sollte. Will die Erdäpfel vom Brunnen holen, Ihr seid dann so gut und beschneidet mir diese.« Flugs war Vreneli wieder da, stellte das Körbchen der Base dar samt einem Kessel mit Wasser, in welchen die zerschnittenen und gerösteten Kartoffeln zu werfen waren, und half ab- und zugehend der Base. »Habt ihr es abgeredet mit der Sichelten, wie ihr es machen wollt?«, frug diese. »Nein«, sagte Vreneli, »aber sie macht mir großen Kummer. Es ist gottlob ein gesegnetes Jahr, und wir können Gott nicht genug danken, dass wir einen solchen Anfang haben, aber Uli ist doch ängstlich wegem Zins, und ich kann es ihm nicht verargen. Es ging ihm gar schwer, bis er hatte, was er hat, und dass er nicht gerne plötzlich darum kömmt, ist begreiflich. Ich fürchte daher, er werde nicht Geld brauchen wollen, sagen, es trage nichts ab, und schuldig sei man niemand was, man solle zufrieden sein, wenn man am Ende des Jahres alles ausgerichtet habe, was man schuldig sei. Aber es käme mir schrecklich vor, wenn wir im Trockenen sitzen, an Käs und Brot kauen müssten und dies noch an einem solchen Orte.« »Selb nicht, daran wird er nicht denken«, sagte die Base. »Ich dachte auch daran, die Sache mache euch Ungelegenheit. Dass ihr es nicht haben könnt wie wir, versteht sich; es machte mir manchmal fast übel, wenn ich zwei Tage lang küchelte und unter den Händen gingen mir die Küchli an den Türen weg, dass mir für uns keine bleiben wollten. Aber ungerne hätte ich es doch, wenn auf einmal alles aufhörte, alle Leute umsonst kämen und z’leerem fortgewiesen würden. Du weißt, wie meiner ist, sonst könnte ich im Stöcklein küchlen und den Armen ausrichten, was üblich und bräuchlich. Darum will ich dir was an die Kosten steuern, viel nicht; seit uns der Tochtermann, Gott behüte uns davor, ausgeplündert hat, ist das Geld auch rarer geworden bei mir. Rede dann mit Uli, wie ihr es ausrichten wollt, anständig, nicht übertrieben. Lieb wäre es mir, ihr lüdet Meinen auch ein, vielleicht kommt er, vielleicht nicht, aber er sieht doch den guten Willen.« »Allweg«, sagte Vreneli, »und Ihr fehlt auch nicht, es wäre sonst wie ein Tag ohne Sonne oder eine Nacht ohne Sterne; es freute mich nicht, dabei zu sein.« »Bist immer ein Narrli«, sagte die Base. »Und Uli tut sonst gut?«, frug sie, »wenigstens arbeitsam ist er, dass ich nie einen so gesehen.« »Ja, Base«, sagte Vreneli, »und wenn ich klagen wollte, so wäre es, dass er es zu ängstlich nimmt, und dass ich Kummer haben muss, er mache es nicht lang, sondern arbeite sich zu Tode.« »Bist ein Tröpfli«, sagte die Base lachend, »das Mannevolk stirbt nicht so bald, und besser, er tue zu nötlich, als er sei zu gelassen. Sieht er, dass er auskommen mag, so bessert es ihm von selbst, aber ist einer zu gelassen, da ist’s nicht zu machen. Brennt das Haus, so ist ein solcher im Stande, er stopft erst die Pfeife und zündet sie an, ehe er Anstalt macht, das Haus zu verlassen.« Vreneli lachte, sagte jedoch mit einem kleinen Seufzer: »Zu wenig und zu viel verderben alle Spiel!«, nahm die Erdäpfel und setzte sie übers Feuer.
Noch selben Abend eröffnete Vreneli die Verhandlungen mit Uli. Uli sagte, es sei ihm schon lange zuwider gewesen, nur daran zu denken. Schon als ihn die Sache nichts angegangen, sondern alles über den Meister ausgegangen sei, habe er sich darüber geärgert, wie so viel durchaus unnütz und überflüssig draufgehe. Wenn er einmal was dazu zu sagen haben sollte, so müsste es ihm anders gehen, habe er immer gedacht. Viel wohler sei man bei Wenigem, und dass jeder arme Mensch an diesem Tage Küchli essen müsse, bis sie ihm zum Mund heraushingen, selb stehe nirgends geschrieben. Wenn sie Küchli haben wollten, so möchten sie sehen, wo sie welche bekämen, sollten zu Joggeli gehen, der könne den alten Gebrauch fortsetzen. »Rede mir nicht so, Uli«, sagte Vreneli, »das ist ungut. Sieh, der liebe Gott speiste von deinem Acker auch seine Vögel, wie lustig waren sie nicht dabei, es war ihre gute Zeit im Jahre, und du musstest es geschehen lassen. Und nun, wie viel besser sind doch Menschen als Spatzen, und die sollten nicht einmal einen guten Tag haben, und wenn Gott sie dir vor die Türe schickt, um deinen guten Willen zu sehen, zu erfahren, ob du weißt, wer dir den guten Anfang gibt, denen willst du dann nichts geben? Selb, Uli, wirst du nicht machen!«
»Bin ich denn Pächter geworden, um Bettlern zu küchlen? Was brauchen die solche Speise? Brot, wenn was sein muss, tut’s. Oder meinst etwa, man solle auch den Vögeln küchlen und Schüsseln voll in den Acker stellen?« »Lieber Uli, rede dich doch nicht in Zorn hinein, denn das ist dein Ernst nicht. Christenbrauch ists ja, dass man die Armen wie Brüder hält und nicht wie Hunde abspeiset, und gibt man ja selbst den Hunden Brosamen vom Teller, jagt sie nicht mit ungesättigten Gelüsten vom Tische weg. Sollte man dann einem armen Fraueli oder einem armen Kinde, welches das ganze Jahr durch nichts Gutes hat, kaum Salz zu den Kartoffeln hat, nicht eine gebackene Brotschnitte geben oder sonst ein Küchli? Soll es umsonst den ganzen Tag, wohin es kommen mag, den Duft der in der Pfanne brodelnden Butter in der Nase haben? Denke doch an die Geschichte vom reichen Manne und vom armen Lazarus.« »Soll ich jetzt etwa noch gar der reiche Mann sein?«, frug Uli nicht sanft. »Aber Uli«, sagte Vreneli, »versündige dich doch nicht, ich kenne dich ja gar nicht wieder. Bist du nicht der reiche Mann, so bist du doch ein gesegneter Mann. Welch gut Jahr haben wir nicht? Und das hat Gott gemacht. Leicht hätte er die Hälfte weniger geben können, und damit hätten wir auch müssen zufrieden sein. Willst du nun mutwillig die Armen erbittern, machen, dass ihre Flüche ums Haus fliegen wie die Schwalben, willst nicht lieber, sie wünschen uns alle Gottes Glück und Segen, was haben wir ja nötiger als dies? Denn ohne dies wären wir nichts, ohne dies werden wir nichts.« »Das wäre alles gut, und bös meine ich es ja nicht, das weißt du«, sagte Uli. »Aber fangen wir einmal an mit Großtun und Austeilen, so müssen wir so fortfahren; ist denn jedes Jahr ein gesegnetes, dass es es ertragen mag? Sollte man nicht gleich anfangs so anfangen, wie man zu jeder und aller Zeit fortfahren kann?« »Ja, sieh«, sagte Vreneli, »verstehe mich recht, nicht wie ehedem begehre ich es zu machen, dies wird kein vernünftiger Mensch uns zumuten. Man kann die Schnitten ungleich groß abschneiden, sie ungleich backen, kann das Pack abweisen. Ich kenne seit Jahren die Leute, welche kommen, glaube, mit Wenigem will ich weit reichen, zudem sieh, die Base hat mir vier Taler gegeben; sie hätte es ungern, hat sie gesagt, wenn die Leute alle umsonst kämen und z’leerem wieder fortmüssten.« »Das wäre wohl gut, wenn es mit dem gemacht wäre, aber denk, was wir noch alles kaufen müssen für die eigenen Leute und denen dann auch noch jedem ein Tuch voll heimgeben, die Weiber der Tagelöhner werden wir noch einladen müssen, und einige davon sind im Stande, sie bringen uns noch die Kinder mit. Schlachte ich ein Schaf, so braucht man kein anderes Fleisch, mit dem Weine mache ich es kurz. Wenn ich auf 2 Personen eine Maß rechne, die Maß 4 Batzen höchstens, so kostet mich das schon ein Sündengeld.« »Das tue nicht«, sagte Vreneli, »es wäre unser eigener Schade, vergiss nie, wie es uns war, als wir noch dienten, was wir gesagt hätten, wenn man uns die Sichelten so spärlich zugemessen hätte. Die Arbeiter haben, solange Joggeli lebt, nie so angestrengt gearbeitet, können nichts dafür, dass wir nur Pächter sind, und eine Mahlzeit ist immer eine Mahlzeit, macht auf Fromme und Nichtfromme, auf Reiche und Arme einen seltsamen Eindruck. Der Arme, welcher Monate lang weder Fleisch noch Wein sieht, freut sich darauf wie ein Kind auf Weihnacht und warum sollte er nicht? An einer Mahlzeit will man genug haben, von allem satt werden, was man noch möchte und nicht bekömmt, das kömmt viel höher in Anschlag als das, was man erhält. Mahlzeiten sind im Leben, was Sterne am Himmel in mondloser Nacht, und nicht bloß wegen Essen und Trinken. Es tauen auch die Herzen auf, es wird einmal wieder Sonntag darin, es bricht die Liebe einmal wieder hervor, wie aus den Wolken die Sonne und wie aus Holland der Nebel, flieht aus mancher Seele der böse Kummer, das Elend wird vergessen, sie wird einmal wieder froh, fasst frischen Mut und danket einmal wieder Gott von Herzen. Nein, lieber Uli, zu mager mach es nicht, mach es um der Menschen willen nicht. Gott hat uns so große Ursache zu Lob und Dank gegeben, gib du jetzt deinen Leuten nicht Ursache zu Groll und Widerwillen, sondern zu Lob und Dank, zu Mut und Freude. Vielfältig bringen wir dieses ein, denn wenn bei allen guter Wille ist, so wird rasch viel wieder eingebracht, während bei bösem Willen unendlich viel zuschanden geht, das hat Joggeli viele tausend Gulden gekostet; bei ihm habe ich gesehen, wie das gehen kann. Schlechten Wein nimm nicht, er freut niemand, wird getrunken wie Wasser und ist also der teuerste. Nimm guten Wein, der erfreut die Herzen, sie rechnen ihn dir hoch an und trinken weniger als vom Wein, der keine Tugend hat als die Köpfe bös zu machen. Denke doch, es ist mir so gut daran gelegen, dass wir mit Ehren bestehen als dir, es geht auch mich was an, denn gewöhnlich soll die Frau daran schuld sein, wenn der Mann zugrunde geht, aber Sparen und Sparen sind zwei. An einer Kuh, welche Milch geben soll, das Heu, an einem Pferde, welches springen soll, den Hafer sparen wollen, hat noch niemand großen Nutzen gebracht, wie man Beispiele von Exempeln an manchem Bauer sehen kann.« Uli begriff Vreneli und hatte sogar Glauben zu ihm, aber gegen Glauben und Verstand stritten Geld und Angst, trieben Uli vielen Schweiß und manches Aber aus. Indessen siegten doch die Erstern; denn Vreneli half ihnen mit all seiner Liebenswürdigkeit. Uli schaffte guten Wein an und so viel, dass er nicht bei jeder Flasche, welche er aus dem Fässlein zog, Kummer haben musste, es möchte die letzte sein, und in Versuchung kam, Käsmilch aufzustellen in Ermangelung des Weines, ein bös und dünn Surrogat desselben. Ein Schaf wurde geschlachtet, indessen auch dem Rind- und Schweinefleisch die landesüblichen Stellen angewiesen.
Nun war Vreneli hellauf, es glaubte alles gewonnen, aber die Angst kam ihm wieder, und zwar am Tage der Sichelten selbst und nicht von Uli her. Als das Sieden und Braten anging, die Feuer prasselten, die Butter brodelte und zischte, die Bettler kamen, als schneie es sie vom Himmel herunter, die Pfannen zu alles verschlingenden Ungeheuern wurden – Vreneli, wie viel es auch hineinwarf, immer frisch wieder angähnten mit weitem, ödem, schwarzem Schlund; da kam die Angst über ihns; aber sie half ihm halt nichts; wie die Sperlinge den Kirschbaum wittern, welcher frühe Kirschen trägt, weither gezogen kommen mit ihren raschen Schnäbeln und nimmersatten Bäuchlein, so kamen die Bettler daher, vom Duft der brodelnden Butter gezogen, schrien heißhungrig von weitem schon: »Ein Almosen de tusig Gottswille«, und trippelten ungeduldig an der Tür herum, weil sie vor süßer Erwartung die Beine nicht stille halten konnten. Vreneli begann Schnittchen zu backen, dass es sich fast schämte, so klein und so dünn die Kruste, und alles half nichts, es war, als ob sie Beine kriegten und selbst zuliefen einem Schreihals vor der Tür. Es ward ihm immer himmelängster, für die eignen Leute könnte es gar nicht sorgen. In der größten Not erschien die Base unter der Küchentüre, wahrhaftig wie ein Engel, und zwar einer von den schwereren, denn sie wog wenig unter zwei Zentnern. »Es dünkt mich, es sei noch nie so gegangen mit Betteln«, sagte der dicke Engel, »es ward mir himmelangst für dich, die Leute haben doch je länger, je weniger Verstand, und wenn es nicht die Halben versprengt vom Küchlifressen, so meinen sie, es sei ihnen übel gegangen. Da habe ich dir eine kleine Steuer, denn viele werden meinen, wir seien noch auf dem Hofe, und kommen unsertwegen, und vielleicht kann ich dir sonst noch helfen.« Sie stellte einen bedeutenden Butterkübel, den sie hinter Joggelis Rücken aus ihrem Keller stibitzt hatte, dem besten Schmuggler zum Trotz, auf den Küchentisch. »Aber Base, Base, nein, das hat doch wirklich keine Art, jetzt noch so viel Butter! Ihr seid doch gewiss die beste Base unter der Sonne! Was kann ich Euch dagegen tun? Vergelt’s Euch Gott zu hunderttausend Malen!«
»Tue nicht so nötlich«, sagte die Base, »und sag’, wo ich dir helfen soll. Es wäre ja unsere Pflicht auszurichten, was üblich und bräuchlich ist, und dass ihr schon zum ersten Mal aufgefressen werdet wie das Kraut von den Heuschrecken, selb meinte sicher selbst Joggeli nicht. Bloß dass ihr scharf gebürstet werdet, das wohl, das möchte er euch gönnen.« »Base, glaubt nur, geben tue ich gar gerne, ich fühle es recht, dass Geben seliger ist als Nehmen. Es kommt mir dabei immer vor, als sei ich Gottes selbsteigne Hand, welche er öffnet zur Stunde, damit sich sättigt, was da lebt. Aber wenn es dahergeflogen kömmt wie Krähen im Winter über einen spät gesäeten Acker, dann wird es einem doch angst ums Herz, man kömmt in Versuchung und versündigt sich fast, wird ungeduldig, wenn die Zeit verrinnt, der Abend kommt und unsre Leute hungrig kommen und nichts finden.« »Allweg«, sagte die Base; »aber wart, ich will dir helfen.« Nun half die Base, sie machte die Schaffnerin und Spenderin nun wirklich so, dass Vreneli Zeit und Stoff für seine Leute die Fülle blieb. Ging jemand unzufrieden weg, so fiel der Groll auf die Bäuerin, deren bekannte Gestalt unter die Tür stund und ihn abgefertigt hatte.
Wie Vreneli in der Küche schwitzte Uli auf dem Felde. Es war ein Tag, in welchen sich fast mehr Arbeit drängte als hinein mochte. 2000 Garben sollten eingeführt werden. Mit zwei Stieren führte er den Wagen auf dem Acker, war er geladen, so fuhren 4 Pferde denselben heim. Eine Partie lud zu Hause die Garben ab, eine andere band Garben, die dritte lud sie. Zu dieser gehörte Uli, er gab alle Garben selbst auf den Wagen; alles griff ineinander, ward in halbem Lauf getan, Uli hatte keinen Augenblick zum Verschnaufen. Aber Uli hatte zwei Augen, und die sahen einen bedeutenden Teil der Bettler, welche bei dem Hause ab- und zugingen. Anfangs achtete er sich nicht so viel derselben. Erst als einer sagte: »Es geht heute aber stark, so wie noch nie«, ward er aufmerksam, wollte sie zählen; aber zugleich sollte er die Garben zählen, welche er auf den Wagen gab, und Bettler und Garben kamen ihm untereinander, dass er nicht mehr wusste, woran er war. Dies machte ihn noch giftiger, auslassen durfte er seinen Grimm nicht, höchstens den Stieren konnte er rauere Worte geben als sonst und unsanfter sie zerren an ihren Hörnern. Aber sie nahmen keine Notiz davon und fraßen gemütlich das vorgelegte Gras und ließen sich behaglich durch einen Knaben Fliegen und Bremsen wehren. »Wart nur, bis ich heimkomme«, dachte Uli, »dann will ich sehen, was übrig geblieben. Hoffentlich gibt es Gelegenheit, die Narrheit ein für alle Male abzustellen.«