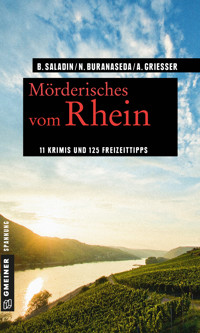Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hofhund Vasco
- Sprache: Deutsch
Nicht nur, dass erst vor ein paar Tagen »die Jungen« im Oberbaselbieter Dorf Hinterberg lauthals Walpurgisnacht gefeiert haben, jetzt liegt auch noch eine Leiche im Wald und es wimmelt von Polizisten! Zum Glück stammte der Tote nicht aus dem Dorf, doch Mara kannte ihn sehr wohl. Ausgerechnet ein Flirt von ihrer Dating-App wurde quasi vor ihrer Haustür um die Ecke gebracht. Während die eine Hälfte des Dorfs eine Bürgerwehr bildet und die andere in Achtsamkeitsstunden um positive Energien bemüht ist, werden Mara, ihre Tante Lotti und deren Hofhund Vasco in den Strudel des rätselhaften Mordfalls hineingezogen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Barbara Saladin
Baselbieter Fluch
Kriminalroman
Zum Buch
Ein Dorf steht Kopf! Das Oberbaselbieter Dorf Hinterberg ist nicht mehr das, was es einmal war – das jedenfalls glauben die Menschen, nachdem im Wald eine Leiche gefunden wurde. Eifrig suchen sie nach der Lösung, denn die Polizei scheint im Dunkeln zu tappen. Derweil muss Mara der Wahrheit ins Gesicht sehen: Sie kannte das Opfer, und das ausgerechnet von der Dating-App, für die ihre Tante Lotti so gar kein Verständnis hat. Ist es Zufall, dass ihr Flirt quasi vor ihrer Haustür zu Tode kam?
Als herauskommt, dass ein Verbrechen zugrunde liegt, und kurz darauf auch noch eine Alteingesessene leblos in ihrer Wohnung aufgefunden wird, gerät das Dorf in Aufruhr. Währenddessen kreuzt sich Maras Weg immer öfter mit den Ermittlungen der Polizei, und auch Vasco, Lottis Hofhund, der das Herz am rechten Herz trägt, sich aber leicht ablenken lässt, hat Witterung in dem Fall aufgenommen. Als Lotti auf eine alte Sage stösst, die sich um den Tatort rankt, und unwissentlich Beweismaterial an sich nimmt, geraten die beiden Frauen und der Hund ins Zentrum des rätselhaften Mordes.
Barbara Saladin wurde an einem Freitag, dem 13., geboren und lebt als freie Journalistin, Autorin und Texterin in einem kleinen Dorf im Oberbaselbiet. Sie schreibt, textet, fotografiert, recherchiert, lektoriert, moderiert und organisiert. Aus ihrer Feder stammen zahlreiche Kriminalromane und Kurzgeschichten, Reiseführer und Theaterstücke, Sach- und Kinderbücher, Artikel und Reportagen. Seit 2023 ist sie Chefredaktorin des Fachmagazins »Hund Schweiz«.
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2024 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Ricarda Dück
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © schame / shutterstock.com
ISBN 978-3-8392-7804-8
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Menschen und Tieren sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Auch das Dorf Hinterberg ist reine Fiktion und findet sich auf keiner Landkarte.
Prolog
Der Mond stand als fast volle Scheibe über den bewaldeten Hügeln und tauchte die Landschaft in ein bläuliches, beinahe unwirkliches Licht. An den Kirschbäumen auf den Feldern leuchteten die letzten weissen Blüten. Grillen zirpten im Gras, irgendwo in der Ferne war das Motorengeräusch eines Autos zu hören.
Der Forst lag als kompakte, schwarze Masse da. Zwischen den Bäumen war es still. Fast still.
Etwas raschelte im Unterholz. Zweige knackten unter menschlichen Füssen. Instinktiv stellten die drei jungen Füchse, die vor ihrem Bau am steilen Waldhang gespielt hatten, die Ohren und lauschten. Schritte näherten sich. Dem ersten der Kleinen wurde es unheimlich, und er suchte Zuflucht im unterirdischen Gang. Gleich darauf folgte ihm der Zweite, nur der Dritte verharrte noch ein paar Sekunden vor der Höhle und schaute mit staunenden Augen Richtung Schattholde, von wo sich ein Mann näherte. Er trug dunkle Kleidung und kämpfte sich den felsigen Abhang herauf. Sein schneller Atem deutete darauf hin, dass er eine solche körperliche Anstrengung nicht allzu gewohnt war. In der Hand hielt er ein merkwürdiges, längliches Gerät. Allmählich wurden seine Umrisse grösser, und der junge Fuchs konnte immer mehr Details erkennen: die schweren Schuhe, die schwarze Mütze, den dunkelblauen Rucksack. Vor allem nahm er den Eindringling anhand der ihm bislang völlig unbekannten Gerüche wahr.
Im Geäst knackte es. Ein grosser Schatten flog zwischen zwei Baumwipfeln auf: ein Waldkauz. Der Mensch sah sich abrupt um; nicht wegen des Vogels, sondern weil in diesem Moment ein anderer Mensch zu hören war, der auf ihn zukam. Er hatte sich bereits oberhalb des abschüssigen Geländes aufgehalten – dort, wo der Waldboden mit Ausnahme eines kleinen, flachen Hügels fast eben war. Fast schien es, als habe er den Neuankömmling erwartet. Als die beiden zu sprechen begannen, war das für den Jungfuchs das Signal zur Flucht, und er suchte Schutz im Bau bei seinen Geschwistern.
Die Stimmen der beiden Männer wurden lauter und wütender, und irgendwann hallte ein dumpfer Schlag durch den Wald, gepaart mit einem Schrei. Dann waren weitere Hiebe zu hören, aber Schreie keine mehr. Nur noch eine Art Stöhnen, doch auch das erstarb nach kurzer Zeit.
Die drei Füchse duckten sich im Bau und drückten sich aneinander, wie der Instinkt es ihnen bei potenzieller Gefahr gebot. Erst später trauten sie sich wieder aus dem Loch. Als sie hörten, dass ihre Mutter sich näherte, sprangen sie ihr begeistert entgegen. Sie trug mehrere erlegte Mäuse im Fang heran. Endlich Mahlzeit. Mit knurrenden Mägen stürzten die Kleinen sich auf die Leichen der kleinen Nager. Den menschlichen Kadaver, der unweit des Fuchsbaus in einem Bett aus blühendem Bärlauch lag, beachteten sie nicht.
Es war der Mann in dunkler Kleidung. Der längliche Gegenstand, den er bei sich getragen hatte, fehlte. Der andere Mann war ebenfalls verschwunden.
Kapitel 1 Dienstag
Hinterberg hat 365 Einwohner: Einen für jeden Tag im Jahr. Das hat Lotti immer gesagt, aber ich glaube, mittlerweile sind es einige mehr. Denn in den letzten Jahren sind an den Rändern des Dorfs neue Häuser aus den Wiesen gewachsen, wie überall in der Region. Bei uns geht es allerdings ein wenig langsamer vonstatten als in Dörfern, die näher an den grossen Verkehrsachsen und an der Stadt liegen.
So ein gewisses Hin und Her gibt es immer, auch in einem so kleinen Dorf wie dem meinen, wo sich die meisten Leute kennen. Obwohl Hinterberg mittlerweile mindestens 380 Einwohner zählt – das sind quasi zwei Wochen mehr als ein Jahr –, hat alles nichts genützt. Heute ist der letzte Tag im Leben unseres Dorfladens, und ich bin untröstlich.
Mit einem Herzen, das schwer ist wie ein ausgewachsener Blauwal, sitze ich vor dem alten Veloständer mit der Glacéreklame und warte. Die sich automatisch öffnende Schiebetür, die die Menschen in den Laden lässt und sie wieder ausspuckt, bildet leider die Schwelle zu einer No-go-Area für mich. Meine Ohren hängen so tief, als würden sie von der Erde magnetisch angezogen, und doch können sie meine Stimmungslage nicht adäquat wiedergeben. Sonst müssten sie förmlich am Boden kleben.
Wieder bewegt sich die Glastür geräuschvoll zur Seite, und Conny, die Wirtin des Gasthofs Hirschen, kommt heraus. »Na, Vasco, wartest du auf dein Wursträdchen?«
Ich wedle und schaue sie treuherzig an. Sehr treuherzig. Denn so schwer mein Herz auch ist, das Stichwort »Wursträdchen« lässt Hoffnung in mir aufkeimen, und unmittelbar läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht sabbere – das finden die meisten Menschen nämlich eklig, und eklige Hunde werden weniger gern gefüttert als niedliche.
Leider scheine ich Conny falsch verstanden zu haben. Sie fragt mich zwar, ob ich auf ein Wursträdchen warte, hat aber offenbar nicht die geringste Absicht, mir an Silvias Fleischtheke im Ladeninnern eins zu beschaffen. Sie streicht mir über mein leicht struppiges schwarzes Fell, das mit weissen Spritzern übersät ist, als wäre ich als kleiner Welpe mal in einen Gipsregen geraten. Stimmt im Fall nicht: Diese Flecken sind echt, und als Welpe kam ich vor bald acht Jahren aus Spanien nach Hinterberg und ein paar Wochen später zu Lotti auf den Hof. Seither ist Lotti meine Chefin und der Rüttigrund meine Heimat.
Durch die grosse Frontscheibe kann ich die Regale sehen und beobachten, wie die Bewohner von Hinterberg mit Silvia anstossen. Die sind ja nicht ganz bei Trost: feiern das Ende ihres Dorfladens, als wäre das nicht die absolute Katastrophe! Ist es aber! Zwar rentierte er schon lange nicht mehr, habe ich von den Menschen aufgeschnappt, da von den 380 Einwohnern nur wenige ihre Einkäufe hier tätigten. Viele fahren lieber mit dem Auto zu den grossen Discountern unten im Tal, die zahlreiche Aktionen und noch grössere Parkplätze haben. Silvia hat den kleinen Laden während der letzten Jahre mehr als Hobby betrieben. Doch nun hat sie eine Stelle in irgend so einem Bioladen in der nächstgrösseren Zentrumsgemeinde angenommen. Vielleicht stossen die Leute mit Silvia auch darauf an, ich weiss es nicht.
Dass ich von allen Festlichkeiten im Laden, warum sie auch immer stattfinden, ausgeschlossen bin, macht mich noch missmutiger. Nicht einmal die Brösmeli unter den runden Bartischchen, die Silvia aufgestellt und mit Apérohäppchen bestückt hat, kann ich wegputzen. Befinden sich alle in der verbotenen Zone. Und das Schlimmste von allem: Auch Lotti hält sich drinnen auf und scheint sich ohne mich bestens zu amüsieren. Durchs Schaufenster kann ich ihre grauen halblangen Locken erkennen, die immer mal wieder hinter dem breiten Rücken vom Frank, dem Vize-Gemeindepräsidenten, hervorwippen. Sie steht mit drei anderen Frauen am Tischli und beigt Salzstangen in sich rein. An mich denkt niemand.
Ich beschliesse, diesem Trauerspiel nicht mehr länger beizuwohnen. Wenn Melancholie und Hunger aufeinandertreffen, ist es höchste Zeit, auf andere Gedanken zu kommen, sonst bricht sich der ultimative Weltschmerz Bahn. Also verlasse ich meinen Posten und das Dorf, wo mich ja eh keiner vermisst, und trabe nach Hause. Ich weiss, dass Lotti es nicht mag, wenn ich allein im »Zeugs rumstriele«, wie sie sagt, aber ich geh ja nur schon mal vor, um nach dem Rechten zu sehen. Und sie kann echt nicht erwarten, dass ich draussen vor dem Dorfladen sitze und zuschaue, wie die Menschen feiern, wenn alles den Bach runtergeht!
Auf dem Nachhauseweg werde ich zwischen dem Dorfrand und unserem Bauernhof, der etwa fünf oder zehn Rennminuten (kommt auf die Dringlichkeit an) von Hinterberg entfernt liegt, abgelenkt. Das kann manchmal passieren. Diesmal ist es die Fährte eines Rehs. Wahrscheinlich tauscht das Tier gerade seinen eher grauen Winterpelz gegen rehbraunes Sommerfell ein. Es hat sich nämlich am grossen Haselstrauch an einer Hecke in der Nähe gescheuert und viele Haare gelassen. Das riecht umwerfend abenteuerlich. Ich weiss zwar, dass ich Rehen nicht nachstellen darf, und wenn einer der Jäger mich erwischt, werde ich zu einer Leinenhaftstrafe verurteilt. Aber ich muss dabei ja nicht ertappt werden. Und diese Fährte ist einfach zu spannend. Also hopp, Schnauze runter, und los geht es!
Bevor ich es merke, schnüffle ich am Waldrand, einige Hundert Meter oberhalb des Rüttigrunds, wo ich gemeinsam mit Lotti und ihrem Mann Ruedi wohne. Ich liebe den Wald und trabe weiter. Hier stehen ziemlich alte Buchen, zwischen deren Wurzeln sich immer wieder Höhlen von Mäusen, Füchsen und Dachsen finden. Weiter oben wird’s steil und schattig. Dort wächst Farn zwischen den Felsen, und die länglichen knallgrünen Blätter der Hirschzunge wedeln im Wind. Da die Menschen nicht immer sehr fantasievoll sind, nennen sie diesen Hang Schattholde. Neben Farn und Hirschzunge gedeihen ganze Felder von Bärlauch, der jetzt, am letzten Tag des Monats April, hochgeschossen ist und bereits seine feinen weissen Blüten gen Himmel streckt. Mit seinem penetranten Duft übertüncht er alles.
Ansonsten riecht es feucht, nach Regen, nach Blättern und den Tieren, die hier wohnen. Doch die Rehfährte habe ich verloren – vielleicht bin ich einfach zu wenig bei der Sache gewesen. Dafür höre ich komische Geräusche drüben am Hang. Klingt, als würden Leute da rumstiefeln und sich leise unterhalten. Das ist echt eigenartig, weil in der näheren Umgebung kein Wanderpfad ausgewiesen ist und sich eigentlich niemand hierher verirrt. Es führt nur ein einzelner Holzweg den Hang hinauf, der sich allerdings – wie es Holzwege so an sich haben – verliert. Wenn ich ehrlich bin: Ich habe überhaupt noch nie eine Menschenseele an diesem Ort gesehen. Ausser Ruedi. Mit dem gehe ich manchmal auf die Suche nach Versteinerungen; Tintenfische, Muscheln und andere solche Dinger, die ansonsten im Oberbaselbiet nicht existieren, eben nur in Form von Steinen. Die sind dann etliche Millionen Jahre alt und leben deshalb nicht mehr.
Aber ich täusche mich nicht: Jenseits des grünen Meers aus Bärlauch müssen sich Menschen am Hang aufhalten. Sehen kann ich sie nicht, weil sie sich offenbar oben, an einer dichten Stelle, befinden, aber ihre Geräusche und Gerüche nehme ich wahr. Es müssen zwei Männer sein. Was eigenartig ist: Sie sind ohne Hund unterwegs. Das rieche ich, und das macht sie irgendwie verdächtig. Menschen gehen nämlich äusserst selten ohne Hund in den Wald. Wäre ich nicht so traurig und antriebslos, würde ich nachschauen gehen. Ich tue es allerdings nicht.
Ein Entscheid, den ich später bereuen werde.
*
Sie hätte nicht so viel trinken sollen. Lotti Niederberger versuchte, den pochenden Schmerz zu ignorieren, der gegen ihre Schädeldecke klopfte und sie am Schlafen hinderte. Entgegen ihrer Gewohnheit war Lotti überaus lange beim Abschlussfest des Dorfladens geblieben. Eigentlich hatte sie nur kurz vorbeischauen wollen, doch dann war es gemütlich gewesen, man war ins Reden gekommen, und irgendwann hatte Silvia verkündet, dass der Wein noch gemeinsam leer getrunken werden müsse. Der ganze Vorrat – und das war recht viel gewesen. Ausser Kirschlikör aus eigener Produktion und hin und wieder einem Gläschen Williams trank Lotti kaum etwas. Wein konsumierte sie nur selten, und Bier mochte sie grundsätzlich nicht. Vielleicht kam das daher, dass sie in einer Zeit aufgewachsen war, in der Frauen sehr selten überhaupt Bier getrunken hatten.
Nun würde sie wohl am nächsten Tag einen tierischen Kater haben. Und das mit 67 Jahren! Ruedi hatte zuerst verwundert geguckt, als sie deutlich beschwipst und mit unverkennbarem Mundgeruch nach Hause gekommen war. Mit ihrem alten, knatternden Töffli hatte sie sogar noch eine Ehrenrunde auf dem Hofplatz gedreht, weil es gerade so Spass machte, und sich dann überschwänglich von ihrem Hund Vasco begrüssen und abschlabbern lassen. Als sie später über Kopfweh zu klagen begann, hatte Ruedi sie laut ausgelacht. Das wiederum war entgegen seiner Gewohnheit. Vielleicht hatte er gedacht, wenn sie sich schon aus der Reihe tanzte, konnte er es ebenso.
Jetzt schlief ihr Mann friedlich im Bett neben ihr. Lotti sah nur seine kurzen weissen Haare unter der Bettdecke hervorlugen. Seine tiefen Atemzüge wirkten beruhigend. Vasco, der in seinem Körbchen im Gang lag, schnarchte hin und wieder. Vorsichtig stand Lotti auf und verliess auf Zehenspitzen das Schlafzimmer. Als sie an ihrem Hund vorbeischlich, sah dieser kurz auf und drehte sich dann wohlig auf den Rücken, alle viere von sich streckend. Sie mochte ihm allerdings gerade nicht den pelzigen Bauch streicheln, auch wenn die Einladung dazu unmissverständlich war. Frische Luft war ihr lieber. Sie zog sich ihre Stalljacke über, verliess das Haus und zog die Tür leise hinter sich zu, bevor der neugierig gewordene Vierbeiner ihr folgen konnte.
Die Nacht war kühl, und der leichte Wind, der ihr um die Nase strich, tat gut. Jeder tiefe Atemzug schien dem Schmerz im Kopf entgegenzuwirken. Lotti setzte sich auf die alte Holzbank vor dem Haus und schaute zum Wald hinüber, der in einigen Hundert Metern Entfernung pechschwarz dalag. Plötzlich sah sie ein Licht zwischen den Bäumen aufflackern. Zuerst war sie sich nicht sicher, ob sie sich getäuscht hatte, doch dann bemerkte sie es wieder. Irgendwo da drüben mussten Menschen sein.
Ihre Armbanduhr lag drin auf dem Nachttischchen, sie hatte keine Ahnung, wie spät es war. Aber sie erinnerte sich, dass heute Walpurgisnacht war. Am Abschiedsapéro im Laden hatte jemand erzählt, dass einige Junge aus dem Dorf ein Fest planten. Schien im Moment hip zu sein, irgendwelche alten Bräuche neu aufleben zu lassen. Lotti musste schmunzeln. Die Nacht, in der die Hexen sich trafen …
Wieder flimmerte kurz ein Licht in der Finsternis des Waldes. Obwohl die Dorfjugend sich gern beim Chreemerchöpfli traf, einem beliebten Ausflugsziel auf einer Felsnase, schien sie es sich diesmal anders überlegt zu haben, denn das Licht lag weit entfernt vom dortigen Grillplatz. Es schien eher, als käme jemand von der Schattholde. Komisch. Da gab es eigentlich keine geeigneten Plätze zum Feiern.
Auf jeden Fall stellte Lotti erleichtert fest, dass die frische Nachtluft und die wandernden Gedanken ihr Kopfweh ein wenig besänftigt hatten, und erhob sich. Nach einem kurzen Kontrollblick in den Schafstall, wo alles in Ordnung war und ihre kleine Herde aus Lacaune-Milchschafen friedlich ruhte, ging sie wieder ins Haus. Vasco begrüsste sie freudig. Er hatte hinter der Tür gewartet und kehrte beruhigt in sein Körbchen zurück, als auch Lotti in ihr Bett kroch und darauf wartete, dass der Schlaf sie endlich übermannen würde.
Kapitel 2 Mittwoch
Am nächsten Tag, nach einem etwas trägen Morgen, verzogen Lottis Kopfschmerzen sich zum Glück vollständig. Dabei halfen ihr nicht zuletzt ein starker schwarzer Kaffee mit Zitronensaft und Ingwertee. Als sie am Nachmittag im Garten arbeitete und Vasco in ihrer Nähe in der Sonne lag, erhielt sie spontanen Besuch. Matthias kam mit seinem Hund über den Hofplatz, wohl auf dem Weg in den Wald. Lotti erkannte ihn bereits aus den Augenwinkeln an seiner Camouflagehose und der dunkelgrünen Faserpelzjacke.
»So, wächst’s?«, fragte er anstatt einer Begrüssung, als er stehen blieb.
Sie nickte. »Bis jetzt kommt alles gut. Aber da die Eisheiligen erst in zwei Wochen sind, ist es noch zu früh, um Ernteprognosen zu stellen.«
Dass Matthias mit Pflanzen nicht unbedingt viel am Hut hatte, wusste sie, immerhin kannte sie ihn, seit er im Kinderwagen durch die Strassen Hinterbergs geschoben worden war. Es waren viel eher die Tiere, die es ihm angetan hatten. Deshalb war er schon in jungen Jahren der Jagdgesellschaft beigetreten. Lotti mochte Matthias. Er war einer jener jungen Leute, die nach der Lehre zwar das Dorf für einige Zeit verlassen hatten, doch bereits wenige Jahre später wieder zurückgekehrt waren.
Matthias war etwa fünf Jahre weg gewesen – nie weiter als zehn Kilometer Luftlinie –, und dann hatte er sich im Haus der Eltern eine Einliegerwohnung gebaut und niedergelassen. Vielleicht waren es der Wald und dessen Tiere gewesen, die ihn zurückgerufen hatten. Auch dass er seine Jagdhündin sehr liebte, war offensichtlich. Sie trug den treffenden Namen Diana.
Während Diana und Vasco sich schwanzwedelnd begrüssten und dazu übergingen, sich ausgiebig zu beschnüffeln, sprachen Matthias und Lotti über das Ende des Dorfladens, übers Wetter (für Anfang Mai eigentlich ganz ordentlich, aber für die Natur wäre etwas mehr Regen gut), über die aktuelle Politik (was der Regierungsrat unten in Liestal mal wieder beschlossen habe, zeige, dass er von den Sorgen der Bevölkerung ausserhalb der grossen Ballungsgebiete wenig Ahnung habe) und über die Wehwehchen einzelner Hinterberger (der Jürg müsse sich beispielsweise einer Rückenoperation unterziehen, die Frau vom Werni leide noch immer an Long Covid, und die Eveline streite mit ihrem Ex-Mann mal wieder um Alimente).
Matthias tat abschließend seinen Unmut kund, dass die heutige Jugend keinen Respekt mehr habe. Dass er selber noch vor nicht allzu langer Zeit genau zu dieser gehört hatte, schien er bereits vergessen zu haben. Allerdings, was den Abfall anging, da war sie einer Meinung mit ihm. Zwar wusste sie nicht, ob wirklich nur die junge Generation für die Energydrink-Aludosen und Fast-Food-Packungen verantwortlich war, die an den Strassenrändern lagen – sie bezweifelte es sogar –, aber auch sie wurde jedes Mal wütend, wenn sie in der Natur auf Müll stiess.
»Die Jungs und Mädels wissen einfach nicht mehr, wie man sich zu benehmen hat. Lassen alles liegen, als würde ihnen überall die Mutter hinterherputzen«, regte Matthias sich auf.
»Und gestern haben einige anscheinend Walpurgisnacht gefeiert im Wald. Walpurgisnacht, so ein Blödsinn!«
In diesem Moment hörte sie ein Knattern, das immer lauter wurde. Auf dem Strässchen zum Hof, das kurz vor dem Wald in die Kantonsstrasse zwischen Hinterberg und dem Tal mündete, näherte sich ein Gefährt, das offenbar mit der Steigung kämpfte. Natürlich würde es siegen, aber alles brauchte seine Zeit … Etwas später bog Ruedi auf seinem uralten Einachsertraktor, mit dem er einen Anhänger voller Strohballen zum Rüttigrund transportierte, auf den Hofplatz ein. Bis zu seiner Pensionierung vor fünf Jahren war er als Zimmermann in einem Nachbarort beschäftigt gewesen, nachdem er in den Neunzigerjahren die Landwirtschaft aus wirtschaftlichen Gründen hatte aufgeben müssen. Die erste Zeit hatte Ruedi sichtlich darunter gelitten, dass er »auswärts arbeiten gehen« musste, während Lotti sich um den stark reduzierten Tierbestand auf dem Hof gekümmert hatte. Die Kühe hatten sie nach und nach verkauft und es mit normalen Schafen versucht, bevor sie auf eine Milchrasse umgesattelt hatten. Nun, da Ruedi in Rente war, ging er seiner Frau beim Bauern ein wenig zur Hand und genoss es ansonsten, den ganzen Tag irgendwo zu werkeln oder seiner grossen Leidenschaft, dem Suchen von Fossilien, nachgehen zu können.
»Ah, der Ruedi. Da kann ich ihn doch gleich noch was fragen«, sagte Matthias, winkte Lotti zum Abschied und trat zu ihrem Mann, der den lärmenden Motor abstellte.
Lotti war nicht undankbar, nicht weiter über die heutige Jugend und die Sinnlosigkeit einer Walpurgisnachtfeier in der freien Natur debattieren zu müssen, umso mehr sich der fiese Schmerz im Kopf wieder meldete. Sie wandte sich wieder ihrem Kartoffelbeet zu. Nur sie und ihre Pflanzen, das reichte ihr für diesen Tag völlig aus.
*
An der jungen Tanne, die als Maibaum an der rechteckigen Steinsäule des Dorfbrunnens befestigt war, flattern bunte Bänder in den Farben des Hinterberger Gemeindewappens. Früher tanzte um den Maibaum die Trachtengruppe, zu der auch Lotti gehörte, aber schon eine Weile nicht mehr, und die Truppe hat sich wegen Nachwuchsmangels längst aufgelöst. Und an dem Brunnen, so erzählen die Menschen, haben früher die Kühe getrunken. Heute tun dies manchmal noch die wenigen Wanderer, die sich in unser Dorf verirren. Und natürlich ich, wenn ich auf Tour bin. Dann stelle ich mich auf die Hinterbeine, beuge mich über den Rand und schlabbere das Wasser aus dem Trog, dass die Spritzer nur so fliegen.
Neben dem Brunnen hat der Dorfplatz zwei weitere wichtige Merkmale: eine alte Linde und ein Denkmal, das ein Steinbildhauer aus dem Nachbardorf vor einigen Jahren fertigte. Es symbolisiert so was wie den Stolz unserer kleinen Gemeinschaft, denn es erinnert an einen unserer Helden: den Wackeren Koni, einen grossen Freiheitskämpfer, der im Bauernkrieg gegen die Unterdrückung gekämpft und in Basel ein frühzeitiges Ende am Galgen gefunden hat. Die Menschen, die sich mit Geschichte beschäftigen, sind sich nicht einig, ob der Wackere Koni wirklich gelebt hat oder dem Wunschdenken der nachfolgenden Generationen entsprungen ist. Den Hinterbergern ist das aber einerlei. Wilhelm Tell ist ja auch der Nationalheld der Schweiz, und da ist man sich ja ziemlich einig, dass es ihn nie gegeben hat. Uns Hunde interessieren diese Dinge eh weniger. Aber der Sockel des Denkmals, der hat es in sich. Er ist nämlich das Nachrichtenportal Nummer zwei im Dorfzentrum, nach dem Hirschen und jetzt, da der Dorfladen zu hat. Zumindest, was die Lokalnachrichten angeht. Und natürlich gehe ich kein einziges Mal am Sockel vorbei, ohne ausgiebig daran zu schnüffeln und als krönenden Abschluss über den Kalkstein zu pinkeln.
Nachdem ich das erledigt habe, laufe ich hinüber zum Hirschen. Ich hasse die Dorfbeiz eigentlich, weil dort Peppino herrscht, die unsympathischste Katze in einem Umkreis von mehreren Kilometern (und das will was heissen, denn die allermeisten Katzen sind unsympathisch). Peppino ist ein richtiger Macho. Er glaubt wirklich, er sei der Herrscher der Welt, und er verteidigt sein Revier bis aufs Blut gegen Eindringlinge. Leider zählt er Hunde zu dieser Kategorie. Es ist schon mehrmals geschehen, dass er einen von uns hinterhältig angegriffen hat, nachdem er aus Unwissenheit oder Sadismus mit in den Hirschen genommen worden war. Glücklicherweise ist Peppino nicht nur unerträglich, sondern geistig etwas beschränkt. Während er in der Dorfbeiz einen auf Zampano macht, lässt er uns in der Gartenwirtschaft in Frieden. Wenn Conny also den gemütlichen Aussenbereich unter der grossen Linde geöffnet hat, kann ich den Hirschen aufsuchen.
In einem Garten in der Nähe hat bis vor Kurzem ein Freund von mir gewohnt, ein lieber, uralter Jagdhund, der eigentlich Artus hiess, den wir alle jedoch nur Alt Schlotterhund nannten. Am Ende seiner Tage war er ein richtiger Greis, wurde immer dementer, hatte zunehmend ein Gnusch im Kopf, und im vergangenen März ist er dann plötzlich nicht mehr da gewesen. Man erzählt sich, Alt Schlotterhund sei nun in den ewigen Jagdgründen, wo er seinen heissgeliebten Hasen nachstellt. Seit er weg ist, fehlt in Hinterberg etwas.
Bevor ich richtig traurig werde, konzentriere ich mich auf meinen Weg zum Hirschen. Am Stammtisch in der Gartenwirtschaft sitzt eine Gruppe von Männern. Ich kenne sie alle: Ruedi, der Mann meiner Chefin, der natürlich für mich der Wichtigste ist, aber in der Runde eher zuhört als spricht. Neben ihm sitzt Jürg. Er ist schon alt – in Menschenjahren gerechnet zwar nicht ganz so betagt wie Alt Schlotterhund, bevor er über die Regenbogenbrücke ging, aber vielleicht fehlt gar nicht mehr so viel. Er spricht ebenfalls eher wenig, das kommt allerdings daher, dass er nicht mehr alles versteht und darum oft nicht so genau weiss, worum’s grad geht. Er verweigert jedoch Hörgeräte, darum lautet seine häufigste Wortmeldung: »Hä?« Deutlich gesprächiger ist Werni, der Schreiner aus dem Dorf, der oft etwas früher Feierabend macht, um im Hirschen nichts zu verpassen. Heute muss er das allerdings nicht, denn es ist ja gesetzlicher Feiertag bei uns im Kanton, was bedeutet, dass die Menschen nicht arbeiten müssen. Und noch lauter rumtröten tut Noldi. Er ist wie die anderen, mit Ausnahme von Werni und Roman, pensioniert, darum sind ihm Feiertage einerlei. Im Dorf geniesst er hohes Ansehen, weil er der Präsident des Musikvereins ist, und der ist für Hinterberg etwas enorm Wichtiges. Der Fünfte im Bunde ist Roman. Er ist wohl der Jüngste der Stammtischrunde, aber er kommt mit allen gut aus. Schliesslich ist das sein Job, denn er ist der Gemeindepräsident.
Die Männer reden über alles, was sie gerade beschäftigt. Im Moment ist dies der Müll, den die Jungen im Wald hinterlassen haben. Davon hat Matthias erzählt, als er offenbar kurz vorher mit Diana vorbeigeschaut hat.
»Walpurgisnacht, so ein Seich«, schimpft Werni. »So was hat es früher nicht gegeben.«
Noldi lacht und widerspricht: »Hast du eine Ahnung! Das kommt von den Hexen her, und die gibt’s schon lange.«
Roman mischt sich ein und erklärt, dass Menschen Rituale bräuchten. Die seien das Gerüst der Gesellschaft, und bei jungen Leuten sei es ganz normal, dass sie Sachen ausprobierten.
»Walpurgisnacht feiern, indem man sich im Wald die Kante gibt und alles rumliegen lässt, das ist kein gutes Gerüst für die Gesellschaft«, widerspricht Noldi, während Werni schnaubt: »Der Roman wieder. Der Psychologe ist mit ihm durchgegangen.«
So geht es weiter. Roman gibt Konter, doch mit Bedacht. Denn er ist von Beruf wirklich Psychologe. Er spricht mit anderen, hört ihnen zu und hilft ihnen damit. Ich begreife nicht genau, wie das funktioniert, doch die Menschen haben ja jede Menge eigenartiger Berufe erfunden im Lauf der Zeit.
Ich höre der Herrenrunde nur noch mit einem Ohr zu. Nun sind es auch Zugezogene, die nicht so tun, wie es einige am Stammtisch gerne hätten. Ruedi sagt wie immer nicht viel. Ich spüre, dass er sich zunehmend nervt, weil Werni und Noldi so rumpoltern und Jürg, der alte Cholderi, an allem und jedem was auszusetzen hat. Als Ruedi genug hat, steht er auf und verabschiedet sich. Darauf habe ich nur gewartet.
Gemeinsam verlassen wir die Gartenwirtschaft, wo die hitzigen Diskussionen weitergehen. Während Ruedi zu seinem Einachsergefährt hinübergeht, renne ich schon mal voraus. So habe ich nämlich noch Zeit, mich auf dem Heimweg um ein paar Maushaufen zu kümmern, die am Wegrand auf mich warten.
*
Beim Abendessen erzählte Ruedi seiner Frau von der Stammtischrunde. Die Kommentare seiner Kumpane wollte er jedoch nicht wörtlich wiedergeben, weil er ganz genau wusste, dass sie sich noch viel mehr darüber aufgeregt hätte als er.
Lotti sagte kopfschüttelnd: »Man könnte fast meinen, die Leute im Dorf hätten keine anderen Probleme.«
Sie dachte an die multiplen Krisen, die die Welt in den letzten wenigen Jahren zerrüttet hatten und zum grossen Teil noch immer präsent waren, selbst wenn der Alltag seinen gewohnten Gang ging: die Klimakrise, die Coronakrise, die Hungerkrise, die Energiekrise, die Flüchtlingskrise, der Krieg in Europa … Von all dem war in den Baselbieter Jurahügeln allerdings kaum etwas zu merken, und in dem Flecken Hinterberg schien der Rest der Welt sowieso oft Lichtjahre entfernt.
Lotti fiel ihre Freundin Leo ein, die eigentlich Eleonora hiess und vor ein paar Jahren genau aus diesen Gründen nach Hinterberg gezogen war. Weil sie ihre Ruhe haben wollte, ihren Frieden. Vor allem den inneren. Momentan machte Leo Ferien in Portugal. Yoga-Urlaub oder Ayurveda-Workshop oder so was, genau wusste es Lotti nicht mehr. Ob der Vielzahl an Theorien, Heilkünsten, Philosophien und Lebenshilfen, derer sich ihre Freundin bediente, verlor sie öfters mal den Überblick. Obwohl die Frauen fast denselben Jahrgang hatten und beide in Hinterberg wohnten, lebten sie in ziemlich verschiedenen Welten. Lotti in einer bodenständigen, Leo in einer doch recht modernen. Und trotzdem hatten sie sich angefreundet – nicht nur, weil sie sich regelmässig sahen, wenn Lotti gemeinsam mit Vasco Leo ihre Schafsmilch brachte. Denn Leo war ihre treuste Kundin. Sie schwor auf die positive Wirkung der Orotsäure in der Milch auf Herz und Leber sowie auf die Lern- und Merkfähigkeit. Von den Mischpaketen aus Lammfleisch, die im Rüttigrund ebenfalls produziert wurden, liess sie allerdings die Finger, da sie bereits lange vor ihrem Zuzug nach Hinterberg den Fleischkonsum eingestellt hatte.
Wenn Leo nicht in der Sonne Portugals gelegen und sich mittels Yoga an Körper und Geist Bewusst- und Achtsamkeit zelebriert hätte, hätte sie sich auf jeden Fall masslos aufgeregt. Einerseits natürlich über die in ihren Augen hinterwäldlerischen Trampel aus dem Hirschen, aber andererseits genauso über die heutige Jugend, die nur auf Konsum aus war und althergebrachte heilige Dinge wie die Walpurgisnacht zum sinnentleerten Saufgelage degradierte.
»Was ist?«, unterbrach Ruedi Lottis Gedankengänge.
»Och, nichts. Ich habe nur gerade überlegt, was Leo zum Thema Walpurgisnacht gesagt hätte.«
»Oh je. Das wage ich mir gar nicht auszumalen.«
Lotti lächelte. »Siehst du. Ich auch nicht.«
Kapitel 3 Donnerstag
Ich warte. Eigentlich wäre es doch langsam Zeit, mit Lotti eine Runde zu drehen, doch meine Chefin kümmert sich mal wieder lieber um den Garten und die Hühner. Immerhin scheint die Sonne auf mein schwarzes Fell und ich kann meinen Gedanken nachhängen. Die Aufregung von gestern mit dem Lärm um die Walpurgisnacht ist mittlerweile verflogen. Vorhin haben Ruedi und Lotti aber nochmals über Leo geredet. Ich hoffe, dass sie bald zurückkehrt und wir sie besuchen können. Ich bin nämlich gern bei Leo – nicht unbedingt wegen ihrer Yorkshire-Terrier-Hündin Mata Hari, sondern wegen ihrer Gutzibüchse. Diese hat die magische Eigenschaft, nie leer zu sein, und weil Leos Herz für Tiere gross ist, profitiere ich ebenfalls davon.
Bereits im letzten Herbst war Leo in den Ferien, und Mata Hari lebte damals für einige Wochen bei uns. Das war für beide von uns keine einfache Zeit, da sie eine rumpelsuurige alte Zeitgenossin ist. Regen betrachtet sie als persönliche Beleidigung, schlafen kann sie nur in ihrem eigenen seidenweichen Bettchen, und wehe, wenn sich in ihrer Nähe ein Strohhalm oder ein Erdklumpen befindet. Dann könnte man meinen, sie erleide darob nächstens einen allergischen Schock. Okay, jetzt übertreibe ich ein wenig, aber empfindlich ist sie schon extrem, und das sind nun mal keine guten Voraussetzungen für Ferien auf dem Bauernhof. Deshalb waren wir beide froh, als Leo Mata Hari wieder abholte und in ihr von Räucherstäbchen parfümiertes Einfamilienhaus brachte. Seither linst mich die Hündin bei unseren Besuchen noch skeptischer an als vorher – vielleicht hat sie Angst, dass sie zu uns zurückmuss.
Nachdem ich lange gewartet und in der Sonne gelegen habe, pfeift mich Lotti endlich zu sich. Juhu, wir gehen spazieren! Als ich wie ein Rumpelstilzchen um meine Chefin herumhüpfe, muss sie lachen.
»Schon gut, ich sehe, dass es höchste Zeit ist, dass Mara wieder zurückkommt. Heute Abend ist sie zu Hause, und bald geht sie wieder mit dir laufen.«
Mara, ist das wahr? Das ist ja eine Supernachricht! Wenn ich sage, dass ich Leo mag, dann liebe ich Lottis Nichte über alles. Sie ist meine beste Freundin und mein liebster Mensch – ausser natürlich Lotti selbst. Auch Ruedi liegt mir am Herzen, aber er ist nicht einer, der mit mir rumtollt oder Stöckchen wirft, er ist mehr einfach so da. Wie ein alter Baum. Er gehört zum Rüttigrund wie die Schafe, die Hühner und der Einachsertraktor. Aber wenn Mara aus den Ferien zurückkehrt, kann ich es kaum erwarten.
Als Kind hat Mara ein paar Jahre bei ihrer Tante und ihrem Onkel auf dem Hof gewohnt, hat man mir erzählt, weil ihre Mutter wegen der Arbeit und so sich nicht um sie kümmern konnte. Was mit Maras Vater ist, weiss ich nicht. Der war irgendwie nie Thema. Vielleicht gibt es Menschen, die gar keinen Vater haben. Bei uns Hunden ist es ja meist so. Jedenfalls ist Mara fast so was wie eine Tochter für Lotti. Sie lebt in einer kleinen Wohnung im Dorf, doch sie kommt oft auf den Hof, und regelmässig streift sie mit mir durch den Wald und über die Felder.
Vor Freude springe ich um Lotti herum. Diese lacht wieder. »Man könnte fast meinen, du hättest mich verstanden, mein Spinner auf vier Pfoten«, sagt sie, und in ihrer Stimme liegt viel Liebe.
Klar habe ich das. Das ist etwas, das die Menschen nicht begreifen wollen: Wir können ihre Sprache sehr wohl verstehen – zumindest, wenn es sich nicht um Quantenphysik, Fussballregeln oder Finanzpolitik handelt. Und zumindest, wenn wir es wollen. Umgekehrt ist das leider oft nicht der Fall.
Lotti und ich drehen gemeinsam eine Runde durch den Wald. Gleich hinter dem Rüttigrund folgen wir einem kleinen Trampelpfad hinunter Richtung Kantonsstrasse, die vom Tal nach Hinterberg hochführt. Dieser Pfad wird nur selten benutzt. Gleich neben seiner Einbiegung in die Strasse befindet sich ein gut ausgebauter Wanderweg. Das ist der Grund, weshalb oft Leute dort ihr Auto abstellen, um mit ihrem Hund mal ein paar Schritte durch den Wald zu gehen. Ich bemitleide diese Tiere ja, weil sie in einem Fahrzeug eingesperrt werden, um ein klein wenig Zeit in der Natur verbringen zu dürfen. Einer von denen hat mir mal erzählt, dass sein Herrchen ständig im Stress ist und er deshalb sofort umdreht und den Hund wieder in den Kofferraum verfrachtet, sobald das grosse Geschäft erledigt ist. Deshalb verklemmt der Hund sich sein Häufchen immer so lange wie möglich, um den Spaziergang im Wald auszudehnen. Finde ich traurig, so was. Diese Art von Hundeleben wäre nicht das richtige für mich. Ich brauche Freiheit, und ich hasse Autofahren. Mir wird schnell übel davon.
Etwas an dem roten Wagen, der heute am Ende des schlammigen Trampelpfads steht, ist allerdings merkwürdig: Er riecht nicht nach Hund. Wer parkiert hier denn, wenn er nicht das Glück besitzt, einen treuen Freund zu haben? Auch Lotti fällt das Fahrzeug auf, das merke ich. Das ist halt eine Lieblingsbeschäftigung der Einheimischen: sich bei allem, was fremd oder nicht ganz gewöhnlich ist, Gedanken zu machen, woher es kommt, wohin es geht und was um Himmels willen es ausgerechnet an diesem Fleckchen Erde macht, das Hinterberg heisst.
Nach einer ausgedehnten Runde unter dem Sattgrün der jungen Buchenblätter gehen wir langsam heimwärts, der Schattholde entlang. An der schattigen, steilen Flanke eines Jurahügels schnüffle ich ausgiebig im Unterholz und filtere eine fast vollständige Palette des lokalen Wildlebens durch meine Riechzellen. Neben Füchsen und Dachsen haben zahlreiche Eichhörnchen und Waldmäuse ihre Duftmarken hinterlassen. Und natürlich jede Menge Krabbelgetier, doch das finde ich nur mässig spannend, auch weil einige fiese Vertreter stechen können.
Etwas weckt heute mein besonderes Interesse: ein herber Geruch, der am Waldboden haftet und sogar in der Luft liegt. Irgendwie hündisch, irgendwie aber auch nicht. Und wild. Instinktiv stelle ich meine Nackenhaare auf. Lotti – sie ist eine gute Beobachterin – entgeht nicht, dass ich etwas Aufregendes entdeckt habe. Allerdings missversteht sie mein Verhalten als Aufflackern meines Jagdtriebs und nimmt mich vorsichtshalber an die Leine. Als sie mich weiterziehen will, stemme ich mich mit aller Kraft dagegen, denn diese Spur muss eingehend untersucht werden. Ich komme jedoch zu keinem Schluss, welches Tier dahinterstecken könnte. Nur etwas spüre ich deutlich: Es macht mir ein bisschen Angst.
*
»Nächster Halt: Olten.«
Die scheppernde Stimme aus dem Lautsprecher weckte Mara aus ihrem Dämmerzustand, in dem sie die Strassen, Bäume, Flüsse und Hügel vor dem Zugfenster nur schemenhaft wahrgenommen hatte. Sie setzte sich aufrecht hin und streckte den Rücken durch. Fuhr sich mit den Fingern durch ihr halblanges braunes Haar, um die Frisur halbwegs wieder in Form zu bringen oder um wenigstens nicht ganz wie ein Zombie auszusehen. Denn so ähnlich fühlte Mara sich. Übernächtigt, gerädert, desorientiert. Aber egal. Nun war sie bald in Olten und musste nur noch zweimal umsteigen.
Mara hatte ein paar schöne Tage bei einem Malkurs in Südfrankreich verbracht, wo sie nette Leute kennengelernt und daher in den vergangenen drei Nächten wenig Schlaf bekommen hatte. Den würde sie auf der Fahrt von Nîmes nach Hause nachholen, hatte sie sich gedacht, dabei aber ausser Acht gelassen, dass dieses Vorhaben schlecht umsetzbar ist, wenn der Zug überfüllt, laut und verspätet ist. Übermüdet – und definitiv ferienreif – packte sie Reisetasche, Rucksack und Jacke zusammen und stellte sich mit den anderen Leuten zusammen in den Gang, um den Intercity aus Genf, der einmal quer durch die Schweiz bis St. Gallen fuhr, endlich verlassen zu können.
Als sie schließlich in Olten auf dem Perron auf ihre Anschlussverbindung wartete, um das letzte Wegstück durch den Jurahauptkamm hindurch auf die andere Seite des Höhenzugs zu gelangen, blickte sie verträumt zu den bewaldeten Hügeln hinauf, die sich hinter der Stadt und der Bahnanlage in den bewölkten Himmel erhoben. Der grosse Sendemast bei der Frohburg sah ein wenig so aus, als berühre er die Wolken. Alles war grau und schien sich vor dem baldigen Regen zu ducken. Mara konnte das einerlei sein, denn sie hatte für heute keine Pläne, außer anzukommen, zu duschen und etwas zu essen. Und, weil sie es versprochen hatte, noch schnell bei Tante Lotti vorbeizuschauen.
Sie überbrückte die Wartezeit mit dem Handy, las News, checkte Mails und rief dann die Dating-App auf, bei der sie vor ein paar Monaten ein Abonnement gelöst hatte. Aus Neugier, vordergründig, doch wenn sie ehrlich war, wünschte sie sich nach ihrer Scheidung vor anderthalb Jahren allmählich wieder eine Beziehung. Bei der Plattform gab es immerhin eine beachtliche Auswahl an potenziellen Partnern, die laut Algorithmus zu ihr passen könnten, aber ob es wirklich klappen würde, stand auf einem anderen Blatt. Bisher war der Traumprinz jedenfalls noch nicht aufgeploppt. Die ersten drei Männer, die Mara gedatet hatte, hatten sich allesamt als Typen entpuppt, mit denen sie von sich aus niemals freiwillig einen Abend verbracht hätte. Der erste war ein selbstverliebter Schleimer gewesen, der zweite eine hypernervöse Sportskanone und der dritte ein Langweiler, bei dem sie schon nach einer Viertelstunde fast eingeschlafen wäre. Den vierten hatte sie immerhin noch ein weiteres Mal getroffen. Sascha Rossi wohnte im Unterbaselbiet und war von Beruf irgendwas mit IT. In seinen Nachrichten hatte er spannend und humorvoll gewirkt, die Realität hatte allerdings nicht mithalten können. Auch nach dem zweiten Rendezvous war kein Funke übergesprungen. Sascha war zwar ein sympathischer Mensch, vielleicht ein wenig zu brav, mit etwas spiessiger Kleidung und – sehr eigenartig – einem kleinen Plüschbüffel, der an seinem Rucksack gebaumelt war. Als Maskottchen! Erwachsene Männer, die Minikuscheltiere spazieren führten, waren zwar sicher nicht nullachtfünfzehn, doch irgendwie sonderbar.
Das erste Mal hatten sie sich in einem Café getroffen. Zu seinen halbwüchsigen Kindern hatte Sascha nach seiner Scheidung kaum Kontakt, und als Hobbys erwähnte er ein paar alltägliche Dinge und meinte dann: »Was ich sonst noch gern tue, erklär ich dir ein andermal.« Im Witz fragte sie, ob es etwas Anrüchiges oder Kriminelles sei, da er ein Geheimnis drum mache, und er schüttelte lachend den Kopf, verriet es aber trotzdem nicht, was irgendwie einen schalen Beigeschmack hinterliess. Beim anderen Mal hatten sie das historische Museum besucht, und er hatte ungefähr drei Stunden ohne Pause auf sie eingeredet. Theoretisch interessant, doch praktisch, so fürs zweite Date … hmm. Das war kurz vor ihren Ferien gewesen, und während ihrer Abwesenheit hatte sie keine Sekunde an Sascha gedacht oder ihn gar vermisst.
Mara hoffte stattdessen, dass es mit Nummer fünf besser laufen würde. Sven Küng war ein Bauzeichner aus dem Aargau. Unmittelbar vor ihrer Abfahrt nach Südfrankreich hatte sie begonnen, mit ihm zu chatten, und mittlerweile wollte sie ihn kennenlernen. Während ihres Kurses hatten sie jeden zweiten Tag telefoniert, und seine Stimme hatte sehr sympathisch geklungen.
*
Als Mara mit Regionalzug und Postauto die beiden letzten Etappen ihrer Heimreise geschafft und ihre kleine Wohnung im Zentrum Hinterbergs erreicht hatte, stellte sie ihr Gepäck in eine Ecke und die Schuhe auf den Balkon des Hochparterres. Eine schmale Holztreppe führte in den Hinterhof und wurde von Nachbars Kater fleissig benutzt, wenn er sich bei Mara ein paar Streicheleinheiten abholte. Fressalien gab es keine, erstaunlicherweise kam er trotzdem immer wieder.