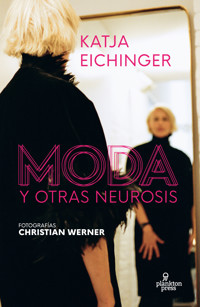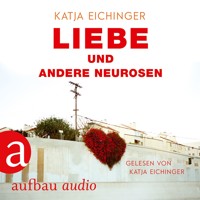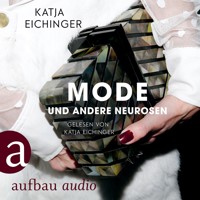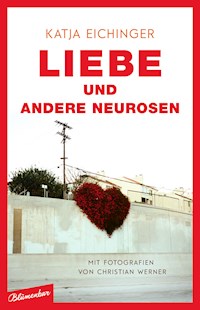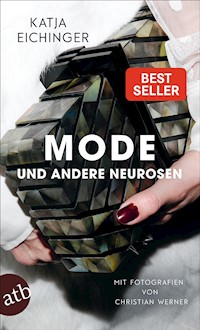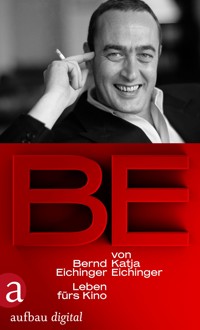
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Bernd Eichingers Weg als größter deutscher Filmproduzent und preisgekrönter Drehbuchautor war ein wilder Ritt, von München nach Hollywood und zurück. Seine großen Erfolge wie Die unendliche Geschichte, Der Untergang, Der Name der Rose, Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo oder Das Parfum waren hart erkämpft. Seiner Frau Katja Eichinger erzählte er von den vielen Dramen und dem Irrsinn, der sich hinter den Kulissen seiner Filmproduktionen abspielte. Von seinen Zweifeln, seinen Ängsten und seinen Sehnsüchten, die ihn bis zu seinem viel zu frühen Tod 2011 begleiteten. Katja Eichinger sprach außerdem mit zahlreichen Freunden und Weggefährten ihres Mannes wie Stan Lee, Werner Herzog und Wim Wenders. Sie erzählt so von einem Leben, das maßlos war in seiner Liebe zum Kino und kompromisslos in seiner Leidenschaft.
Ein Buch das Mut macht, für die eigenen Träume zu kämpfen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 873
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Bernd Eichingers Weg als größter deutscher Filmproduzent und preisgekrönter Drehbuchautor war ein wilder Ritt, von München nach Hollywood und zurück. Seine großen Erfolge wie Die unendliche Geschichte, Der Untergang, Der Name der Rose, Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo oder Das Parfum waren hart erkämpft. Seiner Frau Katja Eichinger erzählte er von den vielen Dramen und dem Irrsinn, der sich hinter den Kulissen seiner Filmproduktionen abspielte. Von seinen Zweifeln, seinen Ängsten und seinen Sehnsüchten, die ihn bis zu seinem viel zu frühen Tod 2011 begleiteten. Katja Eichinger sprach außerdem mit zahlreichen Freunden und Weggefährten ihres Mannes wie Stan Lee, Werner Herzog und Wim Wenders. Sie erzählt so von einem Leben, das maßlos war in seiner Liebe zum Kino und kompromisslos in seiner Leidenschaft. Ein Buch das Mut macht, für die eigenen Träume zu kämpfen.
Über Katja Eichinger
Katja Eichinger studierte am British Film Institute und arbeitete als Journalistin in London, u. a. für »Vogue«, »Dazed & Confused« und die »Financial Times«. Nach ihrem Bestseller »BE«, der Biographie ihres verstorbenen Mannes Bernd Eichinger, erschien bei Blumenbar 2020 der Essayband »Mode und andere Neurosen«, der ebenfalls ein Bestseller wurde. Neben ihrer Arbeit als Autorin produziert Katja Eichinger Musik. Sie lebt in München und Berlin.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Katja Eichinger
BE - Bernd Eichinger
Leben fürs Kino
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Zitat
Im Beginn liegt das Ende
Eingesperrt
Freunde fürs Leben
Wanderjahre
Nur Küsse schmecken besser
Die magischen Kanäle des Verleihgeschäfts – Das Boot
Barbaren, Weise und ein bisschen Heimat
Die unendliche Geschichte
Der Rosenkrieger
Der Prinz von München
Bärbel – oder die erschreckende Frage, was eine Frau alles können muss
Kurzer Exkurs über das Boxen
Babylon
Kontrollverlust
Raging Bull
A Sunny Place for Shady People
Hundstage
Development Hell
The Fantastic Four
Das Geisterhaus
Der lange Weg nach Hause
Bewegte Männer
»Wenn es eine Hoffnung gibt, dann liegt sie bei den Proles«
Zement & Salz
Smillas Gespür für Rosemarie
Wenn man vom Teufel spricht
Eine deutsch-deutsche Beziehung
Bulle & Bär
Der Schuh des Manitu
Geld stinkt nicht
Tief, tief, tief in den Osten
Der Fuchs im Hühnerstall
Aromatherapie
Wer ist Grenouille?
Der reine Tor
Liebe auf das erste Wort
Meine Damen und Herren, wir schweben im All
Ein Parfum, eine Hochzeit und ein Todesfall
Die unerreichbare Leichtigkeit des Seins
Keine Angst
Let’s make a movie together!
Mittendrin
Zwischenwelten
ZORN
Des Wahnsinns fette Beutep
Im Ende liegt der Anfang
How to B. E. – Tipps fürs Leben
Filmographie (Auswahl)
Produzent:
Drehbuchautor:
Regisseur:
Produktionsleitung:
Darsteller:
Danksagung
Impressum
Wer Biograph wird, verpflichtet sich zur Lüge, zur Verheimlichung, Heuchelei, Schönfärberei und selbst zur Verhehlung seines Unverständnisses, denn die biographische Wahrheit ist nicht zu haben, und wenn man sie hätte, wäre sie nicht zu brauchen.
Die Wahrheit ist nicht gangbar, die Menschen verdienen sie nicht, und übrigens hat unser Prinz Hamlet nicht recht, wenn er fragt, ob jemand dem Auspeitschen entgehen könnte, wenn er nach Verdienst behandelt würde?
Sigmund Freud, aus »Briefe an Arnold Zweig«
Im Beginn liegt das Ende
AN dem Abend, als Bernd starb, fuhren wir in seinem alten, etwas verbeulten schwarzen Mercedes den Sunset Boulevard entlang in Richtung Westen. Wir befanden uns auf dem Weg zu Cecconi’s, einem italienischen Restaurant an der Kreuzung von Robertson und Melrose in West Hollywood. Es war eine schöne Nacht. Ein schwarzer Himmel über den Neonlichtern der Straße. Ich liebte das. Mich von Bernd in diesem gemütlichen alten Schiff herumkutschieren zu lassen, noch ein wenig mit ihm alleine zu sein, bevor das Abendessen mit seinen Leuten von der Constantin losging und die ganzen Meinungen und Unterhaltungen auf uns einprasseln würden. Irgendwo auf der Höhe des »Hustler«-Ladens – aus dem übrigens ein beträchtlicher Teil unserer DVD-Sammlung stammte – und der riesigen Billboard Poster einer Led Zeppelin Tribute Band, mussten wir an einer Ampel halten. Vor uns bog ein weißer Fünfziger-Jahre-Schlitten mit Haifischflossen und offenem Verdeck ab. Die Insassen waren mexikanische Hoodies, die sich in ihrem Auto wahnsinnig cool vorkamen. Ich sagte noch: »Schau mal, lauter mexikanische Bushidos …«
»Ein weißer Impala!«, lachte Bernd leise. »In genau so einem bin ich mal fast gestorben!« Und dann tat er das, was ich noch mehr liebte, als mit ihm durch die Gegend zu fahren und die leuchtenden Bilder der Straße an mir vorbeiziehen zu lassen: Er erzählte mir eine Geschichte. Damals, Ende der Sechziger, gab es laut Bernd in Deutschland mit der Ausnahme von UFOs kein auffälligeres Fortbewegungsmittel als einen Chevrolet Impala. Gerade deswegen war der Impala – nomen est omen – vor allem bei Zuhältern beliebt, denn er war ein Magnet für Miniröcke auf zwei Beinen. »Der Impala gehörte einem Bekannten von mir … der war jetzt kein Zuhälter, eher so ein polizeibekannter Kleinkrimineller aus der Provinz.« Bernd ging damals auf ein Internat in München und war auf Elternbesuch in Neuburg an der Donau. »Und du kennst mich ja … ich hatte lange Jahre immer diesen Hang zum Rotlicht. Und so Typen kannte ich eben auch noch in Neuburg, obwohl ich schon längst in München war«, erzählte Bernd und bog nach links auf den Doheny Drive ab. Dieser führt vom Sunset Boulevard hinunter in die Talsenke von West Hollywood und Beverly Hills. Während ich also Bernds Geschichte zuhörte, fuhren wir hinein in diesen funkelnden Juwelenteppich von einer Stadt. Was letzte Autofahrten anbelangt, so kann man sich wahrscheinlich kaum eine schönere Strecke aussuchen.
Aber zurück zu Bernds Geschichte: Der Impala-Besitzer war polizeibekannt und hatte wieder einmal seinen Führerschein entzogen bekommen. Deswegen saß Bernd am Steuer, mit dem Kleinkriminellen auf dem Beifahrersitz, als sie an den Dorfdiscos des Neuburger Landkreises vorbeizogen. »Plötzlich sieht mein Bekannter, wie seine Freundin in ’nem Auto mit ’nem anderen Typen vorbeifährt, rastet komplett aus und will, dass ich diesem anderen Auto hinterherrase. Ich hab ihm gesagt, das kann er vergessen. Ich bin doch nicht blöd und verliere meinen Führerschein, nur weil irgendne Provinzschlampe bei irgendnem Trottel im Auto sitzt und sein Ego das nicht verkraften kann.«
Was folgte, war ein fliegender Fahrerwechsel und eine Verfolgungsjagd über die dunklen Landstraßen des Donautals. Verfolgter und Verfolger fuhren immer schneller, und die Hatz endete damit, dass der Kleinganove mit seinem Impala von der Landstraße abkam und frontal gegen einen Baum fuhr. »Der Impala war Schrott. Kompletter Totalschaden. Dass uns nichts passiert ist, war ein Wunder! Im Nachhinein denk’ ich natürlich: Ich war so ein Depp! Ich hätte ja auch einfach aussteigen können, anstatt diesen Neandertaler, der nur noch Rot gesehen hat, ans Steuer zu lassen und dann auch noch mit ihm durch diese dunklen Straßen zu kurven. Ich hab überhaupt nicht daran gedacht, dass das irgendwie gefährlich werden könnte!« Mittlerweile hatten Bernd und ich den Santa Monica Boulevard überquert und bogen links auf die Melrose Avenue ab. Vor uns lagen die mit bläulichweißen Lichterketten überzogenen Palmen, die vor der Einfahrt von Cecconi’s stehen. Ein Anblick wie aus 1001 Nacht, eins von Bernds Lieblingsbüchern. Anderthalb Stunden später war Bernd tot.
Ich versuche mich immer wieder daran zu erinnern, dass Bernds Tod nur einen Wechsel seines Aggregatzustands darstellt. Anders wüsste ich nicht mit seinem Tod umzugehen. Bernd war nicht Filmemacher von Beruf, er war Filmemacher bis in die letzte Faser seines Körpers. Er hat, wie er oft sagte, »Film geatmet«. Und weil Film in erster Linie Geschichtenerzählen ist – jedenfalls Film, wie Bernd ihn begri. –, will ich nun seine Geschichten erzählen. So kann ich ihn weiteratmen lassen. So gebe ich den flüchtigen Aromen der Erinnerungen wieder eine gewisse Plastizität.
Bernd wurde in Neuburg an der Donau geboren. Am 11. April 1949 um 13 Uhr 15. Sein Vater Manfred Eichinger war Landarzt in dem nahe gelegenen Rennertshofen und wurde besonders als Geburtshelfer geschätzt. Doch weil seine Frau Ingeborg vor Bernds Geburt eine Fehlgeburt erlitten hatte, kam Bernd, anders als seine drei Jahre ältere Schwester Monika, im Krankenhaus von Neuburg zur Welt. Zu seinem ersten Geburtstag ließ eine Patientin des Vaters ein Horoskop für Bernd erstellen. Das Original ist mit Schreibmaschine getippt und in ein Fotoalbum geheftet, das ihm seine Mutter schenkte, als Bernd 1979 die Constantin Film übernahm. Nun mag man von Horoskopen halten, was man will, aber der Text ist wirklich erstaunlich. Und wer Bernd kannte, wird ihn darin sicher wiedererkennen:
Horoskop von Bernd Eichinger, erstellt am 8. 3. 1950
Aszendent in Löwe, allgemein ein starker, stolzer und kühner Charakter mit ausgeprägter, eigener Individualität. Der Wille und das Selbstbewusstsein sind dabei immer stark betont. Die Sonne (…) deutet auf dominierenden Ehrgeiz und das Streben nach hoher sozialer Position, aber auch überragende persönliche Fähigkeiten, die solche erstrebten Positionen auch erreichen lassen. Die Sonne im Zeichen Widder betont das Willenselement. (…) Er braucht Taten und Erfolge, um seinen brennenden Ehrgeiz zu befriedigen. (…) Er ist eine richtige Führernatur, der die anderen durch das eigene Beispiel mitreißt. Allerdings nimmt er auf andere, die nicht mitkönnen, wenig Rücksicht, da er Schwäche und Entmutigung einfach nicht versteht. Er scheut kein Wagnis und fordert darum denselben persönlichen Mut auch von allen anderen. Die ihn aber nicht haben, werden ihn darum als draufgängerisch und rücksichtslos empflinden. Aber tatsächlich ist er großzügig und auch gönnerhaft, keineswegs ein Unterdrücker der Schwächeren. (…) Im Denken stark subjektiv, was ein echtes und gefühlsmäßiges Verstehen der anderen abschwächt. (…) Modern im Denken, Liebe für Sensationen, (…) in Kleinigkeiten nervös und ungeduldig, (…) geringe Klarheit im alltäglichen praktischen Denken. (…) Der Kleinkram des Alltags wird als zu gering erachtet, um ihm viel Aufmerksamkeit zu schenken, da die große Konstellation im Widder an der Spitze vom 10. Haus zu stark die Großzügigkeit im Planen und Handeln betont. (…) Sonne Quadrat Jupiter gibt Neigung zum Großartigen und zur Übertreibung der Großzügigkeit, als zeitweise zur Verschwendung und Unbedachtsamkeit.
Mars Opposition Neptun deutet auf einen Zwiespalt zwischen Tat und Phantasie, sodass der Geborene sich bisweilen in seinen Vorsätzen übernimmt. Im Vordergrund der Persönlichkeit steht jedenfalls das Willens- und Tatleben, der starke Ehrgeiz und das Selbstbewusstsein. Es ist ein außergewöhnliches Horoskop! Die Sonne am MC mit drei vorangehenden Planeten lässt zweifellos eine bedeutende Laufbahn erwarten, einen klangvollen Namen, eine machtvolle Position, Ruhm, Ehre aufgrund eigener Leistungen, Bekanntwerden im In- und Ausland.
Bernd bekam dieses Horoskop erst im Alter von dreißig zu lesen, von einer »self-fulfilling prophecy« kann also keine Rede sein. Trotzdem hat es ihm natürlich gefallen. Und jedes Mal, wenn in unserem Bekanntenkreis ein Kind geboren wurde, ließen wir diesem Kind als Geschenk an die Eltern und den späteren Erwachsenen ein Geburtshoroskop erstellen.
Bei den Eichingers handelt es sich um Rückkehrer aus den USA. Manfred Eichingers Vater, also Bernds Großvater, war in Brooklyn zur Welt gekommen. In unserem Haus in Los Angeles hing immer ein Foto, das Bernds Großvater als Kind mit seinen Geschwistern und Eltern zeigt, und das in einem Fotoatelier in Brooklyn aufgenommen worden war. Dunkelhaarige, stämmige Menschen, der Urgroßvater mit Schnauzer und die Urgroßmutter im bürgerlichen Rüschenkleid. Bernds Vorfahren waren eine von 67 Eichinger-Familien, die um 1900 in Nordamerika lebten – die meisten davon in New York. Sie waren ausgewandert, weil die Familienbrauerei an ein anderes Familienmitglied gegangen war und sich ihnen in Deutschland keine Chancen boten. Als jedoch der Besitzer der Brauerei plötzlich verstarb, kehrten die Eichingers zurück nach Deutschland und übernahmen den Betrieb. Bernd fand es immer kurios, dass sein Großvater die amerikanische Staatsbürgerschaft besessen hatte und seine Urgroßeltern zu den wenigen Auswanderern gehörten, für die die schöne neue Welt auf einmal wieder Deutschland hieß. Ich fand es einleuchtend, dass Bernd, der in seinem Leben Unmengen von Alkohol getrunken und davon nie einen Kater bekommen hat, von Bierbrauern abstammte.
Bernds noch in den USA geborener Großvater wurde nicht Bierbrauer, sondern Arzt. Er heiratete eine Jüdin, die allerdings starb, als Manfred Eichinger erst zwölf Jahre alt war. Während des Dritten Reiches (und auch noch lange danach – Bernd erfuhr erst als Erwachsener davon, als sein Vater sich mit dem Stammbaum der Familie beschäftigte und seinen Sohn eines Tages beiseitenahm, weil er ihm »etwas sagen« wollte) wurde die Religion der Mutter mit Hilfe des Bürgermeisters verschwiegen. Manfred Eichinger bekam seinen Arier-Stempel und durfte später Medizin studieren. Manfred Eichingers Vater war gegen das Medizinstudium seines Sohnes, weil er dachte, der Arztberuf habe kein rechtes Ansehen mehr in der Gesellschaft. Er wollte Manfred zum Priester machen. Der Zölibat stand jedoch für Bernds Vater absolut nicht zur Diskussion. Dazu war Manfred Eichinger, das geht aus seinen Aufzeichnungen hervor, schon als kleiner Junge viel zu sehr von den weiblichen Formen begeistert. Also setzte er sich gegen die Widerstände des Vaters durch, finanziertesein Medizinstudium als Kirchenorganist und machte 1942 als jüngster Doktor von Bayern sein Staatsexamen. 1943 wurde er als Arzt in den Krieg an die Ostfront geschickt.
»Ich habe meinen Vater oft gefragt, ob er denn keine Angst hatte, dass ihm etwas geschehen könnte. Schließlich war er ja an vorderster Front und musste im Kugelhagel Leute verarzten, denen die Gedärme heraushingen. Mein Vater meinte jedoch, er könne es sich auch nicht erklären, aber er sei immer überzeugt gewesen, dass er überleben werde«, erzählte mir Bernd, als wir – wie so oft – über den Zweiten Weltkrieg redeten. Der Zweite Weltkrieg und das Dritte Reich waren ein zentrales Thema für Bernd. Und da die Barbarei des Drittes Reiches auch meine Familiengeschichte geprägt hat, war es auch ein wichtiges Thema für mich. Bernd hat sein Trauma – einer Generation anzugehören, die für die Taten und Unterlassungen sowie die Werte und Tabus der Elterngeneration nur Verachtung und Ablehnung empflinden kann – durch Filme wie »Der Untergang«, »Der Baader Meinhof Komplex« und »Das Mädchen Rosemarie« für sich bewältigt. Insbesondere nach »Der Untergang« und den Diskussionen – privat wie öffentlich –, die der Film auslöste, hatte er in Bezug auf das Dritte Reich und den Zweiten Weltkrieg für sich den Zustand einer gewissen Katharsis erreicht. Filmisch gesehen (und das bedeutete für Bernd etwa 95 Prozent seines Bewusstseins), war das Thema für ihn verarbeitet. Immer wieder wurden Stoffe über das Dritte Reich und den Zweiten Weltkrieg an ihn herangetragen. Besonders den Aufstieg des jungen Adolf Hitler hätte er ohne Probleme zigmal finanziert bekommen. Aber er winkte jedes Mal ab. Bernd hatte alles gesagt, was er zu dem Thema zu sagen hatte – so auch im Frühsommer 2007.
Ich kann mich noch genau an den Moment erinnern, als Bernd an diesem Sommertag einen Anruf in Sachen Drittes Reich aus Los Angeles erhielt. Bernd war gerade in seinen weißen Boxershorts aus dem dunklen Schlafzimmer aufgetaucht und blickte verschlafen ins Sonnenlicht. Plötzlich klingelte das Telefon. »Hi! Paula! Good to hear from you!«, rief Bernd, mit einem Mal wach. Und weil er sich sofort aufs Sofa setzte und die Arme in seiner Konzentrationspose auf die Knie stützte, wusste ich: Das war nicht irgendeine Paula, das musste Paula Wagner sein, die damalige Produzentin von Tom Cruise. Paula Wagner und Tom Cruise hatten schon einige Wochen lang den deutschen Blätterwald ordentlich zum Rascheln gebracht, weil sie den Film »Operation Walküre« über das missglückte Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 planten. Tom Cruise hatte vor, Claus Schenk von Stauffenberg zu spielen. Die Nachricht, dass der überzeugte Scientology-Anhänger Cruise, dessen Religionsgemeinschaft in Deutschland vom Verfassungsschutz wegen anti-demokratischer Tendenzen beobachtet wurde, den Helden des Deutschen Widerstands spielen wollte, war in den deutschen Medien schon im Vorfeld der Produktion mit wenig Begeisterung aufgenommen worden. Tom Cruise war jemand, der auf Talkshow-Sofas herumhüpfte und an Außerirdische glaubte. Dem traute man keine Integrität zu. Dass da nun »die Paula« »den Bernd« anrief, konnte nur eines bedeuten: Paula Wagner brauchte einen deutschen Co-Produzenten. Nicht nur, um Drehgenehmigungen und Fördergelder zu bekommen – sie brauchte jemanden, der sich in Deutschland hinter das Projekt stellte. Einen Lobbyisten. Wagner, Cruise und der Regisseur Bryan Singer hatten »Der Untergang« gesehen. Um Bernds Namen benutzen zu können, war Paula Wagner bereit, ihm eine Million Dollar zu zahlen.
»Also, bevor ich da irgendwas sagen kann, muss ich das Drehbuch lesen«, hörte ich Bernd auf Englisch mit seiner tiefen Stimme ins Telefon brummen. Paula Wagner wollte das Drehbuch jedoch nicht herausrücken. »Aber es ist Tom Cruise, Bernd, Tom Cruise!«, war ihre Antwort. Ihrer Meinung nach war der Name Tom Cruise (und eine Million Dollar) Argument genug, damit Bernd sich auf ein Projekt einlassen würde, ohne das Drehbuch gelesen zu haben und bei dem schon im Vorfeld klar war: »Das gibt Mecker!« (um hier Bernds Lieblingssatz und eine unserer stehenden Redewendungen aus Bernds Zeichentrickproduktion »Werner –Beinhart!« von 1990 zu zitieren).
Bernd ließ sich nicht darauf ein.
»Es tut mir leid, Paula, aber ich drehe dieses Jahr selbst einen Film« (im August sollten die Dreharbeiten zu »Der Baader Meinhof Komplex« beginnen), »da bin ich viel zu beschäftigt, als dass ich dir helfen könnte … und ohne das Drehbuch gelesen zu haben, geht’s sowieso nicht.«
Wenn einer wusste, wie brisant das Thema Drittes Reich in Deutschland ist, dann Bernd. Einer Hollywoodproduktion zu vertrauen und für sie den Kopf hinzuhalten, ohne das Drehbuch zu kennen, wäre wahnwitzig gewesen. Nach dem Telefonat standen Bernd und ich uns gegenüber. Bernd immer noch in seinen verknitterten Boxershorts und mit zerrauften Haaren. Er lächelte mich an mit einer Mischung aus Nervenkitzel, Zweifel und Erleichterung.
»Fuck me, eine Million Dollar – schon ’ne Menge Holz!«, lachte er sein Piratenlachen. »Aber wenn die das Drehbuch nicht rausgeben, dann kann das nichts Gutes heißen. Die wollen doch nur, dass ich für Tom Cruise die Kastanien aus dem Feuer hole. Für den hänge ich mich nicht aus dem Fenster, auch nicht für ’ne Million! Und überhaupt, ich bin fertig mit dem Thema. Ich kann’s einfach nicht mehr sehen … noch mal die Uniformen, noch mal das ›Sieg Heil‹-Geschrei und dann ewig dieselben Diskussionen, wenn der Film rauskommt … Nee, du. Bei mir ist Schicht.«
Bernds Vater war also an der Ostfront stationiert. Und obwohl er, wie anscheinend viele Ärzte, die eigene Verwundbarkeit nie wirklich in Erwägung zog, erkannte Manfred Eichinger kurz vor Kriegsende, dass er sich in einer fatalen Situation befand, die drastischer Maßnahmen bedurfte, falls er am Leben bleiben wollte. Also ließ er Bernds Mutter, damals noch Ingeborg Berkmann, ausrichten, dass er sich Fronturlaub geben lassen würde, um sie zu heiraten. Die Möglichkeit, dass Ingeborg, die ihren zukünftigen Gemahl hauptsächlich durch den täglichen Briefverkehr während der Kriegsjahre kannte, seinen Heiratsantrag ablehnen würde, zog Manfred Eichinger nicht in Betracht. Er schlug sich durch, von der Ostfront zurück nach Schellenberg bei Berchtesgaden, Ingeborgs Heimat. Beinahe hätte Manfred Eichinger es nicht zu seiner eigenen Hochzeit geschafft. Den Zug, in dem er saß, hatte das deutsche Militär in einem Tunnel auf einen entgegenkommenden Zug prallen lassen. Man wollte verhindern, dass die Alliierten den Tunnel benutzen und weiter nach Deutschland vordringen würden. Drei Tage waren Manfred Eichinger und die anderen Insassen der beiden Züge ohne Wasser und Verpflegung eingeschlossen. Niemand wusste, ob und wann sie je wieder herauskommen würden. Ingeborgs Mutter hatte schon die Befürchtung, der Zukünftige ihrer Tochter würde sie sitzenlassen. Das gesamte Dorf nahm sowieso an, dass Ingeborg heiraten »musste« und man sie ohne Mann, nur mit einem Stahlhelm unter dem Arm, verheiraten würde, um dem ungeborenen Kind einen ehelichen Namen zu geben. Der Bräutigam schaffte es dann aber doch noch zu seiner Braut, und die beiden heirateten am 24. Februar 1945.
Nach Kriegsende zog Ingeborg mit ihrem frisch angetrauten Gemahl von den Bergen ins flache Donautal, wo Bernds Großvater eine Landarztpraxis hatte, die Bernds Vater einmal übernehmen sollte. Ingeborg, die in den Büros der Constantin Film aufgrund ihrer Durchsetzungskraft und kernigen Energie auch gerne mal »der General« genannt wurde, hatte wenig gute Erinnerungen an die ersten Jahre ihrer Ehe. Da waren der cholerische Schwiegervater, ein vom Krieg traumatisierter Ehemann und ihre unendliche Sehnsucht nach ihren Bergen. Schon im ersten Ehejahr dachte Ingeborg über Scheidung nach. »Doch dann«, so erinnert sie sich, »war das erste Kind (Monika) unterwegs, das ich nicht vaterlos machen wollte, bevor es überhaupt zur Welt kam, und ich wusste: ›Nun bleibt mir nur noch der Kampf.‹«
Während Bernds Mutter das Familienleben mit Mann und Kindern als Kampf empfand, erinnerte sich Bernd immer gerne an die frühen Tage seiner Kindheit. Für ihn waren das Tage der absoluten Freiheit. Die Familie wohnte auf einem Bauernhof zur Untermiete. Nebenan befand sich eine Pferdeschmiede, deren Tor immer offen stand und wo es zischte und rauchte und die Pferde wieherten. Trotz des Protests seiner Eltern lief Bernd wie die anderen Dorfjungen vom ersten warmen Frühlingstag bis zum Ende des Sommers barfuß durch die Gegend. Das Bauernehepaar, bei dem die Eichingers zur Miete wohnten, war kinderlos. Und so sahen sie es denn relativ gelassen, dass Bernd und seine Schwester Monika ständig Unfug trieben.
»Der Moni saß immerzu der Schalk im Nacken. Ständig hat sie sich irgendwelche Streiche ausgedacht, und die haben wir dann gemeinsam ausgeheckt. Im nachhinein denke ich mir, dass das für die Erwachsenen ziemlich anstrengend gewesen sein muss. Aber wir hatten natürlich einen Riesenspaß. Und wir wussten auch, dass wir bestraft werden würden. Aber das war uns egal. Das war uns der Spaß wert. Einmal – wir hatten die Mauer umgestoßen, die der Bauer zwei Tage lang gemauert hatte – wollten wir dem Bauernehepaar einen Kuchen zur Entschuldigung backen. Das fanden die Erwachsenen natürlich großartig. Nur eben dass wir alle möglichen ungenießbaren Zutaten, wie Asche und Senf, in den Teig mischten. Das kam natürlich gar nicht gut an. Aber uns einfach zu entschuldigen und zu tun, was die Erwachsenen gut fanden, das wäre gegen unsere Ehre gegangen.«
Monika liebte ihren kleinen Bruder abgöttisch, und Bernd liebte seine Schwester. Ich habe sie nur zweimal getroffen, denn sie verstarb im August 2006 im Alter von sechzig Jahren. Damals war sie schon sehr krank. Aber auf allen Fotos, die ich von ihr gesehen habe, wirkt sie voller Leben und ihre Augen blitzen.
Moni war der Liebling des Vaters, und Bernd war der Liebling der Mutter. Während der Vater Moni seinen Patienten immer stolz als das »perfekte Kind« präsentierte, war Bernd das »Erholungskind« der Mutter, weil er als Kleinkind immer »so lieb und ruhig« war, ganz im Gegensatz zur quirligen Moni.
Tagebuchaufzeichnung von Bernds Mutter (2006)
Bernd war das Gegenteil seiner Schwester Monika: immer hungrig, immer rundlich, aber dafür immer gemütlich. Ein ausgesprochenes Erholungskind. Aber er verlangte auch generell die doppelte Portion an Nahrung und unterstützte seine Forderung durch lautes Geschrei. Natürlich war er für den ärztlichen Schönheitsbegriff meines Mannes zu dick … Bernd war von klein auf ein ausgesprochener Genussmensch. Wenn er keine Lust zum Spielen hatte, machte er sich selbst »gute Speise«, wie er es nannte: Haferflocken, Schokolade und Milch, was immer in der Küche für ihn bereitstand, denn er liebte süße Sachen. Mit dieser »guten Speise« legte er sich in einen Liegestuhl und genoss! Da war er höchstens vier.
Bernds Kinderfotos zeigen ihn als kleinen Brocken mit dickem Kopf und stämmigen Beinen, der so gar keine Ähnlichkeit mit seinem späteren Äußeren haben sollte. Ich kenne sonst niemanden, dessen Kinderfotos so wenig von der späteren Erwachsenengestalt erahnen lassen.
Bernds Schwester Moni war es, die ihm sein erstes Kinoerlebnis bescherte. An seinen ersten Film konnte sich Bernd nicht erinnern. Aber er dachte gerne daran zurück, wie er sich als kleiner Junge mit seiner Schwester ein Kinderzimmer teilte. Und wenn die beiden abends im Bett lagen und nicht schlafen konnten, erzählte Moni ihm, dass die Schatten, die durch den Mondschein und die sich bewegenden Wolken und Gardinen an die Wand des Kinderzimmers geworfen wurden, der Schein des Filmprojektors aus dem gegenüberliegenden Kino seien. Und zu diesen Schatten an der Wand erfand Moni Geschichten von Monstern, Cowboys und Indianern, Zauberern und Rittern. »Das war so spannend, sie hatte so eine erzählerische Begabung und Phantasie, ich hab ihr wirklich geglaubt, dass das echte Kinobilder waren. Immer wenn das Wetter und der Mond so waren, dass es Lichter und Schatten auf unserer Kinderzimmerwand gab, dann gab’s Monis Kino«, erzählte Bernd, als wir nach dem Tod seiner Schwester zu Hause auf dem Sofa saßen und er mit der Tatsache fertig werden musste, dass die Person, die ihm als Kind absolute Liebe gegeben hatte, gestorben war.
Moni starb einen Monat bevor »Das Parfum« in den Kinos anlaufen sollte. Es war eine perverse Situation: Einerseits hatte sein Baby, für das er seine Existenz aufs Spiel gesetzt hatte, endlich das Licht des Leinwandprojektors erblickt, endlich war es vor dem Kino publikum zum Leben erwacht. Andererseits war ein Teil von ihm gestorben. Aber auch das gehörte zu Bernds Lebenskonzept. Im Kino, das hat ihm Moni beigebracht, geht es ums Geschichtenerzählen. Und Kino – dieser Meinung war Bernd schon lange vor dem schmerzhaften Verlust seiner Schwester – ist eine Sache auf Leben und Tod.
Bis auf die Kinoabende im Kinderzimmer spielte Kino keine große Rolle in Bernds Kindheit. Er war kein Kinowunderkind, nicht schon von Kindesbeinen an ein Filmbesessener.
»Mein Vater hat mich ja manchmal mitgenommen, wenn er ins Kino gehen wollte – so spontan, wenn’s ihm langweilig war, hat er mich ins Auto gepackt und mit nach Neuburg genommen. Aber es hat auf mich nicht so einen großen Eindruck gemacht. Passt jetzt nicht so zu meiner Story, aber es ist so. Ich hab jetzt nicht speziell danach gefiebert, Filme zu gucken … Obwohl Kino immer interessant ist, als Heranwachsender sowieso immer ’ne spannende Sache … es gab ja kein Fernsehen. Da kam’s nicht so sehr auf die Qualität der Filme an, man hat sich schon gefreut, wenn sich was auf der Leinwand bewegte. Aber ich hab das Kino nicht aufgesogen. Ich war eher ’ne Leseratte. Ich hab mich total in Bücher versenkt, und das war letztendlich spannender als Kino«, erzählte Bernd Alice Hübner in einem Interview für den Dokumentarfilm »Der Bildwerfer«, das sie im Frühjahr 2010 bei uns zu Hause führte. »Filmemacher zu werden, hat für mich damals überhaupt nicht zur Debatte gestanden. Ich weiß, manche Leute erzählen, dass sie schon ganz früh mit Super-8-Kameras herumliefen, die es damals übrigens auch gar nicht gegeben hat … aber bei mir war das nicht so, dass ich mir vorstellen konnte, irgendwann mal selbst in irgendeiner Funktion Film zu machen.«
Beim Lesen entdeckte Bernd eine Passion, welche ihn ein Leben lang begleiten sollte. Eine Passion, von der er überrascht feststellen musste, dass sein Vater sie mit ihm teilte: Comics. Am Anfang waren es »Fix & Foxi« und »Micky Maus«, später kamen »Hal Foster’s Prinz Eisenherz« und »Hal Foster’s Tarzan« dazu, sowie einige Jahre später die Marvel Comics und dabei insbesondere »The Fantastic Four«. Bernd erinnerte sich, dass die neuen Comics immer an einem Dienstag erschienen. Und dass die neuen Hefte an diesem Dienstag sofort aus Bernds Zimmer verschwanden, weil Manfred Eichinger sie sich geschnappt hatte. Ohne das auf irgendeine Weise anzusprechen, las der Vater die Comics zur Entspannung und legte sie dann wieder zurück ins Zimmer seines Sohnes. »Ich kann das gut verstehen und war ihm auch nicht böse, dass er mir meine Comics weggenommen hat. Sonst hat er ja damals eigentlich nur Fachzeitschriften gelesen und hatte ständig seine Patienten im Kopf. Also ich fand das schon damals irgendwie witzig, dass mir mein Vater quasi heimlich die Comics geklaut hat«, erinnerte sich Bernd, dem ich zu seinem 59. Geburtstag eine große Freude machen konnte, als ich ihm die ersten drei Bände einer restaurierten Neuauflage von »Prinz Eisenherz« schenkte, die der Bonner Bocola Verlag herausbrachte. Das Dumme war nur, dass der Bocola Verlag die neuen Bände nur alle vier Monate veröffentlichte, weil die Restaurierungsarbeiten so aufwendig waren. Spätestens nach sechs Wochen, wenn Bernd den letzten Band mindestens dreißig Mal gelesen hatte, begann er sich zu sorgen. Bernds Sorge um das Durchhaltevermögen des Bocola Verlags ging so weit, dass er mir spät in der Nacht folgende E-Mail an den Verlag diktierte:
An das hoch geschätzte Team des Bocola Verlags,
als ein manischer Sammler von »Prinz Eisenherz«-Ausgaben (ich war noch persönlich im Keller-Archiv des für uns Fans unvergesslichen Pollischansky) ein Rat: Ihr müsst mit allen Euch zur Verfügung stehenden Kräften daran arbeiten, die Abstände zwischen den Erscheinungsdaten der Bände Eurer grandiosen Neuauflage von »Prinz Eisenherz« zu verkürzen. Sonst lauft Ihr Gefahr, dass Euch irgendwann auf der langen Strecke das Interesse der Leser, selbst der krassesten Fans, verloren geht. Denkt nur z. B. an die »grünen« Melzers Comic Ausgaben und auch an die wirklich guten »weißen« Carlsen Comics in Farbe. Von den Prachtbänden ganz zu schweigen. Ihr müsst jetzt dranbleiben! Ich und die Nachwelt werden es Euch danken! Dass ich, wie Ihr zu Recht bemerkt habt, nur einen mittelmäßigen Film über »Prinz Eisenherz« zustande gebracht habe, liegt nicht an meiner fehlenden Hingabe zum Thema. Doch das ist eine andere Geschichte, die ein andermal erzählt werden soll. In Erwartung auf die nächsten Bände grüßt Euch mit einem Toast auf Harold R. Foster,
Euer Bernd Eichinger
Leider ließ sich aufgrund des Arbeitsaufwandes der Abstand zwischen den Veröffentlichungen der einzelnen Bände trotz Bernds flammender E-Mail nicht verkürzen. Aber immerhin halten sie noch durch. Der Bocola Verlag hat mir versichert, dass sie die Neuauflage aller Voraussicht nach vervollständigen werden. Das sind sie ihrem »krassesten Fan« meiner Ansicht nach auch schuldig.
Für Bernd war es jedes Mal wie ein Mini-Weihnachten, wenn ein neuer »Prinz Eisenherz«-Band in seiner Post lag. Dabei konnte er die Hefte ja schon auswendig. Ich wollte es ihm erst nicht glauben, aber wir machten die Probe aufs Exempel: Egal auf welcher Seite ich einen neu angekommenen Band aufschlug und meine Hand auf eine beliebige Textstelle legte, Bernd konnte mir den Inhalt des Textes entweder wortwörtlich oder zumindest inhaltlich zitieren. Bernd verehrte Hal Foster. »Ich habe ›Tarzan‹ nur so lange gelesen, wie er von Hal Foster gezeichnet wurde. Als die den Zeichner gewechselt haben, hat mich Tarzan nicht mehr interessiert. Der hatte einfach ein unglaubliches Gespür für Physiognomie und Dynamik – auch für die Bildaufteilung. Einfach ein genialer Geschichtenerzähler!« Wenn etwas die Synapsen in Bernds kindlichem Gehirn nachhaltig zusammengelötet hat, dann waren es Comics – das Zusammenspiel von Wort und Bild in fernen, phantastischen Welten.
Und noch eine weitere Phantasiewelt eröffnete sich für Bernd während seiner Kindheit, die bis zu seinem Lebensende der ultimative Fluchtpunkt für ihn bleiben sollte: die Bücher von Karl May und dabei vor allem »Winnetou«. Die lange Reihe an grünen Karl-May-Bänden mit dem Goldaufdruck steht in Bernds Bibliothek oben im Regal wie ein Totem. Bernd hat »Winnetou« unzählige Male gelesen und konnte, als ich ihn kennenlernte, auch dieses Buch auswendig. Trotzdem starrte er immer wieder lange gedankenverloren auf die Landkarten, die immer im Einband eines jeden Karl-May-Buches kleben und die Gegenden aufzeichnen, in denen die Geschichte spielt. Immer wieder reiste er in Gedanken die Strecken ab, die Winnetou und Old Shatterhand entlangreiten. Und zwar nicht auf ironische, postmoderne Weise mit einem Augenzwinkern, sondern mit ernsthafter Verträumtheit wie ein kleiner Junge. Andere Leute haben »comfort food« und essen Schoko-Pops, wenn es ihnen schlechtgeht – Bernd hatte sein »comfort book«. An Bernds Bettlektüre konnte ich immer erkennen, wie es gerade in ihm aussah. Bei Büchern, die er noch nicht kannte, war alles in Ordnung. Sein Hirn war aufnahmefähig. Las er zum 48. Mal einen »Prinz Eisenherz«-Band, stand die Ampel auf Orange. Stress lag in der Luft. Bei einem beliebigen Karl-May-Band wie z.B. »In den Schluchten des Balkan« befand er sich im dunkelorangenen Bereich. Wirklich schlimm war es jedoch, wenn Bernd den »Winnetou« aus dem Regal nahm. Dann sahen wir uns beide an und lachten, denn wir wussten, wie es um ihn bestellt war.
»Es hilft ja nichts«, seufzte er, während er frustriert auf sein Kopfkissen einschlug und sich dann darauf sinken ließ. »Ich muss diesen Quatsch jetzt lesen.«
Wenn Bernd von seiner glücklichen Kindheit sprach, dann war davon die Zeit ausgenommen, als er im Alter von vier Jahren für mehrere Monate nach Aschau in die Kur geschickt wurde. Wahrscheinlich aufgrund von Kalziummangel hatte Bernd eine Trichterbrust entwickelt. Diese sollte in einer Kinderklinik in Aschau im Voralpengebiet mit gymnastischen Übungen und Sonderkost behandelt werden. »Es war grauenhaft. Ich kann mich immer noch an dieses ekelhafte Essen – Haferschleim – aus Blechnäpfen erinnern. Und die Krankenschwestern in ihren weißen Kitteln, mit denen ich Übungen machen musste. Ein paarmal kam mich meine Tante aus Berchtesgaden besuchen, aber ansonsten war ich alleine … Ich habe nie verstanden, warum mich meine Eltern damals weggeschickt haben. Das bisschen Gymnastik, das hätte meine Mutter doch auch mit mir machen können! Mein Vater war doch schließlich Arzt!«
Die Klinik in Aschau gibt es immer noch. Ironischerweise liegt sie nur ein paar Hundert Meter entfernt von einem der berühmtesten Fresstempel in Europa, der Heinz Winkler Residenz, einem Gourmetrestaurant mit angeschlossenem Hotel. Dort sind Bernd und ich ein paarmal abgestiegen, ohne zu wissen, dass die Klinik immer noch existiert. Wenige Monate vor Bernds Tod besuchten wir das Set der Constantin-Produktion »Die drei Musketiere« ganz in der Nähe von Aschau. Bernd hatte der Constantin Film die Drehgenehmigungen für verschiedene Schlösser und Burgen in Bayern besorgt, darunter auch Herrenchiemsee. Hier hatte zuletzt Bernds großer Held Luchino Visconti 1971 »Ludwig II.« gedreht und dabei Löcher in Wände gebohrt, das Parkett verschrammt und allgemein so viel Schaden angerichtet, dass die Bayerische Schlösser- und Seenverwaltung danach allen Filmproduktionen den Zutritt versagt hatte. Auch »Die drei Musketiere« hätten hier nicht drehen können, hätte Bernd nicht im Frühsommer 2010 von der Bayerischen Staatskanzlei die Europamedaille erhalten. Die Staatsministerin Emilia Müller, die zufällig auch der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung vorstand, hatte ihm dabei die Hand geschüttelt und gemeint: »Wenn ich irgendwann mal was für Sie tun kann …« Bernd, nicht schüchtern, hatte daraufhin gemeint: »Ja, wissen Sie, ich hätt’ da schon was. Die Constantin hat da so ein Problem mit Drehgenehmigungen …« Und so wurden »Die drei Musketiere« dann in Bayern gedreht und nicht in Frankreich.
Wir wollten uns das natürlich unbedingt vor Ort anschauen. Die Darsteller – darunter Milla Jovovich, Christoph Waltz und Orlando Bloom – sowie die Herstellungsleitung waren in der Residenz Heinz Winkler untergebracht. Der Plan war, erst das Set zu besuchen und dann bei Winkler mit Milla, dem Regisseur Paul Anderson sowie den Produzenten Jeremy Bolt und Robert Kulzer – Bernds altbewährtem »Resident Evil«-Team – zu Abend zu essen. Es war ein grausames Echo aus der Vergangenheit, als wir auf der Rückfahrt vom Filmset an einem Klinikgebäude vorbeifuhren und sahen, dass es sich hier um die Orthopädische Kinderklinik Aschau handelte. Es gab sie also noch, die Stätte seiner tiefen Verlassenheit. Viel Zeit blieb nicht, um über die Bedeutung dieses Zufalls nachzudenken. Ein paar Hundert Meter weiter wartete ein 5-Gänge-Menü mit dem »Resident Evil«-Team auf uns.
Nach der Trichterbrust kam die Nierenentzündung. »Da haben meine Eltern dann aber aufgepasst. Ich musste monatelang das Bett hüten. Die Lehrerin kam zu uns nach Hause, um mir Unterricht zu geben. Ich fand das überhaupt nicht schlimm, dass ich mich nicht bewegen durfte. Ich war ja damals schon so faul. Das war herrlich … den ganzen Tag lang lesen zu können, und Vanillepudding hab ich auch noch bekommen!« Bis auf wenige Ausnahmen, wie z.B. Reiten und Skifahren, war Bernd ein eingeschworener Stubenhocker. »Oh Gott, die Sonne scheint …« war des öfteren seine entsetzte Feststellung, wenn wir ein Wochenende in unserer Münchner Wohnung verbrachten und Bernd allein schon bei der Vorstellung, das Haus verlassen zu müssen, Schweißausbrüche bekam.
Die Tatsache, dass Bernd so ungern das Haus verließ und ihm vertraute Umgebungen vorzog, war auch der Grund, warum unser Haus in Los Angeles eine solche Oase für ihn war: Dort konnte er jeden Tag in der Sonne sitzen (gegen Sonnenlicht und Frischluft hatte er ja per se nichts, es war nur die Auseinandersetzung mit der unkontrollierbaren Außenwelt, die ihn abschreckte) und ab und zu mal ein paar Bahnen im Pool schwimmen, ohne dafür das Haus verlassen zu müssen. Anstatt in ein Restaurant zu gehen, luden wir unsere Freunde und Bernds Geschäftspartner zu uns zum Essen ein. Für Bernd war dieser Zustand paradiesisch: ein Haus, in dem er sich wie in eine Höhle zurückziehen konnte und trotzdem kein schlechtes Gewissen haben musste, dass er die Sonne und die frische Luft vermied.
»Ich bin eben ein Höhlenmensch. Die Leute meinen immer, ich wäre so extrovertiert und hätte so viel Energie. Das stimmt überhaupt nicht. Ich bin wahnsinnig faul. Der Unterschied ist nur der, dass ich mir sehr gut überlege, wie ich meine Energie einsetze. Das heißt wenn ich sie einsetze und wenn ich nach draußen gehe, dann hat das auch einen konkreten Effekt«, meinte Bernd öfter mal und verglich sich dabei mit einem Löwen, der auch die meiste Zeit dösend im Gras liegt und sich gut überlegt, wann er auf die Jagd geht.
»Ein Löwe hat nur zwei oder drei Chancen, sein Wild zu erlegen. Wenn er’s dann nicht packt, hat er keine Energie mehr und muss verhungern. Deswegen muss jeder Angriff durchdacht sein. Bei mir ist es genauso. Ich überlege mir sehr gut, bevor ich mich bewege, ob es sich auch wirklich lohnt. Das war schon immer so, seit ich ein kleiner Junge war.«
Diese Aussage will nicht zu dem Bild passen, was in der Öffentlichkeit von Bernd existiert. Da ist immer von dem »Getriebenen« die Rede, von einem unruhigen Geist. Und es stimmt ja, die »Stuben«, in denen Bernd jahrzehntelang hockte, waren Restaurants wie das »Romagna Antica« in München oder das »Borchardt« in Berlin. Da saß er festgemauert, immer am selben Tisch, am selben Platz. Das waren seine Wohnzimmer, seine festen Burgen, wo sich das Chaos kontrollieren ließ. Wohnzimmer, in denen er immer der letzte Gast war und den Moment, bis er nach Hause gehen musste, so lang wie möglich hinauszögerte. Klar, Bernd war ein Berserker. Aber Bernd war keiner, der blindlings herumraste. Sein Wahnsinn hatte immer ein Ziel.
Bernds Mutter half ihrem Mann als Sprechstundenhilfe in der Praxis. Deshalb hatte Bernd immer ein Kindermädchen, das ihn und seine Schwester betreute. Dieses Kindermädchen, Herta Theuer, war anfangs noch selbst ein Kind und ging noch zur Schule. Schon im Alter von zehn Jahren, als Moni erst anderthalb und Bernd noch nicht geboren war, kam Herta Theuer nach der Schule in den Eichinger-Haushalt, um zunächst nur auf Moni und später auch auf Bernd aufzupassen. Wenn die Kinder zu Bett gebracht waren, saß sie noch mit »der Frau Doktor«, strickte und wartete gemeinsam auf den »Herrn Doktor«. Da nach dem Krieg die Wolle knapp war, wurden zum Stricken alte Pullover aufgetrennt und neu zu Kinderkleidung verarbeitet.
Herta Theuer sollte für Bernd immer unvergessen bleiben, weil sie ihm einmal »das beste Käsebrot der Welt« gemacht hatte.
Herta Theuer erzählte mir 2011:
Mein zweites Zuhause war bei der Familie Dr. Eichinger. Vormittags war ich in der Schule und dann bei der Familie Dr. Eichinger. Bei uns zu Hause war’s sehr eng. Wir hatten auch nicht viel, denn wir waren ja fünf Kinder. Bei uns hat sich immer viel abgespielt. Es war immer so gemütlich. Man hat sich halt einfach gegenseitig gehabt. Weil halt sonst nicht viel da war, war der Zusammenhalt besser. Aber das Zusammensein mit der Familie Dr. Eichinger, das gehört zu meinen schönsten Erinnerungen. Besonders Weihnachten war sehr schön. Dr.Eichinger hat da immer Orgel gespielt. Aber der Herr Doktor war ja viel unterwegs. Deswegen haben wir immer auf ihn warten müssen. Der Herr Doktor war ja noch ein echter Landarzt und sehr beliebt. Er war auch unser Hausarzt. Später, als ich dann selbst Kinder hatte, hab ich die Bernd, Monika und Manfred genannt. Nur mein Jüngster hat einen anderen Namen, der heißt Ralf. Bei meiner Hochzeit, am 12. August 1961, hat Bernd Gitarre gespielt und seine eigenen Lieder vorgetragen. Als Kind ist Bernd immer gerne in den Stall gegangen. Wenn man ihn gesucht hat, war er meistens bei den Kühen. Und auf dem Viehwagen ist er gerne mitgefahren. Er hat mir damals gesagt, er will Bauer werden. Auf gar keinen Fall Arzt, hat er gesagt, denn er will nicht andauernd nackige Bäuche sehen müssen. Als er ganz klein war, war er ein bisserl ein Pummerle, aber das hat sich dann gegeben, als er anfing zu laufen. Zum Spielen hat’s ja nicht viel gegeben. Man hat ja nichts kaufen können. Wenn wir Bernds Oma besucht haben, dann hat die immer gemeint: »Geht’s hinaus in den Garten und spielt mit den Steinchen.« Und sie hatte einen Packen beschriebener Postkarten. Damit haben wir dann auch gespielt. Als Bernd gestorben ist, das war für mich, als ob mein eigener Sohn gestorben wäre.
Dass er mit Steinchen und Postkarten gespielt hat, hat mir Bernd nicht erzählt. Wohl aber, dass er keinen Zugang zu der Pixar-Zei-chentrickfilm-Trilogie »Toy Story« hatte. Weihnachten vor seinem Tod versuchten wir, uns »Toy Story 3« anzuschauen. Wir hatten eine »Screener«-DVD, die vor den Oscars an Mitglieder der amerikanischen Filmakademie herausgeschickt wurden, um das Abstimmen für die Oscars zu erleichtern. Obwohl er Pixar-Filme großartig fand, war Bernd schon nach kurzer Zeit gelangweilt. Für ihn war die Vorstellung, dass Spielzeuge lebendig werden könnten, uninteressant. Bernd bestand darauf: Er hatte als Kind keine Spielzeuge gehabt! Er könne sich nicht einmal an einen Teddy erinnern. Wir haben dann die DVD ausgeschaltet und »The Fighter« von David O. Russell angeschaut. Bis zum Ende.
Bernds Vater war bis zu seinem 75. Lebensjahr Arzt aus Überzeugung. »Dass man seinen Beruf mit aller Energie ausübt und seinem Beruf alles gibt, das hab ich sicherlich von meinem Vater mitbekommen«, so Bernd. Als Landarzt war Manfred Eichinger auch für die ärztliche Versorgung eines Heims für geistig Behinderte zuständig. In dieses Heim nahm er Bernd und Moni gelegentlich mit, besonders an Weihnachten. Bernd hat davon immer mal wieder erzählt, weil er diese Besuche als Kind sehr mochte.
»Unser Vater hat da halt seinen Dienst gemacht und uns da im Zimmer mit den Behinderten gelassen. Und ich kann mich an keinerlei Scheu oder Angst erinnern, die Moni und ich den Leuten gegenüber gehabt hätten. Wir haben mit denen Fangen gespielt, und es war irgendwie toll, wie die sich gefreut haben. Als Kinder mochten wir das natürlich, dass wir da so eine Begeisterung bei diesen Menschen hervorrufen konnten, die ja viel größer waren als wir! Nur wurden die dabei immer sehr aufgeregt, und ab einem gewissen Punkt wurde es dann zu wild. Dann gab’s Geschrei und Tränen, und die Erwachsenen griffen ein.« Später als Teenager kehrte Bernd in das Heim zurück und machte Fotos von den Bewohnern. Nicht weil er konkret mit dem Gedanken spielte, Fotograf zu werden, sondern weil ihre Gesichter so einen Eindruck hinterlassen hatten, dass er sie festhalten wollte.
»Bei uns in der Gegend gab’s auch ein Dorf, da waren alle so abweisend Fremden gegenüber, die haben nur untereinander geheiratet. Richtige Hinterwäldler. Da gab’s natürlich irre viel Inzucht. Und wenn ich mit meinem Vater durch das Dorf gefahren bin, stand vor fast jeder zweiten Tür so einer, dem man’s angesehen hat, dass da ein paarmal zu nahe beieinander geheiratet worden war. Das war das Idiotendorf. Unser Vater hat uns das erklärt. Als Kinder fanden wir das natürlich richtig schön gruselig und total aufregend«, erzählte mir Bernd, als wir uns »Deliverance – Beim Sterben ist jeder der Erste« von John Boorman ansahen, in dem debile Hinterwäldler das Horrorelement darstellen. Bernd bewunderte »Deliverance« sehr und hielt ihn für einen der besten Filme der Kinogeschichte, war es doch ein Film, der seine Vorliebe für das Dunkle, den menschlichen Abgrund, mit Spannung verband. Er hatte »Deliverance« zum ersten Mal 1972 gemeinsam mit Uli Edel gesehen, als die beiden noch Filmstudenten waren und der Film in Deutschland anlief. Uli Edel erinnert sich: »Wir sind gleich am ersten Abend reingegangen. Du wirst es vielleicht nicht glauben, aber es ist wahr: Als diese nur schwer zu ertragende Szene ablief, in der einer der ›mountain men‹ Bobby (Ned Beatty) vergewaltigt und ihn dabei zwingt, wie ein Schwein zu quieken, ist Bernd aufgestanden und hat den Kinosaal verlassen. Er fand es unerträglich. Ich war völlig überrascht, weil ich Bernd nie zuvor so hab reagieren sehen. Nach einer Weile, als die Szene vorbei war, kam er wieder zurück und sah sich den Film zu Ende an.«
Jahre später, als Bernd schon Verleiher war und John Boormans »Excalibur« in Deutschland verlieh, war Uli bei einem Abendessen dabei, das Bernd für Boorman veranstaltete. »Bernd erzählte Boorman beim Essen, dass er bei dieser Szene das Kino verlassen hatte. Boorman konnte gar nicht glauben, dass ausgerechnet Bernd so zart besaitet war. Es klang fast wie eine Entschuldigung, als John sich damit verteidigte, dass die ›Quiek‹-Idee gar nicht im Drehbuch stand und beim Drehen von Ned Beatty improvisiert worden war. Wir haben Boorman erbarmungslos ausgequetscht. Ich erinnere mich noch, wie er erzählte, dass die Einstellung mit der Hand, die am Ende über der Wasseroberfläche erscheint, ihm auch die Idee für die berühmte ›Excalibur‹-Einstellung geliefert hätte, wenn die Hand mit dem Schwert aus dem Wasser kommt. Wie Boorman den debilen Jungen in der Szene mit den duellierenden Banjos dazu bekommen hatte, so unglaublich Banjo zu spielen, hat er uns damals jedoch nicht verraten. Erst viele Jahre später lüftete Vilmos Zsigmond, der ungarische Kameramann von ›Deliverance‹, das Geheimnis, als er mit mir ›Die Nebel von Avalon‹ drehte: Ein professioneller Banjospieler hatte hinter dem Jungen gesessen. Der Junge verbarg seine Arme hinter seinem Rücken und die beiden Arme, die wir sehen, sind die des unsichtbaren Profis«, so Uli Edel.
Diese Faszination mit dem Grotesken ist in Bernds Filmen immer wieder zu sehen, sei das nun »Der Name der Rose«, »Ballermann 6« oder auch »Das Parfum«. Nun ist es sicher nicht so, dass sich bei einem Menschen die Verbindungslinien zwischen Kindheitserinnerungen und künstlerischer Tätigkeit einfach so gerade und stringent ziehen lassen. Das wäre zu simpel. Aber es ist sicherlich ein interessanter Gedanke, dass es während seiner ländlichen, fernsehfreien Kindheit bei Bernd eine gewisse Faszination für Schauriges und – im Falle des Inzest-Dorfs – Tabuüberschreitung gab.
Und da wir nun schon beim Gruseln sind: Während der Erntezeit kamen häufig Bauern oder Knechte in die Praxis, denen beim Mähen ein Finger abgeschnitten worden war. Und wenn in diesen Fällen keine Sprechstundenhilfe zur Hand – zum Finger – war, dann mussten Bernd oder Moni »anhalten«. Moni wurde später Ärztin. Bernd dagegen lehnte von da an den Anblick von echtem Blut kategorisch ab und zog es stattdessen vor, einige Jahrzehnte später die Zombie-Franchise »Resident Evil« ins Leben zu rufen und zu produzieren.
Leider habe ich Bernds Vater nie kennengelernt. Er starb 2004 im Schlaf an einem Herzinfarkt. Aber alle Frauen in Bernds Umfeld mochten ihn, besonders seine langjährige Assistentin Marianne Dennler schmilzt dahin, wenn sie von ihm redet. Demnach war er ein ausgesprochen charmanter Mann und als Arzt sehr beliebt. Er war, ähnlich wie Bernd, ein Kettenraucher und von seiner Arbeit besessen. Wenn er während der Arbeit zum Mittagessen aus der Praxis kam, schlang er schweigend das Essen herunter – in Gedanken immer noch bei seinen Patienten – und rauchte während des Essens weiter. Und während sich seine Frau nach der Bergidylle ihrer Heimat sehnte und wenig Freude an der Arbeit in der Praxis ihres Mannes und demtäglichen Umgang mit kranken Menschen fand, baute sich der Vater seine Idylle im Keller mit einer ständig wachsenden Modell eisenbahn.
»Ich kann mich erinnern, dass sich meine Eltern viel gestritten haben. Das war dann immer ein Riesendrama mit vielen Tränen, das meistens damit endete, dass meine Mutter uns in ihr Auto packte und irgendwo hingefahren ist. Aber mein Vater hat sie immer gefunden. Ich weiß nicht wie, aber er wusste immer, wo sie war, und dann hat er sie zurückgeholt«, erinnerte sich Bernd und meinte dann auch, dass er schon als Kind eine innere Distanz zu solchen Szenen entwickelt hat: »Wenn das alles zu wild wird, dann klinke ich mich einfach aus. Das ist dann, als würde ich mich selbst und die anderen von außen wie durch eine Kamera betrachten. So ein Drama mache ich nicht mit. Ich werde dann innendrin ganz kalt, und alles läuft dann vor meinen Augen ab wie ein Film.« Auf einem Filmset ist eine so extrem distanzierte Wahrnehmung sicherlich von Vorteil. Bei Dreharbeiten kann sich die scheinbare Harmonie innerhalb von Sekunden in totales Chaos verwandeln. Ein Streit, ein Missverständnis oder ein unbedachtes Wort führen dazu, dass ein Schauspieler durchknallt, vom Set stürmt, seinen Bullterrier von Agenten anruft und sich weigert, am nächsten Tag zum Dreh zu erscheinen. Schon ist der Drehplan durcheinander, und es muss verlängert werden. Ganz zu schweigen von dem unangenehmen Telefonat, das der Produzent mit dem Bullterrier führen muss. Das kann teuer werden. Was ich persönlich am Anfang immer so anstrengend an Filmsets fand, war die Tatsache, dass es sich bei der Atmosphäre am Set um eine seltsame und letztendlich unkontrollierbare Alchemie handelt. Es ist, als ob man ständig über dünnes Eis geht. So viele Unsicherheiten mischen sich mit Exhibitionismus und prallen mit Zeit- und Gelddruck aufeinander. Da kann leicht der Fokus verloren gehen. Und auch wenn es nicht unbedingt zum Supergau kommen muss und ein Star vom Set stürmt, kann es doch immer wieder ohne offensichtliche Vorwarnung gewaltig knallen. Und jeder Knall kostet Kraft und Geld. Sich da nicht in den Strudel der Emotionen hineinziehen zu lassen, sondern einen kühlen Kopf zu bewahren, die Wogen zu glätten und wieder eine Arbeitsatmosphäre herzustellen, das war sicherlich eines von Bernds großen Talenten. Ein Talent, das er sich offensichtlich schon in der Kindheit antrainiert hat.
Bei Bernds Eltern schlug sich die Affinität zu großem Drama auch in ihrer Liebe für schwere Musik nieder. Wagner, Bruckner, Mahler – das waren Manfred Eichingers Favoriten. Wenn Musik, dann heftig. Schon als Student hatte sich Manfred Eichinger Wagner-Opern von Stehplätzen aus angeschaut. Und wenn Wagner an sich schon eine Herausforderung an die menschliche Blase ist, so stellt eine Wagner-Oper vom Stehplatz aus noch einmal ganz andere Ansprüche an die Physis und die Willenskraft. Später, als verheirateter Mann, brachte Manfred Eichinger auch seine Ehefrau Ingeborg auf den Geschmack von so schwerer Kost. Jeden Sonntag spielte der Vater Wagner zu Hause auf dem Harmonium, und die Mutter summte mit. Weniger erbaulich war die Tatsache, dass Manfred Eichinger, der ähnlich wie Bernd an heftigen Schlafstörungen litt, mitten in der Nacht Schallplatten mit Wagner-Opern auflegte. Dass der Rest der Familie damit seine Schlafstörungen teilte, schien ihn wenig zu kümmern.
Manfred Eichinger hatte patriarchalische Vorstellungen von der Rolle des Vaters innerhalb der Familie. Er begriff sich selbst als Autoritätsperson, die die Pflicht besitzt, gewisse Regeln durchzusetzen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. »Mein Vater hatte gelegentlich solche Anfälle, dass er uns disziplinieren wollte. Da mussten Moni und ich uns auf einen spitzen Holzscheit knien, wenn wir etwas ausgefressen hatten. Moni hat das immer als Demütigung empfunden, aber ich konnte das gar nicht ernst nehmen. Ich wusste, das machte er nur, weil er dachte, dass er es machen musste. Ich hab nie verstanden, warum Moni das alles so ernst genommen hat. Wenn es hieß: ›Entschuldige dich bei deiner Mutter!‹ hat sie immer bockig den Kopf geschüttelt und sich geweigert, weil sie nicht einknicken wollte. Ich hab ihr immer gesagt: ›Dann entschuldige dich halt! Dann ist die Sache gegessen. Kann dir doch egal sein, was die denken. Hauptsache, du hast deine Ruhe.‹ Aber Moni ging’s immer ums Prinzip«, erzählte Bernd in Anspielung auf den »Baader Meinhof Komplex«, den er in Gedenken an Moni schrieb. Moni, die auf Gerechtigkeit pochende Idealistin, und Bernd, der anti-autoritäre Pragmatiker – Bernd sah diesen grundlegenden Unterschied, der sich später in den politischen Ansichten der beiden Geschwister äußern sollte, schon von Kindheit her angelegt. »Der Baader Meinhof Komplex« ist letztendlich Bernds persönliche Auseinandersetzung mit der für ihn schwer verständlichen Denkweise seiner Schwester.
Das Verhältnis zwischen Bernd und Moni spiegelt sich auch in Bernds erster professionellen Regiearbeit seit seiner Hochschulzeit wider, dem Film »Das Mädchen Rosemarie« von 1996. Darin spielt Bernds Exfreundin Hannelore Elsner die Schwester der männlichen Hauptfigur, gespielt von Heiner Lauterbach. Das Verhältnis dieser beiden Geschwister ist eng, sehr eng. Nicht inzestuös, aber doch so intim, dass es da eine Verschworenheit gibt, die gewisse Besitzansprüche nicht ausschließt. Obwohl wir »Das Mädchen Rosemarie« kurz vor seinem Tod noch einmal sahen, wurde mir erst bei einem Screening des Films im Rahmen der Berlinale 2011 zu seinem Gedenken bewusst, wie unglaublich persönlich dieser Film ist. Zwischen dem Abend, an dem ich mir den Film mit Bernd auf DVD anschaute und dem Screening auf der Berlinale lagen nur zwei Monate. Bernds Tod hat meine Sicht auf den Film jedoch komplett verändert. Es ist natürlich anders, wenn man einen Film anschaut und die Person, die ihn gemacht hat, sitzt neben einem auf dem Sofa, als wenn man ihn in einem dunklen Kinosaal sieht. Die Präsenz des lebenden Bernd war viel zu stark und hat den Film so überstrahlt, als dass ich erkennen konnte, wie sehr er sich mit seiner Gedankenwelt und seinem weiblichen Schönheitsideal in »Das Mädchen Rosemarie« verewigt hat. Außerdem hat er ständig dazwischengeredet.
Bernds Vorstellung, wie seiner Meinung nach eine schöne Frau auszusehen hat (obwohl er da gelegentlich schon erkennbare Zeichen einer gewissen Flexibilität zeigte), ist in seiner Inszenierung von Weiblichkeit in »Das Mädchen Rosemarie« wunderbar erkennbar. Und ja, bei der Vorführung in Berlin war dieser seltsame Moment, als Nina Hoss im Film als Rosemarie in einem goldenen Kleid durch einen Raum voller Menschen schreitet. Ihr Gesicht ist nur in Umrissen erkennbar, aber das Licht fällt auf ihr platinblondes Haar und lässt das Kleid schimmern. Das goldene Kleid hatte Bernd dem Kostümfundus später abgekauft und mir zum Geburtstag geschenkt.
Dieser Film, der von einem berühmt-berüchtigten Callgirl handelt, das 1957 ermordet wurde, zeigt, dass Bernds Schönheitsideal seinen Ursprung in den fünfziger Jahren hat, seiner Kindheit. Es war die Zeit, in der er seine ersten Erfahrungen mit Begehrlichkeiten machte. Wie viele kleine Jungen war Bernd verzaubert, wenn seine Mutter ihm gute Nacht sagte, bevor sie in die Oper oder zu einer Abendveranstaltung fuhr. Das Parfum, die langen Abendhandschuhe, der Schmuck, das Rascheln der Kleider gepaart mit der Vorstellung, dass die Mutter nun an einen geheimnisvollen Ort gehen würde, wo alle Frauen eine solche Aufmachung trugen – all das schlug Bernd in einen Bann, der sein gesamtes Leben anhalten sollte. Wenn man sich Katja Flint in »Das Mädchen Rosemarie« anschaut, dann ist ihre Aufmachung identisch mit dem Kleidungsstil von Bernds Mutter: die hochgesteckten Haare, die kleinen Perlenreihen um den Hals, diese steife, bürgerliche Eleganz, die zwar angepasst, aber nicht prüde wirkt.
Aber die Kostüme in »Das Mädchen Rosemarie« sind nicht nur an die Kleidung von Bernds Mutter angelehnt. Man sieht, wie die unterschiedlichsten Frauenfiguren in den Fünfzigern gekleidet waren – der hypersexualisierte Teenager, die neureiche Großindustriellengattin, das leichte Barmädchen … Frauen, wie Bernd sie bei den Ausflügen der Familie nach München, bei denen auch im Restaurant des Bayerischen Hofs gegessen wurde, gesehen hat. Vom Land kommend, wo er hauptsächlich von Bäuerinnen in Stallkleidung umgeben war, mussten diese herausgeputzten Frauen hoch faszinierend auf ihn gewirkt haben. Und so liebte Bernd die Wespentaillen und Bleistiftröcke, die Pelze und taftigen Stoffe der fünfziger Jahre, und wie sie dann wieder in den achtziger Jahren zurückkehren sollten. Und mehr noch: Er war besessen von diesem Look. So sehr, dass er die Frauen in seinem Leben dazu animieren wollte, sich genauso zu kleiden. Katja Flint erzählte mir, Bernd habe am Anfang ihrer Beziehung gewollt, dass sie sich für jeden Tag der Woche ein auf Taille geschnittenes Kostüm schneidern ließe. Und zu jedem Kostüm wollte er ihr den passenden Schmuck schenken.
Vor allem die Farbe Türkis hatte es Bernd angetan. Ein türkises Satinkleid, ärmellos und figurbetont – genau so wie es seine damalige Freundin Corinna Harfouch in Bernds zweiter Regiearbeit »Der große Bargarozy« trug –, am besten noch mit den passenden langen Handschuhen, davon war Bernd besessen.
»Eine meiner Tanten trug mal so ein türkises Kleid, ganz auf Taille geschnitten. Das war bei so einer Familienfeier, wo sich alle schick gemacht hatten. Und ich weiß nicht, damals als kleiner Junge hab ich das als überwältigend schön empfunden. Diese Farbe hat auf mich einfach eine extreme Wirkung«, erzählte Bernd mir, als wir wieder einmal über Kostüme und Kleidung sprachen. Ich habe meine Abschlussarbeit für meinen MA in Cinema & Television am British Film Institute (BFI) über die Kostüme und die damit verbundenen Weiblichkeitsideale der fünfziger Jahre geschrieben, bin also ebenso fasziniert wie Bernd von dieser Epoche und wie sich die Doppelmoral dieser Zeit in der Kleidung widerspiegelt. Nur eben dass ich im Gegensatz zu meiner damaligen Tutorin Laura Mulvey die Mode der fünfziger Jahre nicht als Unterdrückungsinstrument des Patriarchats gesehen habe, sondern als potenziellen Ausdruck einer starken Sexualität. Und damit lag ich genau auf Bernds Wellenlänge. Ich ließ mir während unserer Ehe das hellgraue Kostüm aus Hitchcocks Psychothriller »Vertigo« von 1958 nachschneidern. Dieses Kostüm lässt James Stewart im Film für Kim Novak anfertigen, um sie wieder wie ihre vermeintliche Doppelgängerin Madeleine aussehen zu lassen. Dieses Kostüm wird zum Sinnbild der Pygmalion-Tragik dieser Geschichte – James Stewart versucht, sich die perfekte Frau zu erschaffen, doch unterliegt einer Täuschung, die letztendlich nicht ihn, sondern die Frau das Leben kostet. Bernd und ich mochten »Vertigo« vor allem deswegen so sehr, weil er Kleidung und Kostüme und die damit verbundenen Manipulationen und Täuschungsmanöver zum zentralen Schauplatz menschlichen Dramas macht. Laut Oscar Wilde lehnen es nur oberflächliche Menschen ab, sich mit Äußerlichkeiten zu beschäftigen. Kein Film verkörpert das besser als »Vertigo«. Und was so großen Spaß daran gemacht hat, als ich mir das »Vertigo«-Kostüm schneidern ließ war die Tatsache, dass Bernd und ich beide genau wussten, welches Spiel wir da spielten.
Für Bernd war es nicht so sehr die natürliche Weiblichkeit, die ihn faszinierte, sondern eine Inszenierung der weiblichen Gestalt. Eine Inszenierung, die mit den Gedanken und den Blicken des Zuschauers spielt. Es war das Wechselspiel von Verstecken und Herzeigen, das Bernd an Kleidung interessierte. Beim Anziehen ging es hauptsächlich ums Ausziehen. Kein Wunder also, dass Bernd »lass-es-alles-raushängen«-Hippies, die Siebziger und die als Emanzipation verstandene Rückkehr zur Gaia immer als ästhetisches Missverständnis empfand. Übrigens war Bernd ein großer Fan der amerikanischen TV Serie »Mad Men«. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass er gestorben ist, ohne die vierte Staffel gesehen zu haben.
Dass Bernd starke Sexualität bei Frauen mochte, manifestierte sich auch in seinem ersten erotischen Erlebnis: Zu Hause bei seinen Eltern gab es eine kleine Nachbildung der Statue »Ariadne auf dem Panther« von Johann Heinrich Dannecker. Sie zeigt Ariadne, die mutige Tochter des kretischen Königs Minos, die Theseus mit Hilfe des Ariadnefadens half, den blutrünstigen Minotaurus zu besiegen und später den Gott Dionysos heiratete. Die Ariadne, wie sie als Statue zu sehen ist, ist nackt und stolz und sitzt aufrecht auf dem Panther, der unter ihr wie eine Schmusekatze schnurrt.
»Ich stand vor dieser Figur und starrte so auf die nackte Frau, da hat’s zum ersten Mal in mir aufgeflackert … da hab ich’s zum ersten Mal gefühlt. Meine erste erotische Erfahrung. Später, als ich mir im Alter von vierzig meine erste Wohnung gekauft habe, hat mich meine Mutter gefragt, ob ich nicht etwas von zu Hause haben wollte. Da hab ich sie gebeten, mir die Frau auf dem Panther zu geben … aber ich hab ihr natürlich nicht erzählt, dass das praktisch mein erster Porno war.«
Die Pantherfrau steht heute auf unserem Kaminsims – umgeben von Familienfotos. In »Das Mädchen Rosemarie« ist sie auch zu sehen: Die Szene, in der Heiner Lauterbach und Katja Flint bei sich zu Hause am Kamin sitzen und über Rosemarie Nitribitt reden, drehte Bernd damals in seinem eigenen Wohnzimmer, weil er für das vorhandene Budget keinen anderen Drehort finden konnte.
Bernd hat immer betont, er habe eine schöne Kindheit gehabt. Seine Mutter sei »ein guter Kamerad« gewesen. Oft seien er und seine Schwester auf den Geburtshof der Mutter in Schellenberg in Berchtesgaden in die Ferien gefahren – meistens ohne den Vater, denn der musste zu Hause bei seinen Patienten bleiben und konnte mit Wandern und Freiluftaktivitäten sowieso nur wenig anfangen. In Schellenberg sei die Mutter viel mit ihnen gewandert und habe Bernd und seiner Schwester das Skifahren beigebracht. Ferien, an die Bernd nur idyllische Erinnerungen hatte. Unmengen von Honigbroten hätten er und seine Schwester verschlungen und wilde Ski- und Schlittenfahrten hätten sie gemacht.
Aus Bernds Kindheit kann man ein weiteres Fazit ziehen: Bernd hat in seiner Kindheit nie gelernt, sich ordentlich die Schuhe zu binden. Er konnte keine doppelte Schleife machen. Die Converse-Turnschuhe, sein Markenzeichen, waren immer nur mit einer einfachen Schleife gebunden.